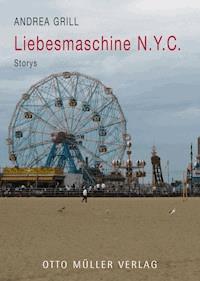Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die schönsten Städte ihrer Welt sind jene, die sie kaum gesehen hat. Die Ich-Erzählerin reist viel von Berufs wegen. Sie ist Wissenschaftlerin, jagt in den verschiedensten Regionen der Welt nach Eichhörnchen, denen sie Haarbüschel ausreißt, um DNA-Sequenzen zu erstellen und daraus die Landkarte der genetischen Vielfalt zu zeichnen. Als wir ihr begegnen, fliegt sie nach Brasilien. Neben ihr sitzt Moor. Wie die Städte, die sie begeistern, weil sie sofort wieder abreisen muss, fühlt sie sich zu ihm hingezogen - weil sie ihn nicht kennt und auch nicht kennen zu lernen vorhat. "Alle suchten etwas, das sie Liebe nannten. Niemand, den ich kannte, wusste, was es war. Wer sie fand, sprach nicht darüber", sagt sie. Ihre Gedanken gehen immer wieder zu Moor, spielen damit, ihn noch einmal zu treffen - oder wandern zu dem Freund, den sie immer wieder in einer bestimmten Stadt sieht. Ist das wirklich ein anderer? Der Text gleitet frei zwischen Erlebtem, Geträumten, Dialog und Erzählung, führt uns Möglichkeiten vor, die "immer wunderbarer sind, als man vermutet, und zugleich bis ins Detail vorhersagbar".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zweischritt
Andrea Grill
Zweischritt
Roman
O T T O M Ü L L E R V E R L A G
ISBN 978-3-7013-1125-5eISBN 978-3-7013-6125-0
© 2007 OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG–WIEN
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Ulli Leikermoser
Satz: Media Design: Rizner.at
Druck und Bindung: CPI Moravia Books GmbH, Korneuburg
für M
What shall we do with you?you ask
and I wonder whois the we,who the you
and what part of themI don’t understand?
Jeder hat einen Kopfeinen Körperund zwei Beine:sie probieren dich zu imitieren
Ingrid Jonker
Inhalt
Vorweg
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Hintan
Dank
Vorweg
Gerne hätte ich gewusst, wie es anderen ging. Ob es ihnen ähnlich erging wie mir, ob sie die Dinge auch so sahen. Ob manche von ihnen auch einmal durch ein Zeitloch gefallen waren. Und wie es sich angefühlt hatte. Meines war weich gewesen und sehr eng. Gerade groß genug für einen. Zwei passten auf keinen Fall gleichzeitig hindurch. Das Loch war plötzlich da gewesen. Ich saß zu Hause und sah, wie es sich vor mir auftat, ein Netz mit einer leichten Vertiefung in der Mitte. Als ich hineinsprang, schloss es sich so weit, dass mein Körper ungehindert hindurchgleiten konnte. Ungemein weich und zart umfing es mich, und ich fiel. In welcher Zeit ich landete, weiß ich nicht. Es schien gleichermaßen Vergangenheit wie Zukunft, ich war alt und zugleich jünger als dort, wo ich herkam. Bei meiner Rückkehr hatte keiner etwas bemerkt. Das fiel mir auf und erstaunte mich, trotzdem ich damals noch sehr jung war.
Dieser Ausflug verlieh mir das Gefühl, die vierte Dimension zu kennen. Und obwohl ich ihn nie wiederholt habe, prägte er mich mit einem Ideal, das uns gegenwärtig abhanden kommt: die Idee der totalen Unvoreingenommenheit, eine Weltanschauung, die das Staunen radikalisiert, alle Selbstverständlichkeit disqualifiziert. An ihrem Ausgangspunkt steht eine prinzipielle Unwissenheit, das immerwährende Aufschieben der Erkenntnis, an ihrer Basis die Verwunderung. Die Wirklichkeit entsteht vorwiegend aus dem Ungesagten, den Zwischenräumen; dem Raum, der sich zwischen ihr und ihm auftut; zwischen dir und mir.
Wie andere sich fühlten und ob es sich anfühlte, wie ich mich fühlte, ist kaum zu erfahren. Und doch hätte ich es oft gerne gewusst. Nicht immer. Manchmal füllte ich mich selber aus bis zum Rand und wäre mit jedem zusätzlichen Gefühl eines anderen übergegangen. Meist schien mir die äußere Form das Einzige, was uns verband: zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Augen, ein Kopf.
Ich hätte gerne gewusst, ob andere auch manchmal alle Dinge zu Ende dachten und was sie mit diesen Gedanken machten. Ob sie sie wahrten oder zu vergessen trachteten, sie täglich ausspuckten, einen nach dem anderen, damit ihnen der Kopf nicht berste, oder kauten und schluckten, dann ausschieden, das Verdaute für unnötig erklärten und überflüssig. Ob sie wussten, was nötig war und was nicht, und sich danach fragten. Ob sie tatsächlich hier waren, wenn sie hier, und dort, wenn sie dort zu sein schienen; oder dort, wenn sie hier schienen, und hier, wenn sie dort waren – wie es mir schien.
Mit den Tieren war es einfacher. Ich wusste, dass sie anders waren und anders sahen. Sie hatten andere Augen. Konnten jagen und auf den Händen gehen. Besaßen einen Schwanz und Reißzähne. Keinen Daumen. Hummeln sahen Muster auf Blüten, die mir glattgelb schienen. Ein Schneeleopard rannte schneller bergauf, als ich mich auf Schiern abzufahren getraute. Der Falter trug ein Parfüm, das ihn den Ameisen in ihresgleichen verwandelte. Sie hielten ihn für ihre Larve, trugen ihn ins Nest im Boden und fütterten ihn den ganzen Winter lang, während ich Schnee schaufelte.
Ich wollte eine schwimmende Katze sein, mit Fell auf der Haut und Häuten zwischen den Zehen, die Luft siebzig Minuten lang anhalten können unter Wasser. Tauchen, mit spitzen Ohren und einer Nase, die alles riecht, was wir nicht sagen können, einer Zunge als Waschlappen, einer Stimme wie eine Raspel.
Personen:
ich.............................Hans Lokomotifer...............................der eineMoor Corriagua......der andereer...............................dem Hans immer begegnet
Orte:
Brasilien
Mokum
Schweiz
Ein Haus unweit eines italienischen Bahnhofs
Der Balkan
Amerika
Zeit:
Einundzwanzigstes Jahrhundert
Kapitel:
Vierundzwanzig
1 MANCHMAL, wenn ich nachts wach werde, habe ich alle Dinge zu Ende gedacht. Ich weiß zum Beispiel, warum Abende und Morgen immer schöner sind als die Tage dazwischen, wie Engel einst erfunden wurden und Worte. Dann schlafe ich nicht mehr, wiederhole, was ich nicht vergessen darf, und vergesse es, sobald es hell wird.
Tagsüber ist es anders.
Was zu Tage gedacht wird, bleibt.
Auch wenn es nachts keiner mehr braucht.
Einer der unnötigen Gedanken, den ich schnell vergessen könnte, aber beharrlich wahre, ist, dass in Flugzeugen nie jemand schnarcht; in Zügen immer. Dieser Gedanke war zu Tage gedacht, zu nichts nutze, und ich wusste nicht einmal, ob er stimmte. In dem Flugzeug, in dem ich saß, schnarchte jedenfalls niemand. Es war Mittag, der Himmel voll Licht. An allen Fenstern wurden die Rollvorhänge zugezogen, damit die Fliegenden nicht merkten, dass sie der Nacht davonflogen. In den Tag hinein. Es war der vierzehnte Juli.
Die Fliegenden schliefen.
„Siehst du etwas?“
Einer schlief nicht. Er saß neben mir. In wenigen Minuten können Sie an der linken Seite den Eiffelturm sehen, hatte der Pilot gerade angekündigt und ich hatte den Sonnenschutz des Fensters neben mir ein bisschen hochgehoben. Unten lagen klar umgrenzte braune, grüne und gelbe Flächen nebeneinander, Ackerland, Getreide-, Mais-, Zwiebelfelder; dazwischen helle Linien, Straßen.
„Nein“, sagte ich.
Manchen mag man allein wegen der Art, wie er einen Namen ausspricht, das R rollt, das E offen lässt, eine Tür, durch die man den Sprecher gerne Eintritt gewährt.
„Du hast Sandalen an“, sagte er.
Und ich freute mich, obwohl keiner im Flugzeug barfuß war.
Bei den Dingen, die wir für alle sichtbar an uns tragen, freut es uns am meisten, wenn sie jemandem auffallen. „Du hast grüne Augen“, sagt jemand und schon freuen wir uns, obwohl diese Gegebenheit kaum erstaunlicher ist, als die Tatsache, überhaupt Augen zu haben.
Der Pfau besitzt ebenfalls zwei und trägt ein drittes im Gefieder.
Wenn die Pfauenfrau ihn sieht, schlägt er ein Rad.
Das ist alles, was wir mit ihm gemein haben.
2 AM TAG bevor ich das Flugzeug bestieg, war ich seit Monaten wieder einmal in der Stadt gewesen, aus der ich gerade abflog. Eine Stadt, die ich gut kannte, oft besuchte, aber trotzdem nicht meine Stadt nannte. Um welche Stadt es sich handelte, ist belanglos. Nennen wir sie Mokum. Nach einer gewissen Zeit, wenn man eine gewisse Anzahl von ihnen gesehen hat, gleichen sie einander alle. Wie sich auch alle Menschen gleichen, in all ihrer Verschiedenheit. „Egal, welche Sprache sie sprechen, werden ihre Worte doch wieder eine anders klingende Version desselben sein.“ Das waren seine Worte gewesen. Es käme auf die Art zu schauen an, zum Beispiel, ob man auf oder unter dem Tisch säße, während man Ausschau hielte. Das waren meine. „Du stiehlst den Leuten die Worte aus dem Mund“, sagte er. „Natürlich“, erwiderte ich, „da kommen sie her.“ Ohne Münder gäbe es sie gar nicht.
Die schönsten Städte der Welt sind jene, die ich kaum gesehen habe. Die, in denen ich gerade lange genug gewesen bin, ihre Umrisse auszunehmen. Den Schatten, den sie auf die nächstliegenden Hügel werfen, auf die daran anschließenden Seen und Meere.
Einen ihrer Gerüche um die Mittagszeit.
Einen Windhauch, der Bäume zum Schweben brachte.
Einen Ball, der einen Strauch Blüten regnen ließ.
Eine Stadt, in der man ankommt, wenn es Frühling ist und die Bäume blühen, ist wie ein Mensch, der einem zufällig begegnet und einige bemerkenswerte Worte sagt, einen festen Händedruck hat, einen zarten Atem. Ein Mensch, der mir alles verspricht, weil ich nicht mehr von ihm weiß, als was ich sehe, fühle und höre; ein Mensch, der mir noch alles werden kann. Jemand, von dem ich gerade genug kenne, um zu bemerken, dass ich ihn mag, doch zu wenig, um zu wissen, dass er Mundgeruch hat und schnarcht, wenn er Bier trinkt. Jemand, der einem ein Geliebter werden könnte, begegnete man ihm nochmals. Jemand, der ein Geliebter wird, weil ich ihm niemals mehr begegne, seinen Namen nur halb verstehe und mich schäme nachzufragen. Jemand, der riecht, als hätte er sich gerade erst gewaschen und mit Sonnenstrahlen eingeölt. Jemand, dessen Armbewegung mir gefällt, seine Art, das Hemd aufzukrempeln an den Ärmeln. Wie die Ellbogen aus dem Stoff ragen und an den Handgelenken feine Haare ihre Wuchsrichtung ändern.
In den kurzen Schatten um die Mittagszeit, unter einem Himmel, der blau genug ist, um Hintergrund zu sein für Bilder, die mir in den Augen schwimmen, während ich am Rücken liege und nach oben starre, deutet eine unbekannte Stadt ihre Geheimnisse an, doch gibt sie nicht preis. Sie verspricht, was sie nicht halten muss, bekommt den Bonus des Flüchtigen, Vergänglichen. Museen, die Fassaden bleiben, weil ich sie nur von draußen sehe, verwandeln sich in viel versprechende Grotten voll wunderbarer Schätze. Restaurants, an deren gedeckten Tischen ich, einen Apfel aus der Hand kauend, nur vorbeigeeilt bin, werden zu himmlischen Tempeln voll herrlichster Speisen, während in den Fenstern der Läden bunte Stoffe und extravagante Plattenhüllen mit unverständlichen Aufdrucken Gegenstände zu sein scheinen, die ich immer haben wollte.
Am Vortag, kaum in Mokum angekommen, hatte ich ihn gesehen, ihn, den ich immer sah, wenn ich hierher kam. Er küsste eine Frau auf den Mund. Ich nehme nicht an, dass es seine Schwester war. Seit ich eines Tages beiläufig verkündet hatte, dass man in dieser Stadt nie jemanden zufällig träfe, den man kannte, dass diese Stadt glücklicherweise gerade die richtige Größe hätte, weil man sie gerade noch zu Fuß durchqueren könne, ohne sich aber fortwährend von bekannten Gesichtern beobachtet zu fühlen, traf ich ihn ständig. Oft saß er auf dem Fahrrad und fuhr so langsam, dass ich ihn weder überholen, noch hinter ihm herfahren konnte. Ich kannte wenige Leute, hinter denen herzufahren lästiger war. Ich fühlte, dass ich schneller war als er, doch sobald ich zum Überholen ansetzte, beschleunigte er, kaum merkbar und scheinbar unabsichtlich, trat rascher in die Pedale. Dann kam Gegenverkehr und ich blieb wieder hinter ihm, der jetzt aufs Neue in sein übliches Tempo zurückfiel, das deutlich unter meinem üblichen Tempo lag.
Meist sah er mich auch, doch manchmal sah er mich nicht. Die Male, da er mich nicht bemerkte, betrachtete ich als Triumph. Ich wohnte nicht in der Stadt, doch er musste wohl davon überzeugt sein, dass ich in der Stadt wohnte. Ich sah ihn öfter als meinen besten Freund. Sobald ich ihn sah, verbarg ich mein Gesicht hinter meiner Haut und sagte schnell ein Wort, das jegliches Gespräch ausschloss. Meist saßen wir auf Fahrrädern, wenn wir uns trafen. Das machte es einfacher, keine Unterhaltung aufkeimen zu lassen. Ab und zu saß er in einem Stuhl des Cafés des Lichtspielhauses. Allerdings saß ihm immer jemand gegenüber, und dieses Gegenüber war immer eine Frau; sodass es bei diesen Gelegenheiten außer eines kurzen Kopfnickens keiner weiteren Kontaktaufnahme zwischen uns bedurfte. Wir nickten und bewegten unsere Münder, als würden wir einen Laut fabrizieren, verschluckten diesen aber, noch bevor er die Lippen passieren konnte, und drehten uns in unsere eigenen Richtungen.
Er hatte dunkelbraunes Haar, das er oft schwarz trug und in Locken bis an die Schultern. Er war kleiner als er sich vortat. Vielleicht lag darin der Grund, dass er saß, wo immer ich ihn traf. Vielleicht war das Sitzen seine bevorzugte Lebensform. Im Sitzen sehen alle ungefähr gleich groß aus. Vielleicht waren die Frauen, die ihm gegenüber auf den Stühlen des Cafés des Lichtspielhauses saßen, größer als er und vermied er es, neben ihnen zu gehen oder zu stehen, saß lieber mit ihnen und schlug daher fortwährend das Kino als Treffpunkt vor, wo die Chancen, dass man einen Abend im Sitzen verbringen konnte, beträchtlich höher waren als an anderen Orten der Vergnügung. Nie sah ich ihn zweimal mit derselben Frau.
Die wenigen Male, da ich ihn stehend traf, stand er immer allein. Das war auf abendlichen Cocktailempfängen des Instituts, in dem wir einst beide gearbeitet hatten. Er arbeitete nach wie vor dort. Ich nicht mehr. Trotzdem wurde ich noch immer zu diesen Festlichkeiten eingeladen und folgte den Einladungen geschmeichelt, wenn ich gerade in der Stadt war, immer hoffend, dass er nicht käme.
Mitunter kam er tatsächlich nicht und ich konnte das Fest in vollen Zügen genießen. Meist aber war er schon vor mir da. Warum ich weniger genoss, wenn er anwesend war, begriff ich selber nicht recht, hatte er mir doch nie etwas zuleide getan, benahm sich weder unhöflich oder gar frech, noch besonders aufdringlich oder herablassend. Nein. Es war einfach so, dass mir seine Anwesenheit im selben Raum unangenehm war und dass dieses Unbehagen auf keiner rationell erklärbaren Ursache gründete. Ich weiß nicht, ob er ähnlich für mich empfand. Doch ich bezweifle es, denn sobald ihn auf diesen festlichen Zusammenkünften die hinund herpendelnden Ströme von Leuten in meine Richtung trieben, suchte er ein Gespräch, das er nie fand. Ich verbarg meine Worte hinter dem Rücken, sobald er sich näherte, oder steckte sie geschwind einem Nächststehenden zu, sodass er sich mir nach dem Austausch der üblichen Wetterberichte mit einem Monolog auf der Zunge gegenüber fand, der ihm in dem Maße leiser geriet, je offensichtlicher ich nach anderen Gesprächspartnern suchend an seiner rechten Schulter vorbeistarrte, bis er ganz verstummte, „wir sehen uns“ murmelte, worauf ich ihm einen guten Abend wünschte.
Immer, wenn ich diesen Wunsch aussprach, glomm ein Leuchten in seinen Augen auf, das auch gebrannt hatte, als er sich mir näherte, im Laufe unseres Nicht-Gesprächs aber verloschen war. Er fühlte die Aufrichtigkeit des Wunsches, denn es war nicht so, dass ich es nicht gut mit ihm meinte. Es war nur so, dass ich mit derselben Intensität, mit der ich ihm am Ende dieser unglücklichen Unterhaltungen Gutes heraufbeschwor, wünschte, er lebte in einer Welt, in der ich nicht war, sodass ich ihm nicht mehr zufällig begegnen müsste. Wäre ich ihm nie begegnet, hätte ich ihn ganz gerne gemocht, glaube ich, vielleicht hätte er mich sogar amüsiert, wie er mit seinen Frauen im Café saß oder alleine am Fahrrad. Hätte ich ihn nie getroffen, hätte ich darüber lachen können, dass es Leute gab, die hinter ihm radelten und schneller waren als er, denen es aber trotzdem nicht gelang, ihn zu überholen, die darum immer vergrämter dreinschauten, vergeblich stets aufs Neue zum Überholen ansetzten, endlich aufgaben und in eine andere Gasse abbogen.
Niemand hatte mich vom Bahnhof abgeholt, als ich in Mokum ankam. Also sperrte ich meine Tasche in ein Schließfach. Später würde ich sie holen und zu denen bringen, auf deren Sofa ich übernachtete. Nach einigem Herumdrücken gelang es mir, sie hineinzuschieben. Ich warf eine Münze in den dafür vorgesehenen Schlitz, doch die Tür schnappte nicht ein. Das Schloss war defekt. Ich zog die Tasche wieder heraus, fing an zu schwitzen und stopfte sie in ein anderes Fach. Das funktionierte. Erleichtert trat ich hinaus auf den Bahnhofsvorplatz, der eine Baustelle war, wie die meisten Bahnhofsvorplätze in den meisten Städten Baustellen sind. Die Luft duftete nach jungen Bäumen und ich ging erwartungsvoll geradeaus.
Wenige hundert Meter weiter hatte ich ihn dann mit ebendieser Frau auf einer Bank sitzen sehen, der Frau, die, wie ich vermute, nicht seine Schwester war. Er bemerkte mich nicht, denn er war, wie gesagt, sehr mit ihr beschäftigt. Ich hielt mir zwei Daumen nach oben. Ein kleiner Sieg, er hatte mich nicht gesehen und die Luft roch noch besser.
Ich streifte durch die Straßen, ging in eine Ausstellung und kaufte mir einen Badeanzug. Ich wollte ins Schwimmbad. Museen und Schwimmbäder gehören zu den wunderbarsten Erfindungen der Menschheit. In aller Welt gleich gestaltet, flößen sie in ihrer Öffentlichkeit und Allgegenwärtigkeit ein Vertrauen ein, das andere Örtlichkeiten nur in Gesellschaft gewähren. Lichtspielhäuser gehören ebenfalls in diese Kategorie. Doch noch war es zu früh, in einem dunklen Saal zu verschwinden. Das würde ich später, abends, nachholen. Zuerst der Badeanzug.
Bereits im ersten Geschäft, das ich betrat, sah ich etwas, das mir zusagte. Die Bedienung gratulierte mir zu meiner Wahl, lobte ausgiebig das Material, seine Festigkeit und Farbe, betonend, dass dieses Stück jetzt günstiger zu haben sei, am Ende der Saison, und dieser Kauf ein außerordentlicher Glücksfall, dass der Preis, den sie mir mache, die Hälfte des ursprünglichen betrage. In meinem Glück drehte ich mich noch einmal um, während sie den Betrag in die Kassa tippte, ging zu den Ständern hinter der Spiegelsäule in der Mitte des Ladens, wo ich die Bademäntel vermutete. Kaum hatte ich die Säule umrundet, sah ich in einem anderen, an der Wand befestigten Spiegel einen bekannten Rücken. Seinen Rücken. Gewiss, ich war schließlich bereits einige Stunden in der Stadt, es wäre ein Wunder gewesen, hätte ich ihn nicht zweimal getroffen. Der Rücken saß. Er saß auf einem der schwarz gepolsterten Hocker vor den Vorhängen der Umkleidekabinen, vor ihm zwei große Einkaufstaschen mit eleganten Aufdrucken. Die Vorhänge ließen zwischen Boden und Vorhangrand einen Spalt frei, durch den in einer der Kabinen nackte Füße zu sehen waren. Auf diese Füße schien er zu warten. Schnell ging ich zur Kasse, nahm flüsternd meine Ware entgegen und verließ das Geschäft mit der Genugtuung, ihm wieder entwischt zu sein. Ein zweiter Sieg.
Vor dem Spiegel in der Vorhalle des Bades meine Haare trocknend, las ich auf einem an die Eingangstür geklebten Plakat von einem Kurzfilmfestival. Es wurde in dem Kino abgehalten, in das ich am liebsten ging, wenn ich in der Stadt war. Es war das Kino, in dem ich auch ihn regelmäßig zufällig traf. Doch das war kein Grund, es zu meiden, traf ich ihn ja immer und überall zufällig. Die einzige Möglichkeit, ihn nicht zu treffen, wäre gewesen, nie mehr in diese Stadt zu kommen. Und selbst dann. Diese Welt war zu klein, um uns beide voneinander fern zu halten.
Der erste Film des Festivals begann in einer halben Stunde. Wenn ich mich beeilte, konnte ich noch rechtzeitig dort sein.
Der junge Mann an der Kasse lächelte im grünen Pullover, als wäre ich der wichtigste Zuschauer dieses Abends. Ich wartete nicht ab, ob er das mit jedem so machte, sondern betrat den Saal. Die Leinwand war nicht besonders groß, also wollte ich so weit vorne wie möglich sitzen. Die meisten Besucher schienen weitsichtig zu sein und drängten sich in den hinteren Reihen. Bereits auf dem Weg in die erste Reihe, die noch leer war, entdeckte ich in der zweiten Reihe, genau hinter dem Platz, auf den ich mich setzen wollte, einen bekannten Hinterkopf. Neben dem Hinterkopf befand sich ein Kopf, den ich auch schon gesehen hatte, allerdings erst einmal. Ich hielt inne und setzte mich irgendwo in die Mitte. Du wirst dich doch jetzt nicht von ihm in deinem Verhalten beeinflussen lassen, sagte ich mir und antwortete mir unverzüglich, dass ich mich keinesfalls beeinflussen ließ, sondern tatsächlich lieber in der Mitte saß, denn die erste Reihe dieses Saales war besonders weit vorne, viel weiter vorne als bei gewöhnlichen Sälen war diese erste Reihe, und auf keinen Fall wollte ich in ihr sitzen. Ich sank so tief in den Stuhl, dass ich die beiden nicht mehr sah, und bald hatte ich sie vergessen.
Im Film füttert eine Katze einen Fisch mit Fliegen, bis er dick und aufgeblasen in seinem Glas schwimmt. Das Glas steht auf einem Piratenschiff, das auf blauen Wogen mit schwarzen Rändern schwimmt. Alle Figuren sind zweidimensional gezeichnet. Die Katze ist flach wie der Fisch und die Piraten. Der ebenfalls flache Piratenkapitän besitzt außer der Katze und dem Fisch noch einen Vogel. Der Vogel ist ein Papagei, spricht aber nicht, sondern probiert, den Fisch zu fressen. Dabei ertrinkt er im Fischglas und wird von den Piraten gebraten und verspeist. Die Katze fängt Fliegen, indem sie Fischgräten auf den Boden legt und die Fliegen, die sich darauf niederlassen, mit ihrem Schwanz erschlägt. Als der Fisch so dick ist, dass er sich im Glas nicht mehr umdrehen kann, zerschlägt die Katze das Glas und frisst den Fisch. Nun umsurren die Fliegen die Katze und machen sie verrückt. Da kein Fisch mehr da ist, um die Fliegen zu verspeisen, springt die Katze ins Meer. Dort ist sie die Fliegen los und ertrinkt. Am Ende hängt der Kapitän alle Tiere als Zeichnungen an die Wand.
Im zweiten Film arbeitet ein Vampir, dem lange Zähne wachsen, sobald er sich in eine Frau verliebt, als Rettungsfahrer. Eines Nachts verliebt er sich in eine Ärztin. Er lockt sie ins Naturhistorische Museum und beißt sie dort in den Hals. Nach dem Biss entblößt auch sie zwei lange Stockzähne. Sie sind glücklich und saugen sich gegenseitig aus. Als sie morgens mit dunklen schweren Lidern unter einem ausgestopften Elch erwachen, öffnet der Kurator des Museums gerade die Oberlichter. Eines nach dem anderen. Den beiden bleibt keine Zeit zu fliehen. Ein Lichtstrahl verwandelt sie in Fledermäuse, die man am Ende des Films ausgestopft im Schaukasten hängen sieht. Nachts aber erwachen sie ab und zu und küssen einander auf die Schnauzen.
Der dritte Film handelt von zwei Frauen, die einander beim Friseur treffen. Sie haben sich ein halbes Jahrhundert lang nicht gesehen. Als Mädchen hatten sie einander einmal auf den Mund geküsst, im Schwimmbad, mit Badeanzügen bekleidet und in Frotteehandtücher gewickelt. Nun küssen sie einander unter den Trockenhauben des Friseurs.
Nach der Abtitelung stand ich schnell auf und verließ den Saal. Draußen war das Licht, als käme es von innen, als strahlte es aus den Dingen. Auf der anderen Seite der Straße lag der See schwarz und unbewegt: Die Nacht war flüssig gefallen und hatte sich über den Boden gelegt. Zwischen See und Saal drehte sich ein Karussell, flitzten Spielzeugautos unter einem sternenbemalten Pappdach, gerade groß genug, dass sich erwachsene Menschen neben ihren Kindern hineinfalten konnten, um in den darauf folgenden Minuten so viele andere Autos zu rammen wie nur möglich. Daneben schwebten leuchtende, flimmernde Kugeln, in denen ebenfalls Sitzplätze vorgesehen waren, leer zu lauter, fröhlicher Musik. Vor dem Kassenhäuschen der wirbelnden Kugeln tanzte ein Herr im weißen Jackett springend Achter in die Luft.
Ich setzte mich auf die Stufen, die zum Autodrom führten, und nahm einen Zettel aus der Tasche. Ich setzte Buchstaben aufs Papier, weil sie mir gefielen. Ein kleiner Bub setzte sich neben mich und aß Gummibären. „Ich heiße Yanik, wie heißt du?“, sagte er. „Mahlzeit“, sagte ich. „Das ist mein Abendessen“, sagte er. Ob er oft abends Gummibären äße, fragte ich. „Immer“, sagte er. Yanik nahm mir das Blatt aus den Händen und bat mich um meinen Stift. Dann schrieb er die Seite voll. „Lies vor, was ich geschrieben habe“, befahl er mir. „Kannst du nicht lesen?“, fragte ich. „Nein“, sagte er. Auf dem Zettel standen Buchstabenreihen, die laut ausgesprochen an den Gesang eines Raben erinnerten. Ich las den Rabengesang vor und Yanik klatschte in die Hände. „Noch mal, noch mal“, schrie er und ich wiederholte den Rabengesang, ließ die Ks noch deutlicher gegen den Gaumen krachen als beim ersten Mal. „Das habe ich geschrieben?“, vergewisserte sich Yanik. „Das hast du geschrieben“, sagte ich und fügte hinzu, dass ich jetzt gehen müsse. Yanik sprang auf und rollte die Stufen hinunter. Er hatte Rollschuhe an. „Servus“, sagte Yanik und rollte hinter das Karussell.
Ich ging zum Seeufer und starrte eine Weile in die Nacht. Dann ging ich zur Straße zurück, wartete am Zebrastreifen, bis die Autos stehen bleiben würden und ich auf die andere Seite konnte. Da kamen die zwei, erst jetzt, vom Kino. Sie querten die Straße ohne Zebrastreifen, ohne auf die Autos zu achten, küssten sich auf der Straße, gingen langsamer, blieben fast stehen. Die Autos bremsten Streifen auf die Straße, aber kein Fenster wurde heruntergekurbelt. Sein Haar war schwarz, wie meistens, ihr Haar war hell. An ihrer Hand hing ein Kind mit glatt gekämmten Haaren. An ihrer Hand hing Yanik. Er rollte langsam neben den beiden her, doch es schien, als bemerkten sie ihn nicht. Sie war nicht groß und nicht klein. Das Kind mit den Rollschuhen reichte ihr bis an die Hüften. Ich erinnerte mich, dass ich ihre nackten Füße kannte. Sie und er waren gleich groß, obwohl er nicht saß. Sie waren schön, bewegliche Skulpturen, die jetzt den Gehsteig erreichten. Ohne stehen zu bleiben, küsste er sie auf den Mund. Er steckte seine Nase in ihr Haar und hatte mich zum dritten Mal nicht bemerkt. Yanik hing an ihrer Hand und rollte weiter, ohne seine Füße zu bewegen. Yaniks Hand winkte mir.
3 IM FLUGZEUG raschelte ich mit der Zeitung. Neben mir raschelte er ebenfalls mit einer Zeitung. Ich hörte, dass er seine Zeitung las, genau wie ich Zeitungen lese. Ich hörte, wie er halbe Seiten herausriss, die Bögen so intensiv umschlagend, als handelte es sich um ein Gespräch, in dem er beabsichtigte, die Zeitung von seiner Meinung zu überzeugen. Ein Dialog mit dem Text. Auf diese Art las er zuerst den Kunst- und Literaturteil, dann – oberflächlicher – den Rest. Die gelesenen Seiten legte er unter seinen Sitz. Die Ausschnitte, die er bewahren wollte, steckte er in eine Tasche an der Wand. Wir saßen in der ersten Reihe der Economy-Klasse, beim Notausstieg. Als er genug gelesen hatte, schien die Zeitung aufs Zehnfache angewachsen, hatte sich von ihrem Platz unter dem Sitz her über einige Quadratmeter hin ausgebreitet, lag als halbzerknülltes Papiergewirr überall vor und unter unseren Sitzen. Nur die herausgerissenen Seiten verweilten ordentlich gefaltet in der Wandtasche.
„Falls wir abstürzen, küsse ich den Mann neben mir und sage ihm, dass ich ihn mehr als alles auf der Welt geliebt habe“, sagte er. Dann beugte er sich vor, bückte sich zum Stapel unter seinen Sitz hinunter und holte ein Buch herauf, das er sich in den Schoß legte. Der Mann neben ihm sei Philippiner und habe bereits zwei schlaflose Nächte hinter sich, fügte er hinzu. Nun schlief er vor seinem Essenstablett. Der Philippiner trug einen Anzug. Sein Kopf hing vornüber, ruckte in unregelmäßigen Abständen auf und ab, zuckte manchmal unversehens zurück, schlug leicht gegen die Lehne, einen nackten Hals freilegend, der wie bei allen Schlafenden so verwundbar wirkte, dass ich mich fragte, wie er sich traute, ohne Halsschoner herumzulaufen, konnte ihm doch jederzeit einer die Kehle durchschneiden.
„Warum fragen wir Leute, die zufällig neben uns im Flugzeug sitzen, immer nach ihrem Beruf?“, fragte er neben mir, während ich mein Besteck aus dem Plastik mit dem aufgedruckten Flugliniennamen wickelte, und fragte mich nach meinem. Wäre es nicht besser zu fragen, was sich jemand wünschte? Was er täte, wenn er wüsste, dass er nur mehr einen Tag zu leben hätte? Die meisten würden sich eine lange Reise wünschen. Wir befanden uns auf einer langen Reise und dachten daran, zu Hause zu bleiben. Sein Vater sei viel gereist, sagte er, allerdings hätten ihn die Länder, die er besuchte, nicht sonderlich interessiert, mehr die Stempel, die er im Reisepass sammelte und seinen Freunden zeigte, wenn er zurückkam.
Er trank Orangensaft und las Plato aus einem Taschenbuch, in dem er während des Lesens manche Stellen schwarz umrandete. Im hinteren Drittel des Buches steckte ein Foto, das er mir herüberreichte. Auf dem Foto war eine Frau. Sie trug eine Sonnenbrille mit braunem Rand, die außer den Augen auch die Hälfte der Wangen verdeckte. Die Frau war seine Mutter. Sie bitte Gäste immer aufzustehen und sich gerade hinzustellen, damit sie sie genau betrachten könne, sagte er. Dann mustere sie die Stehenden eingehend von unten nach oben und sage ihnen, dass sie sich vorstellen sollten, einen Stapel Bücher am Kopf zu tragen, der nicht herunterfallen dürfe. Das würde ihre Haltung bessern. Er müsse in der Vergangenheit sprechen, verbesserte er sich, denn seit einigen Jahren spräche sie kaum und erkenne nicht einmal mehr ihn, den Sohn. Eigentlich müsste er den ganzen Flug über weinen, sagte er.
Mein Hund starb am selben Tag wie mein Vater, sagte er.
Wenn ich an den Hund denke, kommen mir noch immer die Tränen.
Über den Vater habe ich keine einzige geweint.
Der Mensch ist ein seltsames Tier.
Er schaute, als fühle er den Hund noch einmal in seinen Armen sterben, und ich schaute schnell weg von ihm, auf das Foto der Mutter, damit der Hund noch einige Zeit am Leben bliebe. Außer der Sonnenbrille trug die Mutter einen schwarzen Badeanzug und brünettes Haar und lächelte geradewegs in die Kamera. Als ich ihm wieder ins Gesicht sah, erkannte ich in seinem das Gesicht der Mutter und fragte, ob seine Schwester ihr ähnlich sähe. Er nahm eine runde Brille mit dick geschliffenen Gläsern aus einem schwarzen Etui und blätterte ein weiteres Foto aus seinem Buch. Die Schwester hatte ein rundes Gesicht und keine Brille. Das dritte Foto, das er aus dem Buch zog, war das Foto einer Frau mit langen schwarzen Haaren, die er als „Laura“ vorstellte.
In der Sitzreihe hinter uns erwachte eine Dame und beschwerte sich bei einer anderen Frau. Lauter als irgendjemand sprächen wir und würden noch alle Insassen des Flugzeuges aus dem Schlaf reißen, hielten sie sogar vom Radiohören ab. Die andere reagierte nicht, rückte nur ihre Kopfhörer zurecht und den Fernsehschirm im Sitz vor ihr, der die Flugroute angab. Der Mann zwischen den beiden schlief tief, bemerkte nichts. Sie wurde unruhig, erhob sich und setzte ihre Klagen zu ihrem nun leer gewordenen Sitz gewandt fort. Mit uns sprach sie nicht. Dessen ungeachtet entschuldigten wir uns und wurden nicht rot und versprachen Stille. Eine Weile flüsterten wir nahe an unseren Ohren, lehnten uns zurück, beugten uns vor, holten zum Zeichen unseres guten Willens Zeitungen und Bücher unter den Sitzen hervor. Aber solange wir uns sichtbar gern mochten, konnte die Dame keine Ruhe finden.
Wir sind nicht daran gewöhnt, uns jemandem erst vorzustellen, nachdem wir bereits seine Nachspeise aufgegessen haben. Meist tun wir dann, als hätten wir uns gerade erst getroffen. „Freut mich sehr“, drücken wir unserem Gegenüber die Hand und tun, als hätten wir ihm nicht bereits unser halbes Leben erzählt. Die Nachspeise war eine rosa Torte mit Biskuitteigboden.
Er hieß Moor Corriagua.
Ich heiße Hans Lokomotiv.
Möchtest du noch etwas trinken? Wir tranken Wasser aus Plastikbechern. Gleich würde er Caipiriña trinken, sagte der Steward, der einen Moment lang uns gegenüber an der Wand lehnte. Es sei immer ein Wahnsinn, nach Brasilien zu kommen, fuhr er fort, ein Wahnsinn. Winter sei es jetzt in Brasilien, sagte Moor neben mir, kein Wahnsinn. Der Steward lachte. Er werde schwimmen gehen. Noch am selben Abend. Schwimmen, im Winter! Ein Wahnsinn. Dann ging er freundlich winkend zurück in die Küche des Flugzeugs.
„Warum fliegst du nach Brasilien“, fragte Moor nahe an meinem Ohr. Ich schwieg. Nicht, dass ich keinen Grund für meine Reise nennen hätte können, nicht, dass ich nicht zu sagen gewusst hätte, wer mein Flugticket bezahlte und wofür. Zwar war ich mir sicher, er würde lachen, erzählte ich, was ich dort suchte, mir nicht glauben oder, wenn er mir glaubte, sich empören über diese Verschwendung von Energien und Mittel für etwas, das keineswegs dem Wohle der Menschheit diente – sondern ausschließlich meinem eigenen; aber das war es nicht. Er hatte mich mit seiner Frage in einem der Momente erwischt. Momente, die mich manchmal überfielen, in denen ich nichts beantworten konnte, ohne mich gleichzeitig zu fragen, ob die Antwort auch unter Berücksichtigung allen mir zur Verfügung stehenden Wissens eine absolute und richtige sei. Legte ich die mögliche Antwort auf seine Frage an die Basis meiner Existenz und maß sie an dem Wenigen, das ich in einem Moment wie diesem als triftiges Motiv gelten ließ, gab es durchaus keinen vernünftigen Grund, um ausgerechnet an diesem Tag nach Brasilien zu reisen. Wie es für die meisten Tätigkeiten selten absolut vernünftige Gründe gibt. Er, neben mir, wirkte wie einer, der eine solche Antwort sogar verstehen, zumindest akzeptieren würde. Wie einer, der sich auch schon einmal gedacht hatte, dass der Mensch ein ziemlich schlappes Tier war. Eines, das für gewöhnlich im Halbdunkel seiner Höhle saß, nur ab und zu herauskam, wenn es hungrig wurde, und einen Seehund erschlug oder was ihm unter die Finger kam, solange es nicht zu schnell war oder zu stark und gut schmeckte.
Er aß und ich driftete ab. Gedanken sind schwierig zu fassen. Zugleich überall und nirgends anwesend, ähneln sie vorbeihuschenden Insekten, die wegfliegen, sobald man sie bemerkt, schon tot sind, während man den Wind ihrer Flügel noch auf der Haut spürt. Weder die Gesetze der Physik noch die der Geographie beherzigen sie.
Menschen wollen effizient sein. Nichts vergeuden, wissen, wohin es geht und warum folgen. Wir erbosen uns über Verzögerungen im Reiseplan, sofern ihnen nicht eine belegbare Ursache zugrunde liegt, sind unterwegs: nach, um, zu. Und ich gehöre zu uns und erbose mich (mitunter) mit uns. Aber manchmal, während der Momente, merke ich, dass es nichts ausmacht. Dass es egal ist wie früh oder spät und aus welchen Gründen. Dass es keine Gründe gibt, sondern nur gibt. Dass die Zeit sich zwangsläufig selbst und von selbst verschwendet, allein dadurch, dass es sie gibt und uns gibt und andere gab. Einen, der stand, der saß und ging und herum hing. Einen, der viel fragt und wenig Antworten weiß, oder umgekehrt, viel antwortet und wenig fragt. Dass wir die Zeit erfunden haben, sie gar nicht da wäre ohne uns. Davon auszugehen, sie dauere ewig, unzählbare Billionen von Millisekunden, sei folglich dasselbe, wie anzunehmen, sie dauere nur einen Augenblick – einen meiner Momente – und solange ich tat, als sei sie unendlich, war sie unendlich; tat ich, als sei sie mir zu kurz, schrumpfte sie wie ein zu heiß gewaschener Pullover. Nie mehr würde er mir passen, so sehr ich auch daran zerrte, um viele Nummern zu klein war er mir geworden, sodass ich ihn besser gleich einem Kind geben konnte, dem es vielleicht mit Mühe und Not noch gelang, hineinzuschlüpfen.
Es gebe Indianerstämme in Nordamerika, die in ihrer Sprache keinen Unterschied machten zwischen Zeit und Raum, sagte Moor. Als hätte er meine Gedanken belauscht. Egal, ob es lange her war, erst viel später geschehen würde oder sich auf einem anderen Erdteil befand, nannten sie es weit weg. Es käme durch ihre Lebensweise. Jahrhunderte lang hätten sie in einer riesigen leeren Landschaft gelebt, die sie nur zu Fuß oder auf Pferden durchquerten. War etwas weit fort, dauerte es lange, es zu erreichen.
Er legte sein Besteck hin, bestellte ein Glas Wein.
Ich zog mir die Schuhe aus.
Ich fliege, um Eichhörnchen zu fangen, sagte ich schließlich – eine verspätete Antwort auf seine Frage nach dem Ziel meiner Reise. Sobald ich eines habe, reiße ich ihm einige Haare aus. Danach lasse ich es wieder frei. Durch das Haar des Eichhorns schaue ich in seine Vergangenheit. Ich ziehe seine Gene aus dem Haar, seine Geschichte. Wie es einst nach Brasilien gekommen ist, vor Millionen Jahren. Es scheint, dass es die Beringstraße überquert hat, als sie noch trocken war und Bäume darin wuchsen, ein dichter Wald. Wälder sind die Hauptverkehrswege der Eichhörnchen, baumlose Flächen in all ihrer Offenheit und Leere bieten ihnen unüberwindliche Barrieren. Die Eichhörnchen waren lange vor uns da. Lange bevor wir Parks hübscher fanden als Wälder. Lange bevor wir lernten, eine Nuss zu knacken, legten sie bereits Vorratslager an, sagte ich und sah ihn an. Wie man Eichhörnchen finge, fragt er. Der Steward bat mich, mir meine Schuhe anzuziehen, wir würden gleich landen.
Den Wein haben sie wohl vergessen, sagte Moor, beugte sich wieder unter seinen Sitz, griff sich die Bücher, steckte die Zeitungsausschnitte aus der Wandtasche dazwischen, stapelte sie ordentlich aufeinander und legte sie auf den Boden zurück. Einen der Artikel behielt er auf dem Schoß. Er zeigte das Bild dreier Tiere. Eine Giraffe, ein Zebra, ein Löwe. Die Tiere waren Figuren eines Zeichentrickfilms. Das Zebra beschloss an seinem Geburtstag, genug zu haben vom Zoo, in dem es lebte, und in die Welt hinaus zu ziehen. Als das Zebra fort war, erschraken die anderen Tiere, befürchteten, es würde in der Stadt ermordet werden, und machten sich auf, es zu suchen und zu retten.