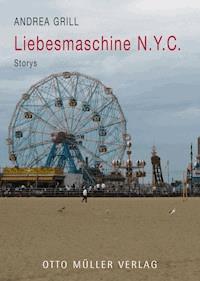
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Wienerin in New York City - nach Romanen und einem Gedichtband erscheint von Andrea Grill nun ein Band mit Reise-Essays, die allesamt in und um New York herum spielen. Aber eigentlich schreibt hier nicht nur eine Wienerin, sondern jemand, der sich zeitlebens als New Yorkerin gefühlt hat. Andrea Grill nimmt uns mit auf ihre Reise. Sie stellt uns Menschen vor, denen sie begegnet ist, und berichtet Ereignisse, die sie miterlebt hat. So erfährt man ei-niges über das Leben in dieser ewig faszinierenden Stadt und gleichzeitig - wie es dem Ideal des Reisens entspricht - sehr vieles über die Person, die reist. Wie filmische Short cuts reihen sich die Episoden der Porträtierten zu einem bunt gewürfelten Ganzen. "Liebesmaschine N.Y.C." ist die Liebeserklärung einer Schriftstellerin an eine Stadt, die einen in ihren Rhythmus und ihre Lebendigkeit hineinzieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Grill
Andrea Grill
Liebesmaschine N.Y.C.
STORYS
OTTO MÜLLER VERLAG
www.omvs.at
ISBN 978-3-7013-1199-6
eISBN 978-3-7013-6199-1
© 2012 OTTO MÜLLER VERLAG, SALZBURG-WIEN Alle Rechte vorbehalten Satz: Media Design: Rizner.at, Salzburg
Reisende verschieben die Orte, die sie besuchen, bringen sie einander näher.
Anita Pichler
Any inventory of America is inevitably anti-scientific, a delirious ,abracadabrant‘ confusion of objects, in which jukeboxes resemble coffins.
Susan Sontag nach Jack Kerouac
METRONOM
ICH BIN EINE New Yorkerin gewesen, bevor ich je einen Fuß in die Stadt setzte. Das ist nicht einfach so dahin gesagt. Das Tempo der Schritte der Fußgänger ist das Metronom einer Stadt, ein Code, anhand dessen sich identifizieren lässt, wo man sich befindet; auf der Suche nach einer Messgröße für die Verschiedenheit von Städten ist man darauf gestoßen. Nicht die Bauwerke, die Schritte der Menschen, die sich in ihr aufhalten, machen jede einzelne Stadt unverwechselbar.
Ich gehe so schnell wie die New Yorker, kann nicht mehr aufhören zu gehen, wenn ich gehe, höre ich ein Klicken im Rücken, unterm Schulterblatt, ein dumpfes metallisches Geräusch, das Echo eines Knisterns. Ganz plötzlich ist es da gewesen, kein echter Schmerz, eher ein Drücken, manchmal vergessen, trotzdem: anwesend. Wie, wenn einem jemand eine Hand auf die Hand legt, das tut nicht weh; erst auf Dauer tut es weh. Ich muss ein Stück Eisen absorbiert haben, oder Stahl, nach Aluminium klingt es nicht. Das Metall hat sich unmerklich ins Fleisch integriert, klickt zu jedem meiner Schritte entlang der Avenues.
Habe ich eine der Tabletten verschluckt? Die es geben wird, wenn singularity eintritt, das Eingreifen der Technik in die menschliche Evolution; kleine Hardwarechips, die nach Bedarf diverse innere Organe reparieren, sie folgen der auf ihnen befindlichen Software. Man schluckt sie, statt sich einer Operation zu unterziehen. Es klingt nach Fortschritt.
Bei einem Thema, das es erlaubt, nimmt er kurz meine Hand, hält sie fest, obwohl sich das Thema geändert hat; die Geste könnte noch als unverbindlich gelten.
Ich habe einen Zwilling in New York, sagt er.
Wie oft Menschen einander im Gespräch berühren – ein anderes Metronom; in Mexiko hundert Mal pro Stunde, in Rom zwanzig Mal, in London ein Mal, in manchen Städten hält man sich während des Sprechens immer an den Händen. In New York, wo ich zuhause bin, geschieht es, wie es sich ergibt, einmal so, einmal so. Je nachdem, mit wem man spricht; je nachdem in welcher Sprache.
Wenn Musiker in einer Stadt auftreten, sprechen sie das Publikum mit dem Namen der jeweiligen Stadt an, egal woher die Leute in Wirklichkeit kommen; manchmal sind sie aus einem anderen Land. Bei vielen Konzerten habe ich mich von einer solchen Anrede angesprochen gefühlt ohne aus der betreffenden Stadt zu sein.
Bevor ich nach New York reise, liege ich am Strand einer italienischen Insel, auf der ich mich regelmäßig aufhalte. Es ist Mai, es ist windig, ich lese am Telefon meine elektronische Post. „Wenn Sie wollen, können Sie ab September nach New York kommen.“
New York steht nicht in der Nachricht, aber für mich steht da: New York. In Wirklichkeit steht da: New Jersey, die Achselhöhle Amerikas. Und plötzlich will ich, an der Küste des tyrrhenischen Meeres, dringend nach New York. „Falls Sie so kurzfristig reisen können“, steht da. Ja, antworte ich, ja ich kann.
Zu allen sage ich: Ich gehe nach New York, meiner eigentlichen Heimat, es ist mir vertraut. Zu keinem sage ich: New Jersey.
Ich liege im Mittelmeersand und denke an schnurgerade breite Straßen, deren Enden sich in staubigem Dunst verlieren. Bald werde ich sein, wo ich hingehöre.
Ich fahre mit einem Kajak auf der Donau.
Ich organisiere eine Party.
Ich kaufe einen Koffer.
Eine Freundin schenkt mir ein Armband mit einem echten Skorpion darin.
Habe ich dir je ein Armband mit einem in Glas eingelassenem Insekt geschenkt, fragt sie, als wir uns verabschieden.
Nein, antworte ich wahrheitsgemäß.
Die Antwort überrascht sie. Sie zieht eine Lade auf und nimmt aus der Lade, ohne zu suchen, genau das richtige Armband.
Das habe ich vergessen, dir zu geben, das wird dein Flugzeug und alle Flugzeuge vorm Absturz bewahren. Sie ist Astronomin, mit sehr blonden Haaren, einem senegalesischen Herz.
Der Koffer ist der erste Koffer, den ich mir nicht ausborge.
Den größten, den Sie haben, verlange ich im Geschäft. Als ich ihn über die Mariahilferstraße rolle, scheint er mir viel zu groß. Zuhause fülle ich ihn an. Nicht mit dem, was ich für drei Monate brauche, sondern bis er voll ist. Ich versuche, ihn aufzuheben; es geht nicht. Ich räume alles wieder aus und packe ein, was ich normalerweise für zwei Wochen mitnehmen würde. Ich hebe den Koffer auf – ob das zwanzig Kilo sind? Waage besitze ich keine.
Mein Wissen über New York City setzt sich, wie das bei Heimatorten so ist, kaum aus Zahlen, Fakten zusammen, ich weiß, welche Farben, Umrisse es hat; klar, scharf, kein Pastell. Licht, sehr viel Licht, crispy, knuspriges, resches Licht, vor allem: Bars. Ich kenne das Leben in New York, seine Bewohner, wie sie sich kleiden, was sie hören, lesen, beschäftigt; wie beschäftigt sie sind.
Wie meine Reise auf einer Insel beginnt, hat die Idee zu dieser Stadt mit einer Insel angefangen, holländische Siedler nannten sie New Amsterdam, kein Wunder, Holländer hatten nie Scheu vor dem Wasser. Unter dieser Insel, Manhattan, muss ein enormer Magnet sein, dessen Gravitationsfeld alle Leute der Erdoberfläche ansaugt und das hinausreicht bis in andere Galaxien. Kaum denkbar, wie es die Erde schon so lange geben hat können, bevor es New York gab. Niemand sagt zu mir, Ach schade, du Arme, du musst nach New York.
In New York haben wir es zum ersten Mal geschafft, eine Landschaft zu bauen, mit Canyons, Talmündern – ein für den einzelnen unkontrollierbares Relief, aber doch ganz von uns und nicht von einem Gletscher oder Fluss gestaltet und bewohnbar bis in seine äußersten Spitzen.
Wir bewundern unser Talent. New York ist ein Talisman, ein Amulett, dem wir glauben, dass uns Menschen nichts wirklich Schlimmes zustoßen kann; wir haben den Glücksbringer ja selber gemacht.
Für mich als New Yorkerin im Exil erfüllt die Zeitschrift The New Yorker eine ähnliche Funktion. Ich kaufe den New Yorker zu einem überteuerten Preis auf europäischen Flughäfen oder in Bahnsteigkiosken; trage ihn mit mir herum, lese ab und zu eine Seite. Nie habe ich den New Yorker von vorne nach hinten gelesen, selten einen Artikel zu Ende. Ihn zu haben ist herrlich. Er ist die einzige Zeitschrift, die ich möglichst jede Woche haben will. Ich lege mich mit ihm auf die Couch und das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben, stellt sich ein; smart zu sein, clever und crisp. Er fällt mir aus den Händen auf die Nase. Dass ich den New Yorker lese, ist der Beweis dafür, dass es mir gut geht.
Am elften September des Jahres zweitausendundeins war ich ebenfalls auf der Insel, auf der ich neun Jahre später die Einladung aus New York erhalte.
Ich betrat eine Bar in einem Dorf mitten in den Bergen und sah, wie Fenster eines Wolkenkratzers – hinter den mit Aperol gefüllten Cocktailgläsern erkannte ich das Gebäude auf den ersten Blick gar nicht – wie Erdäpfelchips herumflogen, die der Luftzug einer knallenden Tür aus der Schale fegt. Die Übertragung war kein Thriller, sondern Live-Nachrichten.
Questo è New York, sagte der kahle Mann hinter der Theke damals bedächtig, stellte eine Schale Oliven neben die Gläser mit dem durchsichtig roten Aperol.
Neun Jahre später bin ich wieder dort und alles ist ruhig wie damals. Auf der Straße spricht man in Großbuchstaben, in Kleingruppen, an ein Auto gelehnt, zählt die Sonntage an den Segeln der Frachtschiffe aus dem Westen.
Bevor ich nach New York City abfliege, esse ich mit einem Freund Risotto. Vielleicht riecht es noch danach, wenn du zurück kommst, sagt er, als er sich verabschiedet.
Ich reise über Paris, die Flight-Attendants sprechen Französisch, sind höflich wie ich mir eine Schwiegermutter wünsche. Über den Wolken scheint, wie immer, die Sonne; neben mir sitzt eine glücklicherweise ziemlich dünne Frau. Die Dinge, die während des Fluges in ihrem Schoß liegen, ein Mobiltelefon, ein Kalender, Stifte, ein Gebetbuch mit der Aufschrift „Rain Prayers“, sortiert sie jedes Mal, bevor sie zur Toilette geht, sorgfältig in eins der papierenen Spucksackerl, auf denen ein Aufdruck in Blau diverse Städte in Erinnerung ruft: Cairo, Rom, Kiev, Delhi, San Francisco.
Das ist nicht mein erster Flug nach New York, ich bin schon einmal dort umgestiegen.
JANE
MEIN ERSTES AMERIKA hieß Jane, und ist einmal neun Stunden lang neben mir gesessen, Ellbogen an Ellbogen. Der erste Satz, den ich von ihr gehört habe, lautete, Where are my pills? Mühsam bahnt sie sich den Weg zu ihrem Platz, obwohl da gar nichts im Weg ist. Hinter ihr geht ein Bub. Er gehört zu ihr, trägt nämlich vier der mir zahllos erscheinenden Papiertaschen und -täschchen, die ebenfalls zu ihr gehören. Nachdem sie einige im Gepäckfach verstaut hat, und andere wieder heraus gefallen sind, nimmt sie ihm die restlichen Taschen ab. Mein Amerika atmet laut, mit offenem Mund. Sie verrichtet Schwerstarbeit. Ein Steward bietet Hilfe an. Sie nennt ihn darling und lehnt dankend ab. Die Täschchen, die partout nicht oben bleiben wollen, klemmt sie sich unter die Arme. Als Jane neben mir in ihren Sitz sinkt – noch nie habe ich jemanden so vollendet in einen Sitz sinken sehen, als wäre der Ausdruck eigens für Jane erfunden worden –, übersieht sie mich geübt. In einer winzigen Handtasche auf ihrem Schoß findet sie eine Tablettenschachtel, holt die Packung heraus, drückt zwei der Pulver in die hohle Hand, schluckt sie trocken hinunter. Dann streicht sie dem Buben übers Haar, legt einen Stapel Bücher, Zeichenpapier und Spiele auf seine Oberschenkel und schnallt ihn an. Er lässt alles gelassen über sich ergehen. Während Jane die Tabletten nimmt, rückt er die Brille auf seiner Nase um zwei Millimeter hinauf.
Ich habe mir vorgenommen, mich meinem Sitznachbarn vorzustellen. Egal wer es ist. Neun Stunden lang Ellbogen an Ellbogen zu verbringen wäre an sich schon Grund genug sich vorstellen zu wollen, ich habe aber einen anderen. Die Maschine, in der wir sitzen, wird von Buenos Aires nach New York City fliegen. Seit geraumer Zeit vermeide ich Flüge. Ab und zu überliste ich mich aber, und buche blitzschnell, bevor ich es selber richtig merke, heimlich doch eine Flugreise. Sobald ich am Flughafen in Socken vor einer Sicherheitsbeamtin stehe und darum bettele, meine Zahnpasta mit ins Flugzeug nehmen zu dürfen, wird mir jedes Mal wieder klar, dass ich ungern fliege. Ich sehe Leute mit Katzenkörben auf dem Schoß, Passagiere mit Yorkshire-Terriern an der Leine in der Abflughalle promenieren. Die Zahnpastatube muss draußen bleiben. (Sie fällt in eine große Mülltonne zu hunderten anderen Zahnpastatuben.) Jane nimmt einen Spiegel aus einer anderen Handtasche und wirft sich darin einen mitleidigen Blick zu. Ich muss mich ihr vorstellen, weil es sein könnte, dass wir bald ganz nah nebeneinander sterben werden. Das kann auch an anderen Orten passieren. Nur, im Flugzeug weiß man schon vorher ganz genau, wen man dann an seiner Seite hätte. Ich habe mir immer gedacht, dass ich gern jemandem die Hand geben würde, wenn ich sterbe, und seltsamerweise auch, dass ich dann gerne wissen würde, wie der heißt. Jane holt eine winzige Zahnpastatube aus der allerwinzigsten ihrer vielen Taschen, in der auch die Tabletten sind, wirft die übrigen Taschen auf den Sitz und drängt sich am Bub vorbei, der in einem der auf ihn gehäuften Bücher blättert. Sie eilt zur Toilette.
Als sie zurückkommt, stelle ich mich ihr vor.
Freut mich, Jane Miller, sagt sie, ich bin sehr nervös.
Fliegen Sie selten, frage ich voll Verständnis.
Jede zweite Woche, sagt sie. Aerolineas Argentinas ist die ärgste Fluglinie von allen.
Beim Start schließt sie die Augen. Ihre Lider zucken. Der Bub, den sie mir als ihren Sohn vorgestellt hat, reibt beruhigend über ihre Schulter. In einem argentinischen Dorfkino habe ich wenige Tage vorher zufällig einen Dokumentarfilm über Aerolineas gesehen. Wie eine Landebahn zu kurz gebaut wurde, und das erste Flugzeug, das zu landen versuchte, im Wald explodierte. Jane ist zart und blond. Sie sei Ärztin, sagt sie, Gynäkologin, deshalb müsse sie ständig auf Kongresse und ständig fliegen. Sie lebe in einem großen Haus in New Jersey. Wenn ich nach New York käme, solle ich sie unbedingt besuchen, ich könne bei ihr wohnen, sagt sie, das Haus sei so groß. Da merkt man gar nicht, ob einer mehr oder weniger da ist. Ich sage, dass ich diesmal leider nur sechs Stunden in New York bleibe, danach weiter fliege. Some other time, sagt sie. Auf ihrer Visitenkarte lese ich: Dr. Jane Miller, specialist for in vitro fertilization. Jane singt mir leise summend eine Melodie vor. Aus „Sound of music“ sei dieses Lied, ein großartiger Film, ob ich ihn kenne? Sie sei fünfunddreißig Mal in Paris gewesen, beim Tennisturnier French Open, leider erst ein einziges Mal in Wien. Ein weiterer Lieblingsfilm von ihr ist „Heaven can wait“ von Ernst Lubitsch. Auch den kenne ich nicht. Ich müsse ihn mir unbedingt anschauen, ein must! Jane Miller zückt einen Stift und schreibt „Heaven can wait“ auf die Rückseite ihrer Visitenkarte. Ich stecke die Karte ein. Man kennt das. Amerikaner laden einen immer zu sich nach Hause ein, ernst meinen sie das natürlich nicht. Auf Amerikaner darf man sich niemals verlassen. Ich würde ihr schreiben und ihr meine Adresse geben, falls sie nach Europa käme. Von Bei-mir-Wohnen sage ich nichts, murmle stattdessen etwas von small house und dass ich ihr, wenn sie nach Wien käme, die Stadt zeigen würde. Die Stunden vergehen im wahrsten Sinne des Wortes im Fluge. Ab und zu schläft Jane. Ab und zu schlafe ich. Nur der Sohn scheint immer wachsam durch seine Brille zu blicken.
Der Steward gießt Milch in den Kaffee, als die Maschine zu fallen beginnt. In Sekundenschnelle scheint sie mehrere hundert Meter zu sacken. Schlagartig sind alle wach und schreien. Neben mir schreit Jane Miller. Die Stewardessen schreien auf spanisch. No pasa nada! No pasa nada! Jemand sagt, das sind bloß Luftsäckchen. Ein Luftsack von den Ausmaßen eines Hügels. Die Maschine fängt sich. Vorsichtshalber schreien alle weiter. Mit einem Ruck sinkt das Flugzeug wieder. Der Kaffee ist überall, nur nicht in der Schale. Jane Miller schreit aus Leibeskräften. We ’ve hit a cow!, höre ich aus ihrem Mund, frage mich, ob das ein Ausdruck ist, den Amerikaner benützen um Entsetzen auszudrücken. Mit einer Kuh zusammenstoßen? Janes’ Sohn schreit nicht, aufmerksam blickt er um sich. Nur das Buch hat er zugeklappt. Ich bin auch still. Warum eigentlich?, denke ich, zwischen den Kuhgedanken, bei dieser Gelegenheit wäre Schreien eindeutig angemessen. Und warum schreit das Kind nicht? Was ist mit uns beiden los, dass wir stumm dasitzen, während das Flugzeug abstürzt?
Es stürzt nicht ab. Jane Miller entschuldigt sich überschwänglich dafür, dass sie geschrien hat.
Bitte, bitte, nicht der Rede wert. Manchmal ist es gut zu schreien.
Ich war überzeugt, es ginge uns an den Kragen!, Jane wischt sich mit einem Taschentuch den Mund ab. Mit einem anderen wischt sie Kaffee von meiner Hose. In America, sagt sie,





























