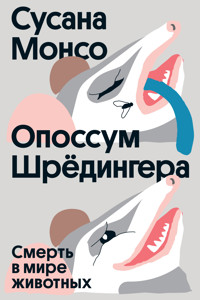23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schimpansen putzen die Zähne toter Artgenossen. Krähen meiden Orte, an denen sie Kadaver gefunden haben. Elefanten sammeln wie besessen Elfenbein. Wale tragen ihre Toten wochenlang durch das Meer. Dennoch glaubt der Mensch beharrlich, dass nur er allein in der Lage ist, sich einen Begriff von der eigenen Sterblichkeit zu machen. Denn seit jeher verstellt die anthropozentrische Perspektive den Blick auf die Vielfalt im Umgang mit dem Tod auf unserem Planeten. Dabei lassen sich derart viele faszinierende Reaktionen auf den Tod beobachten, die unseren zwar nicht gleichen mögen, doch trotzdem von Verständnis handeln.
Das Schweigen der Schimpansen verbindet philosophisches Nachdenken mit den aktuellsten Erkenntnissen aus der Verhaltensforschung und der vergleichenden Psychologie. So präsentiert Susana Monsó eine neue wissenschaftliche Disziplin: die vergleichende Thanatologie. Und sie zeigt eindrücklich, dass wir, wenn es um Tod und Sterben geht, vielleicht nur ein Tier unter vielen sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Susana Monsó
Das Schweigen der Schimpansen
Wie Tiere den Tod verstehen
Aus dem Spanischen von Thomas Brovot
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel La Zarigüeya de Schrödinger bei Plaza y Valdés Editores, Madrid.
eBook Insel Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025
© der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2025© 2021, 2022 Plaza y Valdés Editores.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildungen: Bridgeman Images, Berlin: Opossum (Karl Joseph Brodtmann/Purix Verlag Volker Christen); mauritius images, Mittenwald: Orca (Varvara Larionova/Alamy); Shutterstock, Berlin: Elefant (Gringoann.art), Delfin (Mai Chiem Thang)
eISBN 978-3-458-78454-8
www.insel-verlag.de
Widmung
Für Tote, dem ich so vielvon dem verdanke, was ich heute bin
Motto
Der Tod ist banal,
und verspüren wir das Bedürfnis,
über ihn zu theoretisieren,
sollten wir uns im Banalen üben.
Bob Plant
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Inhalt
Vorwort
1 Einführung. Das Schweigen der Schimpansen
2 Die Ameise, die ihrer eigenen Beerdigung beiwohnte
Ameisen und der Tod
Die philosophische Debatte über die geistigen Fähigkeiten von Tieren
Konzepte in der Tierwelt
Stereotype und kognitive Reaktionen auf den Tod
3 Die Walmutter, die ihr Baby um die halbe Welt trug
Methoden zur Erforschung der geistigen Fähigkeiten von Tieren
Vergleichende Thanatologie und die Gefahr durch den Anthropomorphismus
Anthropomorphismus, Anthropektomie und Anthropozentrismus
4 Die Schimpansin, die mit toten Äffchen Mama-Papa-Kind spielte
Intellektueller Anthropozentrismus
Das Minimalkonzept vom Tod
Warum das Minimalkonzept vom Tod ein Konzept ist
5 Der Hund, der seinen Menschen für einen Leckerbissen hielt
Emotionaler Anthropozentrismus
Trauer bei Tieren
Tragen toter Jungtiere
Trauer und das Konzept vom Tod
6 Der Elefant, der Elfenbein sammelte
Die Heilige Dreifaltigkeit des Konzepts vom Tod
EMOTION in der Natur
ERFAHRUNG in der Natur
KOGNITION in der Natur: Nichtfunktionalität
KOGNITION in der Natur: Irreversibilität
Das natürliche Konzept vom Tod
Können Tiere ihre eigene Sterblichkeit verstehen?
7 Schrödingers Opossum
Gewalt und das Konzept vom Tod
Tötung in Koalitionen und das Konzept vom Tod
Infantizid und das Konzept vom Tod
Prädation und das Konzept vom Tod
Thanatose und das Konzept vom Tod
Schluss. Das Tier, das den Toten Blumen brachte
Dank
Bildnachweis
Anmerkungen
Kapitel 1: Einführung.
Das Schweigen der Schimpansen
Kapitel 2:
Die Ameise, die ihrer eigenen Beerdigung beiwohnte
Kapitel 3:
Die Walmutter, die ihr Baby um die halbe Welt trug
Kapitel 4:
Die Schimpansin, die mit toten Äffchen Mama-Papa-Kind spielte
Kapitel 5:
Der Hund, der seinen Menschen für einen Leckerbissen hielt
Kapitel 6:
Der Elefant, der Elfenbein sammelte
Kapitel 7:
Schrödingers Opossum
Informationen zum Buch
Vorwort
»Nimmermehr« – sprach der titelgebende Rabe in Edgar Allan Poes Gedicht. Um zu verstehen, dass jemand gestorben ist, muss man, könnte man meinen, verstehen, dass die Person nimmermehr zurückkommt. Nimmermehr wird man ihr Gesicht sehen. Nimmermehr ihre Stimme hören. Nimmermehr mit ihr zusammen sein. Zumindest nicht auf dieser Daseinsebene.
Aber nimmermehr ist ein komplexer Begriff. Nimmermehr läuft auf die Ewigkeit hinaus. Niemals, bis ans Ende aller Zeiten, wird dieser tote Mensch noch einmal bei uns sein. Nimmermehr bedeutet für immer, und für immer ist nur eine andere Bezeichnung für die Ewigkeit. Aber müssen wir, um den Tod zu verstehen, wirklich die Ewigkeit verstehen? Wer von uns versteht die Ewigkeit schon wirklich? Ewigkeit ist ein unendlicher Zeitraum – eine unendliche Spanne Zeit, in der die Verstorbenen von ihren Angehörigen und ihren Liebsten getrennt sind. Und versteht irgendwer von uns das Unendliche? Vielleicht niemand. Nicht einmal in der Mathematik ist man sich einig, ob es so etwas gibt.
Soll das nun heißen, dass niemand von uns – abgesehen vielleicht von einigen der hellsten Köpfe, die es je gegeben hat – den Tod versteht? Das wäre eine seltsame Schlussfolgerung. Wir alle wissen, was der Tod ist. Wir mögen nicht gern an ihn denken. Und tatsächlich sagen uns manche Philosophinnen und Philosophen, dass wir, existenziell betrachtet, vor ihm fliehen. Wir weigern uns, ihn zu akzeptieren. Versuchen, nicht an ihn zu denken. Sehen unseren eigenen Tod als bloßes entferntes Ereignis in einer noch unbestimmten Zukunft. Aber wenn wir vor unserem eigenen Tod fliehen, sagen ebendiese Philosophen, dann nur, weil wir den Tod in unserem tiefsten Inneren sehr wohl verstehen.
Wir Menschen sind vielschichtige Lebewesen. Viel zu kompliziert, könnte man sagen. Zweifellos neigen wir dazu, Dinge übermäßig zu verkomplizieren. In dieser Hinsicht treiben es die Philosophen am ärgsten. Bei manchen von ihnen wird die Philosophie zur Kunst des Verkomplizierens. Nichts ist so einfach, dass Philosophen es nicht so lange kneten könnten, bis es in die Form einer unglaublichen, unnötigen und letztlich unplausiblen Komplexität gebracht ist. In dem Punkt täten sie gut daran, ein wenig intellektuelle Zurückhaltung zu üben. Eine Möglichkeit, sich eine solche Zurückhaltung anzugewöhnen, besteht darin, etwas von Individuen zu lernen, die nicht unseren Hang zum Verkomplizieren haben. Solche Individuen kennen wir als Tiere.
Susana Monsó bietet mit ihrem Buch ein passendes Gegenmittel gegen die unselige Neigung der Philosophie zur Verkomplizierung. Können Tiere den Tod verstehen? Schwer vorstellbar, dass sie es nicht könnten. Jedes Tier, das den Tod nicht versteht, hätte im darwinschen Überlebenskampf einen schweren Nachteil. Aber vermutlich verstehen Tiere die Ewigkeit, das Unendliche, kaum besser als wir. Was also verstehen Tiere, wenn sie den Tod verstehen? Und kann es uns etwas darüber sagen, was wir – menschliche Tiere – vom Tod verstehen?
Das vorliegende Buch ist eine überzeugende Darstellung dessen, was wir – und andere Tiere – verstehen, wenn wir den Tod verstehen. Und wollen wir uns selbst verstehen, halten wir uns dann an die Philosophie oder an die Tierwelt? Susana Monsó – eine Philosophin, und eine überaus begabte, keine Frage – liefert uns triftige Argumente, dass wir uns am besten an beide halten.
Mark Rowlands
1
Einführung
Das Schweigen der Schimpansen
Im November 2009 veröffentlichte die Zeitschrift National Geographic ein Foto, das Laien wie Fachleute gleichermaßen in seinen Bann schlug. Es zeigt Dorothy, eine etwas über vierzigjährige Schimpansin, die in einer Schubkarre liegt, befördert von zwei Menschen. Im Hintergrund drängt sich eine Gruppe von sechzehn Schimpansen hinter einem Zaun, sie alle starren, ein jeder von ihnen, auf ihre Gefährtin. Der Grund, warum das Foto so viele faszinierte, war die Tatsache, dass Dorothy gestorben war und ihre Artgenossen, mit denen sie die letzten acht Jahre in der Schimpansen-Rettungsstation Sanaga-Yong in Kamerun zusammengelebt hatte, sich offenbar versammelten, um von ihr Abschied zu nehmen.
Monica Szczupider, die Fotografin, die den Moment festhielt, beschrieb ihn so: »Schimpansen sind nicht still. Sie leben in Gruppen, sind gesellig, laut, echte Schreihälse, ihre Aufmerksamkeitsspanne ist normalerweise relativ kurz. Aber sie konnten den Blick nicht von Dorothy wenden, und ihr Schweigen sprach Bände, mehr als alles andere.«1 Aber was genau besagte es? Kann es sein, dass die Schimpansen etwas Ähnliches empfanden wie wir, wenn wir den Tod eines geliebten Menschen betrauern? Konnten sie verstehen, was mit Dorothy geschehen war? Wussten sie vielleicht, dass es früher oder später auch ihnen selbst passiert?
Abbildung 1: »Die trauernden Schimpansen« (The grieving chimps), Foto von Monica Szczupider.
Das Foto fand ein so breites Echo, dass nicht wenige Wissenschaftler beschlossen, ähnliche Fälle, die sie im Laufe der Jahre beobachtet und in ihren Schubladen hatten, zu veröffentlichen; andere schenkten nun dem Verhalten der von ihnen untersuchten Tiere, sobald der Tod ins Spiel kam, eine sehr viel größere Aufmerksamkeit. Es war die Geburtsstunde einer neuen Disziplin, der vergleichenden Thanatologie, die sich vornimmt zu erforschen, wie Tiere auf verstorbene oder dem Tod nahe Individuen reagieren, welche physiologischen Prozesse ihren Reaktionen zugrunde liegen und was ihr Verhalten uns über die geistigen Zustände der Tiere sagt. Zwar lag der Fokus ursprünglich auf den Primaten, aber in den letzten Jahren ist die Zahl der Publikationen explosionsartig gestiegen, und es erscheinen immer mehr Artikel, in denen es um Spezies geht, die weit entfernt sind von Affen und Menschenaffen, um Elefanten etwa, Wale, Pferde, Krähen und sogar Insekten.
Das Interesse an der Frage, wie Tiere mit dem Tod umgehen, ist Teil eines wachsenden wissenschaftlichen Trends, um herauszufinden, inwieweit andere Tiere über Fähigkeiten verfügen, die man traditionell einzig und allein dem Menschen zuschreibt. Immer zahlreichere Studien lassen den Schluss zu, dass viele Tierarten zumindest in rudimentärer Form aufweisen, was bisher als Garant galt für die menschliche Einzigartigkeit, eine Fähigkeit zur Unterscheidung von Mengen ebenso wie Rationalität, Moral, Sprache oder Kultur.2 Der Gedanke, der Mensch sei eine gesonderte, weit über das Tier hinausreichende Spezies, wird von Tag zu Tag weniger plausibel. Und so wird auch die Frage, ob Tiere eine Vorstellung von der Sterblichkeit haben, immer bedeutsamer, denn über Jahrhunderte hat sich der Mensch als die einzige Spezies begriffen, die – Segen oder Fluch – mit einem Verständnis vom Tod aufwarten kann.
Die vergleichende Thanatologie – die Untersuchung der Beziehung der Tiere zum Tod – ist eine Fachrichtung an der Schnittstelle zwischen Ethologie und vergleichender Psychologie. Die Ethologie ist der Zweig der Biologie, der sich der Erforschung des Verhaltens von Tieren widmet, und mit der vergleichenden Thanatologie teilt er eine Vorliebe für Feldstudien in mehr oder weniger natürlicher Umgebung. Die vergleichende Psychologie wiederum versucht, in Experimenten den geistigen Fähigkeiten von Tieren auf den Grund zu kommen, und vergleicht hierzu, wie verschiedene Spezies mit ähnlichen Problemen umgehen und welche kognitiven Mechanismen sie zu deren Lösung einsetzen. Die vergleichende Thanatologie teilt mit diesem Fach das Interesse an der Psychologie der Tiere, auch schöpft sie aus vielen ihrer Studien, um die Diskussion darüber zu bereichern, wie Tiere Sterblichkeit erleben und verstehen.
Allerdings hat das vorliegende Buch keine Ethologin geschrieben und auch keine Psychologin, sondern eine Philosophin. Das mag meine Leser und Leserinnen überraschen, wenn ihr Bild vom Philosophen dem eines älteren, bärtigen und pfeiferauchenden Mannes entspricht, der in seinem Sessel sitzt und über den Sinn des Lebens nachdenkt. Ich will nicht leugnen, dass eine solche Beschreibung auf einige von uns zutrifft, in Wahrheit aber ist die Philosophie eine sehr heterogene Disziplin, und Philosophen unterscheiden sich nicht nur erheblich in Alter, Geschlecht und Herkunft, viele von uns verwenden ihre Zeit auch auf Themen – ob Klimawandel, Terrorismus, Videospiele, Medizin oder Pornos –, die nicht zu dem gängigen Bild dessen passen, worüber ein Philosoph so grübelt.
In der Vielfalt der Themen, mit denen die Philosophie sich befasst, spiegeln sich einige Besonderheiten, die dieses Fach von anderen unterscheiden. Im Gegensatz zu anderen Zweigen der Natur- und der Geisteswissenschaften gibt es hier keinen festgelegten Untersuchungsgegenstand. Philosophieren lässt sich über alles Mögliche, denn die Philosophie ist eine Methode, eine Art, die Welt zu betrachten und über sie nachzudenken, nicht das Studium dieses oder jenes konkreten Phänomens. Was es Philosophen erlaubt, in einen ständigen Dialog mit anderen Wissensgebieten zu treten, sich locker von einer Disziplin in eine andere zu bewegen, nichts als gegeben anzusehen, jede Annahme infrage zu stellen und innovative und belebende Sichtweisen zu eröffnen, die als Katalysator dienen können für jegliche Debatte.
Mein Buch fügt sich ein in einen relativ jungen Zweig der Philosophie, die Tierphilosophie mit ihren Fragen nach den geistigen Fähigkeiten von Tieren. Zwar reicht die Philosophie des Geistes bis ins antike Griechenland zurück, wenn nicht noch weiter, doch im Laufe der Geschichte hat sie sich fast ausschließlich auf den menschlichen Geist bezogen. Die Tierphilosophie nimmt für sich in Anspruch, den Geist der Tiere nicht nur zu studieren, um uns selbst besser zu verstehen, sondern auch als ein Ziel an sich, da sie davon ausgeht, dass die Psychologie anderer Spezies auch unabhängig von dem, was sie uns über unsere eigene lehren kann, von Interesse ist. Zugleich steht diese Disziplin im Dialog mit den Naturwissenschaften, reflektiert die Methoden, mit denen wir das Verhalten und die Kognition anderer Spezies untersuchen, zeigt mögliche Voreingenommenheiten auf, die unsere Sicht verzerren, und nimmt sich vor, größere begriffliche Klarheit zu schaffen.
Die vergleichende Thanatologie, als eigenes Fachgebiet kaum zehn Jahre alt, bedarf dringend eines philosophischen Blicks, um verborgene Annahmen, die sich nachteilig auf die Forschung auswirken, zu identifizieren und die Bedeutung von Schlüsselkonzepten zu klären. Konkret soll es in diesem Buch darum gehen, jene anthropozentrischen Vorurteile zu erkennen und auszuräumen, die der Erforschung des Verhältnisses von Tieren zur Sterblichkeit im Weg stehen. Das Schlüsselkonzept, auf das ich mich dabei konzentriere, gleichsam das Rückgrat meiner Argumentation, ist das Konzept vom Tod. Was genau bedeutet es, den Tod zu verstehen, ihn zu begreifen? Ist die Vorstellung, der Begriff, das Konzept vom Tod etwas Binäres, ein Alles-oder-nichts, oder können wir es als ein Spektrum auffassen, als etwas, was einen höheren oder geringeren Grad an Komplexität zulässt? Wäre es sinnvoll, von verschiedenen Konzepten vom Tod zu sprechen, in denen die Perspektiven verschiedener Spezies ihren Platz haben?
Zu einem nicht unwesentlichen Teil geht es mir in diesem Buch daher um eine begriffliche Analyse. Was nicht heißen soll, dass eine bloß sprachliche Klärung das Ziel wäre, denn durch eine solche Analyse lassen sich Schlussfolgerungen über die Welt ziehen. Wollen wir zum Beispiel herausfinden, ob Experimente, die ein altruistisches Verhalten bei Tieren zeigen, ein Beleg dafür sind, dass Tiere eine Moral haben, müssen wir von einer klaren Definition dessen ausgehen, was es bedeutet, moralisch zu sein. Das Gleiche gilt auch hier. Durch eine Analyse dessen, was es bedeutet, ein Konzept vom Tod zu haben, können wir mit anderen Augen auf das uns vorliegende Material schauen. Mehr noch, die Analyse wird es uns ermöglichen, die kognitiven Voraussetzungen für ein Verständnis vom Tod klar zu umreißen, das heißt die psychologische Architektur, die ein Tier aufweisen muss, um ein Bewusstsein von der Sterblichkeit zu entwickeln. Wenn wir das wissen, können wir über die vergleichende Thanatologie hinausblicken und uns ansehen, was andere Bereiche wie etwa die Evolutionsbiologie uns sagen können zu der Frage, mit welcher Verbreitung dieser Fähigkeit in der Natur zu rechnen ist.
Verstehen Tiere den Tod? Im Buch verwende ich die konzeptionellen und argumentativen Instrumente der Philosophie, um die empirischen Daten, die sich auf dem Gebiet der vergleichenden Thanatologie im letzten Jahrzehnt haben sammeln lassen, zu analysieren und eine Antwort zu geben. Wie wir noch sehen werden, ist diese Disziplin seit ihren Anfängen gekennzeichnet von manch anthropozentrischer Verzerrung, die Thanatologen dazu verleitet hat, den Begriff vom Tod allzu intellektuell anzugehen und die Trauer als emotionale Reaktion auf das Ableben anderer in den Vordergrund zu rücken. Sind diese schiefen Wahrnehmungen erst aufgespürt und ausgeräumt, werden wir sehen, dass das Konzept vom Tod nur eine geringe kognitive Komplexität erfordert und dass es vielfältige Arten und Weisen gibt, wie Tiere emotional auf den Tod reagieren und etwas über ihn lernen können. Treffen meine Argumente zu, ist ein Konzept vom Tod sehr viel einfacher zu erlangen als bisher vermutet und im Tierreich weit verbreitet.
All das mag befremdlich klingen, wenn man es nicht gewohnt ist, bei Tieren von Vorstellungen, Begriffen, Konzepten zu hören oder von Emotionen. Sollte das der Fall sein, bitte ich um einen Vertrauensvorschuss, denn ich habe das Buch für interessierte Laien geschrieben, es setzt keine Kenntnisse in Tierpsychologie voraus. Aber vielleicht gehört der eine oder die andere ja auch zu der Gruppe von Personen, die bezweifeln, dass Tiere überhaupt Geist und Verstand haben. In dem Fall wartet eine Überraschung, denn ich werde hier nicht nur von der Beziehung der Tiere zum Tod sprechen, sondern ebenso auf die philosophischen Argumente eingehen wie auch auf viele der empirischen Belege, die den Gedanken stützen, dass der Mensch bei weitem nicht das einzige Tier mit mentalen Eigenschaften ist. Skeptiker sollten in meinem Buch also zumindest einen Denkanstoß finden.
Auf den folgenden Seiten beginnen wir mit der Philosophie und dringen sodann weiter vor in die vergleichende Thanatologie und ihre anverwandten empirischen Wissenschaften. Ich habe versucht, fachliche Abgrenzungen auf ein Minimum zu beschränken, und wo es nicht anders ging, habe ich mich bemüht, sie mit viel Liebe und möglichst auch einer Prise Humor zu erklären – auch wenn ich Heiterkeit nicht garantieren kann. Ich bitte all jene, denen die Philosophie doch ein wenig schwerfällt, um Geduld. Und verspreche all denen, die sich auf Tiergeschichten freuen, dass es sie geben wird. Bleibt mir nur noch, Dank zu sagen, liebe Leserin, lieber Leser, für das Interesse an diesem Buch. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass alle es mit Vergnügen lesen und etwas darüber lernen, wie Tiere den Tod verstehen – und vielleicht auch ein wenig darüber, wie wir ihn verstehen.
2
Die Ameise, die ihrer eigenen Beerdigung beiwohnte
Als ich acht Jahre alt war, bekam ich vom Weihnachtsmann ein Mikroskop. Ich hatte mir eins gewünscht, nachdem ich es in der Fernsehwerbung gesehen hatte, da untersuchten Kinder mit großen Schutzbrillen und weißen Kitteln alle möglichen Alltagsgegenstände, die bei Vergrößerung unendlich spannend wurden. Ich versprach mir wer weiß was von dem Geschenk.
Als ich dann mit meiner neuen Errungenschaft spielte, merkte ich bald, dass es sehr viel langweiliger war, als die Werbung mir weisgemacht hatte. In dem Mikroskop-Set waren zwar ein paar Proben zum Untersuchen, aber viel zu wenige, und sie waren bei weitem nicht so faszinierend wie versprochen. Und die Sachen, die sich mir zu Hause anboten, waren zu groß, zu trübe oder zu öde, um sie unterm Mikroskop zu erforschen. Nein, ich brauchte etwas Reizvolleres.
Da kam mir die Idee, eine Ameise unter die Lupe zu nehmen – wer hat nicht schon mal gestaunt über das außerirdische Gesicht dieser Insekten, ihre riesigen Augen, die grimmigen Kiefer, die bedrohlichen Antennen? Das war genau die aufregende Erfahrung, nach der ich suchte.
Mein Plan hatte nur einen kleinen Haken: Die Ameise musste tot sein. Sie würde sonst die ganze Zeit herumwuseln, und es wäre unmöglich, sie gründlich zu untersuchen. Die einzige mir bekannte Methode zum Ameisentöten – das klassische Zertreten – hätte fabelhaft funktioniert, wenn ich mir Gliederfüßerbrei hätte anschauen wollen, aber ich war mehr an einem unversehrten Exemplar interessiert.
Also nahm ich eines Morgens eins der Röhrchen, die dem Mikroskop beilagen, und fing eine Ameise darin ein, dort wollte ich sie so lange eingesperrt lassen, bis ihr der Sauerstoff ausging. Ich schäme mich, es zuzugeben, aber ich habe das Röhrchen den ganzen Tag in meiner Hosentasche behalten und es ab und zu herausgeholt, um zu sehen, ob die Ameise endlich zum Fortschritt der Wissenschaft beitragen wollte und die Liebenswürdigkeit besaß, den Löffel (die Antennen) abzugeben. Aber nein, sie krabbelte immer noch. War lebendig. Überaus lebendig. Weder sie noch ich wussten es damals, aber diese nervige Beharrlichkeit, nicht aufzugeben, rettete ihr schließlich das Leben.
Später am Nachmittag – mein Schnurrbart von den Resten des Kakaotrunks war längst eingetrocknet – wurde ich mir meines Tuns vollends bewusst. Aus irgendeinem Grund versetzte ich mich in die Lage der Ameise, und mich überkam eine unendliche Traurigkeit (Neugier war das eine, aber herzlos war ich nicht). Wie konnte ich zulassen, dass die Ameise starb? Wer war ich, einem unschuldigen Wesen das Leben zu nehmen? Auf einmal erschien mir das von einer nicht hinnehmbaren Grausamkeit.
Ich weiß noch, wie ich zu einem prachtvollen Rosenstrauch in unserer Wohnanlage ging, das Röhrchen vorsichtig öffnete und die Ameise, endlich frei, auf ein Blatt hinauskrabbeln ließ. Gut möglich, dass die Ärmste, die dort verwirrt herausschlich, als fragte sie sich, warum man sie auf diese sonderbare Weise entführt hatte, kurz darauf gestorben ist, aber in dem Moment war mir, als hätte ich sie gerettet. Als hätte ich alles richtig gemacht. Na ja, als wäre ich so etwas wie eine eins zwanzig große Miss Captain Marvel.
Dieser Moment der Verbundenheit und der Empathie mit der Ameise ist mir so lebhaft in Erinnerung geblieben, dass er sicherlich dazu beigetragen hat, den Menschen zu formen, der ich heute bin. Schließlich habe ich mich, auch wenn ich damals eigentlich Malerin werden wollte, am Ende der Tierethik zugewandt.
Auf den folgenden Seiten wird uns die Ethik als konstanter Hintergrund begleiten, aber nicht deshalb habe ich die kleine Geschichte erzählt. Im Buch werde ich davon sprechen, wie Tiere den Tod erfahren und verstehen. Natürlich sind auch wir Menschen Tiere, und so wird unser Konzept vom Tod stets präsent sein. Tatsächlich dient er als Kontrapunkt und Leitfaden für meine Überlegungen zu der Frage, was es heißt, Sterblichkeit zu verstehen.
Die Anekdote mit der Ameise ist hier insofern von Belang, als sie meinen damaligen Begriff vom Tod widerspiegelt. Ich wusste, dass die Ameise zu den Dingen gehörte, die sterben können (anders als zum Beispiel ein Stein, der nicht lebendig ist, aber auch nicht stirbt). Ich konnte vorhersagen, dass die Ameise sich, war sie erst gestorben, nicht mehr bewegen würde, sodass ich sie unterm Mikroskop hätte untersuchen können. Ebenso verfügte ich über gewisse Kenntnisse darüber, was bei einer Ameise zum Tod führen kann (auch wenn ich angesichts meiner höchst ineffizienten Methode zugeben muss, dass es keine allzu ausgeprägten Kenntnisse waren). Außerdem war ich in der Lage festzustellen, dass die Ameise noch lebte, und hätte ihren Tod erkennen können. Schließlich war ich imstande, mich in die Ameise einzufühlen und ihren Tod als Tragödie zu empfinden, als etwas Negatives, was es zu vermeiden galt. All das zeugt von einem recht komplexen Konzept vom Tod.
Ameisen und der Tod
Wir können durchaus einige Ähnlichkeiten erkennen zwischen meiner Anekdote und der Art, wie Ameisen selbst auf den Tod einer Gefährtin reagieren. Zum einen sind auch Ameisen bereit einzugreifen, wenn eine ihrer Schwestern in Lebensgefahr ist. Vor einigen Jahren wurde in einem Experiment1 eine Ameise mit einem Nylonfaden an einem Stück Papier befestigt und halb im Sand vergraben, um eine Situation zu simulieren, die sich in der Natur häufig ergibt, wenn diese Insekten unter Trümmern feststecken. Bei dem Experiment konnte beobachtet werden, wie die anderen Ameisen alles daransetzten, sie zu befreien. Zuerst gruben sie im Sand und zogen an den Gliedmaßen der Ameise, um sie herauszuziehen. Als ihnen das nicht gelang, konzentrierten sie sich auf die Schlinge und bissen so lange auf den Nylonfaden, bis sie ihn durchtrennt hatten und ihre Gefährtin retten konnten.
Zum anderen sind Ameisen ebenfalls in der Lage zu unterscheiden, ob eine von ihnen gestorben ist oder nicht. Stirbt eine Ameise im Inneren einer Kolonie, machen sich die anderen emsig daran, das tote Tier aus dem Nest hinauszubefördern, ein als Nekrophorese bekanntes Verhalten.
Trotz dieser Ähnlichkeiten können wir mit einiger Sicherheit sagen, dass Ameisen keinen Begriff vom Tod haben. Die Ameise, die ihre gefangene Gefährtin rettet, hat nicht deren Tod vor Augen und versucht auch nicht, ihn zu verhindern; sie reagiert auf einen chemischen Hilferuf, den die gefährdete Ameise aussendet. Tatsächlich würden die anderen die gefangene Ameise, hätten wir sie betäubt, nicht retten. Sie benötigen dieses chemische Signal zur Einleitung ihres Verhaltens.
Für die Nekrophorese gilt das Gleiche. Nicht dass die Ameisen verstanden hätten, dass sie es mit einer toten Ameise zu tun haben, es ist vielmehr eine bloße vorprogrammierte Reaktion auf einen chemischen Reiz. Die Nekrophorese wird ausgelöst durch den Duft von Ölsäure, den die Leichen dieser Insekten verströmen. Nehmen die anderen Ameisen ihn wahr, reagieren sie sofort auf die tote Ameise als »Müll, der aus dem Nest zu entfernen ist«. Aufgrund dieses starren Mechanismus wäre es einfach, sie zu täuschen. Nähmen wir eine lebendige Ameise und tupften ihr ein Tröpfchen Ölsäure auf den Hinterleib, würden die anderen Ameisen sie behandeln, als wäre sie tot. Mit anderen Worten, sie würden sie im Nu packen und aus dem Nest transportieren.2 Sie wären nicht imstande, zu dem Schluss zu gelangen, dass sie nicht tot ist, sosehr die »Leiche« auch zappelt und versucht, ihren Entführerinnen zu entkommen.
Wie auch immer, die Tatsache, dass ein solches Verhalten durch das Erkennen chemischer Stoffe gesteuert wird, muss nicht heißen, dass jede Flexibilität ausgeschlossen wäre. Ameisen, die ihre in einer Nylonschlinge steckende Artgenossin retten, zeigen ein gewisses Verständnis für die Situation; geht ihre Strategie nicht auf, können sie die Taktik ändern, denn sie haben verstanden, dass das Problem in der Falle selbst liegt, auch wenn ein Nylonfaden nichts ist, was sie in der Natur vorfinden würden.
Bei der Nekrophorese passiert Ähnliches. Obwohl es sich um ein Verhalten handelt, das auf einem Reiz-Reaktions-Mechanismus beruht, ist es nicht so einfach, wie man es üblicherweise darstellt.3 Ölsäure ist nämlich nicht der einzige Reiz, der eine Nekrophorese auslösen kann. Auch andere chemische Stoffe, die bei der Verwesung entstehen, können sie bewirken. Einige Ameisenarten reagieren schon, noch ehe der Verwesungsprozess einsetzt, sodass auch das Fehlen eines chemischen Lebenszeichens (wie bestimmter Pheromone) auszureichen scheint. Manche Spezies unterscheiden zwischen neuen und alten Leichen, und während sie die einen vergraben, entfernen sie die anderen aus dem Nest.4 Die jeweilige Situation scheint ebenfalls von Bedeutung zu sein: Wird bei der Nahrungssuche eine verwesende Ameise gefunden, löst dies keine Nekrophorese aus, es sei denn, die Leiche befindet sich nahe dem Nest. Und lässt sich ein toter Körper aufgrund von Umweltfaktoren wie Frost oder Überschwemmung nicht aus der Kolonie abtransportieren, können die Ameisen zu anderen Methoden greifen, um ihn zu beseitigen, sei es durch Vergraben oder gar in Form von Kannibalismus.5
Angesichts einer solchen Flexibilität im Verhalten stellt sich die Frage, wie wir überhaupt sicher sein können, dass Ameisen kein Konzept vom Tod haben. Um das zu beantworten, müssen wir eine klare Vorstellung davon haben, was ein Konzept ist.6 Konzepte können wir uns denken als die Grundbestandteile vieler unserer Gedanken. Der Gedanke »der Tisch wackelt« zum Beispiel ist dann zusammengesetzt aus den Konzepten Tisch und wackeln. Zwar erfordert, wie wir noch sehen werden, nicht jede Art des Denkens Konzepte, doch ein Lebewesen, das nicht in der Lage wäre zu denken, könnte niemals über Konzepte verfügen. Bevor wir uns also eingehender mit der Frage beschäftigen, ob Tiere Konzepte haben, müssen wir einen kleinen philosophischen Umweg machen und uns einer allgemeineren Frage zuwenden: Haben Tiere geistige Fähigkeiten?
Die philosophische Debatte über die geistigen Fähigkeiten von Tieren
1982 veröffentlichte der Philosoph Donald Davidson einen berühmten Vortrag, in dem er die Frage, ob Tiere geistige Kräfte haben und denkende Vernunftwesen sind, verneinte.7 Davidson fordert uns auf, uns einen Hund vorzustellen, der die Katze des Nachbarn durch den Garten jagt. Die Katze läuft direkt auf eine Eiche zu, doch im letzten Moment schwenkt sie ab und klettert auf einen anderen Baum, einen Ahorn. Der Hund sieht das Manöver der Katze nicht und rennt stur auf die Eiche zu. Er bleibt davor stehen, stützt sich mit den Vorderpfoten am Stamm ab und bellt in die Baumkrone hinauf. Wären wir Zeugen dieser Szene, würden wir wohl sagen: »Der Hund glaubt, die Katze ist auf der Eiche!«8 Mit anderen Worten, wir würden das Verhalten des Hundes erklären, indem wir ihm eine Überzeugung zuschreiben, eine Art des Denkens also. Gleichwohl sieht Davidson in solchen Zuschreibungen zwei große Probleme.
Das eine hat mit den Grenzen unseres Wissens zu tun. Wir können schlicht nicht die Perspektive des Hundes einnehmen, was uns einen direkten Zugang zum Weltverständnis des Hundes verwehrt. Ein solcher Zugang ist jedoch fundamental, wollen wir einem Individuum Überzeugungen zuschreiben. So können wir etwa der Reporterin Lois Lane die Überzeugung zuschreiben, dass sie mit Clark Kent zusammenarbeitet, nicht aber die Überzeugung, sie arbeite mit Superman zusammen, auch wenn Clark Kent und Superman dieselbe Person sind. Aber Lois Lane weiß nun mal nicht, dass Clark Kent und Superman dieselbe Person sind, und so verwenden wir auch den Namen »Clark Kent«, wenn wir davon sprechen, wie sie ihren Arbeitskollegen wahrnimmt.
Das uns hier beschäftigende Problem ist nun, dass wir unmöglich wissen können, wie sich die Überzeugung des Hundes genau ausnehmen würde. Woher sollten wir auch wissen, ob der Hund glaubt, die Katze sei auf »den ältesten Baum im Garten« geklettert, auf »den Baum, der am besten riecht« oder »den Baum, den die Katze das letzte Mal hinaufgeklettert ist«. Wollten wir dem Hund konkrete Überzeugungen zuschreiben, würden wir an diesem unüberwindlichen Hindernis scheitern.
Andererseits sind für Davidson Überzeugungen niemals isoliert zu haben, eine jede bedarf, wenn sie einen Sinn ergeben soll, zusätzlicher, mit ihr verbundener Überzeugungen. Ein Hund kann nicht glauben, dass etwas ein Baum ist, wenn er nicht zugleich eine ganze Reihe allgemeiner Überzeugungen im Hinblick auf Bäume hat: dass sie wachsen; dass sie Blätter haben, Äste, Wurzeln; dass sie Wasser und Licht brauchen et cetera. In Bezug auf die Katze gilt das Gleiche: Zu glauben, es sei eine Katze, impliziert auch die Überzeugung, dass sie ein Säugetier ist, dass sie vier Beine hat, dass sie miaut und so weiter. Zwar gibt es keine starre Liste allgemeiner Überzeugungen, die man haben muss, um zu glauben, dass etwas ein Baum ist oder eine Katze, doch ohne die Zuschreibung zumindest einiger dieser allgemeinen Überzeugungen, so Davidson, hat es keinen Sinn, dem Hund die Überzeugung zuzuschreiben, die Katze sei auf dem Baum. Aber noch einmal, wir können nicht wissen, welche dieser Überzeugungen der Hund hat, wenn überhaupt eine.
Nur wenige Philosophen mochten Davidsons Argument gelten lassen.9 Einerseits wurde darauf verwiesen, dass uns die Problematik, Tieren konkrete Überzeugungen zuzuschreiben, in nicht ganz so ausdrücklicher, aber doch ähnlicher Form begegnet, wenn wir anderen Menschen Überzeugungen zuschreiben. Wir können einfach nicht genau wissen, was ihnen durch den Kopf geht, und ebenso wenig können wir im Vorhinein und in allen Einzelheiten wissen, wie sie die Welt begreifen. Was uns nicht daran hindert, ungefähre Zuschreibungen vorzunehmen, etwa auf Grundlage dessen, was wir über ihre Persönlichkeit oder ihre Lebensgeschichte wissen. Vielleicht denkt Lois Lane an ihren Kollegen als den »Tollpatsch mit der Brille« und nicht als »Clark Kent«, aber es ist immer noch angemessen, ihn so zu nennen statt »Superman«, schließlich wissen wir, dass sie den Braten noch nicht gerochen hat.
Zugleich wurde argumentiert, Davidson sei allzu pessimistisch, wenn es um die Beschreibung dessen gehe, was wir über Tiere wissen können. Denn beobachten wir ihr Verhalten unter sehr kontrollierten Bedingungen, erfahren wir recht gut, wie sie die Welt verstehen, sodass wir ihre Überzeugungen auch eingrenzen können, sehr viel stärker jedenfalls, als Davidson meint.
Vorgebracht wurde auch, dass die Überzeugungen der Tiere keineswegs, wie von Davidson angenommen, aus Konzepten bestehen müssten. Genauso könnte es etwa sein, dass der Hund die Katze nicht als vierbeiniges, miauendes Säugetier begreift, sondern im Hinblick auf mögliche auszuführende Handlungen: als etwas Jagdbares oder Verzehrbares zum Beispiel.
Schließlich wurde betont, dass Davidsons Argument, wenn wir ihm denn folgen wollten, nur den Schluss zulasse, dass wir nicht wissen, welche Überzeugungen Tiere haben, es stütze jedenfalls nicht die Annahme, sie hätten gar keine. Die Frage, was den Tieren genau durch den Kopf gehe, sei eine andere als die, ob sie über geistige Fähigkeiten verfügten.
Für Davidson geht es jedoch nicht nur darum, dass wir unmöglich wissen können, welche Überzeugungen Tiere haben, für ihn ist allein die Vorstellung problematisch, Tiere seien denkende Wesen. Sein Argument ist das folgende: Ein Lebewesen, das Überzeugungen hat, muss überrascht sein können, denn überrascht zu sein heißt, zu registrieren, dass die Wirklichkeit nicht so ist, wie man glaubte, dass sie ist. Überrascht mich zum Beispiel, dass mein Bankkonto im Minus ist, dann bin ich imstande, mir den Gegensatz zwischen dem Geld, das ich zu haben glaubte, und dem Geld, das ich in Wahrheit habe, bewusstzumachen. Damit ein Lebewesen die Fähigkeit besitzt, überrascht zu sein und also Überzeugungen zu haben, so Davidson, muss es über den Begriff von Überzeugung verfügen; es muss in der Lage sein zu verstehen, dass etwas das ist, was es selbst glaubt, dass es ist, und etwas ganz anderes, wie die Welt sich darstellt. Überrascht mich der Anblick meines Bankkontos, zeige ich damit, dass ich den Unterschied zwischen dem Fantasiegebilde in meinen Kopf und der harten Realität verstehe.
Nun denn, für Davidson muss man, um den Begriff von Überzeugung zu haben, eine Sprache können. Sprache ermöglicht es, das von uns Geglaubte mit dem, was andere glauben, zu vergleichen und so die Vorstellung von einer objektiven Realität zu konstruieren, die unabhängig ist von all unseren subjektiven Überzeugungen. Da nur die Menschen über eine Sprache verfügen – oder zumindest über eine, die für diese Aufgabe hinreichend entwickelt ist –, können auch nur Menschen den Begriff von Überzeugung haben und somit Überzeugungen. Und da für Davidson Überzeugungen grundlegend und wesentlich sind für alles Denken, haben auch nur Menschen Gedanken.
Auch damit mochten sich nur wenige Philosophen anfreunden. So warf man Davidson etwa vor, er zäume das Pferd beim Schwanz auf. Selbst wenn es einen Zusammenhang gäbe zwischen der Fähigkeit, Überzeugungen zu haben, einem Begriff von Überzeugung und Sprache, sei es doch höchstwahrscheinlich genau andersherum. Das heißt, um Sprache und einen Begriff von Überzeugung zu entwickeln, sei es notwendig, erst einmal Überzeugungen zu haben, nicht umgekehrt. Auch impliziere die Annahme, Überzeugungen erforderten sowohl Sprache als auch einen Begriff von Überzeugung, dass vorsprachliche Kinder keine Überzeugungen hätten. Womit sich wiederum äußerst schwer erklären lasse, wie sie Sprache erwerben könnten. Ohne Überzeugungen, mit einem von Gedanken völlig freien Kopf, lässt sich tatsächlich kaum erklären, wie wir uns all die Namen der Dinge angeeignet und gelernt haben könnten, Gedankliches auszudrücken.
Davidsons Argumente sind also nicht sonderlich überzeugend. Aber fürs Erste haben wir nur aufgezeigt, dass speziell dieser Philosoph falschlag. Welche positiven Argumente können wir für die Existenz geistiger Fähigkeiten bei Tieren anführen? Im Allgemeinen unterscheidet man hier zwischen drei Hauptstrategien: dem Analogieschluss, dem Schluss auf die beste Erklärung und der Erklärung nach dem Sparsamkeitsprinzip.10
Der Analogieschluss legt den Fokus auf eine Eigenschaft X, von der wir wissen, dass sie mit den geistigen Anlagen des Menschen zusammenhängt, und versucht, durch Analogie zu dem Schluss zu gelangen, dass Tiere, die diese Eigenschaft X aufweisen, auch Geist haben müssen. Die Fähigkeit etwa, Probleme zu lösen, oder ein flexibles Verhalten sind Eigenschaften, die beim Menschen abhängig sind von seinen mentalen Fähigkeiten. Durch Analogie können wir schlussfolgern, dass jene Tiere, die in der Lage sind, Probleme zu lösen, oder ein flexibles Verhalten zeigen, ebenfalls Geist besitzen. In der Tat gibt es eine enorme und weiter zunehmende Anzahl von Studien in vergleichender Psychologie, die darauf hindeuten, dass viele nichtmenschliche Spezies fähig sind, Schlussfolgerungen zu ziehen, sich an Vergangenes zu erinnern, Zukünftiges vorherzusehen, zu planen, innovativ zu sein, sich an veränderte Umstände anzupassen und vieles mehr, was bei uns eine Form des Denkens erfordert.
Der Schluss auf die beste Erklärung beruht auf der Vorstellung, dass sich, gestehen wir Tieren Geist zu, bestimmte beobachtete Verhalten am besten erklären lassen, solche etwa, die allem Anschein nach falsch sind oder nicht mit der Realität übereinstimmen. Da sich die Katze nun mal nicht wirklich auf der Eiche versteckt, sondern auf dem Ahorn, ist die beste Erklärung für das Verhalten des Hundes, dass er glaubt, die Katze sei auf der Eiche. Hinter diesem Argument steht auch der Gedanke, dass wir bestimmte Verhalten nicht nur besser erklären können, wenn wir mentale Zustände zuschreiben, sondern dass wir, basierend auf ebendiesen mentalen Zuständen, auch Vorhersagen treffen können. Gehen wir zum Beispiel davon aus, dass der Hund den Wunsch hat, die Katze zu jagen, und die Überzeugung, dass die Katze auf der Eiche sitzt, können wir vorhersagen, dass er, sobald er merkt, dass die Katze in Wirklichkeit auf dem Ahorn sitzt, erst einmal überrascht reagiert und sofort dorthin läuft, wo nun, wie ihm soeben klar geworden ist, die Katze ist. Wenn unsere Vorhersagen zutreffen, deutet die beste Erklärung für diesen Erfolg auch hier darauf hin, dass Tiere tatsächlich über Geist verfügen.
Die Erklärung nach dem Sparsamkeitsprinzip schließlich basiert auf unserem Wissen über die biologische Evolution und die natürliche Selektion. Alle Spezies sind miteinander verwandt. Wir können zwei beliebige herausnehmen, und egal wie unterschiedlich sie sind, haben sie doch immer einen gemeinsamen Vorfahren. Je enger die Verwandtschaft, desto ähnlicher sind sie sich. Was auch für die geistigen Fähigkeiten gilt. Jene Spezies, die im Baum des Lebens nah beieinander sind, haben diese Fähigkeiten mit großer Wahrscheinlichkeit gemeinsam. Beobachten wir bei Spezies, die uns nahestehen, ein Verhalten, von dem wir wissen, dass unsere geistigen Fähigkeiten dazugehören, können wir annehmen, dass diese Spezies auch Geist besitzen. Das wäre die einfachste, die »sparsamste« Erklärung. Genauso bedeutet es: je enger die Verwandtschaft anderer Spezies mit der unseren – oder mit solchen, deren Psychologie hinreichend belegt ist –, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie Geist besitzen.11
Konzepte in der Tierwelt
Nehmen wir also an, dass zumindest einige Tiere in der Lage sind zu denken, auch wenn sie nicht über eine Sprache verfügen. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass sie Konzepte hätten, sich also von etwas einen Begriff machten, da manche Formen des Denkens durchaus unbegrifflich sein können. Stellen wir uns ein Eichhörnchen vor, das plant, wie es von dem Ast, auf dem es hockt, zu einem Ast des Baums gegenüber kommt. Dazu braucht es im Grunde weder ein Konzept von einem Ast noch ein Konzept von einem Baum. Genügen würde ihm zum Beispiel die Fähigkeit, in Bildern zu denken, sich im Kopf eine Karte des Baums auszumalen und mögliche Routen durchzuspielen. Was wiederum nicht bedeutet, dass Eichhörnchen keine Konzepte hätten, nur würden sie die für diese konkrete Form des Denkens nicht benötigen. Um sagen zu können, dass ein Tier Konzepte hat, müssen wir nicht nur zeigen, dass es denken kann, es muss auch über einige spezifische Fähigkeiten verfügen.
Erstens wird ein Tier mit einem Konzept die Einheiten, auf die dieses Konzept zutrifft, mit einem gewissen Grad an Zuverlässigkeit als solche erkennen können. Hat Carla zum Beispiel das Konzept Hund, sollte Carla imstande sein, einen Hund von Dingen wie einem Schuh oder einem Regenschirm und von anderen Lebewesen wie einem Frosch oder einer Fledermaus zu unterscheiden. Vielleicht ist Carla nicht gänzlich unfehlbar, wenn es darum geht, Hunde als Hunde zu erkennen. Sind alle Hunde, die sie in ihrem Leben gesehen hat, Pyrenäenberghunde, mag sie bei der ersten Begegnung mit einem Chihuahua denken, dass es ein anderes Tier ist, was aber nicht heißt, dass ihr ein Konzept vom Hund fehlt. Ein Konzept zu haben bedeutet also nicht, frei zu sein von jedem Irrtum, sobald eine Einordnung vorzunehmen ist, sehr wohl aber sollte es mit der Fähigkeit einhergehen, eigene Konzepte zu erlernen und zu verbessern. Würden wir Carla erklären, dass Chihuahuas ebenfalls Hunde sind, sollte sie imstande sein, diese aus der Schublade »mögliche Nagetiere« herauszunehmen und in die Schublade »Hunde« zu stecken, dann könnte sie ein solches Tier bei der nächsten Begegnung auch richtig einordnen.
Zweitens meint der Besitz eines Konzepts nicht nur die Fähigkeit, die Einheiten, auf die dieses Konzept zutrifft, als solche zu erkennen, es impliziert auch ein gewisses Verständnis für das, was in der Philosophie der »semantische Gehalt« eines Konzepts genannt wird, seine Bedeutung. Um bei Carla zu bleiben, so wird sie nicht nur Hunde von anderen Einheiten unterscheiden können, sie wird auch eine gewisse Kenntnis darüber haben, was es heißt, ein Hund zu sein. Sie wird zum Beispiel wissen, dass Hunde Säugetiere sind, dass sie vier Beine haben, dass sie bellen, dass sie ein Fell tragen oder dass sie verrückt danach sind, einem Ball hinterherzujagen. Was, wie schon bei Davidson anklang, darauf hinausläuft, dass jedes Konzept mit anderen Konzepten in einer Art semantischem Netz verbunden ist. Das Konzept vom Hund ist verbunden mit Konzepten wie dem vom Säugetier oder vom Bellen.
Zugleich ist der Gehalt eines jeden Konzepts weder statisch noch von Dauer. Im Gegenteil, er variiert je nach Zeitpunkt, Kultur und der betreffenden Person. So ist unser heutiges Konzept vom Hund ein gänzlich anderes als das vor zweitausend Jahren, als die wissenschaftlichen Erkenntnisse noch nicht so weit gediehen waren. Und das Konzept vom Hund, das wir in Europa haben, wo Hunde in erster Linie Haustiere sind, wird sich von dem Konzept in anderen Gesellschaften unterscheiden, in denen sie als kulinarische Delikatesse gelten mögen. Schließlich wird mein heutiges Konzept vom Hund – nachdem ich sechzehn Jahre mit einem zusammengelebt habe – ein anderes sein als zu der Zeit, als ich noch ein Kind war und schreckliche Angst vor Hunden hatte. Auch wird mein Konzept vom Hund ein anderes sein als das meiner Cousine Almudena, die Tierärztin ist und alles Mögliche weiß über die Anatomie und die Physiologie von Hunden, Fakten, die mir völlig unbekannt sind.