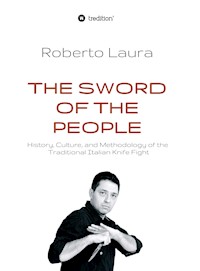19,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch "Das Schwert des Volkes" führt den Leser in die Geschichte und Kultur des volkstümlich italienischen Messerkampfes. Es liefert einen Einblick in die Riten und Jargons sowie in die Techniken und Taktiken der geheimen Schulen des Duells des Volkes, wie sie im 19. Jahrhundert im ganzen Mezzogiorno Italiens vorzufinden waren. Der Autor studiert diese fechterischen Traditionen der Halbinsel seit nunmehr vielen Jahren und ist einer der renommiertesten Experten auf diesem Gebiet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
© 2015 Roberto Laura
Gestaltung des Umschlages, Illustration:Irina Hutzler
Satz:Roberto Laura (unter Mitwirkung von Özgen Senol und Mario Schmidt)
Lektorat, Korrektorat:Andreas Runge, Özgen Senol, Simone Laura, Schlußlektorat Mario Schmidt
Verlag:tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-7323-5233-3
Das gesamte Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Schwert des Volkes
Geschichte, Kultur und Methodik destraditionellen, italienischen Messerkampfes
von Roberto Laura
Meiner Familie
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1Traditional Italian Knife FightingEine Einführung
1.1
Einleitung
1.2
Der Versuch einer Definition
1.3
Ein Ausflug in die Vergangenheit
1.3.1
Die ersten Schritte
1.3.2
Genua, Ligurien
1.3.3
Manfredonia, Apulien
1.3.4
Sizilien und die A.S.A.M.I.R.
1.3.5
Canosa, Apulien
1.4
Die Pfeiler des Gebäudes
1.4.1
Ein freier Geist im Dienste des Fortschritts
1.4.2
Der eine folgenschwere Fehler
1.4.3
Die zwei Kreise
1.4.4
Das Durchschreiten des Kreises
1.5
Aus einem ethischen Blickwinkel betrachtet
1.6
Fazit
Kapitel 2Im Zeitraffer durch die Geschichte des Fechtens in ItalienMögliche Einflüsse auf die Waffenschulen Süditaliens
Vorwort
2.1
Einleitung
2.2
Gladiatores
2.2.1
Die regionale Entwicklung
2.2.2
Die Gemeinsamkeiten
2.3
Der neu entflammte Geist
2.3.1
Kunst und Literatur
2.3.2
Die Kleinstaaten
2.4
Mit Schwert und Dolch
2.4.1
Fiore dei Liberi
2.5
Der Stoßdegen und die Stoßfechtschule
2.5.1
Achille Marozzo
2.5.2
Camillo Agrippa
2.5.3
Nicoletto Giganti
2.5.4
Salvator Fabris
2.5.5
Ridolfo Capo Ferro
2.5.6
Ferdinando Alfieri
2.5.7
Resümee über die fechterischen Entwicklungen, soweit sie das volkstümliche Messerfechten betreffen
2.6
Mögliche Übergänge vom Schwert zum volkstümlichen Messer. Die Verbote, sich zu duellieren bzw. Waffen zu tragen und die daraus folgende Entwicklung des Messerfechtens
2.6.1
Eine Kultur des einfachen Volkes
2.7
Der Dolch und das italienische Militär – die Arditi
2.8
Fazit
Kapitel 3Die Waffenschulen Süditaliens, eine geschichtliche und kulturelle ÜbersichtPotentielle Einflüsse, die zu deren Entstehung beigetragen haben könnten
3.1
Einleitung
3.2
Kulturelle Einflüsse vor Ort,Legenden und erste Hinweise auf Duelle
3.2.1
Das ritterliche Puppentheater
3.2.2
Die drei spanischen Ritter
3.2.3
Der Gesang der Mafia
3.2.4
Unterdrückt im eigenen Land
3.2.5
Das Duell – erste Hinweise und Verbote
3.3
Mögliche weitere Einflüsse auf die Fechtschulen des Südens
3.3.1
Spanien
3.3.1.1
Allgemein
3.3.1.2
Manual del Baratero
3.3.2
Die Briganten
3.3.3
Der konkrete Einfluss der kriminellen Syndikate auf die technische Entwicklung des Messerfechtens
3.3.3.1
Die Camorra
Allgemein
Die Struktur der Camorra
Sfregi – die Schandmale
Die zumpata – das Duell mit dem Messer
Gründung der Gesellschaft
Die Herkunft des Namens und die Kostüme der Gesellschaft
Tribunale, Ordnungskräfte und die guappi
Die Camorra innerhalb der Gefängnisse
3.3.3.2
Die ‘Ndrangheta
3.3.3.3
Die Mafia/Cosa Nostra
Allgemeiner Teil und Namensherkunft
Die Beati Paoli
Die ersten (schriftlichen) Nachweise des Namens
Die Übernahme der Macht
Die hierarchische Struktur des Clans
Die Berufung zum Mafioso
3.3.3.4
Die Stidda
3.3.3.5
Sacra Corona Unita (SCU)
3.3.4
Die Glücksspiele des Gesellschafft: smazzolatina, morra bzw. tocco sowie Tattoos
3.4
Uomini di vita, uomini di malavita und die bulli
3.5
Der Einfluss des Katholizismus auf die Fechtschulen Süditaliens
3.6
Die tarantella, die pizzica-pizzica, die imbrecciata
3.7
Fazit
Kapitel 4Die Regeln der >>Sprache<< und der >>Gesellschaft<< Eine Einleitung in die >>Regeln der Schule<<,Graduierungen und Grenzwertiges
4.1
Einleitung
4.2
Zweitausendfünfhundert Jahre Akusmatik bzw. Symbola
4.2.1
Ein wichtiger Hinweis
4.3
Jargons – baccagliò, serpentìna und baccàgghiu
4.3.1
Kampanien – ein alter Jargon, vorwiegend aus Neapel
4.3.2
Nordapulien – baccagliò
4.3.3
Kalabrien – serpentìna
4.3.4
Sizilien – baccàgghiu (Region Palermo)
4.4
Graduierung und Titel innerhalb der Schulen bzw. der Clans
4.5
Grenzwertiges
4.5.1
Allgemein
4.5.2
Grenzwertiges – San Michele Archangelo, der Erzengel Michael
4.6
Die Regeln der favella oder auch codici sociali
4.6.1
Codice sociale del Aspromonte – die gesellschaftlichen Regeln aus Kalabrien
4.6.2
Weitere Regeln sowie Schwüre, Taufen und Poesien und auch einige ursprüngliche Regeln aus dem Neapel des 19. Jahrhunderts
4.7
Schriftverkehr und nonverbale Kommunikation
4.8
Ein aktueller Fall
4.9
Fazit
Kapitel 5Die zwei PfadeFechtschulen mit und ohne Duellkonvention
5.1
Einleitung
5.2
Eindrücke eines Duells
5.3
Questione und dichiaramento – eine Definition
5.3.1
Appicceco, raggiunamento und questione
5.3.1.1
Appicceco
5.3.1.2
Raggiunamento
5.3.1.3
Questione bzw. auch dichiaramento – der Ablauf
5.4
Die Verwendungsart verschiedener Messertypen und Beispiele klassischer Auseinandersetzungen mit dem Messer
5.5
Die eine große Gemeinsamkeit
5.6
Kulturelle, technische und taktische Eigenheiten – Schulen des Saals
5.7
Kulturelle, technische und taktische Eigenheiten – Systeme der Selbstverteidigung
5.8
Fazit
Kapitel 6Cavalieri d‘umiltà– die Ritter der Demut – dieelegante Schule für Messer und Stock ausManfredonia, Apulien
6.1
Einleitung
6.2
Nach den Regeln der Schule – die geheimen Messerschulen Apuliens
6.3
Coltello pugliese – das apulische Messer
6.3.1
Cavalieri di umiltà (die Messertradition der Ritter der Demut aus Manfredonia) – allgemeines
6.3.2
La scuola – die Schule
6.3.2.1
Waffengattungen, favella und baccagliò
6.3.2.2
Gymnastik
6.3.2.3
Didaktik – Der Weg der Formen
6.3.2.4
Didaktik – Der Weg der Figuren
6.3.2.5
Didaktik – Der Weg der Stiche
6.3.2.6
Die tirata bzw. der tiro di sfida – das Sparring bzw. die Herausforderung
A pose e figure
A regola di scuola/a piena regola di scuola
A chi ne sà più/a chi più ne sà
6.3.3
Regole di scuola – die (technischen) Regeln der Schule
Saluto
Giro/girata
Tre passi giranti/tre passi del giro
Passi dello studio dell’averssario
Saltelli
Passo al mancino
Passi striscianti
Chiamata semplice
Uscita con sparata di colpo
Mezzo ponte
Parata chiusa
Schiacciamento/Schiacciata
Braccio di sbarramento
Quartiatura
Mezza galeotta, mezza galeotta del mancino, galeone
Catenella
Specchietto
Chiusure
Calci
Fuori colpo
Noch einige Besonderheiten
6.3.3.1
Weitere Fechtstellungen – die pose
6.3.4
Die Regeln der Schule wie auch die Unterweisung aus der Perspektive des Meisters einer verwantdten Tradition
6.3.4.1
Das Interview
6.3.4.2
Eine freie Erzählung
6.4
Fazit
Kapitel 7Scuola Ruotata– die kreisende Schule – diedynamische Tradition für Duell undVerteidigung aus Riposto, Sizilien
7.1
Die A.S.A.M.I.R.
7.2
Die Geschichte Siziliens, der größten Insel des Mittelmeers
7.3
Die zahlreichen geheimen Schulen des Messers auf Sizilien
7.3.1
Allgemein
7.3.2
Das Messerduell im italienischen Verismus
7.4
Die fünf großen Schulen der Insel – ein allgemeiner Überblick
7.4.1
A battiri – die schlagende Schule
7.4.2
Scuola riali – die königliche Schule
7.4.3
Scuola missinisi – die Schule aus Messina
7.4.4
Scuola fiorata – die blumige Schule
7.4.5
Scuola ruotata – die kreisende Schule
7.5
Das Messer der scuola ruotata – ein genauerer Blick
7.5.1
Allgemeines
7.5.2
Die Lektionen – eine kleine technische Einführung
Corridoio stretto – der enge Flur
Corridoio largo – der weite Flur
Colpi d‘attacco – die Angriffsschläge
Colpo d‘assalto – die Überfallschläge
Passi giranti – die drehenden Schritte
I quattro angoli – die vier Ecken
7.5.2.1
Piante – die systemspezifischen Fechtstellungen
7.5.2.2
Die schiacciata – die Hauptparade der Stichschule
7.5.2.3
Schule der paranza vs. Schule des Messers
7.6
Fazit
Kapitel 8Cielo e meraviglia– Himmel und Wunder – diebäuerliche Tradition zur Selbstverteidigungaus Canosa, Apulien
8.1
Einleitung
8.2
Cielo e meraviglia – das System
8.2.1
Die Ikone des Systems – das Messer und der Rosenkranz
8.2.2
Die Methode des Messers mit der Kordel
8.2.3
Die Didaktik
8.2.4
Posture – die Garden
8.2.5
Die ersten Schritten – die Griffvarianten
8.2.5.1
Die ersten technisch-taktischen Schritte – salve, die Salven
8.2.5.2
Die ersten technisch-taktischen Schritte II – spassi, das Vorbeischreiten
8.2.5.3
Die ersten technisch-taktischen Schritte III – la parte irrazionale, die irrationale Seite
8.2.6
Die mostranze
8.2.7
Das Messer in Verbindung mit Hilfsgegenständen
8.2.8
Zu guter Letzt – der monsignore
8.2.9
Die Improvvisata
8.3
Fazit
Kapitel 9Bastone genovese– der genuesische Stock –die kompakte Methode der Selbstverteidigungmit Stock, Messer und der leeren Hand ausGenua, Ligurien
9.1
Eine allgemeine Einleitung über die Methoden des Nordens
9.2
Der bastone genovese – eine Einführung
9.3
Der antike beidhändige Stock aus Genua
9.3.1
Die Beschaffenheit des Stockes und eine sehr grobe Übersicht der Techniken
9.4
Der Spazierstock
9.5
Die waffenlosen Künste der Genuesen
9.6
Der Knochenbrecher – desfa osse
9.7
Das Messer – scherma du tagan zeneise
9.7.1
Grundtechniken der Messerschule
9.8
Fazit
Kapitel 10Traditionelle Messer für Duell und Verteidigung
10.1
Einleitung
10.2
Genua und Korsika
10.2.1
Genua
10.2.2
Korsika
10.3
Latium
10.4
Kampanien
10.5
Basilikata
10.6
Kalabrien
10.7
Sizilien
10.8
Fazit
Literaturverzeichnis
Bildverzeichnis
Danksagung
Einleitung
>>Bei diesem Vorhaben ist anzumerken, dass im ganzen Süden Italiens, beginnend beim Landleben vor Rom, das Messer nicht als verräterische Waffe, sondern als >Schwert des Volkes< betrachtet wurde.<<
Corrado Tommasi-Crudeli,
La Sicilia nel 1871,
Florenz, 1871
Dieses Buch dient dazu, dem Leser den Weg der traditionellen italienischen Fechtschulen mit Messer und Stock näher zu bringen und dadurch ein Stück zu deren Erhalt beizutragen. Es erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wie soll man die Geschichte des süditalienischen Messers erzählen? Bis noch vor wenigen Jahren lagen diese alten Künste für Unbeteiligte im Verborgenen. Es ist eine Geschichte der Verschwiegenheit, der omertà. Schwüre und Bünde sowie die Angst vor Vergeltung aber auch der Stolz, einer geheimen und ritterlichen Gesellschaft anzugehören, verhinderten mitunter, dass die Geheimnisse der Klinge – aber auch die des Hirtenstockes – an fremde Ohren drangen.
Die Furcht, Spuren zu hinterlassen bzw. entlarvt zu werden, oder auch der Analphabetismus, der im Italien des 19. Jahrhunderts in den unteren, ländlichen Schichten wie auch im städtischen Subproletariat Süditaliens präsent war, erzeugte zudem eine Kultur der reinen mündlichen Überlieferung. Und so begann meine Forschung für dieses Buch, vor dem ich gedanklich schon viele Jahre sitze, im Dunkeln. Sie war zuerst vornehmlich von Spekulationen geprägt – von Annahmen also. Im Laufe der Jahre beschäftigte ich mich nicht nur körperlich, vielmehr auch geistig und literarisch mit dieser Subkultur meines Geburtslandes. Ich las zudem viel Sekundärliteratur – Bücher, die mit der Thematik des Messers auf den ersten Blick weniger zu tun haben und sich eher der Geschichte, der Kunst und der Kultur Italiens widmen.
Um abwägen zu können, wann eine Sache substantiell ist bzw. wann sie es nicht ist, sollte man weitgehend alles verstehen, auf das sie sich bezieht. Und nur durch dieses Verständnis lässt sich Wahrscheinliches von Unwahrscheinlichem unterscheiden. So ging ich allen Spuren und Gerüchten nach. Und dass diese Suche so geheimnisvoll war, machte ihren Reiz erst aus. Es konnte aufgrund der mangelnden schriftlichen Nachweise auch nicht anders sein. Das war der Weg, den es zu bestreiten galt. Ich begab mich auf Reise – auf viele Reisen mittlerweile. Dabei traf ich wahre Meister und auch solche, die sich nur so nannten. Einige von ihnen begleitete ich für eine gewisse Weile. Mit anderen arbeite ich heute noch zusammen.
All diese Meister – aber auch alle Forscher, die wie ich ihre Zeit der Entdeckung, Aufschlüsselung und Bewahrung dieser Traditionen widmen – sind Pioniere, Bindeglieder der Vergangenheit zur Moderne. Durch diese Forschung eröffnen sich uns heute Welten mit eigener Kultur, Tradition und Geschichte, aber auch mit eigener Wertvorstellung und Rangordnung. Dennoch ist Italien bis heute, trotz aller bisherigen Pionierleistungen und Publikationen zum Thema, in Sachen Kampfkunst eine terra incognita.
Daher möchte ich dem Leser diese bis dato >>unbekannte Welt<< ein wenig näher bringen. Bei diesem Werk handelt es sich deshalb nicht nur um die bloße Erklärung der Bewegungsmuster wie auch der Prinzipien, Techniken und Taktiken: Soweit mir bekannt und in diesem Kontext notwendig und interessant, erörtere ich auch die möglichen geschichtlichen Entwicklungen und ferner die kulturellen Aspekte der volkstümlichen italienischen Fechtweise. Dieses Buch ist deshalb auch nicht mit allzu vielen Bildern versehen – es stellt eher die Inhalte in den Vordergrund.
Ohne ein Grundverständnis für die geschichtlichen Zusammenhänge einer Epoche, für deren Kultur und Traditionen und für die Mentalität der jeweiligen Bevölkerung, entwickelt sich eine Waffenkunst zu einem seelenlosen >>Etwas<<. Sie wird zu einem reinen Instrument des Todes und damit zu einer toten Kunst. Auch glaube ich nicht, dass ohne eine Spur kultureller Kenntnis tiefe Leidenschaft innerhalb der Kunst entstehen kann. Die italienischen Waffenkünste sind weit mehr als bloßes Fechten: Sie bestechen durch Ausdrucksstärke und Eleganz, Rhythmus und kulturelle Tiefe. Kultur und Geist können urban oder landwirtschaftlich geprägt sein. Sie sind teilweise religiös inspiriert oder entspringen Legenden und Mythen um Soldatentum beziehungsweise Ritterlichkeit. Auch wurden sie zum Teil von den süditalienischen Verbrechersyndikaten beeinflusst.
Zudem beinhalten sie wiedererkennbare Muster: Je nach Region ist entweder der tänzerische Charakter ausgereifter, die Haltung stolzer oder auch geerdeter. Aber die gemeinsamen Nenner sind stets sichtbar: Man bewegt sich leichtfüßig entlang eines (gedachten) Kreises und durchschreitet diesen auf Geraden oder Ellipsen. Man kämpft aus Garden (Fechtstellungen) und steht meist profiliert zum Gegner. Der geradlinigen Stich, die Punkt-zu-Punkt-Verbindung, ist das zentrale technische Mittel aller Schulen und Systeme.
Die Didaktik ist meist recht klar gegliedert. Sie verläuft weitgehend in Bahnen oder setzt sich aus diversen Lektionen bzw. Figuren zu einer Form zusammen. Im Grunde kann die Wertigkeit dieser Entwicklungen des einfachen Volkes durchaus mit den Kunstformen einer Hochkultur verglichen werden, die im Bürgertum oder auch beim Adel beliebt waren, wie zum Beispiel mit dem Ballett. Um das Wesen dieser Künste begreifen zu können, um sich des Wertes wirklich gewahr zu werden, sollte also beides bekannt sein: die geistige Ausrichtung des jeweiligen Kulturkreises und die technisch-taktischen Werkzeuge.
Meine Intention geht einmal dahin, Fragen aufzuwerfen:
Fragen nach dem >>Warum<< es vor allem in den Regionen Süditaliens zu der Entwicklung einer Kultur des volkstümlichen Messerfechtens gekommen ist?
Was genau sind die Bedürfnisse gewesen, die letztendlich zur Entwicklung dieser Schulen führten?
Inwieweit standen diese Fechtkünste des Volkes mit den kulturellen Gegebenheiten ihrer Zeit im Einklang?
Inwiefern hatten geistige Klarheit, natürliche Bewegungsmuster, effiziente Kampflogik, Pragmatismus, ein spezifisch europäischer Geist sowie ein neu gewonnenes Verhältnis zur Ästhetik einen Einfluss auf diese Entwicklungen?
Woher also stammen die Faktoren, die eine Kunstform erst zur Kunstform machen?
Des Weiteren möchte ich auf mögliche Einflüsse aufmerksam machen, die so vorwiegend in den Regionen auftraten, die heute die Heimat der volkstümlichen Schulen des Messers und des Stockes in Italien bilden. Denn auch wenn Indizien letztendlich keine Beweise sind, berechtigen diese zu vorsichtigen Annahmen, wenn sie als stets wiederkehrende Muster auftauchen. Im Verlauf dieses Buches wird auf die spezifischen, kulturellen Eigenschaften dieser Traditionen eingegangen (natürlich auch kritisch). Besonders der Aspekt der Ritterlichkeit ist es, der den Charakter wie auch den Mythos einiger italienischer Messer- und Stockschulen geprägt hat. Dieser Wesenszug, der vorwiegend viele süditalienische Fechtschulen des Volkes weitgehend von denen anderer Kulturen unterscheidet, unterliegt dem codice d‘onore, dem Ehrenkodex. Auch spielt(e) die oben bereits angesprochene Verschwiegenheit eine große Rolle. Einige dieser Fechtschulen wurden durch Volksschichten mitgeprägt, welche Verschwiegenheit und die Mitgliedschaft zu sogenannten >>Inneren Kreisen<< voraussetzten.
Andere entstammten Zeiten und Umständen, die vorwiegend die Fähigkeit zur Verteidigung erforderten. Es sind im Geheimen gereifte Künste, geformt durch Erfahrung, Stolz und Blut.
Glaubt man einigen Meistern heutiger Zeit, lassen sich die italienischen Schulen bzw. Systeme des Waffenkampfes grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilen: die Fechtschulen des Saals – scuole da sala, Fechtschulen mit zusätzlicher Duellkonvention – und die reinen Systeme der Verteidigung bzw. Schulen der Straße – sistemi da difesa bzw. scuole da strada. Da es sich bei allen italienischen Traditionen des Fechtens mit Messer und Stock, ob mit Duellkonventionen oder bloße Verteidigung, nicht um akademische Schulen, vielmehr um Schulen des einfachen Volkes handelt, sind viele dahingehenden Überlieferungen mit Vorsicht zu genießen. Eine exakte wissenschaftliche Überprüfung ist aufgrund mangelnder Quellenlage nicht mehr wirklich möglich.
Mir geht es hierbei nicht um die Beweisbarkeit etwaiger Auseinandersetzungen in Hinterhöfen oder Kneipen oder illegaler Duelle auf verlassenen Bauernhöfen (Anm.: Duelle und bewaffnete Streitigkeiten fanden in weiten Teilen Europas des 19. Jahrhunderts nämlich in nahezu allen Schichten statt, jedoch gab es kein offizielles Duellwesen der unteren Schichten. Speziell vor der Mitte des 19. Jahrhunderts aber auch danach fanden diese in Italien nur im Verborgenen statt. Duelle durften offen vorwiegend ab dem mittleren Bürgertum ausgetragen werden. Leibeigene durften sich gar nicht duellieren). Es geht mir vielmehr um definitive Nachweise für eine tradierte Vorgehensweise hinsichtlich Methodik und Didaktik, also um Belege für die Existenz einer präzisen, technischen Unterweisung.
Und das ist ein erheblicher Unterschied in Bezug auf eine fundierte Dokumentation. Solche >>Duelle<< oder regellose Messerkämpfe hätten auch leicht zwischen ungeschulten Straßenstechern stattfinden können, ohne dass diese jemals eine technische Unterweisung erhalten haben mussten.
Um die eigene Schule aufzuwerten bzw. um ihr einen mystischen Hauch zu verleihen, schuf man zudem Legenden um Rittertum und Ehre, die dann von Generation zu Generation ungeprüft übernommen wurden. Die Legenden wurden kulturelles Gut und zum Teil betrachtete man sie als >>geschichtliche Realität<<. Diese Entwicklung ist jedoch nur noch in einigen Fechtschulen mit Duellkonvention vorzufinden. Die meisten italienischen Fechtschulen sind durchaus sachlich und bekennen sich zur mangelnden Quellenlage.
Vermutungen, wie interessant sie auch sein mögen, sollte man selbstverständlich als solche ausweisen. Aber gleichzeitig darf man sie nicht, sofern kein eindeutiger Beweis vorliegt, der sie widerlegt, von vornherein als unmöglich ausschließen. Exakt auf diese differenzierte Weise werde ich in diesem Buch verfahren.
Um dem Leser eine deutlichere Vorstellung zu geben, werden einige dieser Schulen und Systeme eingehender beschrieben. Diese Künste erlernte bzw. erlerne ich von verschiedenen Meistern, die heute teilweise als >>Erben<< ihres Familien- bzw. Systemzweiges betrachten werden können. Auch werde ich weitgehend nur über die Schulen und Systeme ausführlich sprechen, die ich kennenlernen durfte. Über Systeme und Traditionen zu sprechen oder auch nur zu spekulieren, die sich meiner persönlichen Kenntnis entziehen, betrachte ich als anmaßend. Es würde zudem von mangelnder intellektueller Integrität zeugen. Dieses Buch enthält dahingehend eine Art Ausnahme, die ich aber als solche eindeutig gekennzeichnet habe. Wobei ich diesbezüglich erwähnen möchte, dass ich lediglich ein Interview mit der einstigen Ikone der südapulischen scherma salentina übersetzt habe, um Gemeinsamkeiten zwischen den apulischen Traditionen besser aufzeigen zu können. Das heißt folglich, dass nicht ich diese Schule beschrieben habe, sondern der letzte große Meister dieser Tradition selbst (siehe Kapitel 6.3.4, Seite 469).
Das 21. Jahrhundert erlaubt uns zum Glück, diese Kampfsysteme nur noch aus dem Blickwinkel historisch bzw. kultureller Neugierde zu betrachten, nicht mehr aus Notwendigkeit. Die Aspekte des Lernens und des Verstehens stehen heute im Vordergrund. Des Weiteren verbindet uns der freundschaftliche Austausch untereinander und das Analysieren und Ausarbeiten miteinander. Auch ermöglicht diese Forschung dem Neugierigen, sich auf Kulturreise zu begeben, die verschiedenen Winkel Italiens zu bereisen, unterschiedliche Denkweisen zu erfahren wie auch die kulinarischen Leckerbissen der Halbinsel zu kosten. Und durch die einem Mikrokosmos gleichende Komplexität, gewährt diese Kunst zudem – sofern man das möchte – einen sehr interessanten anthropologischen Ansatz.
Abgesehen vom bastone genovese habe ich weitere mir bekannte Fechttraditionen Norditaliens bewusst weggelassen, da mir die Quellenlage unzureichend und auch zu spekulativ erscheint. Aber vor allem deshalb, da ich meine Kenntnisse hinsichtlich dieser Systeme als nicht ausreichend betrachte, um abschließend urteilen zu können. Die Quellenlage zum bastone genovese lässt meines Erachtens nach ebenfalls zu wünschen übrig.
Den Grund, weshalb ich diese Tradition trotzdem erwähne, habe ich in Kapitel 1.3.2 entsprechend dargelegt. Und weil einige Meister zu diesem Zeitpunkt selbst ein Buch in Planung haben, werde ich deren Schulen nur soweit erklären, dass ich diesen Werken den Inhalt nicht vorweg nehme (siehe die Kapitel 6 bis 9). Neben der hypothetischen Geschichte und den mir mündlich überlieferten Legenden und Mythen, werde ich die Prinzipien dieser Künste erläutern sowie auch einige technische Eigenheiten benennen.
Das Buch ist wie folgt gegliedert:
Das erste Kapitel beschreibt das Traditional Italian Knife Fighting, meine Schule und somit auch meine Sichtweise bezüglich der italienischen Traditionen des Messerkampfes.
Die Kapitel 2 und 3 geben einen Überblick der möglichen geschichtlichen und kulturellen Entwicklungen samt eventueller (Fremd)Einflüsse, auch die der kriminellen Clans des 19. Jahrhunderts.
Kapitel 4 gewährt einen Einblick in die Rituale und Jargons (Geheimsprachen) der soeben benannten Clans wie auch einiger Schulen des Messers.
Kapitel 5 unterscheidet die Fechtschulen des Messers mit Konvention von den Fechtschulen der reinen Selbstverteidigung. Es stellt folglich eine Brücke zwischen dem geschichtlichen und dem eher technischen Teil – wobei eine klare Trennlinie nicht wirklich vorhanden ist und nicht vorhanden sein kann.
Die Kapitel 6, 7, 8 und 9 stellen regionale Schulen und Systeme des volkstümlichen, italienischen Messerkampfes aus den Regionen Apulien, Sizilien und Ligurien vor.
Kapitel 10 präsentiert eine Auswahl traditioneller Duellmesser aus dem Latium und aus Süditalien, aber auch ein Modell aus Ligurien sowie zwei Varianten davon aus Korsika, da diese im direkten Kontext zu diesem Buch stehen.
Den Abschluss bilden ein Literaturverzeichnis und eine Danksagung.
Dieses Buch habe ich bewusst in der Ich-Form verfasst. Zwar mache ich mich somit angreifbarer, jedoch erhält der Inhalt dadurch eine persönliche Note. Zudem ist es mir wichtig klarzumachen, wie ich die Dinge sehe, sei es geschichtlich, kulturell, philosophisch oder auch fechterisch.
Ferner bitte ich um Beachtung, dass ich aus stilistischen Gründen und aufgrund sprachlicher Vereinfachung bewusst keine gendergerechte Sprache verwendet habe. Schreibe ich vom >>Schüler<<, >>Praktikanten<<, >>Lehrer<< oder auch vom >>Meister<<, sind damit gleichwertig Damen und Herren gemeint. Es wäre mir eine große Freude, würden sich Frauen vermehrt unseren Künsten widmen. Dies würde auch im Sinne der Tradition stehen, wonach sich im Mezzogiorno des 19. Jahrhunderts ebenfalls Damen zum Duell trafen.
Auch habe ich mich weitgehend an die italienischen Regeln zur Groß- und Kleinschreibung gehalten: Italienische Wörter sind klein geschrieben, sofern sie nicht am Anfang eines Satzes stehen oder es sich nicht um Namen von Personen oder Orten handelt. Das erleichtert dem Leser die Lektüre, da er dadurch Fachtermini besser von Eigennamen unterscheiden kann. Die Gliederung des Buches habe ich an die wissenschaftliche Vorgehensweise angelehnt, wonach jedes Kapitel zuerst eine Ziffer erhält. Die thematisch dazu gehörenden Unterpunkte werden durch Folgeziffern nach einem Punkt hinter jeder weiteren Ziffer als solche gekennzeichnet.
Einige Lehrer und Meister wollten nicht benannt werden, einige möchte ich nicht benennen. Ich bitte daher um Verständnis, wenn nur diejenigen Meister namentlich erwähnt werden, mit denen ich freundschaftlich zusammenarbeite bzw. von denen ich nachweislich zertifiziert wurde.
In diesem Sinne wünsche ich dem Leser eine angenehme und interessante Reise in die verschiedenen Epochen und Winkel Italiens, der geschichtsträchtigen Apenninhalbinsel im Süden Europas.
Roberto Laura
Kapitel 1
Traditional Italian Knife Fighting
Eine Einführung
>>Die Götter haben den Sterblichen nicht von Anfang an alles offenbart, sondern erst nach und nach finden diese suchend das Bessere.<<
Xenophanes aus Kolophon
6. bis 5. Jahrhundert v. Chr.
1.1 Einleitung
Bevor wir uns der Geschichte und Kultur der Messertraditionen Süditaliens widmen, möchte ich in diesem ersten Kapitel verdeutlichen, wie es zu meiner >>persönlichen Auslegung<< der Tradition gekommen ist. Es soll den Weg dahin aber auch die Gedanken dahinter erklären. Der Weg alleine ist jedoch nicht das Ziel. Denn das eigentliche Ziel innerhalb der europäischen Fechttraditionen lag und liegt immer noch schlichtweg darin, zu treffen ohne dabei selbst getroffen zu werden – also nicht zu sterben, wie auch vielleicht in der Entwicklung eines persönlichen Flairs. Deshalb werde ich auch einige Gedanken dazu äußern, worauf man meiner Meinung nach achten sollte, um nicht allzu leicht letale Treffer zu erleiden. Die Umsetzung gelingt natürlich erstens nicht von heute auf morgen, zweitens gelingt sie auch leider nicht immer, drittens wird sich die persönliche Forschung dahingehend auch nie wirklich abschließen lassen.
Gerade zu Beginn ist es schwierig abzusehen, wie sich etwas oder wie man sich selbst entwickeln wird. So waren gerade meine Anfänge in der Fechtkunst mit dem Messer zwar hochinteressant aber undurchsichtig. Die folgenden Zeilen stellen demnach meinen Werdegang innerhalb der italienischen Traditionen dar, und sie beinhalten einige Rückschlüsse betreffend Technik, Taktik und Ethik des Messerfechtens.
Ferner geht es mir darum, aufzuzeigen, dass der italienische Weg des volkstümlichen Fechtens mehr ist als die bloße Ansammlung von Techniken und Taktiken. Diese Traditionen haben, über die Verteidigung hinaus, einen >>sportlichen Wert<<. Über diesen hinaus haben sie zudem den Wert einer hoch kulturellen Kunstform mit hohem ästhetischem Anspruch, der sich durchaus mit der Tanzkunst messen lässt. Auch setzen diese Traditionen die Philosophie ihrer Zeit praktisch in die Tat um.
1.2Traditional Italian Knife Fighting– der Versuch einer Definition
Das Traditional Italian Knife Fighting (traditionell italienischer Messerkampf; ferner auch als Akronym TIKF) ist ein Überbegriff, eine Art Truhe, die mehrere kulturelle Schätze enthält. Es ist auch ein Weg zu einer individuellen fechterischen Identität. Da ich Schulen mehrerer Regionen und Lehrer durchlaufen habe, ist es mir nicht möglich, mich auf nur eine Schule namentlich festzulegen. Allen anderen Schulen und Lehrern würde dadurch der verdiente Respekt versagt bleiben. Weiterhin erscheint es mir vorteilhaft, heutzutage einen Namen zu verwenden, der auch international verstanden wird. Der Tradition ist dadurch kein Abbruch getan, da die Prinzipien, Techniken und Taktiken der einzelnen Systeme und Schulen innerhalb des TIKF selbstverständlich ihre überlieferte Didaktik und ihren >>traditionellen<< Namen beibehalten. Ursprünglich hatten die meisten Schulen des Südens sowieso keine Namen. Im 19. Jahrhundert sprach man lediglich von Messer und Stock bzw. von der Schule des Stiches und des Schnittes – scuola di punta e taglio – oder auch generell vom Messerfechten – scherma di coltello.
Meine Interpretation der Traditionen betrifft nicht nur die technische Umsetzung, vielmehr ist es ein psychologisch etwas verfeinerter und philosophischer, aber auch ein didaktisch und taktisch-analytischer Weg. Ferner erhebe ich nicht den Anspruch, meine Schule sei besser als andere Traditionen oder Systeme. Das Traditional Italian Knife Fighting ist zwar technisch und grundlegend betrachtet eine >>Synthese<< der in diesem Buch beschriebenen Traditionen1, es handelt sich aber um weit mehr als dies. Es ist die Aufforderung zum konstruktiven Zweifel, zur Analyse mittels Kraft des eigenen Verstandes. Und demzufolge handelt es sich beim TIKF nicht um ein Hybridsystem im klassischen Sinne und nicht um die bloße Auslese der aus meiner Sicht besten Techniken und Taktiken. Vielmehr lehrt das TIKF alle traditionellen Schulen, aus denen es besteht, um sie dann den Ansprüchen des jeweiligen Schülers anzupassen, sie dem Lernenden mit dessen Unterstützung >>auf den Leib zu schneidern<<. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass ein Praktikant, sobald er eines Tages die notwendige fechterische Qualität erreicht bzw. das in sich geschlossene Denksystem einer Tradition geistig und körperlich durchdrungen haben sollte, die Schule seinen Bedürfnissen stets weiter anpassen kann. Er kann sie gegebenenfalls individuell verbessern. Der Schüler soll sich nämlich auf Dauer nicht mit meiner Auswahl begnügen müssen, er soll sich stattdessen frei entwickeln können. Auch soll er ohne Furcht vor Schmerzen trainieren. Schmerzen, erfahren sie die Schüler vor allem zu Beginn, können dazu beitragen, dass die Lernenden nicht mehr frei agieren können, stets die Furcht im Hinterkopf behalten, weiterem Leid ausgesetzt zu werden. Aufgrund dieser Überlegungen habe ich Hendrik Röber von Trinity Combat Gear gebeten, die Padded Duelling Knives, eine gepolsterte Variante der traditionellen Übungsmesser aus Holz zu entwerfen, wie sie im Süden Italiens verwendet werden. Ist einmal die technische Sicherheit vorhanden, kann man getrost auf Holz zurückgreifen. Aber gerade für Aktionen, die zum Waffenarm gerichtet sind und auch viel Übung erfordern, eignen sich diese Trainingshilfen hervorragend. Die hölzernen Trainingsmesser (paranze) nach original sizilienischen Vorbild fertigt Stephan Ernst von Kuen Sporst freundlicherweise für mich an.
(1) Padded Duelling Knives von Trinity Combat Gear
Seit meinen ersten Schritten in diese Thematik, seit dem Beginn dieser Leidenschaft und Forschung sind nunmehr viele Jahre vergangen. Ich begegnete vielen Lehrern, sah dadurch verschiedene Ansätze und Interpretationen und hörte unterschiedliche Geschichten. All diese Lehrer, ich benenne im Verlauf dieses Kapitels stellvertretend nur diejenigen, die meine Schule noch immer maßgeblich beeinflussen bzw. mit denen ich zusammenarbeite, wie auch all meine langjährigen Schüler unterstützen mich dabei, diesen fechterischen Weg zu bestreiten. Sie halfen mir, die richtigen aber auch die falschen Schritte zu erkennen und diese besser unterscheiden zu lernen. Vor allem aber, und das ist fast widersinnig, begann meine Reise zu den süditalienischen Schulen des Messers nicht in Süditalien, der traditionellen Heimat dieser Künste, sondern im Norden des Belpaese.
1.3 Ein Ausflug in die Vergangenheit
Eigentlich ging ich diesen Pfad vom ersten Tag an nicht wirklich alleine. Wir waren von Beginn an eine kleine Gruppe Freunde. Während ich der Sprache wegen weitgehend die Fahrten übernahm, leisteten mir meine ersten Wegbegleiter analytischen, finanziellen und auch moralischen Beistand – es war nämlich nicht immer leicht. Nach jedem Ausflug trafen wir uns, um das Erlernte zu wiederholen, es technisch zu analysieren und auch schriftlich zu erfassen. Viele dieser Kameraden, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen und auch teilweise mit mir reisten, begleiten mich noch heute.
1.3.1 Die ersten Schritte
Die erste Reise führte mich im Jahr 2001 in die Provinz von Ravenna, wo ich von einem der renommiertesten Forscher des Fechtens italienischer Tradition und dem ersten, der diese Künste in Schrift und Film festhielt, Unterricht erhielt. Aus seiner Feder entstammt das Werk >L‘arte italiana del maneggio delle lame corte, dal 1350 al 1943. Storia e tecnica<, >Die italienische Kunst der Handhabung der kurzen Klingen von 1350 bis 1943. Geschichte und Technik<. Dieser erste Lehrer führte mich in die allgemeinen Prinzipien des Messer- und Stockkampfes ein, militärisch wie auch volkstümlich. Er war es auch, der mir im Dezember 2002 mein erstes Lehrerdiplom für den italienischen Messer- und Stockkampf ausstellte.
Durch seinen Unterricht verlagerte sich meine Sichtweise weg vom Schnitt, hin zum Stich. Des Weiteren lehrte er mich die Notwendigkeit wohl durchdachter Garden (Fechtstellungen). Letztendlich veränderte er meine Sichtweise bezüglich des notwendigen Umfanges und der Strukturierung eines Systems: Er führte mich weg von einer technischen, hin zu einer methodisch und taktischen Ausrichtung. Diese Jahre hatten irgendwie etwas >>Romantisches<<. Wir waren schließlich Pioniere, quasi allein auf einsamer Flur. Oder wie es Hermann Hesse in seinem >Glasperlenspiel< (1943) auszudrücken vermochte:
>>Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, […]<<
1.3.2 Genua, Ligurien
Mein nächster Halt war im Jahr 2006 beim genuesische Stock- und Messerkampf, dem bastone genovese. Diesen habe ich beim letzten verbliebenen Meister dieser Tradition und Autor des Buches >Bastone genovese, coltello e gambetto< erlernt. Ich bin auch Lehrer dieser Fechtkunst. Die Tradition aus Genua lag mir deshalb am Herzen, da ich nicht unweit davon geboren wurde. Es handelt sich demnach auch um eine Tradition aus dem Lande meiner Eltern.
Mein Mentor in dieser Tradition war folglich der erste wirklich volkstümliche Fechtlehrer, von dem ich unterwiesen wurde. Zwischen meinen ersten Erfahrungen in Ravenna und dieser Tradition aus Genua gab es didaktisch keine nennenswerten Unterschiede. Beide Lehrer gliederten ihren Unterricht ähnlich und mit einer mir bis dahin unbekannten Konsequenz, Logik und Einfachheit.
1.3.3 Manfredonia, Apulien
Kurz darauf ergab sich die Möglichkeit, die apulische Fechtschule mit Messer und Stock aus Manfredonia zu erlernen. Diese süditalienische Tradition, die eigentlich keinen spezifischen Namen trägt, von einigen aber als die Schule der Ritter der Demut – cavalieri d‘umiltà –, von anderen als fioretto – Florett – bezeichnet wird, war folglich mein Einstieg in die geheimnisvolle und auch komplexere Methodik und Didaktik der südlichen Traditionen des Messers und des Stockes.
Bezüglich der Schule aus Manfredonia konnte ich über Jahre mit diversen Lehrern Erfahrungen sammeln und unterschiedliche Auslegungen einsehen. Dadurch eröffnete sich mir ein differenziertes Bild dieser Kultur. Meine ersten Unterweisungen dahingehend, mein Grundgerüst, erhielt ich zunächst durch Kleingruppentraining.
Danach begab ich mich zu einer der traditionellen Messerfamilien, die in Manfredonia bis heute ansässig sind, wo ich weitere Unterweisung erhielt. Dieser Zweig basiert auf den Lehren des verstorbenen Meisters U Sardun.
Aber an dieser Stelle möchte ich besonders maestro Salvatore D‘Ascanio erwähnen, der hinsichtlich dieser Tradition technisch den wichtigsten Einfluss auf meine Entwicklung hatte. Er war es, der mir die Feinheiten dieser alten Schule aus Manfredonia letztendlich und gänzlich aufgeschlüsselt hat (siehe Kapitel 6), auch wenn dieser Zweig von den vorherigen technisch, didaktisch und auch terminologisch etwas abweicht. Maestro D‘Ascanio verbesserte meine Dynamik. Er lehrte mich bezüglich dieser Schule Wichtiges von Unwichtigem noch besser zu unterscheiden. Zudem erhielt ich durch ihn eine verfeinerte und lebendigere Form der Didaktik.
(2) Maestro Salvatore D‘Ascanio
1.3.4 Sizilien und die A.S.A.M.I.R.
Maestro Orazio Barbagallo
Maestro Salvatore Scarcella
Durch Zufall ergab sich einige Jahre später die Möglichkeit, innerhalb der A.S.A.M.I.R.2 die sizilianischen Fechtschulen mit dem Messer und dem Hirtenstock zu erlernen. Zuerst erhielt ich Unterricht für den Hirtenstock der scuola fiorata, der blumigen Schule aus Calatabiano. Diese Schule ließ mich meine Einstellung zu einer >>ordentlichen Deckung<< überdenken. In maestro Orazio Barbagallo, der Gründer der A.S.A.M.I.R. und mein Förderer bezüglich der sizilianischen Kultur, fand ich eine hervorragende Quelle für die alte Tradition der scuola ruotata, die kreisende Schule aus Riposto. Maestro Barbagallo war der erste überhaupt, der mir die Tür zu den Schulen der Insel öffnete. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich an die Wurzel dieser Tradition gelangen konnte. Bis heute ist er mein Lehrer für den traditionellen Hirtenstock der kreisenden Schule, so wie er ihm einst vom Meister der Meister U Scapellinu gelehrt wurde. Weiterhin war Orazio Barbagallo derjenige, der mir den Kontakt zu maestro Salvatore Scarcella ermöglichte, einer Ikone der kreisenden Messerschule aus Riposto (corto ruotato tradizionale; siehe Seite 510). In maestro Scarcella habe ich einen Lehrer gefunden, der einem durch eine einzige Bewegung seines Waffenarmes im rechten Moment vor Augen führen kann, wie und wo man jahrelang falsch lag. Er war es, der mir als erster klargemacht hat, dass in einem einfachen Stich wesentlich mehr steckt, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Auch war er es, der mir das wahre sizilianische Messer offengelegt hat. Aus maestro Scarcella sprechen sechs Jahrzehnte fechterische Erfahrung – und das spürt man deutlich.
1.3.5 Canosa, Apulien
Fast parallel dazu begann ich die bäuerliche Tradition der Verteidigung mit Messer und Stock, das System Himmel und Wunder, cielo e meraviglia, aus Canosa in Apulien zu erlernen. Dieses übte ich mit einem der wenigen verbliebenen Meister dieser Kunst (siehe Kapitel 8). Durch dieses System erschloss sich mir auch der Nahkampf mit dem Messer, der in den Fechtschulen mit Duellkonvention gegebenenfalls verloren gegangen ist bzw. an dem man dort wahrscheinlich weniger glaubt(e). Diese spezielle Form des >>Ringkampfes mit dem Messer<<, die teilweise Bezug zum mittelalterlichen Dolchfechten aufweist, zeigt dadurch die technisch nahe Verwandtschaft zu den europäischen Fechtmeistern vergangener Tage. Es waren demnach die systemspezifischen Nahkampfbindungen, welche meine Fähigkeit verbesserten, einen Kampf schnell aus der Defensive in die Offensive umzukehren, ohne dabei stets aus der langen Distanz heraus agieren zu müssen.
1.4 Die Pfeiler des Gebäudes
Wie ich im Verlaufe dieses Buches noch erörtern werde, ist die Progression einer jeden Fechtschule mit Duellkonvention nahezu gleich: Zuerst erlernt man die Schule (scuola), die Grundbewegungen in streng festgelegten Lektionen, beziehungsweise Figuren oder auch Stiche genannt (lezioni, figure, puntate). Je nach Tradition haben sich diese Einzellektionen teilweis zu komplexen Formen entwickelt. Danach folgt die >>Schulung<< oder auch >>Unterweisung<< (insegnamento). Hier werden die Grundbewegungen mit einem Partner eingeübt. Zur Unterweisung gehören auch alle Aspekte, die nicht Teil der Grundbewegungen sind. Hierzu zählen nebst den Listen und Kniffen auch diverse Fechtstellungen in Relation zu ihrer taktischen Notwendigkeit. Im TIKF habe ich diese traditionelle Vorgehensweise selbstverständlich übernommen.
Ferner besteht die Unterweisung meiner Schule aus der >>didaktischen Trinität<< Spiel, Verteidigung und Angriff – trinità didattica: gioco, difesa e attacco. Dies ist jedoch kein traditioneller Name, vielmehr Teil meiner Schule: Zuerst erlernt der Schüler das systemspezifische >>Spiel der Figuren<<, welches aus den Grundbewegungen besteht, die für die Positionswechsel (im Kreis) erforderlich sind. Danach, aus dem >>Spiel der Figuren<< heraus, folgen die spezifischen Verteidigungen mit der Klinge und der leeren Hand. Anschließend führt man den Schüler an die diversen Grundangriffe und Kniffe, die ebenfalls aus dem Kreisgehen erfolgen. Der letzte Schritt besteht darin, die drei Kernpunkte – Spiel, Verteidigung und Angriff – derart zu verbinden, dass das eine in das andere übergeht bzw. eine klare Trennlinie nicht mehr vorhanden ist.
Eine Verteidigung kann demnach ein Angriff sein sowie auch der Angriff als Verteidigung genutzt werden kann. Eine Kreisfigur lässt sich zu Zwecken der Verteidigung und des Angriffes verwenden. Angriffe und Verteidigung stellen gleichermaßen Figuren des Kreisgehens dar. Diese Vorgehensweise erfordert jedoch einen klaren und geradlinigen Geist, da dieses Ziel nicht etwa durch Akkumulation, vielmehr nur durch Vereinfachung und Pragmatismus erreicht werden kann. Und so folge ich hier einer Richtlinie Nietzsches, die dieser in seinem >Antichrist< wie folgt formulierte:
>>Formel unseres Glücks: ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel.<<
Es folgen alternative Methoden (Messer mit Jacke, Gürtel, Kamm, ein waffenloser Aspekt und auch das Doppelmesser) und auch die malizie, die hinterlistigen Vorgehensweisen, die nicht zum traditionellen Konventionsduell gehören, sondern zum Straßenkampf. Die malizie werden auch in Kombination zu den Listen und Kniffen gelehrt.
Messer mit Jacke
Zudem verfügt das TIKF über eine eigene Vorgehensweise im >>Nahkampf<<, es handelt sich eher um eine verkürzte mittlere Distanz, die zwar auf den selbigen technischen Prinzipien aufgebaut ist wie die der Fechtschulen des Saals, jedoch keinen Teil dieser Traditionen darstellt. Die Traditionen mit Duellkonvention verfügen, wie angedeutet, über keinen schulischen Nahkampf. Es handelt sich dabei auch nicht nur um die Konzepte der Tradition Himmel und Wunder (siehe Kapitel 8). Dieses bäuerliche System verfügt über einen eigenen und spezialisierten, sehr engen Nahkampf. Im Grunde ist es aber auch keine eigene systematische Entwicklung, da es sich lediglich um die Befolgung einer einzigen Taktik, eine geistige Ausrichtung handelt.
Sofern der Schüler nicht möchte, muss er nicht jede Methode, jedes Subsystem innerhalb des Traditional Italian Knife Fighting erlernen. Das Beherrschen einer einzigen Schule ist absolut ausreichend, um mit einem Messer vernünftig umgehen zu können. Diese erlernt man bei entsprechendem Talent und Fleiß auch in einer recht übersichtlichen Zeit. Alles, was über das Erlernen einer einzigen Tradition hinausgeht, kann getrost als Leidenschaft und/oder Forschung bezeichnet werden. Jedoch kann man das TIKF nur als Gesamtkonzept gänzlich erfassen. Und dazu gehört nebst drei Messerschulen, die den Kern des Systems ausmachen, auch die Kenntnis des Hirtenstockes. Der Hirtenstock ist es nämlich, der dem Fechter die körperliche Haltung vermittelt, die benötigt wird und versteckt alle Klingenaktionen beinhaltet, die zum Meistern der Messerschule erforderlich sind.
1.4.1 Ein freier Geist im Dienste des Fortschritts
Das Hauptmerkmal des TIKF ist aber der in der Einleitung angesprochene wissenschaftliche Charakter bzw. die wissenschaftliche Herangehensweise. Da ich zum freien Denken erzogen wurde, waren Zweifel, Infragestellung und die Suche nach den Schwächen einer Idee wie auch das Streben nach deren Behebung meine steten Begleiter. Dogmatismus war mir hingegen schon als Kind suspekt. Da ich diese Geisteshaltung bis zum heutigen Tage bewahrt habe, ist es mir unmöglich, Tatsachen, nur weil sie z. B. von einer >>hohen Instanz<< behauptet werden, als gegeben hinzunehmen, ohne diese zuvor im Rahmen meiner Möglichkeiten auf Herz und Nieren überprüft zu haben. Und wenn sich eine Behauptung als unhaltbar bzw. als verbesserungswürdig herausstellt, muss diese aus meiner Sicht entweder verworfen oder verbessert werden. Das ist der Weg der Denker, und zwar seit Anbeginn der menschlichen Entwicklung. Es ist eine Art steter Kampf gegen das Starre und auch gegen die eigene Trägheit. Und man mag dabei selbstverständlich auch mal irren oder gar scheitern, denn nur durch das Prinzip >>Versuch und Irrtum<< nähert man sich schrittweise einer möglichen Lösung.
Analysiert man die obigen Ausführungen, könnte man zur Ansicht gelangen, dass mein Vorgehen dem einer klassischen Tradierung widerspricht. Das stimmt zum Teil, zum Teil aber auch nicht. Es ist richtig und wichtig, herauszuheben, dass ich all mein Wissen zuerst einmal von den oben erwähnten Traditionen und Lehrern übernommen habe bzw. teilweise immer noch übernehme. Es ist aber falsch, dass ich partout nichts verändern darf, selbst wenn mir mögliche Schwächen auffallen.
Zur Tradition gehört nämlich gleichermaßen die Traditionskritik. Formen und Lehren dürfen sich nicht gänzlich frei von Sinn und Verstand verselbständigen. Im Geiste des Rationalismus und der Aufklärung und dem daraus hervorgegangenen kritischen Hinterfragen überlieferter Ideen mittels des Vernunftprinzips ist man es sich schuldig, eigenständig zu denken. Den eigenen Geist nicht abzuwerten, ist übrigens eine Frage der Selbstachtung. Das blinde Verfolgen vorgekauter Ideen widerspricht hingegen der Vernunft. Erweisen sich diese Ideen nämlich als falsch, kann das je nach Bereich erhebliche Folgen haben, denn:
>>Niemand irrt nur für sich allein, sondern ist auch Grund und Urheber fremden Irrtums<< Seneca, De vita beata 1,4
Und im Bereich Messerkampf könnten die Folgen solcher Irrtümer unmittelbar auftreten und eventuell auch ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen – in geistigen Dingen verhält es sich gleich. In vielen Fechtschulen Süditaliens zeigt sich diese Eigenständigkeit dadurch, dass eine Tradition viele verschiedene Zweige hervorbringt, die zum Teil unterschiedliche Taktiken verfolgen.
Ein Mensch kann, ohne zuvor Wissen erlangt zu haben, dieses natürlich nicht kritisieren, nicht überprüfen. Deshalb ist zu Beginn ein gegebenes Fundament erst einmal von Nöten. Und das ist eben die Tradierung bereits bestehender Erfahrungen, ohne auch nur eine Veränderung meinerseits. Damit aus einem Fundament aber kein Fundamentalismus gedeiht, muss der Schüler irgendwann an den Punkt gebracht werden, dass er die ihm vorgelegten Ideen bewusst und selbständig auf Fehler und Widersprüche untersuchen kann. Er sollte eines Tages in der Lage sein, die Tradition seinen körperlichen Voraussetzungen und seinen charakterlichen Eigenschaften und Überzeugungen anzupassen.
Es liegt am Lehrer, den Schüler dahingehend zu animieren, alles Erlernte auf Richtigkeit zu überprüfen. Er muss dafür sorgen, dass sich der Schüler von ihm und dem vorgeschriebenen Weg >>abnabelt<<, dass er in der spezifischen Materie erwachsen wird oder, um auch hier den großen Stoiker zu zitieren:
>>Folgen wir nicht wie das Herdenvieh der Schar der Vorangehenden. Wandern wir nicht, wo gegangen wird, anstatt auf dem Wege, den man gehen soll. Nichts bringt uns in größere Übel, als wenn wir uns nach dem Gerede richten, für das Beste halten, was allgemein angenommen wird, nicht nach Vernunftgründen sondern nach Beispielen leben<< Seneca, De vita beata 1,3
Entscheiden wir uns aber stattdessen gegen Senecas Rat, nur nach Beispielen zu leben, werden wir Zeit unseres Lebens >>Kinder<< bleiben, die der Führung eines >>Erwachsenen<< bedürfen.
Und deshalb besteht der letzte Schritt im TIKF in der Hinterfragung der überlieferten Ideen und deren Adaption an die eigene Sichtweise, den eigenen Möglichkeiten und Anforderungen. Damit der Schüler aber auch die gleichen Optionen hat wie ich sie hatte, muss er zuerst Zugang zum >>Original<< erhalten, statt sich im Vorfeld schon mit meiner Adaption befassen zu müssen.
Das Traditional Italian Knife Fighting ist also grob gesprochen zweigeteilt: Zuerst erlernt man die originalgetreue Tradition, danach analysiert man die Materie und versucht, diese bestmöglich den eigenen Anforderungen und Voraussetzungen anzupassen.
1.4.2 Der eine folgenschwere Fehler
Sofern man es sich leisten sollte, in einer echten Auseinandersetzung mit Messern Fehler zu begehen, kann ein einziger dieser Fehler kampfentscheidend sein. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Fehler eigenverschuldet ist oder uns vom Gegner aufgezwungen wird. Fehler in diesem Kontext entstehen aus einer Vielzahl von Möglichkeiten. Die wesentlichen Fehlerquellen resultieren jedoch:
a) aus einer der Situation unangebrachten Deckung
b) aus einem falsch berechneten Abstand zum Gegner
c) durch die unkontrollierte Kollision der Waffen
d) durch Mangel an psychischer Stabilität – man gibt quasi schon vor dem Ende des Kampfes auf – bzw. aufgrund großer Angst (welche dann vor allem auftritt, wenn man plötzlich realisiert, dass man sich auf offener See befindet, obwohl man eigentlich ein eher schlechter Schwimmer ist)
e) durch die Gier, den Gegner zu schnell letal treffen zu wollen
f) durch die Wahl der falschen Schrittarbeit im Verhältnis zur Beschaffenheit des Raumes bzw. des Untergrundes
g) durch mangelndes fechterisches Verständnis
Der letzte Punkt führt meist dazu, dass die Praktikanten umständliche Wege bestreiten, zum Teil auch zu viel oder zu wenig unternehmen.
Der Stich durch die fehlerhafte Deckung des Gegners
Fechterisch ließe sich das auf die Formel modo, tempo e misura, die Art und Weise, die Zeit/das Timing und die Distanz reduzieren. Jedoch stimme ich dieser >>Dreifaltigkeit<< nicht ganz zu. Richtiges Timing sollte man zuerst überhaupt nicht explizit behandeln, da dieses nur vorhanden sein kann, sofern die Distanz richtig eingehalten wurde. Befindet man sich nämlich zu nah am Gegner, kann man nicht mehr schnell genug auf dessen Angriffe reagieren. Befindet man sich zu weit vom Gegner entfernt, kann man dessen Lücken bzw. Fehler erst gar nicht ausnutzen. Damit also von Timing überhaupt geredet werden kann, muss zuerst die Theorie des richtigen Abstandes zum Gegner verstanden werden bzw. muss überhaupt begriffen werden, dass man beim Klingenkampf per Definition primär Raum zum Gegner schaffen sollte. Danach folgen das Verständnis der kurzen Wege wie auch die ideale Ausnutzung der Reichweite und das Verständnis um die Notwendigkeit einer soliden Deckung samt der dazugehörigen Fähigkeit, sich durch den Einsatz der Klinge erfolgreich zu schützen. Und hier sind wir bei der Philosophie angelangt: Ursache und Auswirkung werden zumeist verwechselt. Timing ist keine Ursache, die zum Vorteil reichen kann, vielmehr ist Timing die Auswirkung, die entsteht, sofern man die zuvor angesprochenen Punkten – Distanz, kurze Wege, maximale Ausnutzung der Reichweite, solide bzw. taktisch angebrachte Deckung, Sicherheit durch die Verteidigung mit der Klinge – befolgt.
Eine weitere Auswirkung ist übrigens die fechterische Eleganz. Auch sie ist keine Ursache, die einem Selbstzweck folgt. Stattdessen ist fechterische Eleganz erstens die Auswirkung bzw. das Resultat wissenschaftlicher Überlegungen und physikalischer Gesetze. Zweitens ist sie eine Willensanstrengung, diese Gesetzmäßigkeiten bis hin zur >>Perfektion<< immer wieder zu üben, sie sich stets vor Augen zu führen, sie sich quasi nicht nur körperlich, sondern auch geistig einzuverleiben. Drittens ist Eleganz die Auswirkung einer wohl durchdachten >>Schauspielkunst<<, die dem Auge des Gegners Stärke oder Schwäche, falschen Abstand, eine Lücke oder ein falsches Timing suggerieren soll.
1.4.3 Die zwei Kreise
Das TIKF ist ein System, das auf zwei gedachten Kreisen aufgebaut ist, welche zu Beginn unabhängig voneinander gelehrt werden. Es handelt sich um einen äußeren, weiten Kreis und um einen inneren, engen Kreis. Der äußere Kreis genießt in der Ausbildung erst einmal Vorrang. Der Grund hierfür ist, dass der äußere Kreis alle Schrittarbeiten schult, die notwendig sind, um die zum Gegner gewählte Distanz auch dann beibehalten zu können, wenn dieser sie verkürzen oder erweitern möchte. Diese Distanz nennt man in unserer Schule die Trennung (divisione). Alle Aktionen, ob diese vom Gegner wegführen oder zu diesem hin, versucht man dabei so zu wählen, dass man sich entweder gänzlich oder zumindest teilweise aus der Linie der gegnerischen Klinge bewegt.
Diese Taktiken, die ich an dieser Stelle das >>Aufrechterhalten der Trennung<<, das >>Raumschaffen<< oder auch das >>Vierteln<< nenne, stellen zu Beginn einen Imperativ dar, da sie im Einklang zur menschlichen Psyche stehen, sobald die Waffen echt sind und somit die Situation ernst wird. Der Drang, zunächst aus der Reichweite des gegnerischen Messers zu gelangen, ist ein Überlebensinstinkt. Diesem nicht nachzugehen bzw. auf diesem Instinkt aufbauend keine durchdachte Taktik zu entwerfen, müsste in diesem Kontext als grob fahrlässig bezeichnet werden.
Man darf nämlich nicht vergessen, dass es zwar nicht unmöglich aber auch nicht gerade einfach ist, ein Konzept für den Kampf mit einem Messer mit kurzer und schmaler Klinge zu entwickeln (einer Klingenwaffe also, die über keine ordentliche Parierstange verfügt), das vornehmlich auf Standardparaden aufgebaut ist. Das verlangt viel Übung und Zeit. Beherrscht man diese Vorgehensweise aber erst einmal, sind solch auf solide >>Paraden<< (es handelt sich eigentlich um Gegenangriffe zur Hand oder zum Arm) aufgebaute Systeme durchaus effizient, sofern zum Beispiel kein Platz vorhanden sein sollte, um das Problem durch Rückschritte oder Ausweichmanöver zu lösen.
Nach dem Beherrschen des äußeren Kreises geht es darum, sich im kleineren, inneren Kreis den Bewegungen des Gegners anpassen zu können – zuerst einmal. Ich bezeichne diese Idee den >>Dialog des Versatzes<<. Ein Kampf stellt im Grunde ein Frage-und-Antwort-Spiel dar. Stellt uns der Gegner eine Frage (Angriff), so können wir ihm eine beliebige Antwort erteilen (Parade oder Meidung) oder auch eine entsprechende Gegenfrage stellen (Gegenangriff zum Körper oder zur Hand, sprich selbst die Initiative übernehmen). Der Kampf stellt folglich die physische Ebene der Dialektik dar.
Der >>Dialog des Versatzes<< lehrt vornehmlich auf eine noch relativ unkonkrete Frage zu reagieren, frei nach dem Motto: >>Was meinen Sie dazu, dass ich mich hierher bewege?<<. Man sollte diesen Schritt nicht unterschätzen, da der Gegner durch Versatz, durch Veränderung seiner Position, was er z. B. durch bestimmte Posen, Figuren oder Schrittarbeiten bewerkstelligen kann, sich uns derart nähren könnte, dass daraus folgend eine für uns nachteilige Situation resultieren würde. Diese Übung dient somit primär dazu, die Trennung – auch im traditionellen Jargon divisione genannt, nicht nur im TIKF – beizubehalten und/oder einen vorteilhaften Winkel zum Gegner zu erzeugen.
Der nächste Schritt wäre das >>Durchschreiten des Raumes<<, dann die >>Beibehaltung der Trennung unter hohem Druck<< und letztendlich die >>Befreiung aus der Enge<<. All diese Begrifflichkeiten dienen vorwiegend der besseren Erklärung, man darf sie demnach nicht mit traditionell überlieferten Termini verwechseln, die ich an dieser Stelle absichtlich vernachlässige. Diese werden erstens im Verlauf des Buches eingehender erklärt und zweitens wäre man als Leser zu früh einem Wulst Fremdwörter ausgeliefert bzw. würde man gegebenenfalls in der Luft hängen, da einige traditionelle Schulen für viele Techniken und Taktiken keinerlei standardisierte Begriffe haben.
Das TIKF strebt taktisch vornehmlich danach, dem Gegner in der Zeit voraus zu sein, sprich sich so zu positionieren und zu bewegen, dass der Zeitvorteil durch Geometrie und Physik entsteht, weniger durch die genetische Veranlagung oder den körperlichen Zustand des Fechters (beides ist natürlich wichtig: Schwäche, Alter und Krankheit sind sicherlich keine Vorteile). Hier habe ich mich gedanklich übrigens an dem großen, italienischen Fechtmeister Camillo Agrippa orientiert (siehe Kapitel 2.5.2). Um dies im Rahmen meines Systems zu verstehen, ist nebst dem >>Dialog des Versatzes<< auch das Prinzip der Waage (bilancia) relevant. Waage steht hier für Gleichgewicht und somit auch für die Fähigkeit, sich jederzeit in jede Richtung mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen zu können wie auch für die Fähigkeit, Aktionen so durchzuführen, dass sie weitgehend umkehrbar bleiben. Sie steht aber auch dafür, bei körperlichem Druck seitens des Gegners, nicht allzu schnell ins Wanken zu geraten – letzteres ist vor allem im Nahkampf relevant. Die Bewegungen müssen leichtgängig wirken, selbst wenn der Weg dorthin mühselig sein kann. Oder wie es Friedrich Schiller 1795 in seinen >Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen< (22. Brief) ausdrückte:
>>Der ernsthafteste Stoff muss so behandelt werden, dass wir die Fähigkeit behalten, ihn unmittelbar mit dem leichtesten Spiel zu vertauschen.<<
Die bilancia ist dem Prinzip der Pendelwaage nachempfunden, wie man es auch beim Balancieren auf einem Seil ausführt. Zum anderen erreicht man die Waage, das Gleichgewicht, durch einen im Vergleich zum olympischen Fechten engeren Stand, der schnelle Drehungen um die Körperlängsachse, rasche Schrittfolgen, Rückzüge und Richtungswechsel ermöglicht (etwas weitere und tiefere Stände gibt es selbstverständlich auch, wobei diese nur präzisen, taktischen Vorgaben folgen, z. B. teilweise im erwähnten Nahkampf, beim bewusst langem Ausfall oder auch, um einen psychologischen Effekt zu erzielen).
Ebenso hilft eine leichte und ausgewogene muskuläre Vorspannung, das Drehmoment zu erhöhen. Um sich dies besser vorstellen zu können, denke man an die körperliche Vorspannung eines Matadors während der Corrida3. Die Haltung des Matadors entspricht natürlich nicht wirklich der unseren, da wir uns etwas legerer bewegen. Diese leichte muskuläre Vorspannung erzeugt zudem eine elegante und stolze Haltung, die sich entsprechend ausgleichend auf die eigene Psyche und auch, verunsichernd, auf die des Gegners auswirken kann.
Hier bietet die traditionelle Verbindung mit dem Hirtenstock innerhalb der Schulen auch eine für den Messerkampf nicht zu unterschätzende Hilfe. Gerade der Stock fördert die notwendige Muskelspannung. Der Hirtenstock ist das Fundament des Messers und auch der >>Ersatz der Langhantel<<. Es verleiht dem Fechter alle notwendigen Attribute. Das Erlernen des Messers fällt dadurch leichter. Zudem beinhaltet der Hirtenstock Aktionen, die für das Messerfechten entscheidend sind, in einigen Messerschulen aber teilweise nicht gelehrt werden, da man sie durch die Kenntnis des Hirtenstocks voraussetzt. Schließlich bezieht sich die >>Waage<< auch auf das Kräfteverhältnis, sprich auf die symmetrische Ausrichtung der Gliedmaßen in Relation zu der natürlichen, muskulären Spannung.
Mit bilancia, der Waage, ist eine Idee zu verstehen, die weit über das bloße körperliche Gleichgewicht halten reicht. All diese Faktoren führen dazu, dass sich dieser Zustand auf den Geist auswirkt und umgekehrt, sofern der Körper in allen Belangen ausbalanciert ist. Geist und Körper oder auch Seele und Leib stellen aus meiner Sicht eine untrennbare Einheit dar. Schwächt man das eine, schwächt man gleichzeitig auch das andere, stärkt man das eine, stärkt man gleichzeitig auch das andere. Die Wechselwirkung kann nicht ausbleiben4. Zudem bezieht sich das Gleichgewicht auf die Aufteilung des Systems selbst: Das TIKF ist >>dreidimensional<<. Es verfügt nicht nur über drei Mensuren auf der horizontalen Ebene (die weite, mittlere und nahe Mensur), vielmehr auch über drei vertikale Ebenen (die hohe, die mittlere und die tiefe Schule; scuola alta, media e bassa) und über eine dreifache Dynamik hinsichtlich der Zeit (die gestandene Schule, die gleitende und die springende Schule; scuola posata, striciata e saltata).
1.4.4 Das Durchschreiten des Kreises
Um in einem Messerkampf den Gegner treffen zu können, ohne dabei selbst allzu leicht getroffen zu werden, ist es von Nöten zu verstehen, wie man sich zeitliche Vorteile verschaffen kann und wie man es vermeidet, direkt in den gegnerischen Konter zu laufen. Vor dem Gegner am Ziel zu sein und auch weg zu sein, bevor dieser einen selbst erreichen kann, klingt zwar nach einem simplen Plan, aber er zerstört in der Regel die komplexesten Strategien. Dafür ist es wichtig, zwischen Schnelligkeit und Eile unterscheiden zu können.
Es geht nicht darum, sich besonders schnell oder gar eilig zu bewegen – körperliche Schnelligkeit nimmt spätestens im Alter ab –, vielmehr darum sich >>ausgeruht<< am Ziel zu befinden, bevor der Gegner dieses erreicht hat. Napoleon I. (Bonaparte, 1769–1821) formulierte es einst so:
>>Ordnung marschiert mit gewichtigen und gemessenen Schritten, Unordnung ist immer in Eile.<<
Diese Aussage macht klar, dass stets Ordnung, ein Gleichgewicht der Kräfte (bilancia) herrschen muss, auch wenn wir schnell sein wollen. All die aufgeführten Gedanken definieren übrigens den gravierenden Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Man sollte deshalb nicht darüber reden, ob ein System nur effektiv ist. Man sollte vielmehr analysieren, inwieweit es auch effizient ist.
Um diese Vorteile zu erzielen, hilft uns wieder der >>Dialog des Versatzes<<. Dieser lehrt, die Posen oder Stellungen in logischer Relation zueinander auszurichten. So erfährt der Schüler, wann er dem Gegner in der Zeit bzw. in der Reichweite voraus ist, wann er den >>geometrischen Vorteil<< hat und wann eben nicht. Hier ist der Lehrer stark gefordert, der wie beim Tanzen den Schüler führen muss. Der Lehrer muss sich zwar gelegentlich bewusst treffen lassen, dem Schüler dann aber auch dessen Stellungsfehler durch Treffer seinerseits immer wieder aufzeigen.
Den Vorteil im Raum bzw. im Kreis erzielt man u. a. durch das >>okkulte<< Verkürzen der Verbindungen zwischen dem äußeren und dem inneren Kreis. Um nicht geradewegs in der gegnerischen Klinge zu landen, bedient man sich zuerst einer Taktik, die in meiner Schule und auch traditionell der Halbmond (mezza luna) genannt wird. Hierbei geht es schlicht darum, den Gegner vorsichtig zu flankieren. Weiter reicht es zum Vorteil, lässt man den Gegner z. B. dahin gehen, wo man selbst schon ist oder auch wenn man sich dort positioniert, wo der Gegner hingehen wird bzw. wo er zuvor war. Diese Taktik entspricht grammatikalisch betrachtet einer Tempusform. Auch ist es vorteilhaft, wenn man seine Aktion startet, während der Gegner kurz davor ist, dies seinerseits zu tun (anticipo; das Antizipieren).
1.5 Aus einem ethischen Blickwinkel betrachtet
Ein weiteres Bestreben meiner Schule ist, eine gewisse ethische Gesinnung zu bewahren. Wobei ich hier nicht von >>hoher Moral<< schreibe, wie sie zumeist von metaphysischen Philosophen, Glaubensfanatikern oder kleinbürgerlichen Moralaposteln gefordert wird. Ein Messer ist heute per Definition weniger eine Waffe, es ist vornehmlich ein Werkzeug für Bauern, Hirten, Fischer, Köche, Handwerker, Rettungskräfte, Pfadfinder etc. Das Messer primär als Waffe zu betrachten, wird den eigentlichen Klingenwaffen, wie wir sie zum Beispiel aus der Antike, dem Mittelalter, der Renaissance, dem Barock oder eben auch dem Italien des 18./19. Jahrhunderts kennen, nicht gerecht. Selbst die ab dem Mittelalter verwendeten langen Dolche hatten aufgrund ihrer Beschaffenheit (Länge, Klingenform und Parierstange) einen kriegerischen Charakter, der den eines heutigen Gebrauchsmessers oder >>Kampfmessers<< bei weitem übertrifft. Auch waren die neapolitanischen, sizilianischen oder die kalabrischen Duell- bzw. Kampfmesser des 19. Jahrhunderts aufgrund ihre Form und Beschaffenheit für jede Arbeit ungeeignet – sie dienten nur dem Duell und der Verteidigung (siehe Kapitel 10).
Überfall mit einem Messer
Zu denken, das Messer sei heutzutage ein ideales Werkzeug zur Selbstverteidigung, ist aus meiner Sicht etwas unbedacht. Jede Waffe, die man mitführt und die zuerst gezogen werden muss, dient nur zweitrangig der Verteidigung, vorrangig der Arbeit. Je nach Geisteshaltung dient sie leider auch der Aggression. Liest man
zudem die Tageszeitungen genauer, wird entsprechend meist von Überfällen mit Messern berichtet, nicht von Verteidigungen damit.
Will man sich also mit einem Messer verteidigen, muss auch die Gefahr rechtzeitig erkannt worden sein. Die Zeit, die Waffe zu ziehen, wäre ansonsten nicht mehr vorhanden. Hat man die Gefahr aber frühzeitig erkannt, stehen eventuell – natürlich nicht unbedingt! – auch andere Mittel zur Verfügung, um womöglich erst einmal deeskalierend zu agieren oder sofern die Umstände es erlauben, zu fliehen bzw. erst einmal auf Hilfsgegenstände zurückzugreifen (Jacke, Gürtel, Gläser etc.). Jeder hat natürlich seine Gründe und Sichtweisen. Ich will hier nur Gedanken in den Raum werfen, nicht urteilen oder gar verurteilen. Die eigentliche Selbstverteidigung findet meines Erachtens nach zuerst und vorrangig durch Vermeidung, Früherkennung und Deeskalation statt. Zweitrangig findet sie mit der leeren Hand statt, mit Handflächenschlägen, Fausthieben und von mir aus auch mit Tritten, Ringen etc. Dies ist die logische Reihenfolge, da Rhetorik und Körperwaffen nicht erst gezogen werden müssen. Sie stehen einem gleich zur Verfügung. Das Messer muss hingegen nicht nur erst gezogen werden, vielmehr verlangt es einmal gezogen absolute Konsequenz. Lässt sich nämlich der Angreifer durch unser Messer nicht abschrecken, sondern geht bereitwillig und eventuell ebenfalls mit einem Messer bewaffnet auf den Kampf ein, entsteht eine Situation, in der sich entscheiden wird, ob man psychisch überhaupt in der Lage und willens ist, einen Menschen gegebenenfalls zu töten – und das ist eine Frage des individuellen Charakters und der persönlichen, ethischen Sichtweise. Das >>Spiel<< bzw. die einfache Schlägerei ist hier zu Ende. Ab jetzt geht es um Leben oder Tod. Und das ist übrigens der Kernpunkt: Wer glaubt, dass es einfach mal so möglich sei, einen mit einem Messer bewaffneten Angreifer durch gezielte Aktionen lediglich lahmzulegen, ohne diesen eventuell umbringen zu müssen, irrt gewaltig.
Es ist in einer solchen Stresssituation, in der das eigene Leben auf dem Spiel steht, äußerst schwer ein ruhiges Gemüt zu bewahren. Aber erst dieses würde einem die nötige Übersicht gewähren, die vor Fehlern schützt bzw. den Fechter in die Lage versetzt, einen Angreifer gegebenenfalls bewusst zu schonen. Mein Anliegen ist gewiss nicht, das Messer als mögliche Option zur Selbstverteidigung auszuschließen, vielmehr will ich aufzeigen, dass es aus ethischen Gründen sowie aus Gründen der Vernunft stets nur die zweite oder die dritte Wahl darstellen sollte.
Wir Menschen leiden zudem des Öfteren an Selbstüberschätzung. Zu glauben, ein wenig Training mit einem Übungsmesser, Schutzhandschuhen und Kopfschutz würde der Realität eines echten Messerkampfes auch nur ansatzweise gleichkommen, ist Fantasterei. Und nicht vollends zu berücksichtigen, welch unglaubliche psychische Belastung die Frage nach Leben oder Tod darstellt und wie sich diese auf unser taktisches Verhalten während eines Messerkampfes tatsächlich auswirkt, führt unter Umständen in den Untergang (Anm.: bezüglich der psychischen Belastung während z. B. einer Konfrontation mit Klingenwaffen lesen Sie bitte Kapitel 5.1. Es handelt sich um die Erinnerungen des großen Fechters Aldo Nadi an sein erstes Duell).
Die echte Klinge ist psychologisch betrachtet eine Art technischer Regulator, quantitativ wie auch qualitativ. Ferner ist sie ein automatischer Abstandshalter. Und genau unter diesen beiden Gesichtspunkten ist meine Schule, das Traditional Italian Knife Fighting, taktisch und technisch aufgebaut.
Abschließend noch eine Buchempfehlung zum Thema gewaltlose Selbstverteidigung: Der Sachbuchautor und Kampfkunst-Lehrer Michel Ruge durchbricht mit seinem Buch >Das Ruge-Prinzip: Signale der Gewalt erkennen, Konflikte meistern, Zivilcourage zeigen!