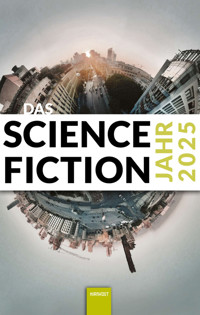
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Das Science Fiction Jahr
- Sprache: Deutsch
In der 40. Ausgabe von DAS SCIENCE FICTION JAHR stehen Utopie und Science Fiction im Vordergrund. Denn die Literatur hat das große Potenzial, Lebenswelten aufzuzeigen und mit Ideen aufzuwarten, etwas in unserem Denken und Handeln für die Zukunft zu bewegen. So beleuchten Autor:innen wie Judith C. Vogt, Matthias Fersterer, Lena Richter, Jol Rosenberg, Wolfgang Both u.a. Hopepunk als Hoffnungsaktivismus, die Wirkmächtigkeit sozialer Utopien und die konkrete Umsetzung utopischer Lebensweisen à la Le Guins »Für immer nach Hause«. Zudem wird im zweiten Schwerpunkt »Kosmische Visionen« ein ganz anderes Spektrum er SF beleuchtet: Es geht um Darstellungen im 21. Jahrhundert ebenso wie um das Zusammenspiel mit der Hard Science Fiction und den Beginn des planetaren Denkens. Natürlich dürfen in der Jubiläumsausgabe unser Dauerschwerpunkt »Zeitgenössische Dramaturgien« sowie die Rückblicke auf die Entwicklungen der Science Fiction in Buch, Film, Game, Comic und Podcast nicht fehlen. Ein Überblick über die wichtigsten Genre-Preise sowie ein Nekrolog runden die Ausgabe ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von Melanie Wylutzki und Hardy Kettlitz
Impressum
Das Science Fiction Jahr 2025
Originalausgabe
© 2025 Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin
www.hirnkost.de
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage Oktober 2025
Vertrieb für den Buchhandel:
Runge Verlagsauslieferung: [email protected]
Privatkunden und Mailorder: http://shop.hirnkost.de/
Die Rechte an den einzelnen Texten liegen bei den Autor*innen und Übersetzer*innen.
Redaktion: Melanie Wylutzki, Hardy Kettlitz, Wolfgang Neuhaus, Michael Wehren
Gastredakteur für den Schwerpunkt »Kosmische Visionen«: Markus Tillmann
Lektorat: Melanie Wylutzki, Michael Wehren
Korrektur: Michelle Giffels, Steffi Herrmann
Umschlaggestaltung: s.BENeš [https://benswerk.com]
Layout & Satz: Hardy Kettlitz
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns ausdrücklich vor.
ISBN:
Buch: 978-3-98857-081-9
E-Book: 978-3-98857-082-6
PDF: 978-3-98857-083-3
Dieses Buch gibt es auch als E-Book – bei allen Anbietern und für alle Formate.
Aktuelle Infos auch unter:www.facebook.com/ScienceFictionJahr
Instagramm:www.instagram.com/sf_jahr/
Das Science Fiction Jahr kann man auch abonnieren:
https://shop-hirnkost.de/produkt/das-science-fiction-jahr-abonnement/
Inhalt
Editorial
FEATURE – UTOPIE UND SF
Dr. Marie-Luise MeierDie Perfektion im Kleinen
Von Mikro- zu Makroutopien in der Literatur
Aiki MiraUtopische Körper
Africanfuturism und Queer*SF als utopische Praxis
Matthias Fersterer, janas gebauer, Eugen PissarskoiUnleashing Fantasy for Transformation
Mit Spekulativer Fiktion am Utopischen arbeiten
Michael WehrenArbeit am Utopischen
oder: Wie gehen wir heute mit kanonischen SF-Texten um? Ein Werkstattbericht zur Andymonaden-Anthologie
Isabella HermannDie Anti-Dystopie – am Beispiel von Filmen und Serien
Melanie Wylutzki»Eine Utopie ist nur dann eine echte Utopie, wenn sich in ihr neue Utopien erdenken und anstreben lassen.«
Interview mit Theresa Hannig
Alessandra ReßZur Sonne und weiter
Solarpunk im Wandel seines Zeitgeists
Judith und Christian VogtScience Fiction als Hoffnungsaktivismus
Jol RosenbergUtopien für Alle
Utopisches Denken zur Überwindung der Grenzen des eigenen Standortes
Lena RichterNoch-Nicht-Orte – utopische Erzählinseln und ihre Rezeption
Wolfgang BothDie Wirkmächtigkeit sozialer Utopien
Judith MaderaNatur-Utopien auf fernen Welten
Anette SchaumlöffelDen leisen Stimmen lauschen
Über die Rolle, die anthropologisches Denken und Wissen für das Schreiben von Utopien spielen könnten
Silke BrandtConcretopia – Architektur und Utopie
Maurice SchuhmannErnest Callenbach – Ecotopia
The Notebooks and Reports of William Weston
Joachim PaulDu hast immer eine Wahl …
John Brunners Der Schockwellenreiter neu gelesen
FEATURE – ZEITGENÖSSISCHE DRAMATURGIEN
Markus TillmannGreen Narrative New Deal
Post-anthropozänische Szenarien in der deutschsprachigen Climate Fiction
FEATURE – KOSMISCHE VISIONEN
Fritz HeidornReise zum Ende des Universums
Streifzug durch Wissenschaft und Science Fiction
Kosmische Angst bei H. P. Lovecraft und William Hope Hodgson
Hans EsselbornDietmar Daths kosmische Visionen
Trans-, post- und extrahumane Gesellschaften im All
Dominik IrtenkaufWeird Fiction im Weltraum
Die Veränderung der Science-Fiction-Wahrnehmung bei Clark Ashton Smith hin zu einem planetaren, eigentlich kosmischen Denken
Wolfgang NeuhausDer Trost der großen Perspektive
Ein Kommentar zu Olaf Stapledons Werk Sternenschöpfer aus dem Jahr 1937
Markus TillmannJenseits der menschlichen Vorstellungskraft
Kosmische Visionen in dem Roman Blindflug von Peter Watts
FEATURE
Karlheinz SteinmüllerDie Träume eines Physikers
Zu den Gedankenexperimenten Peter Schattschneiders
Kai U. Jürgens»Rowdy Yates trieb unaufhaltsam Richtung Osten.«
Eine Einführung in Juan S. Guses Science-Fiction-Roman Miami Punk (2019)
REVIEW | BUCH
Hardy KettlitzScience-Fiction-Literatur 2024/2025
Rezensionen von Wolfgang Both, Christian Endres, Matthias Fersterer, Isabella Hermann, Christian Hoffmann, Dominik Irtenkauf, Wiebke Jahns, Kai U. Jürgens, Peter Kempin, Judith Madera, Wolfgang Neuhaus, Alessandra Reß, Jol Rosenberg, Alex Stoll, Markus Tillmann, Yvonne Tunnat und Michael Wehren zu aktuellen Belletristik- und Sachbüchern aus den Jahren 2024 und 2025 von Ünver Alibey, J.G. Ballard, Kaliane Bradley, Sarah Brooks, Rebecca Campbell, Becky Chambers, Dietmar Dath, Samuel R. Delany, Ruben August Fischer, Paul Gurk, Samantha Harvey, Isabella Hermann, Tom Hillenbrandt, Ray Kurzweil, Ursula K. Le Guin, Paul Lynch, Christian J. Meier, Luise Meier, Lukas Meisner, Aiki Mira, Richard Powers, Anne Reinecke, Jol Rosenberg, Joanna Russ, Neil Shusterman, Simon Stålenhag, Justin Steinfeld, Swan Collective, Ilija Trojanow, Nils Westerboer, Gene Wolfe und Bettina Wurche.
Peter Kempin / Wolfgang NeuhausUtopie nach dem »großen Umbruch«
Udo KlotzKonfrontation mit der Krise oder Eskapismus
Deutschsprachige SF-Romane 2024
Wolf TressWeniger kosmische, dafür aber Otherland-Visionen
Das Jahr 2024 aus der Sicht eines Fachbuchhändlers
FILM
Thorsten HanischFilm-Highlights 2024
SERIEN
Lutz GöllnerWeniger ist mehr
Ein Blick auf die Highlights der neuen Science-Fiction-Serien und -Filme bei den einschlägigen Streamingdiensten
GAME
Johannes Hahn und Maximilian NitzkeWas heißt hier eigentlich Science Fiction?
FACT
Hardy KettlitzInternationale Science-Fiction-Preise
Erik SimonRussische SF-Preise 2024
Markus MäurerTodesfälle
Autor*innen und Mitarbeiter*innen
Editorial
Liebe Leser*innen,
wir halten die 40. Ausgabe vonDAS SCIENCE FICTION JAHRin den Händen. Und es ist eine wirklich besondere. Als das Jahrbuch 2019 notgedrungen ein neues Zuhause gesucht hat, sind wir mit der Prämisse in die Rettungskampagne gestartet, das Projekt weiterzuentwickeln, ihm frischen Wind zu verleihen und gleichzeitig die Tradition zu wahren. Für diesen besonderen Band wird nun eine Änderung ganz offensichtlich: Die Buchreihe hat ein neues Gewand von Gestalterin benSwerk erhalten – denn auch wenn das Universum und der Kosmos immer zentrale Aspekte der Science Fiction sein werden, entwickelt sich das Genre doch weiter, wird urbaner, technischer und hoffentlich utopischer.
Um diese Entwicklungen auch inhaltlich aufzugreifen, setzen wir den im letzten Jahr eingeführten Dauerschwerpunkt »Neue Dramaturgien« fort, den Redaktionsmitglied Michael Wehren kuratiert. Dabei stellen wir die Frage: Wohin bewegt sich das Genre, wohin die Schreibenden? Gerade auch in der deutschsprachigen SF-Szene gibt es interessante Strömungen und Entwicklungen, inhaltliche wie sprachliche, auf die es sich zu schauen lohnt. In dieser Ausgabe wird beleuchtet, wie SF-Schreibende sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen.
Des Weiteren bereichert der von Markus Tillmann und unserem langjährigen Redaktionsmitglied Wolfgang Neuhaus begleitete Schwerpunkt »Kosmische Visionen« unser Jahrbuch: Dabei schauen die mitwirkenden Autor*innen, wie sich die von H. P. Lovecraft geprägten Vorstellungen in der SF spiegeln und welchen Wandel sie vollzogen haben. Dabei werden u. a. die Werke von Schriftstellern wie Peter Watts, Dietmar Dath und Olaf Stapledon beleuchtet.
Im Fokus dieser Ausgabe steht zudem auch ein Thema, von dem wir glauben, dass es die SF-Szene angesichts zahlreicher sich überlagernder Krisen und Kriege in der »realen« Welt derzeit stark bewegt: die Utopie. Wir sind überzeugt, dass es uns guttut und unser Denken verändert, wenn wir utopische Perspektiven lesen. Wir schauen nicht nur darauf, was der Begriff eigentlich meint, wo wir Mikro- oder Makroutopien finden und was anti-dystopische Texte zu diesem Diskurs beitragen können. Es geht auch darum, wie wir ganz konkret utopische Ideen leben können, wie wir (Noch-)Nicht-Orte schaffen und befähigt werden, unsere eigenen Grenzen und Denkmuster zu überwinden, um utopische Räume für alle zu schaffen.
Ganz traditionsgemäß wird das Jahrbuch von unserem Service-Teil abgerundet: Neben einem umfangreichen Rezensionsteil, einer Rückschau auf die deutschsprachige SF sowie einem Rückblick aus Sicht des Buchhändlers freuen wir uns über aufschlussreiche Überblicksartikel zu Games, Filmen und Serien. Auch die wichtigsten Genre-Preise sowie die Rubrik der Todesfälle dürfen nicht fehlen.
Doch auch in unserem Service-Teil gibt es Veränderungen. So haben wir beschlossen, die Bibliographie, die uns Christian Pree dankenswerterweise über Jahre zur Verfügung gestellt hat, nicht mehr im Jahrbuch abzudrucken. Die Zukunft der bibliographischen Recherche sehen wir insgesamt im digitalen Raum und nicht mehr in Jahrbüchern wie diesem. So möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Christian Pree für seine jahrelange Unterstützung und die unermüdliche Arbeit an der Bibliographie von SF-Büchern, die auf Deutsch erscheinen, danken, die in aller Vollständigkeit unterhttp://www.chpr.at/abrufbar und benutzbar ist!
Zuletzt möchten wir allen Mitwirkenden an diesemScience Fiction Jahrdanken. Wir freuen uns, dass wir unseren Autor*innenstamm in diesem Jahr stark ausweiten konnten, und hoffen, dass die vielfältigen Stimmen und Perspektiven Ihnen genauso viel Freude machen wie uns.
Und schließlich: Es ist schon besonders zu wissen, dassDAS SCIENCE FICTION JAHRnun zum 40. Mal in ungebrochener Folge erscheint – ein Jubiläum, von dem wir nicht immer überzeugt waren, dass wir es mitbegleiten können. Wir sind stolz und dankbar für die Unterstützung von unseren Autor*innen, Leser*innen und allen Mitwirkenden, vom Verlag und von den SF-Schaffenden, die demSCIENCE FICTION JAHRin diesem Jahr den Kurd Laßwitz Preis in der Kategorie »Bester Sachtext« zugestanden haben.
In diesem Sinne sagen wir noch einmalDANKEund wünschen viel Freude bei der Lektüre!
Herzlich,
Melanie Wylutzki, Hardy Kettlitz & das Redaktionsteam
Dr. Marie-Luise Meier Die Perfektion im Kleinen
Von Mikro- zu Makroutopien in der Literatur
»Ich glaube nicht, dass es rein utopische Literatur gibt«, sagte Matthew Beaumont, ein britischer Literaturwissenschaftler und Utopienforscher, gegenüber dem Deutschlandfunk Kultur.[1]Das Interview ist von 2016 und wirkt auf den ersten Blick veraltet, denn der Ruf nach reinen Utopien, zukunftsweisend und idealistisch, ist so laut wie lange nicht mehr. Auf Blogs und in Onlinezeitschriften, auf Tagungen und in Interviews wird sich vermehrt gegen die Dystopie und für die Utopie ausgesprochen. Man will nicht noch eine ockergelbe Apokalypse im Stil vonFALLOUT, nicht noch einen Neuaufguss eines Orwell’schen Überwachungsstaats. Zudem sind durchaus Utopien im Handel zu finden. Aiki MirasProxiist mit »eine Endzeit-Utopie« untertitelt, Becky ChambersEin Psalm für die wild Schweifendengilt als solarpunkige Utopie. Und überhaupt: Solarpunk war die letzten Jahre in aller Munde und befasst sich regelmäßig mit besseren oder gar utopischen Zukunftsvisionen.[2]
Dennoch liegt Beaumont nicht falsch, denn all die klassischen Utopien, die »reinen Utopien«, von PlatonsPoliteiabis zu H. G. WellsEin modernes Utopia, sind selten erstrebenswert. Manche sind aus moderner Sicht nicht mehr als Dystopien im utopischen Gewand. Aber warum ist das so? Um zu zeigen, warum die klassisch-allumfassendenMakroutopienweder realistisch noch erstrebenswert sind, will ich mich erst ihrer Geschichte und ihrem Zweck, dann anhand von Beispielen ihren Genrekonventionen widmen. Weil ich aber utopische Ansätze in der Literatur für wichtig und notwendig halte, möchte ich an einigen Beispielen die Relevanz vonMikroutopienhervorheben, von utopischen Impulsen innerhalb von Werken verschiedenster Genres.
Die literarische Utopie: Definition und Geschichte
Dieliterarische Utopieunterliegt wie alle Genres Konventionen. So stellt sie typischerweise eine ideale Welt oder Gesellschaft dar. Die Hauptfigur besucht oft eine utopische Gesellschaft, strandet dort oder erforscht sie, um die Erkenntnisse danach in die eigene Kultur zu tragen. Dadurch fungiert die Hauptfigur als eine Art Kamera für Lesende. Die Haltung der Hauptfigur und die Textbotschaft sind wichtige Indikatoren dafür, mit welcher Art von Utopie man zu tun hat.[3]In einerEutopieist die Haltung von Figur/Text gegenüber der utopischen Gesellschaft wohlwollend. Sie wird als Ideal dargestellt. In derKritischen Utopiewerden Pro und Contra gegeneinander abgewogen. Und in derAnti-Utopieist die Haltung gegenüber der utopischen Gesellschaft durchweg negativ.
Ob Utopien ein Subgenre der Science Fiction sind, ist umstritten. Utopienforscher wie Gregory Claeys, Glenn Negley und J. Max Patrick sehen keine enge Verbindung zwischen utopischer Literatur und der Science Fiction – für sie muss eine Utopie weder in der Zukunft spielen noch machbar sein.[4]Margaret CavendishsThe Description of a New World, Called the Blazing-Worldgilt beispielsweise als Fantasy-Utopie.
Laut dem Soziologen und Utopienforscher Krishan Kumar werden Utopien bevorzugt in Übergangsperioden geschrieben, in denen die großen Umwälzungen in der Gesellschaft nicht mehr von der Politik abgedeckt werden oder die Politik nicht ausreichend auf die Wünsche der Gesellschaft reagiert.[5]Das zeigt auch, für wen Utopien gedacht sind: Das Publikum sind Menschen in der Krise, in letzter Zeit auch marginalisierte Gruppen. Jemand, der mit der Ausgangssituation glücklich ist, braucht keine utopische Literatur. Krisenerfahrungen führen zu einem Streben nach utopischen Gesellschaftsformen, die wiederum utopisches Schreiben fördern. Peter Fitting, der die Verbindung von Science Fiction, Utopien und Gesellschaft erforscht hat, sieht in der Welle utopischer Werke in den 1970er-Jahren eine direkte Reaktion auf den Kalten Krieg.[6]Die vorangehende Bewegung um 1950 war demnach eine Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg.
Dystopien entstehen dann, wenn eine konkrete Angst die Gesellschaft beherrscht. In den 1950er- und 1960er-Jahren entstanden beispielsweise vermehrt Werke, die sich mit der Bedrohung durch Nuklearwaffen und der Angst vor dem Kommunismus (Red Scare) auseinandersetzten, was ebenfalls auf den Kalten Krieg zurückzuführen war. Aktuell ist das Thema künstliche Intelligenz verhältnismäßig häufig in dystopischen Werken zu finden. Viele utopische Werke (wie ChambersEin Psalm für die wild Schweifenden) haben es ebenfalls für sich entdeckt, doch statt zu mahnen, wird die Relevanz von menschlicher Arbeit und Intelligenz hervorgehoben. Somit können Utopien und Dystopien durchaus dieselben Themen behandeln, doch der Gestus ist ein anderer. Dystopien drohen mit negativen Konsequenzen für bestimmte Handlungen, Utopien hingegen stellen eine Belohnung für positive Handlungen in Aussicht, nämlich ein besseres Leben.
Die Makroutopie als Wunschphantasie mit Ablaufdatum
Utopien sollen voller erstrebenswerter Ideale sein. Dazu müssen sie machbar sein und realistisch, so heißt es oft. Dieser Anspruch an Utopien ist tatsächlich neu(er) – und mit den klassischen Utopien nicht vereinbar.Für Machbarkeit und Realitätsnähe lohnt sich ein Blick auf einige bekannte Vertreter des Genres, die aus den verschiedensten Epochen stammen. PlatonsPoliteiaist von 375 v. Chr., H. G. WellsEin modernes Utopiavon 1905, Ursula Le GuinsDie Enteignetenvon 1974 und Becky Chambers Ein Psalm für die wild Schweifendenvon 2021. Diese fasse ich hier als Makroutopien zusammen, also Werke, die eine utopische Welt/Gesellschaft vermitteln wollen oder in denen die utopische Welt zumindest wichtig für die Handlung ist und diskutiert wird.
WährendPolitei,Ein modernes UtopiaundEin Psalm für die wild SchweifendenEutopien sind, also positive utopische Darstellungen, in denen die Hauptfiguren von ihrer utopischen Welt schwärmen, ist Le GuinsDie Enteigneteneine Kritische Utopie, die sorgsam den kommunistisch regierten Planeten gegen den liberalistischen abwägt. Dialoge sind in allen Werken zentral zur Vermittlung der Ideale. DiePoliteiaist dabei ein einziger fiktiver literarischer Dialog,Ein modernes Utopiaeine Art Sightseeingtour mit minimaler Handlung,Die Enteignetenein klassischer Science-Fiction-Roman mit politischem Plot undEin Psalm für die wild Schweifendeneine Selbstfindungsreise, auf der die Hauptfigur einer anderen die utopische Welt näherbringt.
Das erste Problem an der Machbarkeit (im Sinne einer direkten Übertragbarkeit) fast aller genannten Werke ist, dass sie nicht auf der Erde spielen – und das ist ein Merkmal des Genres. Bei Wells heißt es zwar wortwörtlich:
»Our deliberate intention is to be not, indeed, impossible, but most distinctly impracticable, by every scale that reaches only between to-day and to-morrow.«[7]
Dennoch ist Wells Utopia auf einem Planeten jenseits des Sirius angesiedelt. Le Guins Schwesternmonde sind Teil ihres erdachten Ekumen-Universums, und Chambers Geschichte spielt auf Panga, einem fiktiven Mond. Gesellschaften und deren Entwicklung werden erheblich von ihren Rahmenbedingungen geprägt – beispielsweise Rohstoffe, Fruchtbarkeit der Böden, Wegbarkeit des Landes. Das allein schränkt die Machbarkeit ein. Zugleich wird durch den Beigeschmack von »es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis« eine Situation geschaffen, die nichts mit unseren eigenen soziopolitischen Umständen zu tun hat. Es gibt keine Verbindung von unserem Jetzt-Zustand zu dem Ist-Zustand der literarischen Utopien. Und selbst wenn es sie gäbe: Die meisten Utopien sind betont vage. In WellsUtopiaverrichten Maschinen die Arbeit, doch wie es zu diesen Maschinen gekommen ist, wer sie baut und woraus, all das bleibt unklar. Chambers hat eine Art Währungssystem etabliert – ein Minicomputer, den Hauptfigur Dex immer bei sich trägt, registriert alle Leistungen –, doch es wird nicht erklärt, was eine Leistung wert ist und was als Gegenleistung gefordert wird. Utopien sind demnach mehr Atmosphäre als Anleitungen.
Sagen wir aber, es wäre möglich, Utopien nachzustellen, bleibt noch immer offen, ob sie eigentlich in ihrer Gänze erstrebenswert sind, ein Ideal, das verfolgt werden will. Bei den meisten Werken lässt sich das ganz klar verneinen, denn sie schildern Systeme, die totalitären Gemeinwesen näher sind als demokratischen.[8]Bei klassischen Utopien ist der Regelkatalog, der die Gesellschaft zusammenhält, besonders rigide. Eine Weiterentwicklung des Ist-Zustands soll mit allen Mitteln vermieden werden – und das ergibt Sinn, denn man hat schon das angebliche Ideal erreicht. Zum einen ist das unrealistisch, denn Gesellschaften enden nicht – sie sind einem ständigen Wandel unterzogen.[9]Zum anderen sind die Ideale einer Gesellschaft nicht zeitlos, wie sich sehr anschaulich darstellen lässt.
Sowohl Wells als auch Le Guin beschreiben Welten, die in einem einzigen Staat geeint sind – es gibt also keine Alternative, man ist stets der staatlichen Willkür ausgesetzt. Und nicht alle können herrschen. Sowohl Plato als auch Wells unterteilen in Kasten und Kategorien, zwischen denen zumindest erwachsene Menschen nicht wechseln können. Wells sieht die Tauglichkeit von Menschen als angeboren – für ihn teilt sich die Menschheit inPoietic,Kinetic,DullundBase. Nur Mitglieder der ersten beiden »Klassen« können sich der Regierung – den Samurai – anschließen. Auch bei Plato regieren ausschließlich Krieger und Wächter. Der Besitz ist größtenteils (Wells) oder vollständig (Le Guin) staatlich, Berufe werden bis zu einem bestimmten Grad nach staatlicher Notwendigkeit zugewiesen – bei Le Guins Protagonist Shevek führt das zu einer Trennung von seinen Eltern und einer Einschränkung seiner Entfaltung als Wissenschaftler. Für alle drei Werke heißt das, dass eine kleine Elite vollständig über Land und Leute herrscht. Bei Chambers werden keine Aussagen dieser Art getroffen, was auch daran liegt, dass vieles wesentlich vager bleibt als in den anderen Romanen. Vieles beruht auch auf individuellen Wünschen, doch der utopische Zustand wird vor allen Dingen dadurch bewahrt, dass alle von sich aus mit dem Zustand glücklich sind. Es scheint keinen Mord zu geben, keine Armut, keinen Hunger – aber eben auch keine unvereinbaren Ideologien.
In Wells und Le Guins Utopie haben Plansprachen die Sprachenvielfalt abgelöst. Wells Plansprache ist dabei dezidiert westlich und eurozentrisch, inspiriert von Latein, Französisch und Englisch. Individuelle Kulturen mit individuellen Sprachen sind innerhalb von Utopien unerwünscht, denn zu große Vielfalt gefährdet die Einheit. Das gilt auch für das Individuum, das in der klassischen Utopie zugunsten des Kollektivs unterdrückt wird – kulturell, in seinen Bedürfnissen und in Le Guins Fall auch intellektuell. Gerade bei Wells wird aber deutlich, dass das Individuum keine individuellen Wünsche mehr hat. Er verweist hier auf dasbreeding, suggeriert also, dass seine utopischen Bürger*innen bereits genetisch an staatliche Bedürfnisse angepasst sind in ihren Wünschen.
Frauen und Männer sind in Wells Utopia nominell gleichgestellt, aber ihr Wert wird durch ihre Möglichkeit, Kinder zu gebären, definiert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass in Wells Utopie Ehen »ablaufen« (»expire«), wenn kein Kind daraus hervorgeht. Es wird kommuniziert, dass sich »minderwertige« (»inferior«) Bürger*innen nicht fortpflanzen dürfen.
Nun könnte man argumentieren, dass es sicher Menschen gibt, die Wells oder Platon lesen und darin die perfekte Welt sehen. Der Gedanke ist nicht von der Hand zu weisen – so gibt es Forschung dazu, dass Benito Mussolini und Ayatollah Khomeini nachhaltig von PlatonsPoliteiainspiriert waren und den Text als Leitfaden für ihre eigene Herrschaft genutzt haben.[10]Das bringt uns zu der Frage, wer welche Utopien liest – und wie.
Die Makroutopie als Diskussionsansatz
Laut Krishan Kumar interessieren sich Lesende von modernen Utopien grundsätzlich nur für die Art Utopie, die ohnehin ihrem persönlichen Denken entspricht. Sie fühlen sich in ihrem Denken bestätigt und finden innerhalb der Denkschule neue Impulse. Wer nach einem Modell für einen starken Staat sucht, in dem Herrschende unbegrenzte Macht haben, wird mit Wells und Platon glücklich werden. Andererseits genießen ökologisch interessierte Menschen ökologische Utopien, Feminist*innen feministische Utopien.
Die älteren Utopien werden oft als Klassiker des Genres bezeichnet. Im Gegensatz zu einem modernen Buch, das für ein sehr enges Zielpublikum vermarktet wird, werden Klassiker breit rezipiert. So wird Wells vermutlich weniger von Menschen gelesen, die an totalitären Systemen interessiert sind, sondern eher von Fans klassischer Science Fiction. Und tatsächlich finden Lesende auch noch Themen, die vielleicht in ihrer Aufarbeitung nicht zeitgemäß sind, aber zumindest zu Diskussionen einladen.
Ernährung wäre dafür ein Beispiel. Ein wiederkehrendes Thema im Genre ist der Fleischkonsum – ebenso wie in unserer ganz realen Welt. So wird in Wells Utopia kein Fleisch mehr verzehrt, und auf Le Guins kargem Mond können keine Nutztiere gehalten werden, wodurch Protagonist Shevek nie eine Lust an Fleisch entwickelt. Bei Chambers läuft Fleischverzicht auf freiwilliger Basis. Damit haben wir bereits drei Zugänge zu diesem Thema, die gelegentlich auch in der heutigen Diskussion um Fleischkonsum zu finden sind.
Auch andere Themen bleiben aktuell: Zugang zu Bildung, Alternativen zum kapitalistischen System, Gesundheitsversorgung für alle, Verantwortung gegenüber der Natur, Recht und Strafe. Makroutopien sind als Ganzes nicht mehr erstrebenswert. In der Regel kann man ihre Entwicklung nicht nachahmen, weil sie auf fremden Welten spielen. Aber eigentlich möchte man das auch gar nicht: Die politischen Systeme sind darauf ausgelegt, sich nicht weiterzuentwickeln, was sie autoritär wirken lässt. In den oben genannten Beispielen sieht man zudem, dass Vielfalt zugunsten von Einheitlichkeit geopfert wird, damit diese Utopien funktionieren. Viele der kritischen Details sind natürlich auch der Entstehungszeit der Werke zuzuschreiben und der Tatsache, dass sie die Ideologien und Werte der Schreibenden widerspiegeln. H. G. WellsUtopiaist die Sehnsuchtsphantasie eines gebildeten Mannes, der 1905 in England gelebt hat. Dennoch bieten klassische Makroutopien Denkansätze, die diskutiert werden können, weil es Bücher sind, die im Gegensatz zu den heute sehr nischenhaft vermarkteten Werken breit rezipiert wurden und werden. Darüber hinaus bieten auch die klassischen Utopien durchaus zeitgemäße utopische Impulse – Mikroutopien in Makroutopien quasi.
Mikroutopien als Grundidee menschlichen Zusammenlebens
Rein utopisches Schreiben ist unmöglich. Entweder scheitert es am Schreiben selbst oder es scheitert am Publikum – und spätestens mit der zeitlichen Distanz neigen utopische Werke dazu, zu dystopisch-faschistischen Albträumen zu werden. Dennoch ist in Zeiten wie diesen die Forderung nach etwas Utopischem durchaus nachvollziehbar.
Eine weniger absolute, dennoch kraftvolle Form der Utopie ist die Mikroutopie. Der Begriff kommt eigentlich aus der Architektur und beschreibt die Idee, dass große architektonische Komplexe wie Städte nicht mehr utopisch sein können, es jedoch innerhalb von Städten beispielsweise kleine utopische Elemente geben kann –kommunale Gärten, Mikrobibliotheken oder digitale Plattformen, die zu Kollaboration und basisdemokratischen Entscheidungen einladen.[11]Der Begriff passt aber auch wunderbar zur Literatur, denn er heißt frei übersetzt »gute Kleinsterzählung«.
Und genau darum geht es: um gute Kleinsterzählungen. Fast jedes Werk enthält utopische Impulse, was sie jedoch nicht per se utopisch macht. Mikroutopien haben nicht den Anspruch, ganzheitlich utopisch zu sein, für jeden und zu jeder Zeit. Sie sprechen genau jene an, die zu dieser Zeit und in dieser Situation einen utopischen Impuls brauchen – und sind für andere Beiwerk einer Geschichte.
Wie eingangs formuliert: Utopisches Schreiben ist oft eine Reaktion auf Politik, die gesellschaftlichen Forderungen nicht oder zu langsam nachkommt. So gibt es seit Jahren Proteste gegen die als unzureichend empfundene Klimapolitik der Regierung(en). Diese Unzufriedenheit zeigt sich regelmäßig in Werken der Science Fiction.
Die meisten dystopischen Welten (wie die desFALLOUT-Franchises)[12]enthalten Verweise auf Recycling. Aber gerade in Werken, die sich zum Teil oder gänzlich in der Tradition des Solarpunks sehen, sind Vorschläge für ein umweltbewussteres Leben gängig. In Chambers Geschichten (auch in ihrerWAYFARERS-Reihe) finden sich etliche Verweise auf Recycling und Upcycling oder auch die bessere Verwendung von Grauwasser. Diese wären durchaus umsetzbar, weil sie keine vage Zukunftstechnologie enthalten, sondern Technologien betreffen, die wir als Gesellschaft bereits kennen, jedoch nicht oder nur wenig nutzen.
Ebenfalls oft zu finden sind Mikroutopien, die für marginalisierte Gruppen wichtig sind. Mit dem Erstarken rechter Politiken ist das Streben nach Gleichberechtigung ins Stocken geraten. In einigen Ländern werden Grundrechte, die marginalisierte Gruppen errungen haben, rückgängig gemacht (z. B. den USA und Großbritannien). Kein Wunder also, dass gerade hier nach utopischen Visionen in der Gegenwartsliteratur gesucht wird – und tatsächlich findet man gehäuft Mikroutopien, die sich dezidiert damit befassen. Ein Ausdruck für die Akzeptanz des Konzepts von Gender und einer individuellen Geschlechtsidentität in der Gesellschaft von ChambersEin Psalm für die wild Schweifendenist die Sprache, die in der Welt genutzt wird. Unaufgeregt werden neben Neopronomen auch geschlechtsneutrale Begriffe verwendet − für Dex beispielsweise »sibling« statt der mönchsordenstypischen Titel »brother« und »sister«. Auch bei Martha Wells eigentlich eher dystopischerMURDERBOT-Reihe gibt es Neopronomen und verschiedene Beziehungsformen. Diese Mikroutopien stellen eine Einladung für das Überdenken der eigenen Sprache dar, sind aber zudem problemlos umsetzbar. Für die, die sich damit befassen, sind sie sichtbar, sind jedoch zugleich nicht so dominant und handlungsweisend wie beispielsweise H. G. Wells utopisches Gesamtkonzept.
Große utopische Weltkonzeptionen sind statisch, meist problematisch und verlieren schnell ihre Aktualität. Mikroutopien haben nicht den Anspruch, alles zu verändern – sie haben den Anspruch, eine konkrete Sache für eine konkrete Gruppe besser zu machen. Es sind kleine Ziele, auf die man hinarbeiten kann – auch in ansonsten dystopischen Welten. Das macht sie für die, die betroffen sind, attraktiv. Und die Aussage dahinter ist tröstlich: Rein utopisches Schreiben mag unmöglich sein, weil nicht für jeden alles gut ist oder wird, aber es gibt Dinge, auf die wir realistisch hinarbeiten können – Dinge, die die Welt für uns ein wenig besser machen.
[1]Das Interview kann hier nachgelesen werden:https://www.deutschlandfunk.de/die-ideen-sind-da-doch-wir-noch-nicht-so-weit-warum-utopien-100.html.
[2]Vgl. hierzu auch den Artikel von Alessandra Reß in dieser Ausgabe von DAS SCIENCE FICTION JAHR.
[3]Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Untergliederung. Die vorliegende stammt aus Lyman T. Sargents Aufsatz »Three Faces of Utopianism Revisited« (erschienen 1994 in UTOPIAN STUDIES, Vol. 5, No 1, S. 1−37).
[4]Vgl. Gregory Claeys: »News from Somewhere: Enhanced Sociability and the Composite Definition of Utopia and Dystopia«, in: HISTORY 98 (330), 2013.
[5]Vgl. Krishan Kumar: »The Ends of Utopia«, in: NEW LITERARY HISTORY 41, Nr. 3, 2010, S. 549−569.
[6]Vgl. Peter Fitting: »A Short History of Utopian Studies«, in: SCIENCE FICTION STUDIES 36 (1), 2009, S. 121−131.
[7]H. G. Wells:A modern Utopia, Zinc Read 2023, S. 6. Vgl. Ders.:Ein modernes Utopia, Edition Phantasia, 2021 (Übersetzung von Joachim Körber), S. 14-15: »Was uns ganz entschieden vorschwebt, ist nach sämtlichen Maßstäben, die zwischen Gegenwart und naher Zukunft existieren mögen, nicht unmöglich, auch wenn es uns in hohem Maße undurchführbar erscheint.«
[8]Vgl. Vivien Greene: »Utopia/Dystopia«, in: AMERICAN ART 25, Nr. 2, 2011, S. 2−7.
[9]Vgl. Northrop Frye: »Varieties of Literary Utopias«, in: DAEDALUS 94, Nr. 2, 1965, S. 323−347.
[10]Vgl. Alina Utrata: »A Greek and a Persian: Plato’s Influence on Ayatollah Khomeini«, in: AVICENNA 5, Nr. 2, 2015.https://issuu.com/avicenna-stanford-journal/docs/avicenna_5.2_winter_2015_final.
[11]Vgl. John Wood:Design for micro-utopias: making the unthinkable possible. Routledge, 2016.
[12]Das FALLOUT-Franchise umfasst mehrere Videospiele, Brettspiele, Comics, Webcomics, ein Kochbuch, eine Serie und vieles mehr. Es ist in einer retrofuturistischen Welt angesiedelt, in der die Menschen Atomkraft so sehr in ihren Alltag integriert haben, dass sie sogar ihre Autos mit kleinen Reaktoren betreiben. Durch einen Atomangriff wird Nordamerika zerstört – die Geschichten aus dem Universum spielen im postapokalyptischenWasteland.
Aiki Mira Utopische Körper
Africanfuturism und Queer*SF als utopische Praxis
Utopien sind ohne Körper nicht vorstellbar: Unsere Körper schreiben unsere Utopien, die wiederum neue, vielleicht sogar utopische Körper hervorbringen. Während jedoch Utopien scheinbar unerreichbare, idealisierte »Nicht-Orte«[1] bleiben, scheinen unsere Körper sehr konkrete Orte zu sein. Wie Michel Foucault in seinem Radiovortrag »Utopische Körper« aus dem Jahr 1966 feststellt, können wir unserem Körper nie entkommen, ihn zugleich aber nie vollständig sehen oder erfassen. Foucault beschreibt ihn daher als Ort des Paradoxen – sichtbar und unsichtbar, greifbar und unzugänglich, real und imaginär: »Der Körper ist der Nullpunkt der Welt, der Ort, an dem Wege und Räume sich kreuzen.« (Foucault, 2005, S. 34). Ein Körper ist also nicht nur ein Ort, sondern ein Raum, durch den andere Räume (und Zeiten) erfahrbar werden, und damit auch das erste Medium jeder Utopie, weil er sich selbst nie ganz gehört und immer auch anders gedacht werden kann.
Africanfuturism und Queer*SF
Suche ich in der Science Fiction nach Körperkonzepten mit emanzipatorischem und utopischem Potenzial, finde ich diese insbesondere bei zwei aktuellen Strömungen: Africanfuturism und Queer*SF. Beide Bewegungen sind zudem verbunden mit körperlichen Erfahrungen von Ausschluss, Marginalisierung und Gewalt. Das Bedürfnis, sich besonders intensiv mit anderen, vielleicht sogar utopischen Körperkonzepten zu beschäftigen, nach alternativen Zukünften, Identitäten und Körpern zu suchen, wird hier existenziell.
Während der Africanfuturism Science Fiction mit afrikanischen Erfahrungen, Körperemanzipation und Zukunft verbindet, um neue, nicht-westliche Narrative und Poetiken zu schaffen, sucht Queer*SF jenseits des Patriarchats nach Körperemanzipation sowie nach queeren Schreib- und Erzählweisen. Anhand ausgewählter[2] Beispiele möchte ich exemplarisch zeigen, dass Körper nicht nur für beide Bewegungen eine zentrale Rolle spielen, sondern beide sich in ihren Visionen überschneiden und dabei als utopische Praxis verstanden werden können.
Utopische Körper im Africanfuturism: vielfältig, hybrid, verwandelbar
1994 definierte Mark Dery (1994, S.180) im Gespräch mit dem Autor Samuel R. Delany den damals schon gängigen Begriff Afrofuturismus zum ersten Mal als »spekulative Fiktion, die afroamerikanische Themen behandelt und afroamerikanische Belange im Kontext der Technokultur des 20. Jahrhunderts thematisiert.«[3] In seinem einflussreichen Essay »Further Considerations on Afrofuturism« (2003) analysiert Kodwo Eshun die Rolle von Afrofuturismus als eine Praxis der Gegen-Zukunft (counterfuture), die alternative Zukünfte und Identitäten entwirft, um koloniale und rassistische Narrative zu überwinden. Eshun (2003, S. 288) beschreibt die Körper der afrikanischen Diaspora als gezeichnet von Entwurzelung, Versklavung und Entmenschlichung – und damit als erste moderne Körper. Der Begriff Körper ist hier nicht nur biologisch, sondern historisch und politisch aufgeladen – ein Ort, an dem sich die Gewalt der Moderne einschreibt. Utopie beginnt bei Eshun (S. 288) mit der Anerkennung dieser Körper als Archive des Traumas. Der Essay öffnet mit einer spekulativen Szene: Archäolog*innen aus der Zukunft rekonstruieren unsere Gegenwart anhand von »leaking discs« und »ruined documents«. Diese Zukunftsarchäologie ist auch eine Körperarchäologie, denn was sie rekonstruieren, sind verlorene, verdrängte, transformierte Körpergeschichten. Im Afrofuturism, wie er von Eshun (S. 301) verstanden wird, geht es also nicht darum, westliche Fortschrittsnarrative weiterzuführen, sondern Schwarze[4] Diaspora-Geschichten wiederherzustellen. Die Autorin Nnedi Okorafor entwickelte daran anschließend den Begriff Africanfuturism, der im Unterschied zum Afrofuturism »direkter in afrikanische Kultur, Geschichte, Mythologie und Sichtweise verwurzelt ist, sich von da dann in die Schwarze Diaspora verzweigt, und den Westen nicht bevorzugt oder in den Mittelpunkt stellt.«[5] Oder noch persönlicher formuliert sie im Jahr 2024 auf ihrem Blog:
Ich habe jahrelang den Leuten erzählt, dass ich Africanfuturism schreibe. Ich schreibe nicht und habe nie ›Afrofuturism‹ geschrieben, ein reduktionistisches und amerikazentriertes Etikett, das ohne Rücksicht auf alles Schwarze und Spekulative geklebt wird.[6]
Im Folgenden möchte ich drei Romane und ihre Körperkonzepte vorstellen, die in afrikanischen Kulturen verwurzelt sind und dem Africanfuturism, so wie Okorafor ihn versteht, zugeordnet werden können.
Beginnen möchte ich mit dem Roman Who Fears Death (Wer den Tod fürchtet) von ebendieser Autorin, ein Science-Fantasy-Roman aus dem Jahr 2010, der sowohl mit dem World Fantasy Award als auch mit dem Carl Brandon Kindred Award ausgezeichnet wurde. Der Roman thematisiert körperliche Gewalt, Rassismus, Sexismus und Transformation und spielt in einem postapokalyptischen Afrika, in dem die hellhäutigen Nuru die dunkelhäutigen Okeke unterdrücken. Die Protagonistin Onyesonwu (Igbo für »Die den Tod fürchtet«) ist eine Ewu, ein Kind, das durch Vergewaltigung gezeugt wurde, als ein Nuru-Mann sich an ihrer Mutter, einer Okeke-Frau, gegen ihren Willen vergriff.
Ewu ist also mehr als nur eine Bezeichnung, es ist ein Symbol für die körperliche Gewalt, die Krieg hervorbringt, insbesondere die Kriegsstratetgie der Vergewaltigung. Die Protagonistin Onyesonwu wird mit den Vorurteilen und Ablehnungen ihrer eigenen Gemeinschaft konfrontiert. Zugleich besitzt ihr Körper besondere gestaltwandlerische Fähigkeiten, mit denen sie lernen muss, umzugehen. Sobald sie erwachsen ist, macht sie sich auf die Suche, um ihren zauberkundigen Vater Daib mit den eigenen magischen Kräften zu besiegen. Der weibliche Schwarze Körper wird also nicht darauf reduziert, ein Ort des Leids zu sein. Stattdessen wird er auch als Quelle von Magie und Widerstand erzählt. Das utopische Potenzial liegt dabei in der körperlichen Transformation der Protagonistin in ein Kponyungo (mythischer, fliegender Drache), wodurch ihr Körper Kategorien wie Mensch, Tier, Mythos kollabieren lässt.
Das zweite Beispiel, Tlotlo Tsamaases Womb City, nominiert für den Locus Award, kann wie Who Fears Death als ein feministischer Roman über Körper, Kontrolle und Widerstand gelesen werden. In Womb City ist der Körper kein privater Ort mehr, sondern ein staatlich kontrolliertes Objekt. Die Protagonistin Nelah lebt in einem futuristischen Botswana, in dem Körper überwacht, bewertet und sogar getauscht werden. Frauenkörper sind dabei besonders betroffen: Sie werden mit Mikrochips versehen, die Gedanken, Bewegungen und sogar Erinnerungen überwachen. Tlotlo Tsamaase (2023), selbst Motswana, sagt über ihre Protagonistin: »Ich wollte eine Frau sehen, die nicht stirbt, eine Motswana-Frau, die es schafft ohne Schäden an der Psyche oder am Selbst.« Der Roman zeigt körperliche Unterdrückung und am Ende Widerstand als radikale und auch blutige körperliche Transformation. Nelah wird zu einem postgeschlechtlichen, hybriden Wesen, das Kategorien wie Maschine, Mensch, Geister/Spiritualität sprengt. Womb City kann damit ähnlich wie Who fears Death als zugleich africanfuturistisch und feministisch gelesen werden. Aufgrund der postgeschlechtlichen Körperkonzepte und der subtil queeren Nebenfiguren kann der Roman zudem als queer*feministisch verstanden werden.
Während in Womb City queere Identität in Nebenfiguren nur angedeutet wird, benennt The Prey of Gods(Die Beute der Gött*innen) von Nicky Drayden nicht nur queere Identitäten, sondern auch queeres Begehren, hier werden Africanfuturism und Queer*SF miteinander verwoben. Der Roman gewann den Compton Crook Award und wurde sowohl für den Lambda Literary Award für LGBTQ SF/F/Horror als auch für den Locus Award in der Kategorie Bestes Debüt nominiert. Neben Queerness behandelt der Roman auch Krankheit und Be_hinderung[7]: Multiple Sklerose und chronische Schmerzen. Drayden schreibt ein futuristisches Südafrika mit queeren und Schwarzen Figuren. Gött*innen, KI und genetische Modifikation treffen hier aufeinander. Menschen entwickeln dabei übernatürliche Kräfte, und die Grenzen zwischen ihnen, Maschinen und Gottheiten verschwimmen. Körper werden zu wandelbaren, hybriden Entitäten. Der Roman feiert, ähnlich wie die Theoretikerin Donna Haraway in ihrem Manifest für Cyborgs (1995), verschiedene körperliche Mischformen: Mensch und Maschine, Mensch und Tier, Mensch und Gottheit. Das utopische Potenzial dieser Vorstellung liegt darin, dass Identität und Körper dadurch nicht fixiert, sondern fluid werden – eine Absage an koloniale und binäre Körperbilder und eine zugleich africanfuturistische und queere Vision von Körpern jenseits westlicher Normen.
Den drei Romanen ist gemeinsam, dass sie nicht nur in einem zukünftigen Afrika spielen, sondern dass afrikanische Gottheiten, spirituelle Praktiken und mythologische Motive zentral sind. Hier werden Zukünfte entworfen, in denen Körper nicht mehr nur normiert, unterdrückt oder beschädigt sind, sondern auch vielfältig, hybrid und verwandelbar sein dürfen. Wir erfahren dadurch, wie utopische Körper aussehen könnten, wenn sie nicht mehr länger durch westliche, koloniale oder patriarchale Systeme geformt sind, sondern durch poetische Visionen von Freiheit und Selbstbestimmung. Das Utopische an den genannten afrikanischen SF-Werken liegt also weniger in der Darstellung futuristischer Technologien oder Gesellschaften, sondern vor allem in der radikalen Neugestaltung von Körpern, Identitäten und Machtverhältnissen.
Utopische Körper in Queer*SF: vielfältig, transmedial, poetisch
Ähnlich wie der Africanfuturism entwirft auch Queer*SF Zukünfte, in denen körperliche Selbstbestimmung und Veränderung ermöglicht wird. Queer*SF verstehe ich dabei als eine Strömung, die nicht nur queere Körper und Beziehungen, sondern auch queere Erzähl- und Schreibweisen erforscht.[8] So wie viele andere auch versuche ich, mit Essays und Romanen selbst etwas zu dieser Bewegung beizutragen. Queer*SF als ein offenes, partizipatives Projekt ist im deutschsprachigen Raum zudem verbunden mit anderen Projekten wie dem der Progressiven Phantastik (James A. Sullivan, Judith Vogt).[9]
Zentrale Vorgänger*innen für Queer*SF sind für mich neben James Tiptree Jr. insbesondere Samuel R. Delany. Seinen Roman Trouble on Triton. An Ambiguous Heterotopia von 1976 – sowohl für den Nebula Award als auch für den James Tiptree Jr. Award[10] nominiert – verstehe ich nicht nur als ein zentrales Science-Fiction-Werk, sondern auch als eine frühe trans*feministische Utopie und damit zentral für das Projekt der Queer*SF. In ihrem Beitrag »Recent Feminist Utopias« (1995) stellt Joanna Russ fest, dass der Roman immer wieder von anderen feministischen Utopien abweicht. Während sie die anderen Utopien als klassenlose Gesellschaften identifiziert, die ohne Regierung quasi stammesbezogen strukturiert und dabei ökologisch orientiert sind, erkennt sie Delanys Utopie als eine urbane Klassengesellschaft, die zudem viel diverser ist, was Sexualitäten und Körpertransformationen betrifft.[11] Kein Wunder: Seiner Zeit weit voraus kann Trouble on Triton im Rückblick als ein frühes Beispiel queer*feministischer SF gelesen werden, die eben nicht mehr nur binäre Identitäten, männlich vs. weiblich, verhandelt, sondern auch trans* Körper und trans* Identitäten erforscht. Der Roman spielt in einer urbanen Gesellschaft auf Triton, einem Mond von Neptun, wo Technologien eine schnelle und einfache Veränderung von Körpertyp, Geschlecht, Rasse und sexueller Orientierung ermöglichen. Die Figur Sam ist zum Beispiel ein Schwarzer Mann, der früher eine weiße[12] Frau war. Triton wird dadurch zu einer radikalen Utopie der Selbstgestaltung. Doch Delany zeigt auch: Freiheit allein garantiert kein Glück. Die Hauptfigur Bron, die einen männlichen Chauvinismus des 20. Jahrhunderts verkörpert, bleibt auf dem feministischen, nicht-patriarchalen Triton ein Außenseiter. Als Bron schließlich erkennt, dass es unwahrscheinlich ist, jemals eine Frau zu finden, die seine sexistische Definition von Weiblichkeit verkörpert, beschließt er, selbst zu dieser Frau zu werden. Anhand der Figur Bron verhandelt der Roman die Grenzen der Utopie von Triton. Der Untertitel des Romans An ambiguous heterotopia, in Anlehnung an Ursula K. Le Guins (2017) The Dispossesed. An ambiguous utopia und Foucaults Begriff der Heterotopie,[13] verweist darauf, dass die Gesellschaft von Triton eben nicht perfekt ist, sondern ein Experimentierfeld für Differenz.
Als weiteres Beispiel für Queer*SF möchte ich den Roman der trans*feministischen Autorin Sabrina Calvo vorstellen, deren Werke im deutschsprachigen Raum noch wenig bekannt sein dürften, einfach weil sie bisher noch nicht übersetzt worden sind. Calvos Schreiben begegnete mir zum ersten Mal in dem Kurzgeschichtenband SOLEIL•S (2025)[14], für den ich neben Nnedi Okorafor, Peter Watts, Sabrina Calvo und anderen eine Kurzgeschichte beitragen durfte. Seitdem lässt mich Calvos trans*futuristische Poetik nicht mehr los. Ihr Roman Toxoplasma aus dem Jahr 2017 wurde sowohl mit dem Prix Rosny aîné als auch mit dem wichtigsten französischen Phantastik-Preis ausgezeichnet, dem Grand Prix de l’Imaginaire. Vom Verlag wird der Roman als Proto-Cyberpunk bezeichnet, ich ordne ihn zudem der Queer*SF zu. Die Protagonistin Nikki Chanson, eine aus Frankreich geflohene Katzendetektivin und Expertin für miese Z-Filme, sitzt in einer militärisch belagerten anarchistischen Kommune in Montréal fest und beschließt, nach dem Waschbärmörder zu suchen. Während sie sich noch fragt, wer das sein könnte, schließt sich ihr eine Hackerin namens Kim an.
Der Roman reichert Dialoge mit einem Montréaler Dialekt an, mit Wörtern aus dem englischen und quebecer Idiomen, um uns das Eintauchen in die revolutionäre Kommune sprachlich erleben zu lassen. Die anarchistische Kommune ist jedoch keine richtige Utopie:
Es gibt keinen Raum mehr, alle Gebiete sind zu Landkarten geworden. Alles ist kolonisiert. Wir haben die anderen kolonisiert, ihre Gefühle, ihre Gedanken. Und nun auch ihre Seele. Alles ist zu einem Artefakt geworden. (eigene Übersetzung, Calvo 2017: S. 300)
Auch wenn es scheinbar keine Utopien mehr gibt, bleibt ein queer*utopisches Begehren:
[…] und vielleicht gibt es sogar eine Welt dazwischen, einen Ort wie im Herzen einer Welle, wo alles still ist und wir die Welt erschaffen können, die wir wollen, in der wir in Frieden leben können, weit weg von all den Arschlöchern, die uns massakrieren wollen, weil wir anders sind oder weil sie unsere Körper kontrollieren wollen. (eigene Übersetzung, Calvo 2017:S. 360)
Dieses utopische Begehren äußert sich immer wieder konkret am Körper, der nach Zuflucht sucht vor queer*feindlicher Gewalt. Im postrevolutionären, anarchistischen Montréal ist allerdings nichts stabil: Nikkis Wahrnehmung ist durchzogen von VHS-Halluzinationen, Erinnerungen, Medienfragmenten und Begehren. Mithilfe der verschiedenen Medienfragmente wie Radiosendungen, Videos, Computergespräche, ändert Calvo häufig ihren Stil, was die Erzählung zusätzlich destabilisiert.
In dem Roman verbinden sich Cyberpunk, Anarchismus, queeres Begehren und Körpertransformation zu einer spekulativen Vision jenseits normativer Ordnungen. Queere Körper werden utopisch, weil sie fluid, hybrid, halluzinatorisch werden – transmedial und spekulativ: eine Projektionsfläche für Begehren. Die Beziehung zwischen Kim und Nikki wird dabei nicht durch Besitz oder Normen, sondern durch körperliche Zärtlichkeit, Spiel und Widerstand definiert. Eine queere Zärtlichkeit (tendresse queer), die sich einer kaputten Welt entgegenstellt. Beziehung ist hier also nicht romantisch-normativ, sondern utopisch-solidarisch – ein Überleben in der Katastrophe. Im Interview berichtet Calvo (2025), dass sie Neologismen und genderinklusive Sprache verwendet, dafür aber keine Systematik entwickelt hat, sondern:
Mir gefällt die Idee, die Linguistik zu einem sehr flexiblen Spielfeld zu machen. Ich bin keine Linguistin, ich weiß nicht, wie man aus Sprache eine Welt erschafft, real oder imaginär, aber ich kann aus einer Traumwelt eine Sprache erschaffen. (eigene Übersetzung, Calvo: 2025).
Indem sie aus einer Traumwelt eine Sprache erschafft, werden queere Körper als chaotische, schöpferische Räume erlebbar – nicht als normierte Objekte, sondern als Prozesse der Verwundung und Verwandlung:
Zusammengerollt in der Dusche, ihr Rücken vor Angst gebrochen. Der Duschkopf zwischen ihren Schenkeln, wo Hitze schürt, wo alles Feuer fängt. […] Sie lacht in sich hinein, in die Intimität dieses lebendigen Wassers und flüstert sich schreckliche Geheimnisse zu, Visionen von entwurzelten Bäumen, von unmöglichem Tanz und ungesundem Feuer. (eigene Übersetzung, Calvo 2017: S. 104)
So wie ihre Sprache werden auch die Körper eher fragmentarisch, poetisch, traumartig/halluzinatorisch, sowohl verwundbar als auch transformierbar mit einem fluiden Begehren, das sich auch in der Verwischung von Realität und Imagination zeigt. Über ihr Schreiben sagt Calvo: »Ich arbeite mit Körpern, die nicht festgelegt sind, die sich verändern, die etwas anderes erzählen, als von ihnen erwartet wird.«[15]. Darin zeigt sich eine Vorstellung von ihnen als poetische Konstruktionen, die im Widerstand stehen zu normierten Erwartungen. Sowohl sprachlich als auch inhaltlich lese ich Toxoplasma daher so, als ob hier eben nicht Utopie das Ziel ist, sondern eine spielerische verkörpernde Sprache und damit eine Form von utopischer Praxis. Durch diese sehr eigene Sprache und Erzählweise lese ich den Roman als ein queeres, poetisches und politisches Werk, das utopische Körper nicht nur beschreibt, sondern sprachlich performt.
Neben einem afrofuturistischen (Delany) und einem weißen, nicht-US-amerikanischen Beispiel (Calvo) möchte ich zum Schluss noch ein africanfuturistisches Beispiel für Queer*SF vorstellen. Wie bereits The Prey of Gods von Nicky Drayden zeigt, lassen sich Africanfuturism und Queer*SF sehr gut miteinander verbinden. Ein weiteres Beispiel dafür ist Lagoon (2016, Lagune) von der bereits erwähnten Autorin Nnedi Okorafor, nominiert für den James Tiptree Jr. Award. Der Roman spielt in der pulsierenden Metropole Lagos und nutzt menschliche, tierische und spirituelle Erzählstimmen, um zwischen den Perspektiven Schwarzer Menschen und Schwarzer Außerirdischer zu wechseln. Mehrere Figuren[16] stellen binäre Geschlechteridentität infrage, am stärksten vielleicht die außerirdische Gestaltwandlerin Ayodele, die als »Frau, Ding, was auch immer sie ist« (Okorafor: 2016, S.86) beschrieben wird. Ihre Genderfluidität hat zudem konkrete Auswirkungen auf eine queere Studentenorganisation namens Black Nexus, die sich nur einmal im Monat heimlich trifft. Durch die Ankunft von Ayodele fühlt die Gruppe sich ermutigt, sich zum ersten Mal öffentlich zu outen. Denn in Ayodele erkennen sie nicht nur eine queere Verbündete, sondern auch eine revolutionäre Kraft, die eine queer*feindliche Gesellschaft verändern kann.
Der Roman zeigt, wie queere Körper Hass und Gewalt ausgesetzt sind, eröffnet jedoch auch utopische Visionen, in denen verschiedene Körper miteinander kooperieren. Okorafor fusioniert dabei afrikanische Mythen und vielstimmige Erzählweisen: Eine mythische Spinne namens Udide Okwanka erzählt die Geschichte, und das auch noch aus mehreren Perspektiven. Zudem nutzt die Autorin Pidgin-Englisch und macht aus ihrer Erzählung eine filmische, indem sie das Glossar des Pidgin-Englisch mit der Überschrift »Special Bonus Features« (Bonusmaterial) neben den Abschnitt »Deleted Scene« (Gelöschte Szene) setzt, was an Filmmaterial erinnert, das aus der endgültigen Fassung entfernt wurde. Okorafors Schreiben betont wie ein Film visuelle Elemente und bleibt im gesamten Buch lautmalerisch wie ein Comic. Nur wenige Seiten vergehen bis zum nächsten »PLASH!« oder »BAM! BAM!«, und das Eröffnungskapitel selbst trägt den Titel »MUH!«. Dadurch setzt sich der Roman über literarische Normen hinweg und entwickelt eine eigene queer*africanfuturistische Poetik, die sich wie bei Calvos als transmedial identifizieren lässt. Die Entgrenzung des Körpers, unser erstes Medium für Utopie, geht einher mit medialen Entgrenzungen.
Utopische Körper als utopische Praxis
In Ursula K. Le Guins preisgekrönter Kurzgeschichte »The Ones Who Walk Away From Omelas« (»Die von Omelas weggehen«) aus dem Jahr 1973 wird ein einzelnes Kind in einem Raum unter der Stadt im Schmutz und in der Dunkelheit gefoltert, um für das Glück aller anderen zu bezahlen. Der versteckte, unsichtbar gemachte, kontrollierte und Gewalt ausgesetzte Körper kann als Metapher gelesen werden für Kolonialismus und Patriarchat, für die scheinbare Utopie für wenige, die auf dem Leid vieler Körper basiert, die durch Rassismus, Sexismus, Ableismus, Queer*Feindlichkeit unlebbar gemacht werden. Le Guins Kurzgeschichte zeigt, dass Utopien auch exklusiv und gewaltsam sein können. Der gefolterte Körper des Kinds steht dabei für einen konkreten Ort von Trauma, von Gewalt und von Kontrolle. Gerade für Strömungen wie Africanfuturism, Afrofuturism und Queer*SF, die eben auch aus Perspektiven körperlicher Marginalisierung, Diskriminierung und Gewalt schreiben, beginnt die Suche nach dem Utopischen dann nicht mit der Suche nach der großen Utopie, sondern mit der Suche nach den vielen unsichtbar gemachten Körpern, um diese aus den Strukturen der Unterdrückung zu befreien.
Statt der Idee einer abgeschlossenen oder »perfekten« (Tech-)Utopie hinterherzujagen, geht es in den vorgestellten Romanen um das Erzählen von vielfältigen, utopischen und monsternden[17] Körpern. Utopische Visionen werden hier wortwörtlich verkörpert durch vielfältige, verwandelbare, befreite, aber auch durch fluide, hybride, transmediale Körper, die viele bleiben. Denn der Körper ist unser Medium der Zukunft und der Utopie (Foucault), ein Raum, der zugleich unfassbar und ständig in Bewegung bleibt.
Die Beispiele zeigen auch: Africanfuturism und Queer*SF überschneiden sich in ihrer Vision von utopischen Körpern als nicht fixiert, sondern verhandelbar, nicht normiert, sondern vielfältig, nicht unterworfen, sondern ermächtigt. Beide Bewegungen nutzen Science Fiction, um sich Zukünfte vorzustellen, in denen Körper wieder lebbar werden in ihrer Differenz, Fluidität und Widerständigkeit.
Utopische Körper in Africanfuturism und Queer*SF sind also keine »perfekten«, »fertigen« oder »idealen« Körper, sondern solche, die sich der Unterdrückung verweigern, sich verwandeln und neue Welten möglich machen. Zugleich werden diese Körper hier neu erzählt, transformiert, befreit – all das entspricht einer utopischen Praxis, die sich gegen normierte (westliche oder patriarchale) Zuschreibungen stellt. Africanfuturism und Queer*SF lassen sich folglich nicht nur als Bewegung, sondern auch als utopische Praxis begreifen, die Körper jenseits kolonialer und patriarchalischer Narrative als Möglichkeitsräume neu schreibt.
Körper sind dann immer zugleich utopische wie gefährdete Räume.
Quellen
Calvo, Sabrina (2017): Toxoplasma. Clamecy: La Volte.
Calvo, Sabrina (2021): »Podcast-Interview«. Online: https://archive.org/details/podcast-sabrina-calvo-mixage-final [Letzter Zugriff: 25.05.2025].
Calvo, Sabrina (2025): »Interview de Sabrina Calvo«. Online: https://leschroniquesduchroniqueur.wordpress.com/2025/03/03/interview-de-sabrina-calvo/ [Letzter Zugriff: 25.05.2025].
Delany, Samuel R. (1996) [1976]. Trouble on Triton: An Ambiguous Heterotopia. Wesleyan University Press.
Dery, Mark (1994): »Black to the future: Interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, and Tricia Rose., opens a new window«. Online: https://www.uvic.ca/victoria-colloquium/assets/docs/Black%20to%20the%20Future.pdf [Letzter Zugriff: 25.05.2025].
Drayden, Nicky (2017): The Prey of Gods. New York: Harper Collins.
Eshun, Kodwo (2003):»Further Considerations on Afrofuturism«. In: CR: THE NEW CENTENNIAL REVIEW 3, no. 2: 287–302.
Foucault, Michel (2005) [1966]: Die Heterotopien. Der utopische Körper. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Haraway, Donna (1995): »Ein Manifest für Cyborgs. Feminismus im Streit mit den Technowissenschaften«. In: Haraway, Donna: Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen. Frankfurt a. M. und New York. S. 33–72.
La Volte & Mudac (2025): SOLEIL•S : 12 Fictions Héliotopiques. Clamecy: La Volte.
Le Guin, Ursula K. (2017): Freie Geister. Berlin: Fischer Tor.
Le Guin, Ursula K. (1973): »The Ones Who Walk Away From Omelas« Online: https://www.scribd.com/document/809446455/Omelas [Letzter Zugriff: 25.05.2025].
Okorafor, Nnedi (2014): Lagoon. New York: Saga Press.
Okorafor, Nnedi (2018): Who Fears Death. New York: Harper Collins.
Okorafor, Nnedi (2019): »Africanfuturism Defined«. Online: https://nnedi.blogspot.com/2019/10/africanfuturism-defined.html?q=africanfuturism [Letzter Zugriff: 25.05.2025].
Okorafor, Nnedi (2024): »It’s Bigger Than a Label …«. Online: https://nnedi.blogspot.com/2024/09/its-bigger-than-label.html?q=africanfuturism [Letzter Zugriff: 25.05.2025].
Russ, Joanna (1995): »Recent Feminist Utopias«. In: To Write like a Woman. Essays in Feminism and Science Fiction. Bloomington und Indianapolis: Indiana University Press.
Tsamaase, Tlotlo (2023): »When the Sensibility of Art Meets the Pragmatism of Science: A Conversation with Tlotlo Tsamaase«. Online: https://worldliteraturetoday.org/blog/interviews/when-sensibility-art-meets-pragmatism-science-conversation-tlotlo-tsamaase [Letzter Zugriff: 25.05.2025]
Tsamaase, Tlotlo (2024): Womb City. New York: Erewhon Books.
[1]Altgriechisch οὐou »nicht« und τόπος tópos »Ort«, zusammengeschrieben: »Nicht-Ort«.
[2]Die Auswahl der Beispiele ist persönlich und nicht repräsentativ. Ziel ist im besten Fall, neue Verbindungen herzustellen zwischen Black SF, Queer*SF, & Non-USA-SF.
[3]Eigene Übersetzung.
[4]»Schwarz« wird hier und im Folgenden großgeschrieben, um zu zeigen, dass es sich um eine von Menschen selbst gewählte Bezeichnung handelt, die ihre soziale und politische Position in der Gesellschaft beschreibt.
[5]Okorafor (2019), eigene Übersetzung. Online: »Africanfuturism Defined«. Online:https://nnedi.blogspot.com/2019/10/africanfuturism-defined.html?q=africanfuturism[Letzter Zugriff: 25. 05. 2025].
[6]Okorafor (2024), eigene Übersetzung.»It’s Bigger Than a Label …«. Online:https://nnedi.blogspot.com/2024/09/its-bigger-than-label.html?q=africanfuturism[Letzter Zugriff: 25. 05. 2025].
[7]Be_hinderung ist eine bewusst gewählte, politisch und sprachkritisch motivierte Schreibweise. Sie macht deutlich, dass Behinderung nicht (nur) eine individuelle Eigenschaft ist, sondern durch gesellschaftliche Barrieren, Normen und Ausschlüsse entsteht. Menschen werden behindert durch Architektur, Sprache, Vorurteile, Institutionen.
[8]Siehe Aiki Mira (2022): Was ist Queer*SF? Mehr als nur Science Fiction. Online:https://www.tor-online.de/magazin/science-fiction/was-ist-queersf-mehr-als-nur-science-fiction. [Letzter Zugriff: 25.05.2025].
[9]Eine Phantastik, die wie Queer*SF bewusst gegen Rassismus, Sexismus, Ableismus und Queer*Feindlichkeit anschreibt. Siehe dazu den Beitrag von James A. Sullivan und Judith Vogt (2020): Lasst uns progressive Phantastik schreiben. Online:https://www.tor-online.de/magazin/fantasy/lasst-uns-progressive-phantastik-schreiben[Letzter Zugriff: 25.05.2025].
[10]Ein US-amerikanischer Science-Fiction- und Fantasy-Preis, der speziell an Werke vergeben wird, die das Verständnis von Geschlecht erweitern. 2019 wurde der Preis umbenannt in Otherwise Award.
[11]Russ (1995, S. 146) erklärt sich das damit, dass Delany ein Mann ist: »(…) der einzige männliche Autor in der Gruppe schreibt aus einer impliziten Freiheit heraus« (eigene Übersetzung).
[12]Da es bei dem Begriff »weiß« nicht um eine Hautfarbe geht, sondern um ein soziales und kulturelles Konstrukt, wird es hier kursiv geschrieben.
[13]Heterotopien sind nach Foucault (2005) konkrete Orte wie Gefängnisse und Krankenhäuser, die eigenen Normen unterliegen und dadurch als anders wahrgenommen werden. Sie können als realisierte Utopien verstanden werden, die der Gesellschaft gegenüberstehen.
[14]Eine Zusammenarbeit zwischen dem Verlag La Volte und dem Mudac: Musée de Design et d’Arts Appliqués Contemporains, im Rahmen der Biennale Internationale du Soleil.
[15](eigene Übersetzung, Calvo: 2021, Podcast-Interview) Online:https://archive.org/details/podcast-sabrina-calvo-mixage-final[Letzter Zugriff: 25.05.2025].
[16]Neben Aliens gibt es auch menschliche trans*feminine Figuren wie z. B. Tall.
[17]Monstern wird hier als Verb genutzt, das die monsterhaften Transformationen inWho fears DeathundWomb Cityals aktive und widerständige Transformationen versteht.
Matthias Fersterer, janas gebauer, Eugen Pissarskoi Unleashing Fantasy for Transformation
Mit Spekulativer Fiktion am Utopischen arbeiten
Wir imaginieren alternative Zukünfte, …
Der folgende Beitrag nimmt vermutlich eine ungewöhnliche Perspektive in diesem Band ein: Wir schreiben nicht vornehmlich über das Utopische in der Spekulativen Fiktion, sondern darüber, wie SF zum Utopisieren genutzt werden kann, um gemeinsam Zukünfte zu imaginieren – Zukünfte, die angesichts der tiefgreifenden Veränderungen unserer Lebensgrundlagen ein »gutes Leben für alle« ermöglichen. Dabei geht es uns nicht um individuelle Annehmlichkeiten, sondern um eine solidarisch sorgende Lebensweise, die menschliche wie nichtmenschliche, heutige wie künftige Lebensbedürfnisse umfasst und ein für alle ernsthaft wünschenswertes, gerechtes Leben anstrebt.
Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sich seit Langem in verschiedenen akademischen, publizistischen und aktivistischen Zusammenhängen für eine sozial und ökologisch gerechte gesellschaftliche Transformation engagieren. Vor sieben Jahren entdeckten wir unsere gemeinsame Begeisterung für die Autorin Ursula K. Le Guin (1929–2018) – und unsere Lust an SF und Utopien. Daraus entstand die Idee, 2019 auf einer Konferenz zur »Großen Transformation« akademische Routinen zu durchbrechen und einen Raum zum Imaginieren und Utopisieren jenseits klassischer Vortragsformate anzubieten: Wenn die Inhalte eine tiefgreifende Neuorientierung verlangen, dann sollten auch die Formen anders gedacht werden. Wie Le Guin schrieb: »Ideas will not explain it. Theory is not enough.« Geschichten hingegen können Räume öffnen, in denen sich alternative Zukünfte nicht nur denken, sondern erfahren lassen. Le Guins Spekulative Fiktion ist hierfür ein herausragendes Beispiel.
Unsere Kernfrage lautete daher: Welchen Beitrag kann spekulatives literarisches Erzählen zur kollektiven Selbstverständigung über gute Zukünfte leisten? Konkret: Wie können Räume gemeinsamen Imaginierens unsere Vorstellungskraft anregen und uns helfen, radikale Ideen jenseits des Altbekannten zu entwickeln? Können die daraus entstehenden Geschichten dazu beitragen, neue Gesellschaftsentwürfe mit ihren jeweiligen Chancen und Herausforderungen lebendig und greifbar werden zu lassen? Können sie Neugier auf das wecken, was jenseits des Bestehenden möglich und – für die Vielen im Sinn des »guten Lebens aller« – wünschbar ist? Und schließlich: Können wir diese Ideen gemeinsam immer weiterdenken?
Seither führen wir als offenes Kollektiv Unleashing Fantasy for Transformation mehrmals jährlich Veranstaltungen unterschiedlicher Formate durch. Le Guins Werk bleibt uns dabei wichtiger Bezugspunkt. Doch gerade in längeren Seminaren erweitern wir unser Repertoire um multiperspektivisch-emanzipatorische Texte jüngerer, auch deutschsprachiger SF-Schreibender. So entsteht ein vielstimmiger Dialog, der es uns ermöglicht, Geschichten transformativ einzusetzen und die Vorstellungskraft über immer mehr Grenzen hinweg zu entfalten – stets begleitet von Eva von Redeckers Aufforderung, unsere Leben aus der »Perspektive der Veränderbarkeit« heraus zu betrachten.
Seit 2019 taucht dieses Flyer-Motiv immer wieder bei Konferenzen, Workshops und Performances in Stadt und Land quer durch Europa auf.
… weil das Fortschreiben der Gegenwart ungerecht ist:
Derzeit dominiert die Forderung nach möglichst schneller und radikaler Transformation der europäischen Sicherheitsinstitutionen – die sogenannte Zeitenwende – den öffentlichen und politischen Diskurs. Ausgelöst durch die russische Invasion der Ukraine hat dieser Fokus andere Transformationserfordernisse westeuropäischer Gesellschaften fast völlig aus der Debatte verdrängt. Die »imperiale Lebensweise« nach Markus Wissen und Ulrich Brand hält sich ungebrochen in den Gesellschaften, die Minna Salami »europatriarchalisch« nennt. Diese Lebensweise ist zentraler Treiber der gegenwärtigen Polykrise und zutiefst ungerecht.
Zum einen ist sie ungerecht gegenüber künftigen Generationen: Heute lebende Menschen setzen künftiges – menschliches wie nicht menschliches – Leben durch ihr Tun potenziell katastrophalen Verwerfungen aus. So stieg die globale Temperatur 2024 erstmals durchschnittlich um mehr als 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau (1850–1900). Die Erderwärmung verstärkt die Intensität und Häufigkeit von Hitzewellen und Überflutungen und fordert unzählige Leben. Derzeit steuern wir auf noch gravierendere Temperaturanstiege zu – mit exponentiell zunehmendem Leid, verstärkten Migrationsbewegungen und eskalierenden Verteilungskonflikten. Auch die biologische Vielfalt sank in den vergangenen 50 Jahren weltweit in beispiellosem Tempo und Ausmaß. Das Aussterben von Arten kann langfristig verheerende Konsequenzen auch für anderes Leben haben: Wenn dadurch globale Ökosysteme kippen, ist die Existenz zahlreicher Lebewesen – Menschen eingeschlossen – gefährdet.
Zum anderen ist die imperiale Lebensweise bereits heute ungerecht: Ein Teil der Menschheit lebt ausbeuterisch auf Kosten anderer Menschen sowie nicht menschlicher Lebewesen. So verbrauchen Gesellschaften des Globalen Nordens natürliche Ressourcen in einem Ausmaß, das für die Weltgemeinschaft weder erstrebenswert noch möglich wäre. Die Zahl unterernährter Menschen stagniert seit Beginn des 21. Jahrhunderts bei rund 700 Millionen, obwohl das globale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im gleichen Zeitraum fast verdreifacht wurde. Die Quälerei domestizierter Tiere, die in der industriellen Tierhaltung zum Alltag gehört, ist – trotz anderslautender Lippenbekenntnisse – gesetzlich legitimiert. Praktiken der Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sozialen Klasse und kulturellen Identität sowie die Marginalisierung nicht-westlicher Erkenntnisweisen bleiben – trotz teils nennenswerter Verbesserungen – ungebrochen weit verbreitet.
In der politischen Realität stoßen diese Ungerechtigkeiten auf Ignoranz und Verweigerung. Begriffe wie »Grünes Wachstum« oder »Bioökonomie«, die als Lösungen in den politischen Raum gestellt werden, hinterfragen die imperiale Lebensweise nicht, sondern zielen auf den Erhalt des Status quo. Aus Angst vor Verlust und Veränderung unterbleiben visionäre Entwürfe für eine nachhaltig gerechte und umfassend gute Gegenwart und Zukunft.
Dazu erzählen wir kooperative Beutelgeschichten, …
Das weltweite Kollabieren der ökologischen, ökonomischen, sozialen und demokratischen Strukturen hängt maßgeblich mit den Narrativen der imperialen Lebensweise zusammen; diese wurzeln wiederum in Gesellschaftsbildern, die in Eurasien seit Jahrtausenden als gegenseitige Abschreckungsfolie dienen. Dem Kulturanthropologen David Graeber (1961–2020) zufolge sind dies einerseits »heroische Gesellschaften«, in denen sich brutale Anführer mit ihren Gefolgsleuten permanent auf Raubzüge begeben, und andererseits »bürokratische Gesellschaften« mit staatlichen Gewaltmonopolen und technokratischen Verwaltungsapparaten. Sowohl das heroische als auch das bürokratische Motiv und die jeweils damit verbundenen Erzählungen sind Varianten einer größeren, immer wieder reproduzierten Heldengeschichte, deren Grundmotiv von der Beherrschbarkeit der Welt uns Schritt für Schritt an den Abgrund führt.
Damit ein gutes Leben für alle Wirklichkeit werden kann, bedarf es also auch ganz anderer Geschichten. Aber welche könnten das sein? Eine Erzählweise jenseits der Heldennarrative sind die durch Le Guins »Tragetaschentheorie des Erzählens« inspirierten Beutelgeschichten. Der »Beutel« ist das vielleicht älteste menschliche Werkzeug: ein Behältnis – ein Tuch, ein Netz, ein Korb, eine Kalebasse –, worin sich etwas – ein Kind, Haferkörner, Pilze, Wasser – tragen, halten, sammeln, bewahren lässt. Beutel, Kooperation und Sorgearbeit sind aus dieser Perspektive weit älter und zentraler für den Fortbestand menschlicher Kultur, als es Waffen, Kampf und Konkurrenz je waren – auch wenn manche archäologische und anthropologische Darstellungen hartnäckig anderes suggerieren (als Korrektive dazu siehe etwa Andreas Gehrlachs Das verschachtelte Ich oder Ulli Lusts Die Frau als Mensch). Beutelgeschichten sind selbst Behältnisse, in denen viele Welten Platz finden, so wie auch in der Idee des Pluriversums (Ashish Kothari und andere) oder im Motto der Zapatistas: eine Welt, in die viele Welten passen.
… mit denen wir zwischen Trümmern radikale Alternativen vorauslieben.
Das Visionieren guter Zukünfte ist herausfordernd. Unsere Phantasie bewegt sich oft in engen Grenzen des Vorstellbaren, gehemmt durch das »Ja, aber« der Pfadabhängigkeiten und Sachzwänge bestehender Strukturen und Institutionen. Um radikal Anderes zu imaginieren, müssen wir diese Begrenzungen aufbrechen und unsere Vorstellungskraft trainieren. Die Gedankenexperimente der SF, in denen – zeitlich wie räumlich – alternative Realitäten entworfen werden, sind dafür bestens geeignet. Der Zukunftsforscher und SF-Autor Karlheinz Steinmüller sieht sie als Mittel, in den Modus des »Veränderungsdenkens« zu gelangen und unser Vermögen zu erweitern, uns Zukünfte vorzustellen. Für radikales Imaginieren in der Polykrise brauchen wir jedoch spekulative Beutelgeschichten: Erzählungen, die über die üblichen techno-heroischen Fortschrittserzählungen hinausgehen und den Raum für echte Transformation öffnen. Reine Heldengeschichten enden nämlich nur scheinbar in einer geretteten oder neuen Welt: Tatsächlich bleibt sie strukturell unverändert und also – der politischen Autorin Bini Adamczak zufolge – »genauso beschissen wie zuvor«.
Das lenkt den Blick zunächst auf die soziale SF: Im Gegensatz zur techno-heroischen SF entwirft, veranschaulicht und popularisiert sie neue Gesellschaftsformen, Beziehungsweisen und Sozialstrukturen und gewinnt so Relevanz für gesellschaftliche Diskurse um Zukunftsgestaltung, so Steinmüller. Innerhalb dieses Felds suchen wir nach spezifischen, kritisch-utopischen Erzählungen: einer SF, die, wie SF-Autorx Aiki Mira sagt, »über das Ende hinausschreibt« und dazu in Themen und Erzählweise radikale – gerechte – multiperspektivische Gegenentwürfe zum Bestehenden zeichnet.
Der sich beschleunigende Kollaps ist dabei nicht unser Fokus, sondern schlichtweg das Feld, auf dem wir wirken: in und mit den Trümmern kollabierender Strukturen. Wir können den Einsturz der Welt(en), wie wir sie kannten, aufgrund der ökologischen Kipppunkte nicht mehr aufhalten. Aber wir können und müssen das Leid lindern und uns für ein gutes (Über-)Leben einsetzen, indem wir widerständig füreinander sorgen. Dafür nutzen wir alles, was wir aus den Nischen und Rissen zusammengesammelt haben – aus jenen Räumen, die so viele vor und mit uns dem Bestehenden abgerungen haben. In unseren Beuteln tragen wir sorgende Beziehungsweisen, öko-solidarische Praktiken, schöne Dinge – und unsere Phantasie. Wir wissen nicht, ob und wie die Welt, nach der wir uns sehnen, einmal Wirklichkeit werden wird. Doch die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, je stärker wir jetzt schon sehen, riechen, schmecken, fühlen können, wie sie sein kann. Für unseren Weltenbau gibt es keine vorgefertigte Landkarte, keinen Kompass, kein Navigationssystem – nur unser Wünschen, Sehnen und Begehren. Und wenn wir diese Welt möglichst ganz fühlen, dann können wir uns fragen: Wie werden wir dort hingekommen sein? Dieses imaginierte Zurückschauen oder »Backcasting« eröffnet wiederum Handlungsoptionen für die Gegenwart. Wir können diese Welt hier und heute präfigurieren, vorauslieben und aktiv herbeiwünschen, um sie Stück für Stück Wirklichkeit werden zu lassen. So wird die erzählerische zu einer gestaltenden Praktik.
Das Unleashing Fantasy for Transformation Collective gestaltet einen Readers’ and Writers’ Room in einem Park in Zagreb bei der International Degrowth Conference im September 2023.
Unsere Formate sind vielfältig und teilbar, …
Und was tun wir nun dafür? Als offenes Kollektiv und in flexiblen Konstellationen gestalten wir verschiedene Formate wie szenische und musikalische Lesungen, Lecture-Performances, Impulsvorträge, Audiobeiträge, Visionsworkshops und methodenorientierte Trainings. Manche Formate dauern eine Stunde, andere mehrere Tage. Elemente wie Traumreisen, kreatives Schreiben, Techniken aus Improvisation, Assoziation, Craftivism und Kunst verbinden sich dabei mit dem Anspruch, Utopie nicht nur als Thema, sondern auch als Methode erlebbar zu machen. Inspiriert durch SF entstehen so neben individuellen und kollaborativen Erzählungen auch spekulative Landkarten, zukunftsarchäologische Erkundungen und Artefakte, futurologische Kongressdebatten oder Stellenanzeigen für zukünftige Tätigkeiten. Und stets ist Le Guins Tragetasche dabei – denn wer sich aufs Suchen und Finden von Zukünften begibt, sollte nie ohne Beutel unterwegs sein.
Ein zentrales Format ist unser Readers’ and Writers’ Room. In diesen Visionsräumen lesen wir zunächst Passagen aus Geschichten vor, die in nahen oder fernen Zukünften, Vergangenheiten oder Orten spielen und in postkolonialen, emanzipatorischen und transformativen Perspektiven verwurzelt sind. Die Texte aus Subgenres der SF wie (kritische) utopische und anti-dystopische Fiktion, (Post-)Climate Fiction, Solar- und Hopepunk, Weird Fiction, Alternate History, indigene SF, afrikanischer Futurismus und Afrofuturismus kommentieren wir im Kontext sozial-ökologischen Wandels – etwa zu Degrowth, Care, Commons, Subsistenz, konvivialer Technik, kooperativem Wirtschaften, Selbstorganisation, Öko- und Queerfeminismus, Dekolonisierung und artenübergreifender Verwandtschaft. Anschließend schreiben die Teilnehmenden eigene Mikro-Utopien. Orientierung geben wir dabei durch eine einleitende Erzählprämisse und eine Reihe vorbereiteter Fragen – zum Beispiel:
Stell dir vor, es ist das Jahr 3348, und …
… du erwartest ein Kind.
… du möchtest eine weit entfernt lebende Person besuchen.
… du hast Hunger.
… du hast heute eine wichtige Verabredung.
… du triffst auf Zeichen aus der Vergangenheit.
… eine verwandte Person braucht deine Hilfe.
Was tust du? // Was geschieht als Nächstes?





























