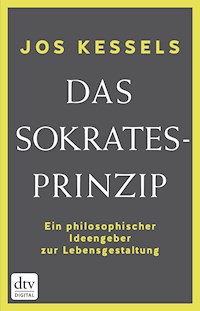
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was können wir von Sokrates lernen? Sokrates, wie wir ihn aus den Dialogen seines Schülers Platon kennen, hatte eine eigene Methode, um der Erkenntnis ans Licht zu verhelfen: Wenn man im Gespräch die richtigen Fragen stellt, findet der Gesprächspartner selbst die richtigen Antworten. Sokrates nannte dies Hebammenkunst, denn auch eine Hebamme hilft der Mutter dabei, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Das Führen von Gesprächen und das Entwickeln von Ideen sind Kernelemente der sokratischen Philosophie. Diese Fähigkeiten sind auch Schlüsselkompetenzen in der modernen Berufswelt. Selbsterkenntnis, das Wesentliche entdecken, Ideen entwickeln, fassen und artikulieren, Ideen in konkretes Handeln umsetzen: Jos Kessels zeigt, wie wir die sokratische Herangehensweise in der heutigen Zeit nutzen können und verbindet dabei Theorie, Praxis und seine persönliche Lebensgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jos Kessels
Das Sokrates-Prinzip
Ein philosophischer Ideengeber zur Lebensgestaltung
Aus dem Niederländischen von Bärbel Jänicke
Deutscher Taschenbuch Verlag
Dieses Buch ist in dankbarer Erinnerung meinen Lehrern im sokratischen Gespräch Nora Walter und Gustav Heckmann gewidmet.
Einleitung: Schule deinen Geist
Dieses Buch möchte eine moderne Vorstellung einer Schulung des Geistes vermitteln, wie sie von Sokrates und Platon betrieben worden ist. Sokrates, der Gründungsvater der westlichen Philosophie, hat sein ganzes Leben lang mit Menschen Gespräche über deren Ideen geführt. Er untersuchte diese Ideen und prüfte sie auf ihre Tragfähigkeit. Doch nahm er nicht nur die Ideen seiner Gesprächspartner, sondern auch sie selbst und ihre Lebensweise unter die Lupe, ebenso wie ihre Rolle innerhalb der Gesellschaft und ihre politischen Auffassungen. Denn Sokrates war der festen Überzeugung, dass zwischen den Ideen über sich selbst und den Ideen über das große Ganze ein enger Zusammenhang besteht. 399 v. Chr. war er von den Richtern Athens zum Tod durch den Schierlingsbecher verurteilt worden, angeblich, weil er nicht an die Götter glaubte und die Jugend verdarb, tatsächlich aber wegen seiner fundamentalen Kritik an den Auffassungen seiner Athener Mitbürger. Nach seinem Tod hat ihm sein Schüler Platon Unsterblichkeit verliehen, indem er ihn zum Protagonisten fast all seiner Dialoge gemacht hat.
Sokrates wollte Ideen untersuchen, sie in Worte fassen und auf ihre Gültigkeit hin prüfen. Diese Passion, die sein ganzes Leben bestimmte, wurde auch sein Tod. Denn obwohl er die Möglichkeit hatte, freiwillig in die Verbannung zu gehen, nahm er sein Los an. Er war nicht bereit, seine Überzeugungen zu opfern, um seiner Verurteilung zu entgehen. Damit wurde er zum großen Vorbild aller klassischen philosophischen Schulen. Sein Leben ist noch immer exemplarisch; auch heute brauchen wir Menschen, die seine Rolle übernehmen – die andere auf ihre Ideen hin befragen und deren Gültigkeit untersuchen.
Schulung des Geistes ist etwas anderes als Schulung des Verstandes. Jeder, der eine gewisse Ausbildung genossen hat, hat seinen Verstand geschult und irgendetwas gelernt, der eine weniger, der andere vielleicht mehr. Aber das heißt noch lange nicht, dass man diesen Verstand auch gut gebraucht. Dazu bedarf es einer ganz anderen Art von Wissen: Man muss wissen, was lohnenswert und einer Situation angemessen ist, was im rechten Verhältnis zueinander steht und was nicht, und was das gute Leben eigentlich ausmacht. Für solche Einsichten in »das Gute, Wahre und Schöne«, in die tragenden Ideen des Lebens, braucht es eine Schulung des Geistes.
Selbsterkenntnis ist das große Ziel der Philosophie und ihr ursprünglicher Beweggrund. Danach war Sokrates in all seinen Gesprächen auf der Suche. Für ihn machte es keinen Unterschied, ob er nach den tragenden Ideen des eigenen Lebens suchte oder nach den Gesetzen, die der Wirklichkeit als Ganzes zugrunde liegen. Ebenso wenig zog er eine Trennlinie zwischen Gefühl und Verstand, Individuum und Gemeinschaft, Erkenntnis und Weisheit, zwischen all den Dingen, die wir heute wie selbstverständlich voneinander trennen. Philosophie war für Sokrates keine Spezialdisziplin, sondern gehörte zur Allgemeinbildung, zu der jeder Zugang hat, eine Schulung, die unabdingbar ist, um ein vernünftig denkender, wohlgesinnter und wohlanständiger Mensch zu werden.
Dieses Buch vermittelt eine Vorstellung davon, was eine solche Schulung ausmacht und welche Vitalität und Aktualität ihr auch in unserer modernen Zeit noch zukommt. Viele Menschen haben heute ein Bedürfnis nach Besinnung und Vertiefung, nach Zusammenhang und Sinn, nach einer gründlichen und methodischen Reflexion, um herauszufinden, was wesentlich und was nebensächlich ist. Sie suchen nach einer bewährten Form, mit der sich ein vernünftiges Denken entwickeln und Ideen auf ihre Tragfähigkeit hin prüfen lassen. Dazu möchte dieses Buch einen Beitrag leisten, indem es darlegt, was die sokratische Schulung kennzeichnet, und Mittel und Wege aufzeigt, um selbst ans Werk zu gehen.
Durchdenke deine tragenden Ideen
Die Schulung, um die es Sokrates ging, beginnt im Grunde mit einer einzigen Frage: Was sind die tragenden Ideen deines Lebens? Eine tragende Idee ist eine persönliche Einsicht darin, wie man sein Leben am besten führt. Sie ist keine abstrakte, theoretische Vorstellung, sondern eng mit der eigenen Erfahrung verbunden. Sie ist keine bloße Gedankenspielerei, sondern eine Sichtweise, die für uns selbst richtungsweisend ist, eine Sichtweise, die wir für unser eigenes Handeln als grundlegend erachten. Eine tragende Idee ist ein Grundprinzip, ein Maßstab, an dem wir uns orientieren wollen und an dem wir uns selbst messen. Sie sagt uns, was wir in unserem Leben für wichtig und wertvoll halten.
Eine tragende Idee hat die Orientierungskraft einer persönlichen Lebensregel: »Das ist wichtig«, »Das ist das Beste«, »Jetzt, da ich das eingesehen habe, werde ich zukünftig auf diese Weise handeln.« Die Ideen, die ich in diesem Buch vorstelle, betrachte ich als meine eigenen Lebensregeln. Ich folge ihnen zwar nicht in jedem Fall, doch ändert das nichts an ihrer Gültigkeit. Manche von ihnen erfordern mehr Schulung als andere und sicherlich sind einige dabei, die noch besser durchdacht oder anders formuliert werden müssten. Als ich zum ersten Mal herauszufinden versuchte, was für mich eine tragende Idee sein könnte, war ich schon froh, überhaupt eine Idee zu finden. Doch je länger ich mich damit befasste, desto deutlicher erkannte ich, dass es mehr Ideen gab, als ich je vermutet hatte. Die Kunst besteht darin, sie kurz und treffend, in einer Maxime, einem Spruch oder einem Bild zu formulieren, zugleich aber auch die Geschichte, die dahinterliegt, mit einzubringen. Anders funktionieren sie nicht.
Ich betrachte Ideen als kompakte Destillate von Geschichten und Argumentationen. Es sind immer persönliche Geschichten über eigene Erlebnisse und die eigene Meinung dazu. Denn schließlich wird man sich seiner tragenden Ideen erst bewusst, wenn man über das, was man erlebt, auch nachdenkt. Und mit Nachdenken meine ich nicht Tagträumen oder Sinnieren, sondern wirkliches Denken, das Denken einer Idee. Wenn wir Menschen uns auf eines gut verstehen, dann wohl darauf, uns selbst mit kleinen oder großen Illusionen, schönen Wunschbildern, düsteren Schreckensszenarien und allerlei schludrigem und halbgarem Denken selbst hinters Licht zu führen. Bis wir uns den Kopf an der Wirklichkeit stoßen und »einen Moment der Wahrheit« erleben, ein kleines Stolpern oder eine große Krise, einen Punkt, an dem wir uns entscheiden und einen Standpunkt beziehen müssen, an dem wir zeigen müssen, wer wir wirklich sind, oder uns von etwas, was uns lieb und teuer ist, verabschieden müssen. Eine Idee ist die Moral einer solchen Geschichte, die Essenz, die man aus ihr zieht, bzw. die Erkenntnis, was daran wirklich wichtig ist. Das kann ein plötzliches Aha-Erlebnis oder eine langsam wachsende Einsicht sein. Es geht darum, diese Einsicht zu formulieren und den Clou darin zu erfassen; erst dann wird sichtbar, was das Wirkliche ist, was wirklich wichtig ist, und erst dann lässt sie sich auch als Lebensregel fassen.
Die tragenden Ideen in meinem Leben sind eng mit meiner Arbeit, dem Führen sokratischer Gespräche, verwoben. Als ich an diesem Buch zu arbeiten begann, glaubte ich, die Grundsätze von Sokrates und seiner Gespräche darlegen zu wollen. Doch nach einiger Zeit wurde mir bewusst, dass es meine eigenen Lebensregeln und meine eigenen tragenden Ideen waren, die ich in Worte zu fassen versuchte. Zwar spielt Sokrates darin eine bedeutende Rolle, doch eine Idee kann erst dann zu einer tragenden Idee werden, wenn sie wirklich etwas mit einem selbst zu tun hat, wenn sie für einen selbst als Person »tragend« ist. Das bedeutet, dass sie kein losgelöster, beliebiger oder nur von anderen übernommener Gedanke ist, sondern eine eng mit dem eigenen Denken und der eigenen Erfahrung verbundene Idee. »Sondern aus häufiger fortgesetzter Unterredung gerade über diesen Gegenstand sowie aus innigem Zusammenleben entspringt es plötzlich aus der Seele wie aus einem Feuerfunken das angezündete Licht«, schreibt Platon, »und bricht sich dann selbst weiter seine Bahn.« (Siebter Brief, 341c-d)1
Den Ausgangspunkt dieses Buches bildet die Auffassung, dass jeder Mensch diesen Funken, dieses Aufscheinen von Einsicht, in sich selbst finden kann. Das war auch der Ausgangspunkt von Sokrates und Platon. Eine Idee ist eine sehr persönliche Form des Wissens. Viele Menschen glauben, gerade wenn es um Ideen geht, müsse man sich bemühen, möglichst objektiv zu sein. Damit eine Idee einen objektiven, universellen Charakter annehmen kann, darf sie das Persönliche jedoch nicht ausschließen, im Gegenteil, sie muss über es hinausgehen. Das eben erfordert durchaus den Mut, persönlich zu sein. Jede sokratische Untersuchung ist im Grunde eine Selbsterforschung. Nur wenn man sich selbst zum Gegenstand der Untersuchung macht, lässt sich ein fruchtbares Gespräch über Ideen führen. Wer das menschliche Denken und Sprechen auf den objektiven Inhalt, den Logos, einzuengen versucht, nutzt nur zwanzig Prozent seines Potenzials. Pathos, das persönliche Gefühl, macht ungefähr dreißig Prozent aus, und Ethos, der Charakter, fünfzig Prozent. Ohne Pathos und Ethos hat das Denken keine Substanz, und ohne Substanz ist ein Gespräch einfach unmöglich.
Folge dem Vorbild von Sokrates
Wie eine systematische Schulung des Geistes aussehen könnte, hat Platon nirgendwo detailliert beschrieben. Immerhin skizziert er in der Politeia die Ausbildung der Führer und die Wissensgebiete, die diese sich in langwierigen Studien aneignen sollten. Außerdem lässt Sokrates in den platonischen Dialogen keine Gelegenheit aus, die formale Ausbildung der Sophisten – der Gurus jener Zeit – mit Ironie und Argwohn zu überhäufen. In deren Lehrpläne hatte er offenbar wenig Vertrauen. Welches Bild einer Schulung stand ihm selbst vor Augen?
Ich denke, Platon wollte ein viel bedeutsameres Bild als ein ausgearbeitetes Curriculum zeichnen: das lebendige Vorbild von Sokrates im Gespräch. Denn dieses Bild hat er uns hinterlassen. In seinen Dialogen entwirft er ein anschauliches Porträt von Sokrates’ Vorgehensweise: auf der einen Seite beharrlich, scharfsinnig und unkonventionell, auf der anderen Seite methodisch und in hoher argumentativer Präzision, niemals davor zurückschreckend, große Themen anzupacken oder sein Gegenüber persönlich zu konfrontieren. Platons Dialoge geben uns ein facettenreiches und tiefgründiges Bild von Sokrates bei der Arbeit, auf dem Markt von Athen, auf der Sportstätte oder im Hause seiner Gesprächspartner. Wo sich Sokrates auch aufhielt, stets war er ganz bei der Sache, in eine Untersuchung vertieft und die zahlreichen Irrwege eines Gesprächs unermüdlich durchlaufend. Wie stilisiert oder in den späten Dialogen gar artifiziell Platons Beschreibungen dieser Gespräche auch immer sein mögen, hat er es doch vermocht, Sokrates’ Vorgehensweise mitreißend zu schildern. So muss es später wohl auch in der von Platon gegründeten Akademie, der ersten Universität in der Geschichte der westlichen Welt, zugegangen sein: Studenten und Dozenten, Forscher und Experten waren fortwährend in Gruppen miteinander im Gespräch, führten Debatten und Dialoge über die unterschiedlichsten Themen, um im Anschluss Reflexionen darüber zu verfassen, die ihnen erneut Diskussionsansätze boten. Eben dieses Bild hat uns Raffael etwa zweitausend Jahre später in seinem berühmten Fresko Die Schule von Athen vor Augen geführt. Die Komposition des Freskos wirkt recht idyllisch, dennoch ist die Darstellung im Wesentlichen zutreffend: In der Nachfolge von Sokrates dreht sich alles darum, Gespräche zu führen und sich beharrlich in Dialektik zu üben.
Daher fällt es ungeachtet eines nicht vorhandenen expliziten Curriculums nicht schwer, aus den platonischen Dialogen die Hauptlinien einer sokratischen Schulung des Geistes herauszudestillieren: die Hauptlinien des Erlernens der sokratischen Gesprächsführung und der Kunst der Dialektik. Ich habe sie in diesem Buch in sieben Disziplinen gegliedert, die jeweils das zentrale Thema eines Kapitels bilden. Auch wenn sie sich zum Teil überschneiden oder ineinander übergehen, bilden sie doch separate Themenschwerpunkte, mit jeweils eigenen Ausgangspunkten, Regeln und entsprechenden Techniken.
Ich beschreibe diese Disziplinen und die Schulung des Geistes, der sie dienen, nicht so sehr aus der Perspektive eines Lehrers, der weiß, was richtig ist, und sein Wissen ex cathedra verkündet. Ganz im Gegenteil betrachte ich mich selbst auch als Schüler, der sich in Sokrates’ und Platons Fußspuren mit wechselndem Erfolg bemüht, seinen eigenen Geist zu schulen und die Finessen der Dialektik zu meistern. In diesem Buch stelle ich eigene Erfahrungen neben theoretische Reflexionen, widme ich den Schilderungen aus meiner Praxis ebenso viel Aufmerksamkeit wie abstrakten Analysen, und scheue mich auch nicht, auf einige der Belastungspunkte, an denen es auch für mich mühsam wird, hinzuweisen.
Ich mache hier übrigens keinen Unterschied zwischen Sokrates und Platon. Sokrates ist durch die Darstellung seines Schülers Platon zu dem geworden, der er ist: Eine historische Person ist zu einer philosophischen Gestalt geworden. Diese beiden voneinander zu trennen, ist unmöglich.
Das erste Kapitel »Erkenne dich selbst« beginnt mit der entscheidenden Umwendung des Blicks, der sich nun nicht mehr nur nach außen, sondern auch nach innen, auf die eigenen Beweggründe der Seele und den Zustand des Geistes richtet. »Schämst du dich nicht«, fragt Sokrates in seiner Verteidigungsrede, die er an die Bürger Athens richtet, »für möglichste Füllung deines Geldbeutels zu sorgen und auf Ruhm und Ehre zu sinnen, aber um Einsicht, Wahrheit und möglichste Besserung deiner Seele kümmerst du dich nicht und machst dir darüber keine Sorge?« (Apologie, 29d-e).
Diese Hinwendung zur Philosophie ist der notwendige Ausgangspunkt jeder Art von Geistesschulung. Das zweite Kapitel »Führe gute Gespräche« geht davon aus, dass sich eine Schulung des Geistes nur in einem begrenzten Maße in der Schule abspielt. Der größte Teil der Schulung vollzieht sich im Leben und entsteht durch Erfahrung, Reflexion und in Gesprächen mit Freunden, Kollegen, der Familie und anderen Menschen. Gespräche sind die wichtigste Schule des Geistes. Allerdings ist es eine wahre Kunst, gute, also potenziell lehrreiche, vertiefende und bereichernde Gespräche zu führen. Dieses Kapitel stellt eine Reihe sokratischer Prinzipien und Techniken der Gesprächsführung vor, die in den darauf folgenden Kapiteln weiter ausgeführt werden. Das dritte Kapitel »Suche das poetische Argument« geht auf einen der zentralen Momente der Gesprächsführung ein: die Suche nach dem, was uns im Kern berührt, nach dem »Brennpunkt«. Dabei kann es sich um eine Sehnsucht handeln oder um einen für uns problematischen Punkt. Diese Suche erfordert Offenheit für das Nicht-Rationale, denn hier ist häufig die größte Einsicht zu finden.
Die drei Kapitel, die sich daran anschließen, befassen sich mit eher technischen Aspekten der Untersuchung von Ideen. Kapitel IV »Steige auf aus der Höhle« geht auf die aufsteigende Dialektik ein, auf die Art zu denken, die erforderlich ist, um sich auf die Suche nach einer Idee zu begeben. Kapitel V »Schaue die tragenden Ideen« thematisiert die Loslösung von altem Denken, die Erneuerung der Sprache und die Bedeutung der Kunst für das Artikulieren neuer Ideen. Kapitel VI »Steige wieder hinab in die Höhle« ist der absteigenden Dialektik gewidmet, dem Versuch, eine Verbindung zwischen den ätherischen Höhen der Ideenwelt und der zerschlissenen, unvollkommenen Praxis des Alltags zu schaffen. Das letzte Kapitel »Übe dich in Liebe« ist das, was man in der Musik als Koda bezeichnet, ein Nachspiel, das gewissermaßen ein Resümee des gesamten Inhalts bietet. Es wirft ein Licht auf die einzige Disziplin, in der sich Sokrates als Experte empfunden hat: auf den Eros, die Liebe. Am Ende habe ich die Schulung noch einmal in einigen Beispielübungen zusammengefasst und darin auch eine Reihe von Anregungen zum Weiterdenken, Weiterreden und Weiterlesen aufgenommen.
Dieses Buch wendet sich an jeden, der dem sokratischen Aufruf zur »Einsicht, Wahrheit und möglichsten Besserung der Seele« Gehör schenken will – nicht nur in Bezug auf das private Dasein, sondern auch »auf dem Markt«, in seiner Arbeit und in seinem alltäglichen Handeln. Denn ein Großteil dieses Handelns besteht schließlich aus Gesprächen: Wir coachen und helfen, beraten und erziehen, managen und leiten. Auch in unserer Zeit besteht, wie schon eingangs erwähnt, ein großer Bedarf an Menschen, die Sokrates’ Rolle übernehmen können, die andere nach ihren Ideen befragen und prüfen, ob diese standhalten. Ideen erfassen zu lernen und sie im Gespräch zu klären, das war es, was Sokrates und Platon wollten. Ich hoffe, mit diesem Buch bei meinen Lesern das gleiche Begehren zu wecken und sie dazu zu inspirieren, es auch in die Tat umzusetzen.
Groet/Amsterdam, Frühjahr 2014
I. Erkenne dich selbst
Mein Name ist Jos Kessels. Ich bin der Sohn eines Schneiders, der selbst ebenfalls der Sohn eines Schneiders war und die Tochter eines Schneiders geheiratet hat. Mein Vater war ein Handwerker und meine Mutter war seine treibende Kraft. Josef haben mich meine Eltern ursprünglich genannt, mit vollständigem Namen: Josephus Petrus Antonius Maria, denn ich stamme aus einer katholischen Familie. Eigentlich sollte ich Piet heißen. Doch ich wurde am 19. März, dem Tag des heiligen Josef, geboren – und auf Namenstage wurde damals noch Wert gelegt. Daher trage ich nun vier statt drei Vornamen. Und mein jüngerer Bruder heißt Piet.
In meiner Kindheit habe ich mir über meinen Namen überhaupt keine Gedanken gemacht; ich hieß einfach so, wie ich nun mal hieß. Auch mein Rufname Jos erschien mir ganz normal, mehr als eine Silbe hat ein Rufname in unserer Familie für gewöhnlich nicht. Außerdem hatte jeder bei uns einen Spitznamen. Meiner war Wolf – aus irgendeinem Grund nannte mich mein Vater früher so. Aber diesen Spitznamen verwendet heute niemand mehr.
Als ich aufs Gymnasium ging, gefiel mir mein Name nicht mehr. Josef kam mir zu brav, zu heilig vor, und wenn ich etwas nicht sein wollte, dann das. Als ich zu studieren anfing, änderte ich daher meinen Namen, ich nannte mich nun Jos. Das fühlte sich besser an, gleichzeitig aber auch fremd. Obwohl es eine Verbesserung war, bedeutete es auch eine Verleugnung des Menschen, der ich eigentlich war. Überdies erschien mir die niederländische Standardsprache damals überhaupt wie eine Verleugnung der Eigenheiten und der Vertrautheit des brabantischen Dialekts, meiner eigentlichen Muttersprache, und der damit verbundenen brabantischen Identität2. Wie dem auch sei, als ich in die Großstadt zog, deklarierte ich Josef zu meinem offiziellen formellen Namen, der mir für den Alltagsgebrauch nicht mehr passend erschien. Nur eine Handvoll enger Freunde benutzte ihn noch als Kosename.
Es hat lange gedauert, bis ich mich an diese selbst gewählte Identitätsveränderung gewöhnt hatte. Heute habe ich zwei Namen. Einen öffentlichen Namen, Jos, und einen eigentlichen Namen, Josef. Mittlerweile ist mir auch bewusst, dass man einen Eigennamen nicht ändern kann, ohne damit den Namensträger zu tangieren. Unser Name ist nicht bloß etwas Willkürliches, unser ganzes Seelenheil ist damit verbunden.
Wenn ich mich anderen vorstelle, nenne ich meinen öffentlichen Namen, Jos Kessels, und beschreibe in wenigen Worten, was ich mache: Ich bin Philosoph und arbeite mit der Philosophie in Organisationen. Das ist die kompakte Zusammenfassung meines Lebenslaufs, die Geschichte, die ich früher potenziellen Auftraggebern zusandte. In ihr spielte Josef überhaupt keine Rolle, es ging selbstverständlich immer um Jos. Mein Lebenslauf umfasste neben meiner Ausbildung und meiner Berufserfahrung eine Auswahl meiner Heldentaten und Qualitäten. Aber das waren natürlich oberflächliche Informationen, Selbstdarstellungen, wie man sie heutzutage auf Facebook oder LinkedIn findet. Den Menschen, die mich Josef nannten, erzählte ich eine andere Geschichte, sie handelte nicht nur von meinen Erfolgen, sondern auch von meinen Misserfolgen, nicht nur von meinen Träumen und Idealen, sondern auch von meinen Zweifeln, beschämenden Erlebnissen und Dummheiten. Verglichen mit dem Inhalt meines Lebenslaufs ist sie viel eher die wirkliche, authentische Geschichte des Menschen, der ich bin.
Verrückterweise wird diese Geschichte, im Gegensatz zu einem Lebenslauf, selten oder nie von Anfang bis Ende und mit den wichtigsten Entwicklungslinien dazwischen aufgeschrieben. Als Coach und Trainer mache ich Übungen zur Grammatica, dem Teil der »freien Künste«3, in dem es um das Schreiben geht. Eine dieser Übungen heißt »Legende«. Das Wort kommt vom lateinischen legenda, was wörtlich »was gelesen werden soll« bedeutet. Die Aufgabenstellung lautet: Schreibe deine eigene Legende, schildere, wie man dich lesen sollte und was in deinem Leben essenziell ist. Die Kunst besteht darin, Fiktion und Realität so ineinander zu verweben, dass das Wesentliche sichtbar wird. Praktisch bedeutet das: Man ersinnt eine Geschichte, in der die eigentliche Wahrheit liegt. Man erfindet eine Figur, einen Konflikt und einen Plot, in denen die Kernaspekte der eigenen Person überzeichnet dargestellt werden.
Als ich selbst diese Übung zum ersten Mal machte, schrieb ich die Legende von Josef, dem Zimmermann. Dieser wollte als eigensinniger junger Mann dem wachsamen Blick seines Vaters, des großen Baumeisters, entfliehen, da er nicht die geringste Lust hatte, wie dieser Zimmermann zu werden. Also zog er in die weite Welt. Doch nach vielen Irrwegen und Fehlschlägen landete er schließlich wieder in den Fußstapfen seines Vaters. Nicht als ein Zimmermann, der mit Holz und Nägeln arbeitet, sondern als ein Handwerker, der mit Sprache und Begriffen konstruiert und logische und poetische Verbindungen schafft: Rahmen für Fenster zur Welt, unterschiedliche Formen geistigen Mobiliars, Dächer und Fundamente für Orte, an denen man bleiben möchte, derartige Dinge. Hin und wieder besuchte ihn sein Vater überraschend an seinem Arbeitsplatz und sah ihm schweigend bei seiner Arbeit zu. Josef empfand seinen Blick nun als Stütze und Ansporn und war froh, dessen Tradition weitertragen zu können, wenn auch auf seine eigene Art. Ich bin kein Literat, daher bezweifle ich, dass es eine gute Geschichte ist. Doch als ich sie aufgeschrieben hatte, hinterließ sie bei mir selbst einen starken Eindruck. Mir war bisher nie klar gewesen, dass ich meine eigene »Urgeschichte« auf diese Weise darstellen konnte.
Während ein Lebenslauf den sichtbaren Teil eines Baumes ausmacht, bringt eine solche Legende das unsichtbare Wurzelwerk zum Vorschein, aus dem der ganze Stamm und die Krone des Baumes erwachsen sind. Hat man sie einmal geschrieben, bleibt sie einem immer in Erinnerung. Meine Legende wurde als Bild meines »echten Ichs« zu einem Ankerplatz und Prüfstein meines Denkens. Ich habe das Gefühl, dass ich mit ihr besser ich selbst sein kann, besser weiß, worum es mir geht und für was ich mich entscheiden sollte, wenn es darauf ankommt. Zugleich macht diese zweite Geschichte auch deutlich, dass es neben meinem Lebenslauf und meiner Legende noch eine dritte, tiefer liegende Geschichte dazu geben muss, wer ich bin. Man könnte sagen: eine Geschichte über die DNA des Baumes, über das, was den Baum zu dem macht, was er ist, und mich zu dem, was ich in meinem Wesen bin. Denn wie anders wäre es mir möglich, eine solche Legende zu schreiben? Woher sollte ich sonst wissen, was in meiner Erfahrung wesentlich ist, was zu mir passt und zu meinem Kern gehört?
Merkwürdigerweise haben wir dafür einen Sinn. Das zeigt sich zum Beispiel dann, wenn wir das Gefühl haben, dass etwas, was passiert oder was wir erleben, zu unserer tiefsten, inneren Natur »passt« oder ihr »entspricht«, als ob es mit dem, was uns wirklich ausmacht, völlig übereinkommt. Es gehört zu uns selbst, es passt zu uns wie eine Liebste, die man auf den ersten Blick erkennt. Die Erfahrung ist untrüglich, doch schwer in Worte zu fassen. Der Dichter Rutger Kopland hat sie in seinem Essay Het mechaniek van de ontroering (Die Mechanik der Rührung) wunderbar beschrieben. Darin schildert er, wie er beim Dichten so lange nach den richtigen Worten sucht, bis er das Gefühl hat, so stimmt es genau. Worte können mehr oder weniger berührend sein, und auch von einem Bild, einer Erfahrung, einer gewissen Sichtweise oder einer Person kann man persönlich stark berührt sein. Was passiert in einem solchen Moment eigentlich?
Kopland erklärt es folgendermaßen: »Die ersten Küsse, die ich von einem Mädchen bekam, waren natürlich Berührungen, doch sie durchdrangen mich bis in die letzten Winkel meines Körpers und meiner Seele. Dort lag etwas bereit, von dem ich nicht wusste, dass es bereitlag, ein Verlangen, das ich erst durch seine Erfüllung kennenlernte.« Jeder kennt solche Erfahrungen, wie flüchtig und unfassbar sie auch sein mögen. Sie sind zu fragil, um sich in ein wissenschaftliches Modell einordnen zu lassen. Und doch wäre es eine Sünde, sie deshalb zu negieren. Es fühlt sich an, als erkenne man etwas wieder, das man nie zuvor gesehen hat, als trage man einen Maßstab in sich, dessen man sich nicht bewusst ist. »Es war eine Entdeckung im vollsten Sinne des Wortes«, schreibt Kopland. »Als werde ein Vorhang aufgezogen, von dem ich nicht wusste, dass er sich öffnen ließ, und es bot sich ein Blick auf eine Welt, die ich wiedererkannte, ohne sie je gesehen zu haben. Als erfahre ich mit einem Mal, wie die Welt ist.«
Dieses Wiedererkennen und dieses überraschende Gefühl von Wahrhaftigkeit stellen die wesentlichen Punkte dar, um die es mir hier geht. Man kann das natürlich alles als poetische Fantasterei abtun, als eine Regung des Gemüts ohne objektiven Wahrheitsgehalt. Aber ich selbst nehme diese Phänomene sehr ernst. Sie spielen nicht nur für mich persönlich eine wichtige Rolle, sondern begegnen mir auch immer wieder in Gesprächen mit anderen. Auch Sokrates war in seinen Gesprächen ständig auf der Suche nach solchen Einsichten, nach Erfahrungen, in denen man sich selbst wiedererkennt, nach Worten oder Bildern, die einen über das alltägliche Ich erheben und einen Widerschein der wirklichen Welt erkennen lassen. Sie geben uns eine Idee davon, was die Welt und uns selbst im Innersten eigentlich ausmacht.
Durch die Differenzierung dieser unterschiedlichen Erzählformen habe ich begonnen, die sokratische und platonische Philosophie als einen beharrlichen Versuch zu betrachten, dem Wissen auf die Spur zu kommen, das unseren Legenden zugrunde liegt. Es ist ein »dunkles« Wissen, das sich nur mit Mühe erhellen lässt. Man besitzt es, doch es steht einem nicht klar vor Augen. Und es enthält wie jede Idee einen Auftrag, den Appell, sich klarzumachen, was man eingesehen hat. Um dieses Wissensniveau geht es in diesem Buch. Ich versuche, eine Reihe von tragenden Ideen meines eigenen Lebens zu formulieren, Einsichten, die mit meiner persönlichen »Urgeschichte« zusammenhängen, Schlüssel und Lebensregeln, die ich als wirklich wahr, gut und schön wiederzuerkennen glaube. Diese unablässige persönliche Suche ist die Art der Schulung, um die sich Sokrates und Platon bemüht haben. Ich jedenfalls habe dadurch wieder begonnen, mein Leben als eine Art Auftrag des großen Baumeisters zu sehen, den Auftrag, zu lernen, mein Leben selbst zu gestalten, und zu sein und zu werden, wer ich wirklich bin.
Tu, was du wirklich willst
»Ich vermag noch nicht (…) mich selbst zu kennen. Und so erscheint mir als Lächerlichkeit, so lang ich darüber noch unwissend bin, die Dinge zu erforschen, die mich nicht betreffen«, sagt Sokrates im Phaidros (229e). Das gilt auch für mich: Ich kann nicht von mir sagen, dass ich mich selbst kenne, ich bin weit davon entfernt. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte. Meinem Gefühl nach habe ich mich sehr darum bemüht, seit ich selbst angefangen habe nachzudenken. Dieser Moment war für mich irgendwann gekommen, als ich etwa fünfzehn war und mich entschied, nicht mehr zur Kirche zu gehen. Ich erinnere mich noch der vernichtenden Klarheit, mit der ich für mich erkannte, was für ein inszenierter Mummenschanz dieses ganze Ritual der Messe war. Kindisch, irreführend und dazu noch schlecht gespielt. Doch wenn diese katholische Erzählung nichts taugte, wie war es dann um die Welt bestellt? Und wo war um Himmels willen mein eigener Platz darin? Damals hat es begonnen, mit diesen Fragen.
Anfangs projizierte ich meine eigene Verwirrung auf die Außenwelt. Ich war ganz versessen auf Camus, der die unbegreifliche Absurdität des Lebens so gut in Worte fassen konnte – seinen Mythos von Sisyphos habe ich völlig zerlesen. Ich empörte mich über die Ungerechtigkeit der Welt, die Armut, die Ungleichheit, die Gleichgültigkeit. Als sei dies die Ursache dafür, dass ich nicht wusste, was ich wollte. Später dann war ich davon überzeugt, bevor ich erkennen könnte, was ich in der äußeren Welt tun sollte, müsste ich erst einmal mein eigenes Innenleben ordnen. Als ich in meinen Zwanzigern war, schwappte aus Amerika eine ganze Selbsterforschungswelle mit Sensitivity-Trainings, Encounter-Gruppen, Gestalttherapie, Bio-Energetik, Psychosynthese nach Europa herüber, und ich saugte sie auf wie ein trockener Schwamm. Für mich waren es Offenbarungen, vollkommen andere Formen des Sprechens, Denkens und Fühlens. Mir kam es vor, als hätte ich eine neue Welt entdeckt, die tiefer und intensiver war, als ich es je für möglich gehalten hatte. Das passte in die Zeit von Flowerpower, der niederländischen, anarchistisch geprägten Provo-Bewegung und der Studentenrevolte. Wir waren jung und wollten alles verändern, die Politik, die Gesellschaft und vor allem uns selbst. Dass ich dadurch immer mehr in Verwirrung geriet, dass meine Beziehungen Schiffbruch erlitten, dass eigentlich alle Beziehungen in meinem Umfeld ein einziges Chaos waren, nahm ich hin. Es gehörte zu der neuen Freiheit, dem neuen Leben, dem Experiment. Alles war mir lieber als die bürgerliche, geruhsame, konventionelle Lebensweise.
Doch nach einigen Jahren hatten die Sprache und Ideale der Selbstkonfrontation ausgedient. Sie wurden brüchig und inhaltsleer. Schließlich fand ich sie ebenso verlogen wie die katholischen Erzählungen, die ich abgeschüttelt hatte. In der Zwischenzeit hatte ich als Therapeut in psychologischen Betreuungseinrichtungen die weniger schöne Kehrseite ihrer Selbstgewissheit gesehen. Das hatte mir die Augen geöffnet: Es gab im Grunde keinen besonders großen Unterschied zwischen Patienten und Therapeuten, weder in Bezug auf Selbsterkenntnis noch in Bezug auf Glück. Daher beschloss ich, definitiv von meiner andauernden Verzweiflung geheilt zu sein. Ich erklärte mich trotz meiner Melancholie für völlig kuriert und entschloss mich, endlich das zu tun, was zu wollen ich bisher nicht den Mut aufgebracht hatte: systematisch die großen Werke der Philosophie zu studieren, ohne mich darum zu scheren, ob ich damit meine Brötchen verdienen könnte oder nicht. Selbsterkenntnis, so dachte ich, hatte nichts mit lästigen Emotionen, sondern primär mit Sprache, Denken und der Art, wie wir uns und die Welt wahrnehmen, zu tun, und vor allem damit, wie wir uns selbst zum Narren halten. Irgendwo in diesem Bereich hoffte ich, die Wurzeln von Gut und Böse zu finden und ein bisschen mehr Einsicht in mich selbst zu erlangen. Ich schrieb mich an der Philosophischen Fakultät ein. Und erneut fühlte ich mich wie ein Schwamm, der gierig alles aufsaugte, was ihm angeboten wurde.
Im Nachhinein betrachtet stellte diese Entscheidung die große Wende in meinem Leben dar. Ich las und studierte und schrieb Abhandlungen, ich malträtierte mein Gehirn und genoss es in vollsten Zügen. Nach meinem Studium bekam ich sogar eine Forschungsstelle in der Wissenschaftsphilosophie. Doch irgendwie entglitt mir dabei, um was es mir ursprünglich gegangen war: um eine Einsicht in mich selbst, eine gewisse Art von Weisheit, eine Wahrheit, die über wissenschaftliche Artikel und abstrakte Theorien hinausging. Dann entdeckte ich das sokratische Gespräch. Hier ging es gerade darum, alle Bücher beiseitezulegen und immer wieder von vorne zu beginnen, indem man Gespräche führte, so, wie Sokrates das getan hatte. Das ließ mich nicht mehr los, das war genau das, was ich wollte, hier hatten Worte eine völlig andere Art von Schönheit und Tiefgang als in der Bücherweisheit. In diesen Gesprächen steckte Erfahrung und Seele, ein gewisses persönliches Ringen, das mir selbst so vertraut war. Und sie eröffneten mir die Möglichkeit, im Zuge meiner eigenen Suche andere nach ihrer Selbsterkenntnis zu befragen. Denn das war es schließlich, was Sokrates getan hatte: Er befragte andere, um sich selbst besser kennenzulernen (Menon,80c). Damit bin ich nun schon dreißig Jahre zugange.
Ich glaube schon, dass ich mich mittlerweile besser kenne als früher. Ich tue, was ich wirklich will, und weiß auch besser, was das impliziert. Ich gerate nicht mehr so schnell aus dem Konzept und erkenne meine Grenzen genauer. Doch vielleicht ist das auch alles mehr Hoffnung als Wirklichkeit. Denn manchmal bin ich über mein eigenes Unvermögen, zu sehen, was gut und richtig ist, oder auch über mein Unvermögen, den Widerstreit aller möglichen vagen und unfassbaren Sehnsüchte zu schlichten, erschüttert. Vielleicht habe ich mich nur mehr und mehr an meine überwältigende Unwissenheit, meine große Ohnmacht gewöhnt. Nein, ich kenne mich selbst nicht gut. Ich habe mich selbst nicht gut genug im Griff. Ich wollte und sollte es besser wissen, aber dem ist nun mal nicht so. Und dennoch glaube ich, dass dieser Weg, Selbsterforschung zu betreiben und zu philosophieren, der richtige ist. Vielleicht ist es nicht der einzige Weg, aber sicherlich der beste, klarste und tiefgehendste – jedenfalls für mich. Und ich denke auch, dass er für andere unausweichlich ist. Jeder muss erkunden, was er will, um den eigenen Platz in diesem Leben im Hinblick auf andere und auf sich selbst zu bestimmen. »Denn fast möchte ich sagen, die Besonnenheit sei eben nichts anderes als das Sichselbsterkennen«, sagt Sokrates im Charmides (164d). Und das erfordert, sich – jeden Tag aufs Neue – auf die Suche zu begeben.
Wahre deine persönliche Perspektive
Bevor ich mich weiter mit Lebensregeln und tragenden Ideen befasse, möchte ich zunächst anhand einer Beobachtung, die ich vor Kurzem gemacht habe, auf eine methodische Frage eingehen, die für das richtige Verständnis von Ideen wichtig ist. In unserem Garten zwitschern viele Vögel, Grünlinge, Schwarzplättchen, Rotkehlchen, Zaunkönige und natürlich auch Amseln. Das Amselmännchen ist mit Abstand der beste Sänger, besser noch als die Drossel, besser sogar als die Nachtigall. Es verfügt über den größten Variationsreichtum, immer und immer wieder entlockt es seiner Kehle neue Melodien. Seine Musikalität ist von einer ungeahnten Freiheit. Andere Singvögel haben meistens feste Motive, die sie ständig wiederholen, die Amsel hingegen trällert immer wieder neue Figuren, als könne sie frei improvisieren und erfinde sie spontan. Manchmal ist es ein Gurgeln, dann wieder ein Tirilieren, ein melodischer Auftakt löst sich in schnatterndes Gelächter auf. Sie gluckst und kichert, ihr Ton schießt von oben nach unten, und sie selbst hat den meisten Spaß daran. Dann klingt sie plötzlich wieder melancholisch, gedankenversunken und ganz in sich selbst zurückgezogen. Um im nächsten Moment bereits darüber zu lachen und Fontänen der Ausgelassenheit um sich zu versprühen. Ihr Gesang wirkt meist wie ein Ausbund purer Freude, ein jubelnder Lobgesang, der Figur auf Figur türmt, wie ein Kind, das voller Entzücken darüber, was seine Hände schaffen, mit seinen Bausteinen spielt. Im Frühjahr und zu Anfang des Sommers sitzt die Amsel abends im Baumwipfel. Mit hochgerecktem Schnabel und aus voller Brust streut sie ihre musikalischen Ideen in die Welt, manchmal eine halbe Stunde lang. Warum tut eine Amsel das, fragte ich mich plötzlich. Was bringt sie dazu, voller Hingabe ganz allein all diese Arien zum Besten zu geben?
»Der Reviertrieb«, sagt einer meiner Freunde nüchtern. »Damit grenzt sie ihr Gebiet ab.« Okay, dass kann gut sein, aber als Erklärung hört es sich für mich kläglich an. »Und das Männchen will das Weibchen anlocken«, fügt er noch hinzu. An einer solchen Antwort stört mich etwas. Als sei die Sache damit abgetan. Als könne man all die Schönheit und Besonderheit des Amselgesangs auf eine simple Notwendigkeit reduzieren. Auf mich wirkt eine solche Antwort so, als würde man von Bachs Matthäuspassion oder Strawinskys Sacre behaupten, sie seien nur des Geldes und Prestiges wegen komponiert worden. Sie bietet keine Erklärung, sondern macht nur das Fehlen von Fantasie deutlich und verbirgt einen erschreckenden Mangel an Wahrnehmungsvermögen hinter oberflächlichen wissenschaftlichen Klischees. Natürlich, wir kennen alle die Evolutionsgeschichte, das survival of the fittest, Darwin und Dawkins. Aber das sagt überhaupt nichts über die Freiheit der Amsel aus.
»Eine Amsel hat keine Freiheit«, sagt mein Freund. »Sie ist nun einmal so geprägt, das liegt in ihren Genen.« Ja, daran glaubt heutzutage jeder, an die kausale Erklärung. Damit entzaubern wir die ganze Welt. Nicht nur die Art, wie eine Amsel singt, sondern auch das, was Menschen denken und tun, oder was den Einzelnen in seinem Wesen ausmacht. »Es beruht einfach auf deiner DNA, so bist du strukturiert, es liegt einfach in deinen Genen.« Aber auf diese Weise verschwindet etwas Wesentliches: das eigene Ich. Man kann sich selbst nämlich nicht als ein Produkt von Genen wahrnehmen, so als sei man nichts weiter als die Folge von DNA-Prozessen, die außerhalb der eigenen Reichweite liegen. Ich befinde mich ganz und gar nicht außerhalb meiner eigenen Reichweite. Wenn etwas nicht außerhalb meiner Reichweite liegt, dann bin ich das ja wohl selbst. Natürlich, oft bin ich nicht Herr im eigenen Hause, wandele ich manchmal irgendwo durch ein Traumland, verstehe mich selbst nicht ganz oder habe mich nicht im Griff. Aber letztendlich bin ich es doch, der zuständig ist. Wenn man bei mir anklopft, bin ich selbst es, der die Tür öffnet.
Haben Sie schon mal versucht, mit einem Menschen, der an Ihre Tür klopft, ein Gespräch in dem Bewusstsein zu führen, dass alles, was Sie selbst sagen, von Ihren Genen bestimmt wird? Ich gehe jede Wette ein, dass Sie das noch nie getan haben; denn das funktioniert nicht. Um ein Gespräch zu führen, muss man sich selbst als Akteur erleben, als jemanden, der frei und autonom seine Worte wählen kann, der seine Gedanken selbst bestimmt, selbst denkt und handelt. Freiheit ist, ob man nun will oder nicht, eine notwendige Bedingung für menschliche Erfahrung und Interaktion.
Wenn ich zur Sprache der Unfreiheit, der objektivierenden wissenschaftlichen Sprache übergehe, grenze ich meine normalen Erfahrungen aus. Die Sprache der Wissenschaft trennt das Subjektive, die Ich-Perspektive, ab und verliert damit etwas Wesentliches. Nicht nur die Amsel wird darin zu einem seelenlosen Automaten, der sich lediglich so verhält, wie es ihm seine Gene vorgeben, ich selbst werde zu einem unfreien, seelenlosen, kausal determinierten Automaten. Ich hebe mich damit gewissermaßen selbst auf. Ich negiere das eigene unmittelbare Erleben zugunsten einer objektivierenden Perspektive, in der kein »ich« mehr existiert. Damit verschwinde ich in gewissem Sinne auch selbst aus dem Gespräch. Alles, was ich dann noch sage, ist in gleichem Maße durch meine Gene determiniert wie das Singen der Amsel, ich selbst bin nirgendwo mehr zu erkennen. Das ist es, was mich an dem Weg-Erklären der Amsel als solcher stört, all meine Erfahrungen werden für nichtig erklärt. Wohlgemerkt, von Menschen, die selbst als solche nicht existent sind!
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich habe nichts gegen die Wissenschaft, ich plädiere nur für das Bewahren der Erfahrung und das Ernstnehmen dessen, was man in einem Gespräch tut. Das erfordert eine Entscheidung für die Subjektivität, die ebenso radikal ist wie die Entscheidung der Wissenschaft für die Objektivität. Mag auch das, was über die Gene gesagt wird, wahr sein, so singt die Amsel für mich dennoch ein Lied der Freude, einen Lobgesang auf die Welt. Und sie tut damit etwas, was ich selbst gerne könnte und worauf ich sogar eifersüchtig sein kann. Ich bewundere sie für ihre enorme Intensität, ihr großes Talent und ihre göttliche Freiheit. Das erhebt sie weit über alle anderen Sänger, sie ist ein Inbegriff musikalischer Improvisation. Ich kann ihren Gesang auf keine andere Weise hören.
Sokrates erzählt im Phaidon eine ähnliche Geschichte. Er hatte sich in seinen jungen Jahren in das Werk der Naturwissenschaftler seiner Zeit vertieft, weil er begierig auf ihre Erklärungen der Welt war. Aber schon damals ging es ihnen allein um Ursachen, nirgendwo spielte bei ihnen der »Geist« eine Rolle. Um zu erklären, dass Sokrates dort im Gefängnis saß und, kurz bevor er den Schierlingsbecher trank, ein Gespräch mit seinen Freunden führte, konnten sie zwar tausend Ursachen anführen, etwa »weil mein Körper aus Knochen und Sehnen zusammengesetzt ist und die Knochen fest sind und voneinander getrennte Gelenke haben, die Sehnen aber (…) gespannt und nachgelassen werden können« usw., weshalb er hier nun »in gebeugter Haltung« saß. Aber die »wahren Gründe« würden sie überhaupt nicht nennen, »nämlich, dass, weil es den Athenern besser zu sein schien mich zu verurteilen, es auch mir besser schien hier zu sitzen, und gerechter auszuharren und die Strafe über mich ergehen zu lassen, die sie angeordnet haben«. (Phaidon,98c-e) Denn »diese Sehnen und Knochen wären längst in der Gegend von Megara (…), wenn ich es nicht für gerechter und schöner erachtet hätte, statt zu fliehen und davonzulaufen jede Strafe des Staates über mich ergehen zu lassen, die er über mich verhängt«. Aufgrund dessen beschloss Sokrates, sich nicht mehr mit den sogenannten wissenschaftlichen Ursachen zu beschäftigen, sondern nur mit der echten Wirklichkeit, dem »wahren Wesen der Dinge«. (99e) Also mit der Welt des Geistes und der Ideen oder Formen, der Idealvorstellungen davon, wie man ist, wenn man »in idealer Form« ist.
Für die Selbsterkenntnis, die tragende Idee des eigenen Lebens und die Gesprächsführung ist das ein entscheidender Ausgangspunkt. Denn das Leben des Geistes basiert auf Freiheit, und das erfordert es, die subjektive Perspektive ernst zu nehmen.
Jeder Mensch hat eine besondere Aufgabe
Über dem Eingangstor des Orakels von Delphi war der Spruch »Erkenne dich selbst« in Stein gemeißelt. Dieser hatte damals, vor 2400 Jahren, übrigens eine andere Bedeutung als heute. Für uns klingt er wie ein Ansporn, unsere eigene, höchst individuelle und charakteristische Persönlichkeit zu erkennen, wie ein Rezept für Zufriedenheit oder ein Inbegriff von Lebenskunst. Zu Sokrates’ und Platons Zeiten sah man darin allerdings eher einen Ansporn, Einsicht in das allgemein Menschliche zu erlangen und sich zu fragen, was den Menschen in seinem Wesen eigentlich ausmacht. Die Antwort auf diese Frage bestand zunächst in der Klärung dessen, was der Mensch nicht ist: Er ist nicht den Göttern gleich. Denn anders als die Götter ist der Mensch in seinen Möglichkeiten begrenzt, schwach, verletzlich und vor allem sterblich. »Erkenne dich selbst« war eine Warnung vor Übermut und Hybris: Kenne deinen Platz, überschreite nicht deine Grenzen, maße dir nicht zu viel Macht an. Wer sich in seiner Überheblichkeit gottgleich wähnt, wird zugrunde gehen. Hochmut kommt vor dem Fall.
Doch Platon hat dieser Bedeutung noch eine weitere hinzugefügt, in deren Zentrum nicht die Spanne zwischen den Menschen und den Göttern, sondern gerade deren wesentliche Verwandtschaft steht. Der Mensch ist mit dem Licht der Vernunft begabt. Er kann Einsicht in das Wahre, das Gute und das Schöne erlangen und – zum Beispiel wenn er vom Eros berührt wird – sich über sich selbst erheben. Wir Menschen sind zwar begrenzte Wesen, tragen aber auch einen göttlichen Funken in uns. Indem wir diesen Funken nähren und entwickeln, können wir, innerhalb gewisser Grenzen, durchaus göttlich werden. »Erkenne dich selbst« ist der platonischen Auffassung nach nicht nur eine Warnung vor Übermut, sondern auch ein Appell, diesen geistig hochstehenden Bereich in uns selbst zu stärken. Denn er ist der beste Bereich, derjenige, der es uns möglich macht, »in idealer Form« zu sein. Und er erfordert Selbsterforschung, ein Erkunden dessen, was uns als Menschen ausmacht, was »in idealer Form sein« bedeutet, was wirklich wahr, gut und schön ist, kurzum: ein Erkunden dessen, was das Beste in uns selbst genau ist.
Einen zentralen Aspekt dieser Selbsterforschung bildet Sokrates’ Überzeugung, dass jeder Mensch etwas Besonderes zu tun hat, etwas, das seinen natürlichen Anlagen entspricht. Sokrates hielt es für das Beste, sein ganzes Leben daraufhin abzustimmen. Denn nur so konnte man seinen Talenten gerecht werden und sich als Person voll und ganz entwickeln. »So beachte nur z.B. die Maler, die Baumeister, die Schiffsbauer und alle anderen Werkmeister, welchen du willst«, sagt Sokrates im Gorgias, »ein jeder von ihnen lässt für jeden seiner Handgriffe eine bestimmte Ordnung walten und zwingt das eine dem anderen anzufügen, bis sich das Ganze zu einem wohlgeordneten und wohlgegliederten Werk zusammengeschlossen hat«. (Gorgias, 504a) Mit anderen Worten, wie ein Maler oder Baumeister seine Tätigkeiten zu einem fachmännischen Ganzen ordne, müsse sich jeder Mensch darum bemühen, sich selbst zu einem »wohlgeordneten Ganzen« zu formen, indem er seine natürlichen Anlagen entwickele. Und das gilt nicht nur im Kleinen, für den Einzelnen, bei dem diese Ordnung als ein Zustand des »Gedeihens« charakterisiert wird, sondern auch im Großen, in einer Gruppe oder der Gesellschaft, wo eine solche Ordnung »Gerechtigkeit« heißt. Nur so ist »das gute Leben« möglich, die eudaimonia, was wörtlich »einen guten Geist haben«, »guten Mutes sein« bedeutet. Ausgangspunkt ist immer die Abstimmung auf ein fundamentales Grundmotiv, ein vorgegebenes Muster oder eine Ordnung der eigenen Natur und der großen Ideen.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass uns eine solche Auffassung heute fernliegt. Nehmen wir nur einmal die Frage, ob man in der Lage ist, eine persönliche Aufgabe zu finden, die zu den eigenen natürlichen Anlagen passt. Viele Menschen zweifeln nicht nur daran, dass so etwas überhaupt möglich ist, sie fragen sich auch, ob es überhaupt wünschenswert ist, sich darum zu bemühen. Unser ganzes Erziehungs- und Bildungssystem orientiert sich ja an flexibler Einsetzbarkeit und lebenslangem Lernen, an dem liberalistischen Ideal von »Jobhopping« und »Multitasking«. Vorherrschend ist die Vorstellung, wer Karriere machen will, darf sich gerade nicht auf eine Profession beschränken, sondern muss zahlreiche unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Und ist denn ein buntes, abwechslungsreiches Leben nicht auch viel interessanter als die ewig gleiche Leier? Lässt sich aus farbenfrohen Einzelteilen nicht ein viel schöneres Gesamtwerk schaffen als aus langweiliger Gleichförmigkeit?
Viele Menschen sind davon fest überzeugt. Doch schauen wir uns einmal die Kehrseite dieser Auffassung an. Früher oder später gerät jeder von uns einmal in eine Krise oder Sackgasse, in der er sich mit Fragen konfrontiert sieht wie: »Was will ich nun wirklich?«, »Wofür kann ich mich begeistern und wofür nicht?«, »Wer bin ich eigentlich oder worum geht es mir in meinem Leben?« Mitunter sprechen wir mit unserem Partner oder Freunden darüber, engagieren einen Coach oder machen eine Therapie. Dann zeigt sich, dass es durchaus so etwas wie einen roten Faden im eigenen Leben gibt, eine Reihe wiederkehrender Sehnsüchte und Wünsche, die einer bestimmten Anlage in uns entsprechen, eine Reihe fester »Motive«, die die eigene »Lebensmelodie« prägen. Jeder Mensch hat Vorlieben und Abneigungen, Talente, Träume und ein intuitives Gespür dafür, was ihn gedeihen lässt oder ihn zermürbt und ihm die Kraft raubt.
Die Frage ist nicht so sehr, ob man dieses Gespür hat, sondern eher, ob man den Mut hat, ihm zu folgen. Zu tun, was man tun soll, seinen spezifischen Anlagen oder Talenten gerecht zu werden, erfordert nicht nur ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis, sondern vor allem die Courage, Konsequenzen aus dem zu ziehen, was man eigentlich will. Man »muss notwendig das Geschäft mit vollem Ernst betreiben und nicht bloß nebenher«, sagt Sokrates in der Politeia. (370c) »Auf dass ein jeder, das ihm zukommende eine Geschäft betreibend, nicht vielgestaltig, sondern einer





























