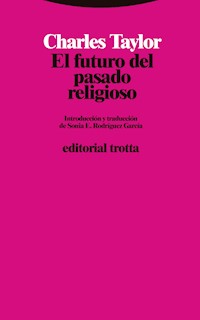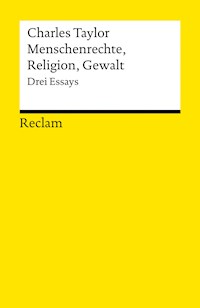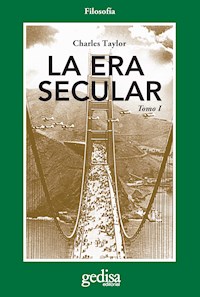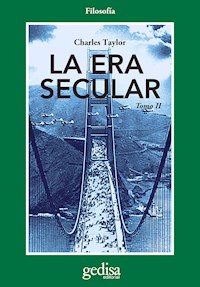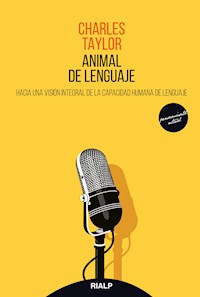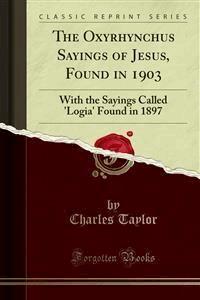37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit Jahrhunderten wird in der Philosophie über die Natur der Sprache gestritten. Für die rationalistisch-empiristische Tradition in der Folge von Hobbes, Locke und Condillac ist sie ein Werkzeug, das Menschen erfunden haben, um Informationen auszutauschen. In seinem neuen Buch bekennt sich Charles Taylor zum gegnerischen Lager der Romantik um Hamann, Herder und Humboldt und zeigt, dass der rationalistisch-empiristische Ansatz etwas Entscheidendes übersieht: Sprache beschreibt nicht bloß, sie erschafft Bedeutung, formt alle menschliche Erfahrung und ist integraler Bestandteil unseres individuellen Selbst.
Taylor geht jedoch noch einen Schritt über das Denken der deutschen Romantik hinaus und entwirft eine umfassende Theorie der Sprache im Sinne des linguistischen Holismus: Sprache ist ein geistiges Phänomen, aber sie kommt auch in künstlerischen Darstellungen, Gesten, Stimmen, Haltungen zum Ausdruck und kennt daher keinen Gegensatz von Körper und Geist. Indem er dieses grundlegende Vermögen des »sprachbegabten Tiers« erhellt, wirft Taylor ein neues Licht darauf, was es heißt, ein Mensch zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 843
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Seit Jahrhunderten wird in der Philosophie über die Natur der Sprache gestritten. Für die rationalistisch-empiristische Tradition in der Folge von Hobbes, Locke und Condillac ist sie ein Werkzeug, das Menschen erfunden haben, um Informationen auszutauschen. In seinem neuen Buch bekennt sich Charles Taylor zum gegnerischen Lager der Romantik um Hamann, Herder und Humboldt und zeigt, daß der rationalistisch-empiristische Ansatz etwas Entscheidendes übersieht: Sprache beschreibt nicht bloß, sie erschafft Bedeutung, formt alle menschliche Erfahrung und ist integraler Bestandteil unseres individuellen Selbst.
Taylor geht jedoch noch einen Schritt über das Denken der deutschen Romantik hinaus und entwirft eine umfassende Theorie der Sprache im Sinne des linguistischen Holismus: Sprache ist ein geistiges Phänomen, aber sie kommt auch in künstlerischen Darstellungen, Gesten, Stimmen, Haltungen zum Ausdruck und kennt daher keinen Gegensatz von Körper und Geist. Indem er dieses grundlegende Vermögen des »sprachbegabten Tiers« erhellt, wirft Taylor ein neues Licht darauf, was es heißt, ein Mensch zu sein.
Charles Taylor, geboren 1929, ist emeritierter Professor für Philosophie und Politische Wissenschaften an der McGill University in Montreal. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Kyoto-Preis, dem John W. Kluge-Preis und dem Berggruen-Preis.
Im Suhrkamp Verlag sind zuletzt erschienen: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung (stw 1929), Ein säkulares Zeitalter (2009 und 2012), Laizität und Gewissensfreiheit (zus. mit Jocelyn Maclure, 2011) und Die Wiedergewinnung des Realismus
CHARLES TAYLOR
DAS SPRACHBEGABTE TIER
Grundzüge des menschlichen Sprachvermögens
Aus dem Englischen von Joachim Schulte
Titel der Originalausgabe: The Language Animal. The Full Shape of Human Linguistic Capacity
First Edition was originally published in English in 2016 by Harvard University Press.
Erstmals erschienen 2016 bei Harvard University Press.
Copyright © 2016 by the President and Fellows of Harvard College
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2017.
Copyright © 2016 by the President and Fellows of Harvard College
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagabbildung: Caspar David Friedrich,
Der Mönch am Meer (1808-1810) Öl auf Leinwand,
© bpk-Bildagentur / Staatliche Museen zu
Berlin, Alte Nationalgalerie / Jörg P. Anders
eISBN 978-3-518-75114-5
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorwort
Teil I Sprache und Konstitution
1 Bezeichnungstheorien und Konstitutionstheorien
2 Wie sich die Sprache entwickelt
3 Jenseits des Codierens von Informationen
Teil II Vom Deskriptiven zum Konstitutiven
4 Die Theorie von Hobbes-Locke-Condillac
5 Die figurative Dimension der Sprache
6 Konstitution 1: Die Artikulation von Bedeutung
7 Konstitution 2: Die schöpferische Kraft des Diskurses
Teil III Weitere Anwendungen
8 Wie Erzählen Bedeutung erschafft
9 Die Hypothese von Sapir und Whorf
10 Fazit: Die Reichweite des menschlichen Sprachvermögens
Namenregister
Für meine Enkelkinder
Francis und AnnikAlba und SimoneSabah und David
Vorwort
Das Thema des vorliegenden Buchs ist das menschliche Sprachvermögen, und es geht mir um den Nachweis, daß dieses Vermögen mehr Formen annehmen kann, als man vermuten möchte. Will sagen: Dieses Vermögen umfaßt Fähigkeiten zur Erschaffung von Bedeutungen, die weit über die viel zu oft als zentral aufgefaßte Fähigkeit zur Codierung und Übermittlung von Informationen hinausgehen.
Besonders angeregt haben mich die sprachtheoretischen Ansichten, die in den 1790er Jahren in Deutschland entwickelt wurden, also in jener Zeit und an jenem Ort, an dem das, was wir unter deutscher Romantik verstehen, in Blüte stand. Die wichtigsten Theoretiker, auf die ich mich stütze, sind Hamann, Herder und Humboldt. Dementsprechend nenne ich die Theorie, die ich ihnen entnehme, die HHH-Theorie.
Die Gegentheorie zu dieser Einstellung wurde von den großen Denkern der frühen Neuzeit ausgearbeitet, also von jenen sei's rationalistischen oder empiristischen Philosophen, die außerdem für die erkenntnistheoretischen Gedanken verantwortlich sind, welche aus dem Werk Descartes' hervorgingen, ja, zum Teil in Opposition zu diesem entwickelt wurden. Die frühen Hauptvertreter dieser Tradition, die ich hier anführe, sind Hobbes, Locke und Condillac. Dementsprechend bezeichne ich diese Richtung abkürzend als HLC-Theorie.
Einem Wissenschaftler des zwanzigsten oder einundzwanzigsten Jahrhunderts, der – wie wir alle – unter dem Einfluß von Saussure, Frege und (bis zu einem gewissen Grad) Humboldt steht, kommt diese Theorie unfaßbar unsubtil vor. Doch einige ihrer Grundannahmen leben in der nachfregeschen analytischen Philosophie sowie in manchen Zweigen der Kognitionswissenschaft weiter.
Ein wichtiger Teil dessen, was ich mir in diesem Buch vorgenommen habe, besteht somit darin, die restlichen Bruchstücke des HLC-Erbes dadurch zu widerlegen, daß ich Einsichten der HHH-Theorie weiterentwickle. Das Ergebnis ist hoffentlich eine sehr viel befriedigendere und daher buntere, wenn auch weniger aufgeräumte Theorie über das Wesen des menschlichen Sprachvermögens.
Als ich mich auf dieses Vorhaben einließ, hatte ich eigentlich vor, diese Weiterentwicklung der romantischen Sprachtheorie durch eine Untersuchung bestimmter Stränge der – aus meiner Sicht eng damit zusammenhängenden – nachromantischen Poetik zu ergänzen. Mit der Arbeit an diesem Projekt begann ich in den späten 1980er und den frühen 1990er Jahren, doch angesichts zahlreicher selbstverschuldeter Unterbrechungen ist es mir bisher nur gelungen, den ersten Teil abzuschließen sowie ein paar verstreute Einzelstudien, die dazu beitragen könnten, daß auch der zweite Teil Gestalt annimmt.
Daher habe ich beschlossen, zunächst dieses Buch über das Sprachvermögen zu veröffentlichen und meine Arbeit über die Romantiker fortzusetzen, um den zweiten Teil hoffentlich als Pendant zu der vorliegenden Untersuchung zum Abschluß zu bringen. Hier werde ich von Zeit zu Zeit Hinweise darauf geben, worum es in dieser zweiten Untersuchung gehen dürfte. Allerdings hoffe ich, daß die vorliegende als solche interessant genug ist, um ihr Erscheinen in einem separaten Band zu rechtfertigen.
In hohem Maße profitiert habe ich von Diskussionen mit zahlreichen Wissenschaftlern, vor allem jenen, die dem Kreis um das Centre for Transcultural Studies angehören. Hervorheben möchte ich hier besonders Akeel Bilgrami, Craig Calhoun, Dilip Gaonkar, Sean Kelly, Benjamin Lee und Michael Warner.
Des weiteren geht mein Dank an Muhammad Velji: Als es darum ging, das Manuskript für die Veröffentlichung vorzubereiten, hat er mich großartig unterstützt, indem er auf Lücken hinwies, die unbedingt gefüllt werden mußten, und besonders indem er brauchbare englische Übersetzungen fremdsprachiger Zitate ermittelte oder erstellte – von sonstigen Verbesserungen ganz zu schweigen. Außerdem schulde ich ihm Dank für die Ausarbeitung des Registers.
Teil ISprache und Konstitution
11
1 Bezeichnungstheorien und Konstitutionstheorien
1
13Welchen Begriff sollen wir uns von der Sprache machen? Das ist eine Fragestellung, die bis in die Anfänge unserer geistigen Überlieferung zurückreicht. In welchem Verhältnis steht die Sprache zu anderen Zeichen? Und zu Zeichen überhaupt? Sind sprachliche Zeichen etwas Willkürliches, oder gibt es Gründe für sie? Was haben Zeichen und Wörter eigentlich, wenn sie Bedeutung haben? Das sind uralte Fragen. Das Thema Sprache gehört seit eh und je zu den Gegenständen der abendländischen Philosophie, aber nach und nach hat es an Wichtigkeit gewonnen. In der Antike gilt es noch nicht als eine der Hauptfragen. Im siebzehnten Jahrhundert – bei Hobbes und Locke – nimmt seine Bedeutung zu. Und im zwanzigsten Jahrhundert wird das Thema nachgerade zur Obsession. Alle Philosophen eines gewissen Rangs haben nun ihre eigene Sprachtheorie: Bei Heidegger, Wittgenstein, Davidson, Derrida und allen möglichen »Dekonstruktivisten« wird die Sprache in den Mittelpunkt der philosophischen Überlegungen gerückt.
In der Neuzeit, wie wir wohl sagen dürfen, also seit dem siebzehnten Jahrhundert, gibt es eine anhaltende Diskussion über das Wesen der Sprache – eine Diskussion, bei der die Philosophen aufeinander reagieren und voneinander zehren. Nach meiner Überzeugung können wir Licht in diese Debatte bringen, wenn wir zwei Haupttypen von Theorien auseinanderhalten. Den ersten Typus möchte ich als »Rahmentheorie« bezeichnen. Damit ist der Versuch gemeint, die Sprache zu verstehen, indem man sich ganz im Rahmen eines 14bestimmten Bilds vom Leben und Verhalten des Menschen, von seinen Zwecken und seinen geistigen Funktionen bewegt, und zwar eines Bilds, das sich seinerseits beschreiben und bestimmen läßt, ohne daß man auf die Sprache Bezug nimmt. Dabei wird die Sprache als etwas gesehen, was in diesem Rahmen, der seinerseits (wie wir feststellen werden) unterschiedlich aufgefaßt werden kann, entsteht und in ihm eine gewisse Funktion erfüllt, während der Rahmen selbst vor der Sprache kommt oder zumindest unabhängig von ihr beschrieben werden kann.
Was den anderen Theorietypus betrifft, möchte ich von einer »Konstitutionstheorie« sprechen. Wie schon das Wort »Konstitution« nahelegt, handelt es sich dabei um den Gegentypus zur Rahmentheorie. Die Konstitutionstheorie vermittelt uns ein Bild, wonach die Sprache neue Zwecksetzungen, neue Verhaltensebenen, neue Bedeutungen ermöglicht und daher nicht im Rahmen eines sprachunabhängig aufgefaßten Bilds vom menschlichen Leben erklärt werden kann.
Damit ist ein wichtiger Streitpunkt zwischen den beiden Theorien genannt. Doch wie sich herausstellt, sind sie im Hinblick auf eine Reihe weiterer wichtiger Fragen ebenfalls verschiedener Meinung. Die beiden Ansätze können einander auch im Hinblick auf mehrere andere Bereiche gegenübergestellt werden. So spricht man manchmal von der instrumentellen Bezeichnungstheorie einerseits und der expressiven Konstitutionstheorie andererseits. Überdies gehen letzten Endes ihre Ansichten auch dann auseinander, wenn es um die Umrisse und Grenzen des intendierten Erklärungsgegenstands – nämlich der Sprache – geht sowie um die Gültigkeit, die atomistischen im Gegensatz zu holistischen Erklärungsweisen zukommt. Im Grunde stehen diese Theorietypen für grundverschiedene Auffassungen vom menschlichen Leben. Doch an irgendeiner Stelle müssen wir das La15byrinth betreten, und ich für mein Teil werde so vorgehen, daß ich mit dieser Gegenüberstellung von Rahmen- und Konstitutionstheorie beginne, um später nach und nach eine Verbindung zu den übrigen Bereichen des Meinungsstreits herzustellen.
2
Das klassische Beispiel für eine Rahmentheorie und zugleich deren einflußreichste, ursprüngliche Form ist das von Locke und Hobbes bis hin zu Condillac ausgestaltete Gedankengebäude. Diese Theorie habe ich in einem eigenen Aufsatz über Sprache und menschliche Natur erörtert.[1] Zusammengefaßt kann man sagen: Die Theorie von Hobbes, Locke und Condillac (HLC) versucht die Sprache innerhalb der Grenzen der von Descartes zur Vorherrschaft gebrachten repräsentationalistischen Erkenntnistheorie der Neuzeit zu verstehen. Demnach gibt es im Inneren des Geistes »Ideen«, bei denen es sich um Bruchstücke von Darstellungen (Repräsentationen) einer weitgehend »äußeren« Realität handeln soll. Wissen bestehe darin, daß die Darstellung tatsächlich mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Das wiederum können wir nur dann zu erreichen hoffen, wenn wir unsere Ideen in Einklang mit einem bewährten Verfahren zusammenfügen. Unsere gegenstandsbezogenen Überzeugungen sind etwas Konstruiertes; sie sind das Ergebnis einer Synthese. Die Frage ist nun, ob die Konstruktion zuverlässig und belastbar ist oder sorglos, schludrig und trügerisch.16
Bei dieser Konstruktion spielt die Sprache eine wichtige Rolle. Eine Bedeutung erhalten die Wörter dadurch, daß sie den dargestellten Dingen mittels der sie darstellenden »Ideen« angeheftet werden. Die Einführung von Wörtern macht es sehr viel leichter, Ideen zu einem belastbaren Bild zu verknüpfen. Diese Erleichterung läßt sich in unterschiedlicher Weise deuten. Nach Hobbes und Locke gestatten es die Wörter, Dinge zu Klassen zusammenzufassen und somit eine pauschale Synthese zu ermöglichen, bei der die nichtsprachliche Anschauung auf die mühsame Assoziation von Einzeldingen beschränkt wäre. Nach Condillacs Meinung verschafft uns die Einführung der Sprache überhaupt erst die Möglichkeit, den gesamten Vorgang der Assoziation zu steuern. Sie gibt uns die »Herrschaft über die Einbildungskraft – empire sur notre imagination«.[2]
Ihren kraftvollsten frühen Ausdruck findet die Konstitutionstheorie bei Herder, und zwar gerade im Zusammenhang seiner Kritik an Condillac. An einer bekannten Stelle der Abhandlung Über den Ursprung der Sprache wiederholt Herder die von Condillac erzählte Fabel (man könnte auch von einer Just-so-Story à la Kipling sprechen), in der es dar17um geht, wie die Sprache in einer Situation hätte entstehen können, in der sich zwei in der Wüste ausgesetzte Kinder befinden.[3] Nach Herders eigenem Bekunden fehlt dieser Geschichte etwas: Sie setzt, wie er meint, voraus, was sie erst erklären soll. Was sie nämlich erklären soll, ist die Sprache – der Übergang von einem Zustand, in dem die Kinder lediglich tierische Schreie von sich geben, zu einem Zustand, in dem sie bedeutungsvolle Wörter gebrauchen. Die assoziative Verknüpfung zwischen Zeichen und mentalem Inhalt ist bereits mit dem animalischen Schrei (den Condillac ein »natürliches Zeichen« nennt) gegeben. Die vorsprachlichen Säuglinge werden, ebenso wie andere Tiere, vor Angst schreien, sobald sie beispielsweise einer Gefahr gegenüberstehen. Das Neue am »instituierten Zeichen« besteht darin, daß die Kinder es jetzt benutzen können, um die damit assoziierte Idee in den Brennpunkt zu rücken und zu manipulieren und somit das ganze Spiel ihrer Vorstellungskraft zu steuern. Der Übergang läuft lediglich darauf hinaus, daß sie zufällig auf den Einfall kommen, die assoziative Verbindung könne in dieser Weise eingesetzt werden.
Das ist ein klassisches Beispiel einer Rahmentheorie. Gedeutet wird die Sprache durch Bezugnahme auf bestimmte Elemente – Ideen, Zeichen und deren assoziative Verbindung –, die ihrer Entstehung vorausgehen. Vorher wie nachher ist die Einbildungskraft am Werk, und Assoziationen finden ebenfalls statt. Neu ist, daß jetzt das Bewußtsein die Zügel in der Hand hält. So kann der Angstschrei benutzt werden, um einer anderen Person durch eine Handlung, die kein bloßer Reflex, sondern eine Willensäußerung ist, mitzu18teilen, daß Gefahr droht. Außerdem kann der Schrei benutzt werden, um mit Bezug auf die Vorgeschichte und die Konsequenzen bestimmter Formen von Bedrohung Schlußfolgerungen zu ziehen.
Diese Art der Steuerung ist natürlich selbst etwas, was vorher nicht vorhanden war. Aber die Theorie sorgt für höchstmögliche Kontinuität zwischen Vorher und Nachher. Die Elemente sind die gleichen, die Zusammenstellung bleibt erhalten, nur die Richtung ist eine andere. Wir können vermuten, daß es genau diese Kontinuität ist, die der Theorie ihre scheinbare Klarheit und Erklärungskraft verleiht: Die Sprache wird ihres geheimnisvollen Charakters beraubt und mit Elementen verknüpft, die allem Anschein nach unproblematisch sind.
Herder geht von der Einsicht aus, daß die Sprache eine neue Art von Bewußtsein ermöglicht – er spricht hier von »Reflexion« oder »Besonnenheit«. Das ist der Grund, weshalb er eine Kontinuitätserklärung, wie sie von Condillac gegeben wird, so enttäuschend und unbefriedigend findet. Mit einer Erklärung, die auf vorher bereits existierende Elemente abhebt, wird die Frage, worin dieses neue Bewußtsein besteht und wie es entsteht, aus Herders Sicht gar nicht angesprochen. Darum wirft er Condillac eine Petitio principii vor: »Der Abt Condillac […] hat das ganze Ding Sprache schon vor der ersten Seite seines Buchs [als] erfunden vorausgesetzt.«[4]
Was meint Herder mit »Besonnenheit«? Das ist gar nicht so leicht zu erklären, und in einem Artikel über die Bedeutung Herders habe ich einen Rekonstruktionsversuch unternommen.[5] Man könnte die Sache wie folgt zu formulieren 19versuchen: Vorsprachliche Lebewesen können auf die sie umgebenden Dinge reagieren. Die Sprache jedoch gibt uns die Möglichkeit, etwas als das, was es ist, zu erfassen. Zwar leuchtet diese Erklärung nicht gerade unmittelbar ein, aber sie bringt uns auf die richtige Spur. Um uns ein klareres Bild zu machen, müssen wir über die Frage nachdenken, was beim Gebrauch der Sprache zum Tragen kommt.
Angenommen, jemand fragt mich nach der Form eines bestimmten Gegenstands, und ich antworte: »Ein Dreieck.« Nehmen wir ferner an, es handele sich wirklich um ein Dreieck. Also trifft meine Feststellung zu. Doch was gehört dazu, daß man in einem Fall wie diesem eine richtige Feststellung treffen kann? Vielleicht kann ich sogar einen Grund für meine Feststellung angeben: »Guck doch, das Ding wird von drei geraden Seiten umschlossen.« Manchmal kommt es jedoch vor, daß ich etwas erkenne, ohne viel oder überhaupt irgend etwas über das Warum sagen zu können. So weiß ich einfach, daß das, was wir im Augenblick hören, eine klassische Symphonie ist. Aber selbst in diesem Fall lasse ich die Berechtigung der Frage nach dem Warum durchaus gelten. Ich kann mir vorstellen, daß ich der Sache weiter nachgehe und auf etwas stoße, was meiner zweifelsfreien Feststellung, daß mein Eindruck stimmt, zugrunde liegt.
Diese Überlegung verdeutlicht, daß ein gewisses Verständnis der Problematik, um die es hier geht, nicht von der Existenz einer deskriptiven Sprache zu trennen ist, also von der Möglichkeit, daß das betreffende Wort richtig oder falsch ist, was wiederum davon abhängt, ob die beschriebene Entität bestimmte Merkmale besitzt. Ein Lebewesen, das sich einer deskriptiven Sprache bedient, handelt dabei aus einer 20gewissen Empfänglichkeit für Fragen dieses Bereichs heraus. Diese Feststellung gilt mit Notwendigkeit. Wir würden niemals behaupten, daß ein papageienhaftes Wesen, dem wir keine derartige Empfänglichkeit unterstellen können, irgend etwas beschreibt – einerlei, wie unfehlbar dieses Wesen das »richtige Wort« herauskreischt. Natürlich, wenn wir bloß drauflosplappern, haben wir die Richtigkeitsfrage kaum im Blick. Das geschieht erst dann, wenn wir unsicher werden und unausgelotete Tiefen des Wortschatzes erkunden. Aber die Richtigkeit ist etwas, worauf wir fortwährend ansprechen, und das ist der Grund, warum wir die Relevanz des Vorwurfs, wir hätten uns falsch ausgedrückt, stets anerkennen. Es ist diese ungerichtete Reaktionsbereitschaft, die ich hier mit Hilfe eines Worts wie »Empfänglichkeit« oder »Sensibilität« in den Griff zu bekommen versuche.
Zur Sprache gehört also Empfänglichkeit für die Frage der Richtigkeit.[6] Im deskriptiven Fall ist die Richtigkeit von den Eigenschaften der beschriebenen Sache abhängig. Hier könnte man von »intrinsischer Richtigkeit« sprechen. Um zu erkennen, was damit gemeint ist, wollen wir uns ein Gegenbeispiel anschauen: Es gibt auch andere Arten von Situationen, 21in denen etwas, was man grob gesprochen ein Zeichen nennen darf, richtig oder falsch gebraucht werden kann. Angenommen, ich richte ein paar Ratten dazu ab, durch die Tür mit dem Dreieck zu gehen, wenn diese als Alternative zu einer Tür mit Kreis angeboten wird. Den Ratten gelingt es, das Richtige zu tun. Das richtige signalbezogene Verhalten besteht hier darin, daß man positiv auf das Dreieck reagiert. Die Ratte, so könnte man sagen, reagiert mit ihrem Hindurchgehen ebenso auf die Dreieck-Tür, wie ich mit der Äußerung des Worts auf das Dreieck reagiere.
Doch jetzt springt die Unähnlichkeit ins Auge. Das Hindurchgehen durch die Tür wird dadurch zur richtigen Reaktion auf das Dreieck, daß es dieses Verhalten ist, das die Ratten zum Käse in der letzten Kammer des Labyrinths führt. Die Richtigkeit, um die es dabei geht, läßt sich durch die erfolgreiche Lösung einer Aufgabe – hier: das Finden des Käsestücks – definieren. Das Reagieren auf das Signal spielt tatsächlich eine Rolle bei der Lösung der Aufgabe, und das ist der Grund, warum es hier so etwas wie einen »korrekten Gebrauch« des Signals überhaupt gibt. Doch dabei handelt es sich um eine andere Art von Richtigkeit als jene, die zum Tragen kommt, wenn man ein Wort auf die Eigenschaften eines beschriebenen Bezugsgegenstands abstimmt.
Aber, so könnte man einwenden, tut die Ratte nicht etwas Ähnliches? Erkennt sie nicht, daß das Dreieck auf »Käse« hinweist? Schließlich reagiert sie doch auf ein Merkmal der Dreieck-Tür, und sei's auch eine rein zweckorientierte Eigenschaft. Die Ratte, könnte man sagen, stimmt ihr Handeln auf ein Merkmal dieser Tür ab, nämlich darauf, daß es die Tür ist, hinter der sich stets der Käse befindet. Dementsprechend wäre es vielleicht besser, diese Auffassung so zu »übersetzen«, daß man behauptet, das Dreieck besage soviel wie »Hier hindurchflitzen!«. Aber dieser Wechsel der Überset22zung macht uns auf das aufmerksam, was mit dieser Angleichung nicht stimmt: Es gibt zwar bestimmt Merkmale der Situation, aufgrund deren »Hier hindurchflitzen!« tatsächlich die richtige Reaktion auf ein Dreieck an der Tür ist, aber daß man es schafft, richtig zu reagieren, steht in keinem Zusammenhang mit der identifizierenden Feststellung dieser oder irgendwelcher sonstigen Merkmale. Das ist der Grund, warum die Frage, unter genau welcher Beschreibung die Ratte richtigliegt – »Das ist der Ort, wo sich der Käse befindet« oder »… wo sich die Belohnung befindet« oder »… wohin man flitzen muß« oder sonst etwas dergleichen –, keinen Sinn hat und gar nicht gestellt werden kann.
Dieses Beispiel verdeutlicht den Unterschied zwischen (einerseits) sonstigen Möglichkeiten, angemessen auf Merkmale der Situation zu reagieren, und (andererseits) der tatsächlichen Bestimmung dessen, worum es sich bei diesen Merkmalen handelt. Letzteres setzt voraus, daß man diese Merkmale irgendwie definiert und ihnen explizit Gestalt verleiht. Damit kommen wir in einen Bereich jenseits des bloßen Reagierens auf solche Merkmale. Anders formuliert: Hier liegt eine weitere Reaktion eigener Art vor, nämlich die Reaktion, die wir in Worten vollziehen. Im typischen Fall definieren wir das Merkmal durch Anwendung des Worts. Das ist der Grund, weshalb diese Anwendung für Fragen der intrinsischen Richtigkeit empfänglich sein muß, also dafür, daß sich das Wort aufgrund der definierten Merkmale anwenden läßt. Sonst ist es eigentlich gar kein Wort.[7]23
Dagegen wollen wir das, worauf die Ratte reagiert, ein »Signal« nennen und mit diesem Ausdruck kennzeichnen, daß diese Reaktion keine Definition von Merkmalen beinhaltet, sondern bloß ein Hindurchflitzen auf dem Weg zur Belohnung. Anders formuliert: Wo das Reagieren auf ein Signal bei der Bewältigung einer Aufgabe eine Rolle spielt, ist das richtige signalbezogene Verhalten durch den Erfolg beim Lösen der Aufgabe definiert. Sofern dieser Erfolg seinerseits nicht durch Bezugnahme auf intrinsische Richtigkeit definiert ist – und das ist beim Zum-Käse-Hinfinden sicher nicht der Fall –, braucht das richtige Reagieren auf das Signal keine Definition bestimmter Eigenschaften vorauszusetzen. Die einzige Voraussetzung ist richtiges Reagieren, und das wiederum ist sowohl damit zu vereinbaren, daß eine Vielzahl solcher Eigenschaften wiedererkannt wird, als auch damit, daß gar keine wiedererkannt werden. Die Ratte weiß einfach, daß sie hier hindurchzuflitzen hat, und das weiß sie ohne Kenntnis irgendwelcher Beschreibungen und ohne zu ahnen, aufgrund welcher Eigenschaften sie hindurchflitzen soll.
Die Richtigkeit, die beim Beschreiben eine Rolle spielt, ist davon grundverschieden. Sie läßt sich nicht ohne weiteres in Begriffen des Erfolgs beim Lösen von Aufgaben definieren – es sei denn, die Aufgabe wird ihrerseits im Sinne der oben 24so genannten intrinsischen Richtigkeit definiert. Mit anderen Worten, die intrinsische Richtigkeit läßt sich nicht auf die bloße »aufgabenbezogene« Richtigkeit zurückführen. Die auf eine Aufgabe bezogene Erklärung funktioniert bei der Sprache nur dann, wenn wir die intrinsische Richtigkeit schon in unsere Erfolgskriterien eingebaut haben.[8]
Diese Unterscheidung ließe sich auch anders treffen, nämlich indem wir Begriffe des Bemerkens oder Gewahrseins heranziehen. Wenn ein nicht sprachbegabtes Tier A ein X bemerkt, heißt das, daß X dazu beiträgt, wie die Reaktion von A ausfällt. Im Regelfall reagiert A in einer bestimmten Weise auf X: Wenn es sich bei X um Nahrung handelt und A hungrig ist, wird sich A nähern, sofern es nicht davon abgehalten wird. Ist X ein Raubtier, wird A die Flucht ergreifen. Handelt es sich bei X um ein Hindernis, wird A ihm aus dem Weg gehen, und so weiter. Sprachliches Bemerken von X dagegen läßt sich weder darauf zurückführen noch damit gleichsetzen, daß unter bestimmten Umständen eine spezifische Reaktion oder Reihe von Reaktionen ausgelöst wird. Nun wäre es möglich, diesen Vorgang als ein von der Reaktionsauslö25sung unabhängiges oder ihr gleichgeordnetes Gewahrsein aufzufassen. Besser wäre es jedoch, wenn man sagte, es beinhalte eine neue Form des Reagierens – ein sprachliches Wiedererkennen –, das sich auf eine bloße Verhaltensreaktion weder zurückführen noch mit ihr gleichsetzen läßt.
Bei uns kann dieses sprachliche Bemerken auch dann vorkommen, wenn wir unsere übliche Verhaltensreaktion unterdrücken – ich kann zwar erkennen, daß mein Gegenüber ein gefährlicher Typ ist, aber ich ergreife trotzdem nicht die Flucht. Oder es kann vorkommen, daß ich zwar wie üblich reagiere, mein sprachliches Wiedererkennen jedoch mehr beinhaltet als die entsprechende Reaktion. Freilich kann es auch bei anderen Tieren geschehen, daß das Bemerken eines normalerweise Interesse erweckenden Etwas keine entsprechende Verhaltensänderung auslöst, wenn die Umstände nicht danach sind: Sieht das Tier Beute, wenn es ganz satt ist, bleibt die Reaktion aus. Beim Menschen dagegen wird es in dem entsprechenden Fall eine Reaktion der eben als »sprachliches Wiedererkennen« bezeichneten Art geben.
Dieses sprachliche Bemerken ist von anderer Art als das bloß Reaktionen auslösende. Es ist ein genauer fokussiertes Gewahrsein, das sich auf den betreffenden Gegenstand als ein zu Recht »W« genanntes Objekt bezieht. Es setzt eine Sammlung der Aufmerksamkeit voraus, die Herder an der Stelle, an der er diese Terminologie einführt, als »Reflexion« oder »Besonnenheit« bezeichnet.[9]26
Kommen wir zurück auf das oben angeführte Beispiel der Ratten, die lernen, wie sie an den Käse kommen. Hier wird die mögliche Doppeldeutigkeit im Gebrauch von Ausdrücken wie »wissen, daß dies die richtige Tür zum Hindurchflitzen ist« sichtbar. Auf die Ratte des obigen Beispiels angewandt, ist damit vielleicht nichts weiter gemeint, als daß sie weiß, wie sie auf das Signal zu reagieren hat. In einem anderen Zusammenhang könnte damit jedoch so etwas gemeint sein wie »wissen, wie man die Beschreibung ›die richtige Tür zum Hindurchflitzen‹ korrekt anwendet«. Bei der bisherigen Erörterung ging es gerade darum zu zeigen, daß es sich dabei um grundverschiedene Fähigkeiten handelt. Daß man die erste dieser beiden Fähigkeiten besitzt, braucht nicht vorauszusetzen, daß man irgendwelche Zeichen aufgrund der von der Realität an den Tag gelegten Merkmale auf diese Realität abstimmt. Der Besitz der zweiten Fähigkeit dagegen besteht wesentlich darin, daß man aus Empfänglichkeit für solche Gründe handelt. Im zweiten Fall muß es um eine bestimmte, das Verhalten anregende Frage gehen, im ersten Fall kann ein solches Thematisieren völlig fehlen.
Daß man diese beiden Fähigkeiten miteinander verwechselt, gereicht vielen Diskussionen über das Verhalten der Tiere zum Nachteil, insbesondere der Kontroverse um die »Sprache« der Schimpansen. Hier können wir von allen Auseinandersetzungen darum, ob die Schimpansen wirklich immer richtig signalisieren, absehen, den Verfechtern der Pro-These einfach recht geben und dennoch die Frage aufwerfen, wie sich die Dinge hier eigentlich verhalten. Daß ein Tier das Zeichen »Banane« nur im Fall des Vorhandenseins 27von Bananen von sich gibt, oder das Zeichen »Banane her!« nur dann, wenn es Lust auf eine Banane hat, ist für sich genommen zur Bestimmung dessen, was vor sich geht, noch nicht ausreichend. Vielleicht haben wir es mit einer Fähigkeit der ersten Art zu tun, und das Tier weiß, wie es die Pfoten bewegen muß, um Bananen – oder Zuwendung und Lob von seinem Trainer – zu bekommen. Tatsächlich ist das Zeichen auf einen Gegenstand mit bestimmten Merkmalen – eine gekrümmte, röhrenförmige, gelbe Frucht – abgestimmt. Das zeigt aber nicht, daß das der Witz der Übung ist; es zeigt nämlich nicht, daß das die Frage ist, auf die das Tier zeichengebend reagiert.
Aber nur in diesem letzteren Fall käme den Schimpansen »Sprache« in dem Sinn zu, in dem wir Sprache besitzen. Im ersteren Fall müßten wir ihr zeichengebendes Verhalten eher als eines ansehen, das zu den geschickten, zweckgerichteten Kunststücken paßt, von denen wir wissen, daß Affen sie lernen können, wie zum Beispiel das von Wolfgang Köhler beschriebene Hantieren mit Stöcken und Herumschieben von Schachteln, um an Dinge heranzukommen, die sich außerhalb ihrer Reichweite befinden.[10] Weder im einen noch im an28deren Fall braucht man zu meinen, daß es sich um eine im eigentlichen Sinn »semantische« Leistung handelt.
Wer dagegen für die Frage der intrinsischen Richtigkeit empfänglich ist, bewegt sich sozusagen in einer anderen Dimension. Hier möchte ich von der »semantischen« oder, all29gemeiner gesprochen, »sprachlichen« Dimension reden (auf das Verhältnis zwischen den beiden werde ich in Abschnitt 3 eingehen). Dann können wir sagen, daß sich im eigentlichen Sinn sprachbegabte Wesen in der semantischen Dimension bewegen. Auf diese Weise kann es uns gelingen, Herders Hin30weis auf die »Reflexion« zu formulieren. Ein reflektierendes Wesen sein heißt: in dieser Dimension operieren, was wiederum bedeutet, daß man aus Empfänglichkeit für Fragen der intrinsischen Richtigkeit handelt.
3
Herders Sprachphilosophie ist in einer Hinsicht holistisch, in der es die von ihm kritisierte traditionelle Anschauung nicht war. Eigentlich ist sie in mehr als einer Hinsicht holistisch, aber im Augenblick möchte ich hervorheben, daß es nicht möglich ist, durch den Erwerb eines Einzelworts in die sprachliche Dimension zu gelangen. Das Eindringen in diese Dimension – die Fähigkeit, Gegenstände durch Wiedererkennen ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken – schafft sozusagen einen neuen Raum, der uns umgibt. Anstatt uns vom Ozean der vorbeirauschenden Empfindungen überwältigen zu lassen, sind wir dazu imstande, die einzelne Welle zu unterscheiden und sie mit klarer, ruhiger Aufmerksamkeit festzuhalten. Diesen neuen Raum der Aufmerksamkeit – des Abstands von der unmittelbaren, instinktiven Bedeutung der Dinge und des oben beschriebenen fokussierten Gewahrseins – möchte Herder als »Reflexion« bezeichnen.[11]
Das ist es, was der Theorie Condillacs nach Herders Auffassung abgeht. Immerhin hat Condillac von dem Schritt, der von den Zeichen der Tiere zu den Zeichen der Menschen führt, eine nuanciertere Vorstellung als Locke: Tiere reagie31ren auf natürliche und »zufällige« Zeichen (der Rauch zum Beispiel ist ein »zufälliges« Zeichen des Feuers, und Wolken sind ein »zufälliges« Zeichen des Regens). Die Menschen kennen außerdem »instituierte« Zeichen. Der Unterschied liegt darin, daß die Menschen mit Hilfe der letzteren den Strom der eigenen Einbildungskraft steuern können, während die Tiere einfach nur den Verbindungen folgen, die durch die Kette der Ereignisse in ihnen hergestellt werden.[12]
Offenbar besteht eine Verbindung zwischen Herders Schilderung der von uns bewirkten Unterbrechung der »ozeanischen« Flut der Empfindungen und Condillacs Vorstellung der Steuerung. Aber was dem französischen Denker noch fehlt, ist jeglicher Sinn dafür, daß die Verbindung zwischen Zeichen und Gegenstand völlig anderer Art sein könnte, sobald man die Kluft überwindet. Diese Verbindung wird nach wie vor in einer ganz verdinglichten – für die Anhänger Lockes typischen – Weise als ein Zusammenhang aufgefaßt, der dinghaft gegeben ist, so daß es ausschließlich um die Frage gehen darf, ob er oder wir die treibende Kraft sind. Condillac vertritt jene Denkweise, von der die Sprache als Werkzeug begriffen wird – als eine Reihe von Verknüpfungen, die wir benutzen können, um Dinge zu konstruieren oder zu steuern. Bei der Sprache gehe es darum, daß sie uns »empire sur notre imagination« ermöglicht.[13] Locke ist die Hauptquelle dieser verdinglichenden Sprache. Häufig gebraucht er, wenn er vom Geist spricht, Bilder des Bauens aus vorgegebenen Materialien.[14] Daß sich im Hinblick auf die Richtigkeit noch ganz andere Fragen stellen, entgeht ihm.
Wer sich auf diese Fragen einläßt, betrachtet die Sprache 32aus einem völlig neuen Blickwinkel. Doch es geschieht leicht, daß man hier etwas verkennt. Condillac war sich gar nicht im klaren darüber, daß er etwas ausgelassen hatte. Herders Standpunkt wäre ihm in der gleichen Weise unverständlich erschienen, in der seine heutigen Erben – die Verfechter der Schimpansensprache, der »sprechenden« Computer und der auf Wahrheitsbedingungen abhebenden Bedeutungstheorien – die entsprechenden Einwände gegen ihre Ansichten unnötig und rätselhaft finden. Das ist der Grund, weshalb Herder an einem für das Verständnis der Sprache in unserer Kultur überaus wichtigen Scheidepunkt steht.
Um uns ein besseres Bild von der Sachlage zu machen, wollen wir der Frage, was Locke und Condillac – aus Herders Sicht – nicht zur Kenntnis nahmen, weiter auf den Grund gehen. Ihre verdinglichte Auffassung des Zeichens rührte nicht daher, daß sie die Sprache vom externen Standpunkt des Beobachters aus betrachteten, wie es heutzutage diejenigen tun, die ich eben als ihre Erben bezeichnet habe. Im Gegenteil, sie wollten die Sprache weitgehend »von innen her« erklären, nämlich durch Bezugnahme auf die Selbsterfahrung des Akteurs. Dabei liebäugelten sie keineswegs mit einer behaviouristischen Theorie à la Skinner, in der die sprachliche Richtigkeit keine Rolle spielt. Vielmehr unterstellten sie, daß diese Art der Richtigkeit problemlos gegeben sei. Die Menschen führten Zeichen ein, die für Gegenstände (oder Ideen von Gegenständen) »stehen« oder sie »bezeichnen« sollten, und sobald diese Zeichen instituiert waren, konnten sie richtig oder falsch angewandt werden. Aus der Perspektive Herders betrachtet, bestand der »Irrtum« unserer Autoren darin, daß sie dieses konstitutive Merkmal nicht wirklich in den Blick bekamen.
Das ist ein Fehler, den man leicht, ja geradezu natürlich be33geht, denn wenn wir sprechen – und ganz besonders dann, wenn wir neue Ausdrücke prägen oder einführen –, bleibt das alles im Hintergrund. Das sind Dinge, die wir als Selbstverständlichkeiten ansehen oder auf die wir uns stützen, wenn wir Ausdrücke prägen, also dafür sorgen, daß Wörter für Dinge »stehen« können, das heißt: dafür sorgen, daß es für uns so etwas wie irreduzible sprachliche Richtigkeit gibt. Der Fehler ist dermaßen »natürlich«, daß er auf einen altehrwürdigen Stammbaum zurückblicken kann, wie Wittgenstein zeigt, indem er ein Augustinus-Zitat als Musterbeispiel für diesen Fehler ins Spiel bringt.
Was wir hier aus dem Blick verlieren, ist der Hintergrund unseres Handelns – etwas, worauf wir uns im Regelfall stützen, ohne es zu bemerken. Insbesondere wird das, was der Hintergrund bereitstellt, so behandelt, als wäre es in jedes Einzelzeichen eingebaut, so als könnten wir einfach loslegen und unser erstes Wort so prägen, daß dieses Verständnis der sprachlichen Richtigkeit bereits darin enthalten wäre. Die Einverleibung des Hintergrundverständnisses bezüglich der sprachlichen Richtigkeit in die Einzelzeichen wirkt sich dahin gehend aus, daß dieses Hintergrundverständnis wirksam ausgeschlossen wird. Als Hintergrund wird es sowieso leicht übersehen; doch sobald wir es in die Einzelzeichen einbauen, versperren wir der Möglichkeit, den Hintergrund als solchen wiederzuerkennen, ganz und gar den Weg.
Dabei handelt es sich um eine Schwäche aller Bezeichnungstheorien der Bedeutung. Aber der seit Descartes und Locke von der neuzeitlichen Erkenntnistheorie in Gang gesetzte Verdinglichungsprozeß – also der Drang, unsere Gedanken und »mentalen Inhalte« zu vergegenständlichen – hat alles noch schlimmer gemacht, sofern das überhaupt möglich ist. Dem Mobiliar des Geistes wurde eine dingähnliche Existenz zugestanden, wie sie den Gegenständen unabhän34gig von jedem Hintergrund zukommen kann. Die Aussperrung des Hintergrundverständnisses der sprachlichen Dimension durch Einverleibung in verdinglichte mentale Inhalte bahnte seiner völligen Ausschaltung den Weg. Diese Ausschaltung erfolgte dann im Rahmen jener behaviouristischen oder semibehaviouristischen modernen Theorien, die bemüht sind, das Denken und die Sprache streng vom Standpunkt des externen Beobachters aus zu erklären. Es fiel nicht schwer, die Assoziationen dingähnlicher Ideen in die Reiz-Reaktion-Verknüpfungen des klassischen Behaviourismus zu übertragen. Es gibt hier offenkundige Abstammungsverhältnisse, die sich von Locke ausgehend über Helvétius bis hin zu Watson und Skinner nachzeichnen lassen.
In diesem Zusammenhang können wir erkennen, daß jeder Versuch, den Hintergrund wiederzugewinnen, einem wichtigen Bestandteil der neuzeitlichen Kultur – nämlich jener Erkenntnistheorie, die man am ehesten mit der wissenschaftlichen Revolution in Verbindung brachte – gegen den Strich gehen mußte. Allerdings haben sich einige philosophische Entwicklungen, die wir heute zu den wichtigsten der letzten beiden Jahrhunderte rechnen, auf diese Wiedergewinnung zubewegt. Ihren Gipfelpunkt erreichten diese Entwicklungen im zwanzigsten Jahrhundert auf ganz unterschiedlichen Wegen im Werk von Heidegger und Wittgenstein, um nur die berühmtesten Spielarten zu nennen. Wenn ich Herder diesbezüglich als Angelpunkt hinstelle, liegt das daran, daß er als einer der Urheber dieser Gegenbewegung eine wichtige Rolle spielte, besonders was unser Verständnis der Sprache betrifft. Damit soll keineswegs behauptet werden, daß er den ganzen Weg bis hin zu dieser Wiedergewinnung zurückgelegt hätte, im Gegenteil: Wie wir später sehen werden, ist es ihm oft komplett mißlungen, die Schlußfolgerungen, die in der von ihm eingenommenen neuen Perspektive angelegt 35sind, wirklich zu ziehen. Dennoch hat er eine entscheidende Rolle bei dem Prozeß gespielt, der dazu führte, daß sich diese Perspektive überhaupt auftat.
Diese Gegenbewegung umschließt zwei überaus weit verbreitete und miteinander verwandte Argumentationslinien, die sich beide an Herders Ansichten veranschaulichen lassen. Die erste besteht darin, einen Teil des Hintergrunds in solcher Form zu artikulieren, daß klar und unbestreitbar zu sehen ist, in welchem Maße wir uns im Denken, Wahrnehmen, Erfahren und Sprachverstehen darauf verlassen. Anschließend zeigt man, daß der auf diese Weise artikulierte Hintergrund mit ausschlaggebenden Merkmalen der anerkannten Lehre unserer erkenntnistheoretischen Tradition nicht zu vereinbaren ist. Auf Argumente dieser Art stoßen wir im zwanzigsten Jahrhundert bei Heidegger, Wittgenstein und Merleau-Ponty. Aber der Wegbereiter dieser Argumentationsweise, in dessen Fußstapfen alle anderen getreten sind, ist kein anderer als Kant.
Die Argumente der transzendentalen Deduktion lassen sich in ganz unterschiedlichem Licht betrachten. Aber einer möglichen Deutung zufolge handelt es sich dabei um die endgültige Verabschiedung einer bestimmten Form des Input-Atomismus, zu der sich der Empirismus bekannt hatte. Da Kants diesbezügliche Kenntnisse von Hume herrührten, schien diese Theorie den Gedanken nahezulegen, daß die Ausgangsebene der Erkenntnis unserer (wie auch immer beschaffenen) Realität in Gestalt partikelhafter Stückchen – nämlich als einzelne »Eindrücke« – daherkommt. Diese Informationsebene lasse sich von einem späteren Stadium abtrennen, in dem diese Stückchen miteinander verbunden werden, beispielsweise zu Überzeugungen, die sich auf Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung beziehen. Daß wir solche Überzeugungen bilden, ist etwas, was einfach geschieht; aber 36indem wir eine für die neuzeitliche Erkenntnistheorie grundlegende Haltung des reflektierten Prüfens einnehmen, kann es uns gelingen, die Grundebene von diesen vorschnell gezogenen Schlußfolgerungen zu trennen. Diese Analyse soll beispielsweise zeigen, daß es im phänomenalen Feld nichts gibt, was der zu leichtfertig zwischen »Ursache« und »Wirkung« eingeschobenen notwendigen Verknüpfung entspräche.[15]
Kant untergräbt diese ganze Denkweise, indem er nachweist, daß sie im Hinblick auf jeden partikelhaften Eindruck voraussetzt, er werde als potentielle Information aufgefaßt. Jeder derartige Eindruck beansprucht auf etwas bezogen zu sein. Das ist das Hintergrundverständnis, das alle unsere Wahrnehmungsunterscheidungen trägt. Die auch von Empiristen getroffene primitive Unterscheidung zwischen Eindrücken des Empfindens und Eindrücken der Reflexion läuft auf eine Anerkennung dieser Sachlage hinaus. Das Brummen in meinem Kopf wird insofern von dem Geräusch unterschieden, das ich aus dem nahen Wald höre, als das erstere meinem Befinden zugerechnet wird, während letzteres mir etwas über das Geschehen dort draußen zu sagen scheint (mein Nachbar bringt wieder seine Kettensäge zum Einsatz). Also selbst eine partikelhafte »Empfindung« muß, um (im empiristischen Sinn, das heißt: im Gegensatz zur Reflexion) wirklich Empfindung zu sein, diese Dimension der »Bezogenheit auf etwas« aufweisen. Später wird man diese Eigenschaft »Intentionalität« nennen, aber Kant spricht noch von einer notwendigen Beziehung zu einem Gegenstand der Erkenntnis: »Wir finden aber, daß unser Gedanke von der Beziehung 37aller Erkenntnis auf ihren Gegenstand etwas von Notwendigkeit bei sich führe.«[16]
Hiervon ausgehend, macht Kant geltend, diese Beziehung zu einem Gegenstand wäre unmöglich, wenn wir den Eindruck wirklich als einen ganz und gar isolierten, mit keinem anderen Gegenstand verbundenen Inhalt auffaßten. Wenn wir ihn als auf etwas bezogen begreifen, siedeln wir ihn nicht in unserem Inneren an, sondern an irgendeinem anderen Ort, zumindest draußen in der Welt, um ihn so in einer Welt unterzubringen, die zwar in vielen Hinsichten, aber unmöglich zur Gänze unbestimmt und uns unbekannt ist. Die Einheit dieser Welt wird von allem vorausgesetzt, was sich als partikelhafte »Information« darstellen könnte. Daher gilt: Was immer wir unter einem solchen Informationspartikel verstehen mögen, es kann nicht völlig ohne Beziehung zu allen sonstigen Partikeln sein. Die Hintergrundbedingung dieser Lieblingsannahme der empiristischen Philosophie – also des simplen Eindrucks – verbietet es uns, die Annahme in jenem radikalen Sinn aufzufassen, den Hume diesbezüglich vorzuschlagen scheint. Wollte man versuchen, gegen diese Hintergrundbedingung zu verstoßen, würde man in Inkohärenz versinken. Wenn es wirklich gelänge, alle Verbindungen zwischen einzelnen Eindrücken zu kappen, so hieße das, daß man jegliches Gefühl des Bewußtseins von irgend etwas verlöre: »Diese [Wahrnehmungen] würden aber alsdann auch zu keiner Erfahrung gehören, folglich ohne Objekt und nichts als ein blindes Spiel der Vorstellungen, d. i. weniger als ein Traum sein.«[17]38
Indem Kant das Hintergrundverständnis der Bezogenheit auf etwas artikuliert, fegt er also den empiristischen Atomismus der Erfahrung beiseite. Nun möchte ich geltend machen, daß Herder etwas ganz Ähnliches tut. Indem er das Hintergrundverständnis der sprachlichen Dimension artikuliert, untergräbt er nämlich seinerseits die damals vorherrschende Bezeichnungstheorie der Sprache und gestaltet sie um. Und um die Parallele noch enger darzustellen: Unter den weggefegten Merkmalen sticht gerade der Atomismus hervor, mithin die Auffassung, die Sprache sei eine Sammlung unabhängig voneinander eingeführter Wörter. Auf diesen Gedanken werde ich bald zurückkommen.
Bei der zweiten Hauptargumentation der Gegenbewegung gegen den Cartesianismus oder den Empirismus geht es um den Versuch, unser Denken im Zusammenhang unserer Lebensform anzusiedeln. Das Bild des Denkens, das die frühen Erkenntnistheorien der Neuzeit zeichnen, ist berüchtigt für seine Desengagiertheit.[18] Das ist auch kein Zufall. Der fundierungstheoretische Impuls – das Bemühen, auf der Basis von vorgegebenen und bereits interpretierten Belegschnipseln eine klare Folgerungsstruktur zutage zu fördern – wirkt darauf hin, das leibgebundene Denken und die tief in den alltäglichen Gepflogenheiten verankerten Voraussetzungen loszulassen.[19] Die Tendenz, auf ein eher situiertes Verständnis 39des Denkens hinzuarbeiten, wird in den Schriften Wittgensteins und Heideggers deutlich sichtbar. Herder gehört jedoch zu denen, die dieser Tendenz den Weg bereitet haben. Ständig betont er, daß wir die Vernunft und die Sprache des Menschen als einen integralen Bestandteil unserer Lebensform begreifen müssen. Man könne sie nicht als etwas auffassen, was ein eigenes Vermögen bildet, das unserer tierischen Natur einfach hinzugefügt wird »wie die vierte Stufe einer Leiter nach den drei untersten«. Wir denken nun einmal gemäß unserer tierischen Arteigenheit, und unsere tierischen Funktionen (Triebe, Gefühle usw.) sind die von vernunftbegabten Wesen: »[…] überall aber wirkt die ganze unabgeteilte Seele.«[20]
Diese beiden Argumentationslinien – Wiedergewinnung des Hintergrunds und Situierung unseres Denkens – sind offensichtlich eng miteinander verflochten. Tatsächlich ist es das überzeugte Festhalten am situierten Denken, das Herder dazu bringt, die sprachliche Dimension auf seine Weise zu artikulieren. Gerade weil er Sprache/Vernunft nicht als bloßen Zusatz zu unserem animalischen Wesen begreifen kann, wird er zu der Frage veranlaßt, welcher Art die Transformation unseres psychischen Lebens als Ganzen sei, die mit der 40Entstehung der Sprache einhergeht. Das ist die Frage, die mit »Reflexion« (oder »Besonnenheit«) zu beantworten ist. Dadurch, daß wir unser Denken als etwas Situiertes begreifen, sehen wir es als eine von mehreren möglichen Formen des psychischen Lebens. Auf diese Weise werden wir uns auch seines charakteristischen Hintergrunds bewußt.
Indem Herder bei diesen beiden miteinander zusammenhängenden Argumentationslinien ansetzt, bewerkstelligt er eine Drehung unseres Nachdenkens über Sprache, die dazu führt, daß wir sie aus einem neuen Blickwinkel sehen. Herders Verständnis des Holismus ist ein gutes Veranschaulichungsbeispiel. Zu den besonders wichtigen und allgemein anerkannten Konsequenzen von Herders Entdeckungsarbeit gehört nämlich eine bestimmte Form von Bedeutungsholismus. Bedeutung hat ein Wort demnach nur im Rahmen eines Lexikons und in einem Zusammenhang sprachgebundener Praktiken, die letzten Endes in eine Lebensform eingebettet sind. Die bekannteste These dieser Art ist in unserer Zeit von Wittgenstein formuliert worden.
Diese Einsicht geht darauf zurück, daß man die Existenz einer sprachlichen Dimension im Sinne der Herderschen Formulierung anerkennt. Sobald man diesen Teil unseres Hintergrundverständnisses artikuliert hat, wird der Bedeutungsatomismus ebenso unhaltbar, wie es der parallele Wahrnehmungsatomismus seit Kant ist. Der Zusammenhang läßt sich wie folgt formulieren:
Ein Wort einer menschlichen Sprache zu beherrschen heißt, einen Sinn dafür zu haben, daß es das richtige Wort ist, oder wie wir das oben ausgedrückt haben: für die Thematik seiner unhintergehbaren Richtigkeit empfänglich zu sein. Anders als die Ratte, die lernt, durch die Tür mit dem roten Dreieck hindurchzuflitzen, kann ich das Wort »Dreieck« ge41brauchen. Das wiederum heißt, daß ich nicht nur auf die entsprechende Gestalt reagieren, sondern sie auch als Dreieck wiedererkennen kann. Aber die Fähigkeit, etwas als Dreieck wiederzuerkennen, schließt die Fähigkeit ein, andere Dinge als Nichtdreiecke zu erkennen. Denn die Beschreibung »Dreieck« hat für mich nur dann Sinn, wenn es etwas (oder manches) gibt, womit sie kontrastiert. Ich muß also eine gewisse Vorstellung von Figuren anderer Art haben. »Dreieck« muß in meinem Lexikon mit anderen Ausdrücken für geometrische Figuren kontrastieren. Aber außerdem gilt: Etwas als Dreieck wiedererkennen heißt, sich auf eine bestimmte Dimension von Eigenschaften zu konzentrieren. Es heißt, daß man die betreffende Sache nicht anhand ihrer Größe, Farbe, Zusammensetzung, Duftnote, ästhetischen Eigenschaften und so fort herausgreift, sondern anhand ihrer Gestalt. Auch dazu ist wieder ein bestimmter Kontrast nötig.
Zumindest einige dieser Kontraste und Zusammenhänge müssen wir artikulieren können. Wer überhaupt kein Gefühl dafür hat, wodurch ein Wort zum richtigen Wort wird, der kann das Wort »Dreieck« nicht als das richtige wiedererkennen. Das gilt beispielsweise dann, wenn er nicht einmal versteht, daß etwas nicht aufgrund seiner Größe oder Farbe, sondern aufgrund seiner Gestalt ein Dreieck ist. Und dafür kann man kein Gefühl haben, wenn man außerstande ist, irgend etwas zu sagen – nicht einmal dann, wenn nachgefragt wird und Eselsbrücken gebaut werden. Freilich gibt es Fälle, in denen wir die spezifischen Merkmale einer wiedererkannten Sache nicht artikulieren können. So kann es sich beispielsweise verhalten, wenn wir es mit einer bestimmten emotionalen Reaktion auf etwas oder mit einer ungewöhnlichen Farbschattierung zu tun haben. Aber selbst in solchen Fällen können wir angeben, daß es sich um ein Gefühl beziehungsweise eine Farbe handelt. Außerdem können wir feststellen, 42daß uns die Worte fehlen. Das Gebiet, auf dem uns unsere Beschreibungen im Stich lassen, liegt in einem Kontext von Worten. Wären wir außerstande, irgend etwas dergleichen zu sagen – könnten wir also nicht einmal sagen, daß es sich um ein Gefühl handelt oder daß es unbeschreiblich ist –, dann würde man uns gar kein Sprachbewußtsein zusprechen. Und wenn wir dennoch irgendeinen Laut von uns gäben, könnte man ihn nicht als Wort beschreiben. Wir ständen gänzlich außerhalb der sprachlichen Dimension.[21]
Mit anderen Worten: Hätten wir ein Wesen vor uns, das, wenn es sich einem bestimmten Gegenstand gegenübersieht, bloß einen Laut ausstößt, aber keinen Grund dafür angeben kann, das heißt: in keiner Weise – außer durch die Äußerung dieses Lauts – erkennen läßt, daß es für die (irreduzible) Richtigkeit dieses Worts einen Sinn hat, müßten wir urteilen, daß es in der gleichen Weise wie die weiter oben beschriebenen Tiere (etwa das papageienhafte Wesen) lediglich auf Signale reagiert.
Daraus ergibt sich, daß ein deskriptives Wort wie »Dreieck« in einem Sprachlexikon nicht allein vorkommen könnte. Es muß von einem ganzen Knäuel von Ausdrücken umgeben sein, die zum Teil mit ihm kontrastieren, es zum anderen Teil jedoch situieren, ihm also einen Ort in seiner Eigenschaftsdimension zuweisen, ganz zu schweigen von der umfassenderen Sprachmatrix, in die die diversen Tätigkeiten (wie Messen, Geometrie und Entwerfen), bei denen unsere Äußerungen über Dreiecke eine Rolle spielen, eingebettet sind und in der das Beschreiben selbst als einer von mehreren Sprechakttypen vorkommt.
Der Bedeutungsholismus läuft auf folgendes hinaus: Ein43zelwörter können überhaupt nur im Zusammenhang einer artikulierten Sprache Wörter sein. Die Sprache ist nichts, was man Wort für Wort nacheinander aufbauen könnte. Ein ausgereiftes Sprachvermögen existiert nicht in dieser Form und könnte gar nicht in dieser Form existieren, denn jedes Wort setzt ein Sprachganzes voraus, das dem Wort als Wort seine volle Kraft verleiht, das heißt: als ausdrucksstarke Gebärde, die uns in der Sprachdimension einen Ort zuweist. In dem Augenblick, in dem Kinder ihr »erstes Wort« zu sagen beginnen, sind sie gewiß auf dem Weg hin zur vollständig ausgeprägten menschlichen Sprache, aber dieses »erste Wort« ist etwas ganz anderes als ein Einzelwort im Rahmen einer entwickelten Sprache. Die Spiele, die das Kind mit diesem Wort spielt, äußern und manifestieren eine ganz andere Einstellung zu dem betreffenden Gegenstand als der deskriptive Ausdruck des erwachsenen Sprechers. Es handelt sich nicht um einen Baustein unter vielen, aus dem dann nach und nach die Sprache des Erwachsenen errichtet würde. Auf diesen Gedanken komme ich weiter unten zurück.
Genau darin besteht der Irrtum der traditionellen Bezeichnungstheorie. Nach Condillac ist ein Lexikon mit einem einzigen Wort durchaus denkbar. Bei ihm lernen die Kinder zunächst ein Wort und später weitere Wörter. Sie errichten den Bau der Sprache Wort für Wort. So verfährt Condillac deshalb, weil er das für die Sprache unerläßliche Hintergrundverständnis außer acht läßt oder es vielmehr, ohne es zu merken, in die Einzelwörter einmontiert. Aber daß dieses Vorgehen nicht möglich ist, geht aus der Art und Weise hervor, in der Herder das eigentliche Wesen des Sprachverstehens artikuliert. An einer bereits zitierten Stelle sagt er zu Recht, daß Condillac »das ganze Ding Sprache« voraussetzt.[22]44
Diese Formulierung scheint die holistische Natur des Phänomens in gelungener Weise zu erfassen. Aber auch an dieser Stelle enttäuscht Herder mit Blick auf die Schlußfolgerungen, die er aus seinen Ausführungen über die Geburt der Sprache zieht. Es ist eben doch so, daß seine Geschichte von der Geburt eines einzigen Worts erzählt. Und zum Schluß streut er leider noch die folgende rhetorische Frage ein: »Was ist die ganze menschliche Sprache als eine Sammlung solcher Worte?«[23] Trotzdem möchte ich Herder das Verdienst zuschreiben, uns auf die richtige, zum Holismus hinführende Spur gebracht zu haben. Das möchte ich nicht nur deshalb tun, weil dieser Gedanke offensichtlich in seinen tatsächlich artikulierten Äußerungen implizit enthalten ist, sondern auch deshalb, weil er selbst die vermittelnde Argumentation schon ausgeführt hat.
Er sieht ein, daß das Wiedererkennen von etwas als etwas – jenes Wiedererkennen, das es uns gestattet, einen deskriptiven Ausdruck für dieses Etwas zu prägen – voraussetzt, daß wir ein diesbezügliches Unterscheidungsmerkmal ermitteln. Daß das Wort für X das richtige Wort ist, hat einen Grund. Ohne einen Sinn für das, wodurch etwas zum richtigen Wort wird, gibt es gar keinen Sinn für die Richtigkeit eines Worts: »Deutlich unmittelbar, ohne Merkmal? so kann kein sinnliches Geschöpf außer sich empfinden, da es immer andere Gefühle unterdrücken, gleichsam vernichten und immer den Unterschied von zweien durch ein drittes erkennen muß.«[24]
Richtig verstanden, zeigt die von Herder artikulierte und allmählich ausgearbeitete Darstellung der sprachlichen Dimension, daß die klassische bezeichnungstheoretische Ge45schichte des Spracherwerbs aus prinzipiellen Gründen aussichtslos ist. In einem gewissen Sinn beinhaltet diese Geschichte eine tiefreichende Verwechslung von bloßem Signal und Wort. Es ist nämlich so: Ein Repertoire mit einem einzigen Signal ist tatsächlich möglich. Man kann etwa einen Hund dazu abrichten, auf einen einzigen Befehl zu reagieren, und später kann ein weiteres Signal hinzukommen und noch später noch ein weiteres. Im ersten Stadium gilt: Was immer von dem einen und einzigen Signal verschieden ist, ist gar kein Signal. Dagegen kann es kein Sprachlexikon geben, das aus einem einzigen Wort besteht. Der Grund besteht darin, daß Richtigkeit beim Signal einfach darauf hinausläuft, daß man richtig reagiert. Beim Wort dagegen setzt sie mehr voraus, nämlich eine Form von Wiedererkennen. Und damit sind wir in der Dimension des Sprachlichen.
Der Bedeutungsholismus ist eine der wichtigsten Ideen, die aus Herders neuer Betrachtungsweise hervorgegangen sind. Humboldt greift darauf zurück, wenn er sein Bild der Sprache als Gewebe entfaltet.[25] Ihre einflußreichste Form nahm diese Idee zu Beginn des vorigen Jahrhunderts an, als Saussure sein bekanntes Prinzip verkündete, in der Sprache gebe es keine positiven Ausdrücke, sondern nur Unterschiede: »Dans la langue il n'y a que des différences sans termes 46positifs.«[26] Dieses Schlagwort bedeutet, daß wir die sprachliche Bedeutung nicht als ein Ausrichten von Lauten (Wörtern) an Dingen begreifen können; vielmehr stimmen wir Unterschiede im Klang auf Unterschiede des Sinns ab. Im Deutschen etwa ergibt der lautliche Unterschied zwischen G und R in einem bestimmten Kontext die den Sinn betreffende Unterscheidung zwischen »Gabe« und »Rabe«. Anders ausgedrückt: Ein Ausdruck bekommt seine Bedeutung nur im Feld der relevanten Kontraste. In dieser Form hat Saussures Prinzip praktisch Allgemeingültigkeit erlangt. Es ist ein Axiom der Sprachwissenschaft.
Humboldts Gewebe-Metapher verdeutlich, daß unser Verständnis eines Einzelworts stets in unser Verständnis der Sprache als Ganzes und der sie definierenden vielfältigen Regeln und Zusammenhänge eingebettet ist. Prägen wir etwa ein neues Verb und bilden mit Hilfe der entsprechenden Modifikation die Vergangenheitsform, versteht jeder das Gesagte. Ebenso haben wir auch bei jedem sonstigen Wort eine Vorstellung davon, wie es mit anderen Wörtern zusammenhängt, beispielsweise welche Verbindung mit anderen einen so gebildeten Satz sinnvoll machen würde. Wie es sich damit verhält, kann man etwa an Chomskys bekanntem Paradebeispiel für Absurdität erkennen: »Farblose grüne Ideen schlafen wütend« (colourless green ideas sleep furiously). Mit Hilfe einer anderen berühmten Metapher vergleicht Humboldt die Erwähnung eines Worts mit dem Anschlagen eines Tons auf einem Tasteninstrument. Dieser Ton läßt das ganze Instrument mitschwingen.[27]
Aber die wohl eindringlichste philosophische Anwendung 47dieser Idee findet sich im Werk des späten Wittgenstein. Seine gründliche Widerlegung der Augustinus unterstellten Bezeichnungstheorie der Bedeutung kommt immer wieder auf das Hintergrundverständnis zurück, das wir in Anspruch nehmen müssen, um überhaupt reden und verstehen zu können. Die herkömmliche Theorie ist der Auffassung, ein Wort erlange seine Bedeutung dadurch, daß es zur Benennung eines Gegenstands oder einer Idee verwendet wird, und diese Bedeutung werde dann durch eine hinweisende Definition weitergegeben. Wittgenstein dagegen verweist auf den sprachlichen Hintergrund, den diese einfachen Akte des Benennens und Zeigens voraussetzen.[28] Die Bedeutung, die unsere Wörter haben, kommt ihnen nur im Rahmen der »Sprachspiele« zu, die wir mit ihnen spielen; und diese wiederum finden ihren Kontext im Rahmen einer ganzen Lebensform.[29]
48Dieser Bedeutungsholismus ist mit der Tatsache verbunden, daß die Menschen als sprachbegabte Tiere auch in einer größeren Welt leben, die über die episodische Gegenwart hinausgeht. Die gegenwärtige Erfahrung der Menschen ist stets von dem Gefühl begleitet, daß ihr eine persönliche und soziale Geschichte vorausging, daß eine Zukunft auf sie folgen wird und daß das, was in ihrer jetzigen prekären Lage geschieht, in einem umfassenderen räumlichen Zusammenhang stattfindet. Man kann sogar behaupten, daß die Menschen nicht nur in ihrer unmittelbar gegebenen Situation leben, sondern auch in einem gewaltigen Kosmos oder Universum, das sich, von unserer momentanen Umgebung her gesehen, weit hinaus in Zeit und Raum erstreckt. Mag sein, daß man über die entlegenen Gefilde dieses Kosmos während eines großen Teils der Menschengeschichte nicht wirklich etwas wußte, sondern sich auf Mythen verließ oder ungesicherte Vermutungen anstellte; aber ohne diesen größeren Kontext kommt man jedenfalls nicht aus.
Aber der umfassende Kontext ist zugleich ein sozialer Zusammenhang: Wir leben unter Verwandten, in einer Ortschaft, und vielleicht gehören wir auch einem Volk an. In diesen familialen oder gesellschaftlichen Zusammenhängen 49interagieren wir durch verschiedene Rollen mit anderen Menschen; außerdem üben wir verschiedene Tätigkeiten aus, die ihrerseits neue Kontexte erschaffen. All dies wird in der Sprache erfaßt, beispielsweise in der Sprache der Blutsverwandtschaft, in der Sprache der unterschiedlichen politischen und sozialen Positionen – Polizeibeamter, Arzt, Präsident –, in der Sprache der diversen Tätigkeiten und Bereiche, etwa des Bereichs der Politik, der Volkswirtschaft, der Religion, der Unterhaltungsbranche usw. Dabei geht es nicht nur darum, daß diese Rollen, Bereiche und Beziehungen ohne Sprache gar nicht möglich wären (das ist ein Gedanke, auf den ich später zurückkommen werde). Vielmehr bedeutet der Sprachholismus auch, daß wir gar nicht umhinkönnen zu spüren, inwiefern sich diese Rollen und Bereiche zueinander verhalten sollen und inwiefern sich einige von anderen abheben. Beispiele sind das Verhältnis zwischen Eltern und Kind, zwischen einem Kontext ernsthafter Verhandlungen im Gegensatz zu einem Kontext spielerischer Beziehungen oder zwischen Arbeit und Erholung usw. Die Sprache der Gesellschaft lernen heißt sich ein Vorstellungsmuster davon zu eigen machen, wie die Gesellschaft funktioniert und handelt, wie sie sich im Laufe der Zeit historisch entwickelt hat und in welchem Verhältnis sie zu den Dingen steht, die außerhalb liegen, etwa zur Natur, zum Kosmos oder zum Göttlichen.
In erster Linie geht es mir jedoch nicht darum, daß diese Wörter für Rollen, Beziehungen, Tätigkeiten und Lebensbereiche es ermöglichen, daß sie je für sich zu unserer Welt gehören, sondern es geht mir um die holistische Einsicht, daß sie durch unsere sprachlichen Ausdrücke für sie in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden, etwa als kontrastierende oder einander abwechselnde Elemente oder als solche, die einander zum Teil durchdringen. Daß man sie sprachlich in 50den Griff bekommt, läuft aufs gleiche hinaus wie: einen Sinn für die zwischen ihnen bestehenden Verhältnisse haben. Dabei kann es durchaus sein, daß der eine oder andere Aspekt dieser Verhältnisse mehr oder weniger deutlich artikuliert ist; aber ein gewisses Sensorium für diese Verhältnisse ist im menschlichen Leben, insofern es sprachlich geprägt ist, stets vorhanden.[30]
Das ist ein Teil dessen, worauf Heidegger mit seiner bekannten Formulierung, die Sprache sei das »Haus des Seins«, hinauswill: Das Haus ist eine Umgebung, in der die Dinge durch unser Handeln und Planen in eine bestimmte Ordnung gebracht werden. Verschiedene Zimmer sind für verschiedene Verwendungen, für verschiedene Personen oder für verschiedene Zeiten vorgesehen, vielleicht aber auch für das Aufbewahren verschiedener Arten von Dingen usw. Das heißt, die Art und Weise, in der die Dinge durch die Sprache, die wir zu einer bestimmten Zeit sprechen, in ein Verhältnis zueinander gebracht und arrangiert werden, wird als eine Form des aktiven Zusammenstellens gesehen. Dieses Herstellen wechselseitiger Beziehungen liegt im Wesen der Sprache.[31]51
Doch was diesem Bild besondere Eindringlichkeit verleiht, ist der Umstand, daß wir diese Zusammenstellung als eine von verschiedenen möglichen menschlichen Bedeutungszuschreibungen begreifen. Unser Gefühl für die Bedeutungen, die den Dingen in ihren verschiedenen Dimensionen zukommen, bekommt in der Sprache Halt. Was uns jedoch im Hinblick auf diese Ausdrucksmöglichkeiten Unbehagen bereiten könnte, ist die Tatsache, daß wir Verwendungen der Sprache entwickelt haben, die die Beschreibung und Erklärung von Dingen gestatten, welche heute nicht mehr durch Bezugnahme auf menschliche Bedeutungen gekennzeichnet werden. 52Ein paradigmatisches Beispiel ist die postgalileische Naturwissenschaft. Als eine Tätigkeit unter vielen befindet sie sich im Inneren des »Hauses«, aber als Bild der Realität führt sie uns über das »Haus« hinaus und präsentiert uns ein Universum, das in allen Arrangements menschlicher Bedeutungen »unbehaust« bleibt.
Es ist also nichts daran zu ändern, daß wir als Menschen in einem umfassenden sozialen, ja sogar kosmischen Zusammenhang leben. Hier scheint die Überlegung auf der Hand zu liegen, daß nur Wesen mit Sprache in einem solchen Zusammenhang existieren können, denn man braucht Sprache, um eine sei's noch so abenteuerliche Vorstellung von dem zu haben, was unsere unmittelbar gegebene Situation nicht beeinflußt und nicht beeinflussen kann. Aber eigentlich geht es um die Einsicht, daß wir als sprachbegabte Wesen gar nicht umhinkönnen, auf diese Weise in einem weiteren Weltzusammenhang zu leben.
Dieser Sprachholismus hat aber noch eine weitere Facette. Sprachliches Bewußtsein haben heißt, daß man ständig an die Grenzen dieses Bewußtseins stößt. Wie wir wissen, fallen uns bestimmte Äußerungen leicht. Manche Fragen zum Beispiel können wir ohne weiteres beantworten: »Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen?« – »Gestern.« »Was für ein Baum ist das?« – »Eine Eiche.« Aber manchmal kommt es vor, daß wir nicht weiterwissen, etwa dann, wenn Fragen der folgenden Art gestellt werden: »Warum hast du das getan?«, »Was hast du dabei empfunden?« oder »Warum magst du dieses Bild nicht?«. In diesen Fällen kann das Problem darin bestehen, daß wir für uns selbst (oft nicht ohne Grund) undurchsichtig sind. Es kann aber auch daran liegen, daß uns einfach die Worte fehlen. Der Stadtbewohner weiß womöglich schon dann nicht weiter, wenn er gefragt wird, was für ein Baum das ist, unter dem er steht.53
Es ist nicht nur so, daß wir dieses Gespür haben für das, was wir (ohne weiteres) sagen oder nicht sagen können, sondern darüber hinaus werden wir häufig dazu angeregt, die Reichweite unseres Artikulationsvermögens auszudehnen. Wir könnten den Stadtbewohner dazu kriegen, sich über Blattformen, Arten von Baumrinde usw. zu informieren, so daß er irgendwann problemlos Eichen und Ulmen auseinanderhalten kann. Oder wir könnten zu Gedanken angeregt werden, die eher auf Selbsttransformation angelegt sind, und auf diese Weise zu einem tieferen Verständnis unserer Motive, Neigungen und Abneigungen gelangen. Die Erweiterung des Artikulationsvermögens kann also zu einer vergleichsweise geringen Umgestaltung unserer Erfahrung führen, wie im Fall der Unterscheidung zwischen Ulmen und Eichen, sie kann aber auch sehr viel tiefer reichen, etwa wenn wir verschiedene Formen der Zuneigung und ihrer Voraussetzungen unterscheiden lernen, bis es uns gelingt, unsere persönlichen Beziehungen und die damit verbundenen Spannungen und Konflikte auf ganz neue Weise zu deuten.
Auf einer abstrakteren und stärker objektivierten Ebene ähnelt diese Form der Veränderung einem durch Paradigmenwechsel herbeigeführten Wandel in der Art und Weise der wissenschaftlichen Forschung. Hier handelt es sich nicht nur darum, neue Wörter hinzuzufügen, sondern auch darum, neue Modelle zu übernehmen und Muster zu erkennen, die bisher nicht wahrgenommen wurden.
Das Verstehen der eigenen Person kann – ebenso wie die Menschenkenntnis im allgemeinen – auch dadurch gefördert werden, daß man neue Modelle anerkennen lernt. Das ist der Grund, weshalb die Literatur eine derartige Quelle von Einsichten ist. So zeichnet etwa Balzac in Les Chouans das Porträt eines Geizkragens mittels einer Aneinanderreihung von Handlungen, Worten und Reaktionen, durch die das 54Muster von Obsessionen, die nach seiner Auffassung diesen Typus definieren, zutage gefördert wird.[32]
Humboldt zeigt, wie wichtig diese Grenze zwischen dem Sagbaren und dem ist, was jenseits dieser Grenze liegt, und gibt außerdem Aufschluß über unseren stets wiederkehrenden Drang, diese Grenze weiter hinauszuschieben und das Gebiet unseres Artikulationsvermögens zu erweitern. Auf einer banaleren Ebene gilt, daß wir häufig genötigt sind, neue Wörter für Dinge zu finden, die wir sagen wollen, etwa wenn der Gesprächspartner meint: »Ich kann dich nicht verstehen, kannst du es nicht auf andere Weise erklären?« Doch aus Humboldts Sicht werden wir zudem dazu gedrängt, uns für Sprachbereiche zu öffnen, über die bisher nichts gesagt werden konnte. Gewiß gehören die Dichter zu denen, die sich auf dieses Unterfangen einlassen. So spricht T. S. Eliot von a raid on the inarticulate – einem »Angriff auf das Undeutliche«.[33] Humboldt wiederum unterstellt einen Trieb, der darauf abzielt, »alles, was die Seele empfindet, mit dem Laut zu verknüpfen«.[34] In Kapitel 6 werde ich auf diesen Trieb ebenso zurückkommen wie auf die Möglichkeit, immer weiter in den Bereich des Unsagbaren vorzudringen.55
4
Unsere Vorstellung von der semantischen Dimension müssen wir allerdings ein wenig erweitern. Eigentlich sollten wir jetzt von der sprachlichen Dimension sprechen, denn das Semantische ist nur eine von mehreren Facetten oder Verwendungen der Sprache. Oben war von der deskriptiven Richtigkeit die Rede. Doch in der Sprache beschränken wir uns nicht auf das Beschreiben. Es gibt auch noch andere Hinsichten, in denen ein Wort le mot juste