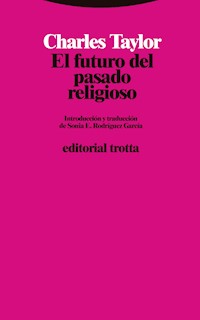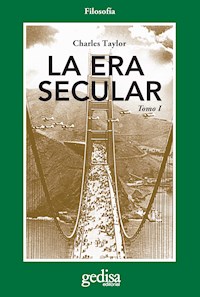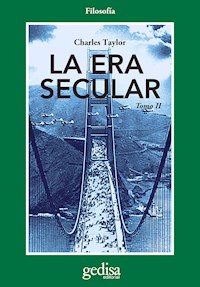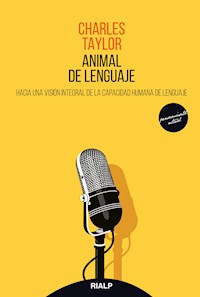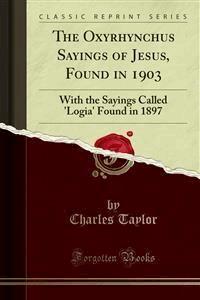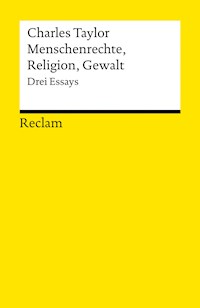
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bbibliothek
- Sprache: Deutsch
Charles Taylor zählt zu den großen Philosophen unserer Zeit. In eindringlichen Analysen hat er (wie in den hier exemplarisch für sein Werk stehenden drei Aufsätzen) die Ursprünge der modernen Identität rekonstruiert. Zugleich hat er damit eine innovative Neu-Erzählung des säkularen Zeitalters verfasst. Menschenrechte, Religion und Gewalt bilden die zentralen Angelpunkte seines Denkens. In immer neuen Anläufen zeigt er Wege auf, wie die vielfältigen Krisen der Gegenwart moralisch, politisch und gesellschaftlich besser gelöst werden könnten: Wer die Gegenwart verstehen will, kommt an den kritischen Analysen Taylors nicht vorbei. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Charles Taylor
Menschenrechte, Religion, Gewalt
Drei Essays
Übersetzt von Ute Kruse-Ebeling und Holger HanowellHerausgegeben von Michael Kühnlein
Reclam
2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2021
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961935-4
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014196-0
www.reclam.de
Inhalt
Bedingungen für einen freiwilligen Konsens über Menschenrechte
Was ist Religion? Über die Vieldeutigkeit eines umkämpften Begriffs
Anmerkungen über die Ursachen von Gewalt. Von damals bis heute
Zu dieser Ausgabe
Anmerkungen
Literaturhinweise
Nachwort: Die Drift des Verstehens. Charles Taylors Werk – Über Menschenrechte, Gewalt und Religion in einer globalisierten Welt
Zum Autor
[7]Bedingungen für einen freiwilligen Konsens über Menschenrechte
Einleitung
Was würde es bedeuten, zu einem echten, freiwilligen internationalen Konsens über Menschenrechte zu gelangen? Vermutlich käme es dem nahe, was Rawls in seinem Buch Political Liberalism als »übergreifenden Konsens« beschreibt.1 Das heißt: Verschiedene Gruppen, Länder, religiöse Gemeinschaften und Kulturen würden sich trotz ihrer unvereinbaren Grundauffassungen über Theologie, Metaphysik, die menschliche Natur usw. auf bestimmte Normen menschlichen Verhaltens einigen. Alle würden dies auf ihre je eigene Art aus ihrer tieferen Grundanschauung heraus begründen. Wir würden uns auf diese Normen einigen, obwohl wir unterschiedlicher Meinung darüber wären, warum es sich um die richtigen Normen handelt, und wir wären ungeachtet der unterschiedlichen zugrundeliegenden tieferen Überzeugungen dazu bereit, mit diesem Konsens zu leben.
Die Idee wurde bereits 1949 von Jacques Maritain formuliert:
Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Art, den Glauben an die Menschenrechte und das Ideal der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu begründen, die einzige ist, die [8]sich fest auf Wahrheit gründet. Das hält mich nicht davon ab, bei diesen praktischen Überzeugungen mit Menschen übereinzustimmen, die sich ihrerseits sicher sind, dass ihre eigene Art, sie zu begründen, die sich von meiner grundlegend unterscheidet oder ihr gar entgegengesetzt ist, […], gleichermaßen die einzige ist, die sich auf Wahrheit gründet.2
Ist eine solche Art von Konsens möglich? Davon bin ich überzeugt, vielleicht wegen meiner optimistischen Natur. Doch wir müssen von vornherein zugeben, dass nicht ganz klar ist, worum sich der Konsens bilden würde, und wir beginnen gerade erst die Hindernisse zu erkennen, die wir auf dem Weg dorthin überwinden müssten. Ich möchte hier ein wenig über diese beiden Themen sprechen.
Zunächst: Worum würde es bei diesem Konsens gehen? Man könnte meinen, dies sei offensichtlich: um Menschenrechte. Darum ging es in unserer ursprünglichen Frage. Doch es gibt ein unmittelbares Hindernis, auf das schon häufig hingewiesen wurde. Der Rechtsdiskurs hat seinen Ursprung in der westlichen Kultur. Bestimmte Merkmale dieses Diskurses wurzeln in der westlichen Geschichte, und zwar dort allein. Das bedeutet nicht, dass etwas sehr [9]Ähnliches wie die zugrundeliegenden Normen, die in Rechtskatalogen zum Ausdruck kommen, nicht auch anderenorts auftauchen würden, doch werden sie dann nicht in dieser Sprache ausgedrückt. Wir können nicht ohne weiterreichende Prüfung unterstellen, dass ein zukünftiger freiwilliger Weltkonsens zur Zufriedenheit aller in der Sprache der Rechte formuliert werden könnte. Vielleicht ginge das, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch zum Teil, zum Teil aber nicht, wenn wir zwischen den Dingen, die im westlichen Rechtspaket miteinander verknüpft wurden, unterscheiden.
Das soll nicht heißen, dass wir bereits irgendeinen angemessenen Begriff für etwaige Universalien haben, die wir zwischen verschiedenen Kulturen erkennen zu können vermeinen. Jack Donnelly spricht von »Menschenwürde« als einem universellen Wert.3Onuma Yasuaki kritisiert diesen Begriff, indem er darauf hinweist, dass die »Würde« selbst ein Lieblingsbegriff in derjenigen westlichen philosophischen Strömung gewesen ist, die Menschenrechte ausgearbeitet hat. Er zieht es vor, vom »Streben nach spirituellem und materiellem Wohlergehen« als der Universalie zu sprechen.4 Während »Würde« ein vielleicht zu streng umgrenzter und kulturgebundener Begriff ist, könnte »Wohlergehen« zu vage und allgemein sein. Vielleicht sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht in der Lage, [10]die universellen Werte, die hier im Spiel sind, zu formulieren. Vielleicht werden wir nie dazu in der Lage sein. Das würde nichts ausmachen, denn was wir für einen übergreifenden Konsens formulieren müssen, sind bestimmte Verhaltensnormen. Es scheint durchaus Grund zu der Hoffnung zu geben, dass wir zumindest eine gewisse Einigung über diese Normen erzielen können. Für Genozid, Mord, Folter und Sklaverei wie auch zum Beispiel für das ›Verschwinden‹ und Erschießen unschuldiger Demonstranten wird man Verurteilungen vermutlich in allen Kulturen finden.5 Die tieferen zugrundeliegenden Werte, die diese gemeinsamen Schlussfolgerungen stützen, werden naturgemäß zu den alternativen, wechselseitig unvereinbaren Begründungen gehören.
Ich habe zwischen Verhaltensnormen und der ihnen zugrundeliegenden Begründung unterschieden. Die westliche Rechtstradition existiert tatsächlich auf beiden dieser Ebenen. Auf der einen Ebene handelt es sich um eine Rechtstradition, die bestimmte Arten von Gerichtsverfahren legitimiert und bestimmte Arten von Menschen dazu ermächtigt, die Verfahren anzustrengen. Wir könnten, und bisweilen geschieht dies auch, diese Rechtskultur als geeigneten Kandidaten für eine Universalisierung betrachten und behaupten, dass sich auf verschiedene Weise begründen lässt, warum man sie übernehmen sollte. Dann würde eine Rechtskultur, die Rechte verankert, diejenigen [11]Normen definieren, um die herum sich der Weltkonsens mutmaßlich herausbilden würde.
Einige haben schon mit diesem Punkt Schwierigkeiten, wie etwa Lee Kuan Yew und diejenigen in Ostasien, die seine Ansichten teilen. Sie erkennen in dieser westlichen Rechtskultur etwas gefährlich Individualistisches, Fragmentierendes, etwas, das die Gemeinschaft zersetzt. (Natürlich haben sie dabei insbesondere die Vereinigten Staaten im Kopf bzw. vor Augen.)6 Bei ihrer Kritik der westlichen Verfahrensweisen scheinen sie auch die diesen zugrundeliegende Philosophie anzugreifen, die dem Individuum vermeintlich einen Vorrang einräumt, während eine ›konfuzianische‹ Perspektive angeblich der Gemeinschaft und dem komplexen menschlichen Beziehungsnetz, in dem jede Person steht, größeren Raum geben würde.
Die westliche Rechtstradition umfasst auch bestimmte Ansichten über die menschliche Natur, die Gesellschaft und das menschliche Gute und führt einige Elemente einer zugrundeliegenden Begründung mit sich. Für die Erörterung könnte es hilfreich sein, diese beiden Ebenen zumindest [12]analytisch voneinander zu unterscheiden, damit wir uns eine genauere Vorstellung davon machen können, welche Optionen wir haben. Vielleicht würde die Rechtskultur tatsächlich besser damit ›fahren‹, wenn sie von einigen ihrer zugrundeliegenden Begründungen getrennt werden könnte. Vielleicht ist aber auch das Gegenteil der Fall, dass die zugrundeliegende Vorstellung vom menschlichen Leben weniger beängstigend erscheinen könnte, wenn sie ihren Ausdruck in einer anderen Rechtskultur fände. Möglicherweise funktioniert aber auch keine dieser einfachen Lösungen (was meine Vermutung wäre), sondern es müssen auf beiden Ebenen Änderungen vorgenommen werden. Dennoch ist es hilfreich, die Ebenen voneinander zu unterscheiden, weil die Änderungen auf jeder Ebene unterschiedlich sind.
Auf jeden Fall wäre es sinnvoll, die Erörterung mit einem kurzen Überblick über die Sprache der Rechte bzw. den Rechtsdiskurs, der sich im Westen entwickelt hat, sowie über die mit ihm verbundenen Vorstellungen vom menschlichen Handeln und dem Guten zu beginnen. In einem nächsten Schritt könnten wir dann bestimmte zentrale kulturübergreifende Differenzen ermitteln und sodann erkennen, was man überhaupt tun könnte, um diese Unterschiede zu überbrücken.
Der Rechtsdiskurs
Viele Gesellschaften waren der Meinung, dass es gut sei, ihren Mitgliedern bestimmte Sicherheiten oder Freiheiten zu gewährleisten – oder manchmal sogar Fremden (man denke an die strikten Gesetze der Gastfreundschaft, die in [13]vielen traditionellen Kulturen gelten). Überall ist es falsch, ein Menschenleben zu nehmen, zumindest unter bestimmten Umständen und bezogen auf bestimmte Personengruppen. Falsch ist das Gegenteil von richtig oder recht, von daher ist es relevant für unsere Erörterung.
Ein ganz anderer Sinn des Wortes ›recht‹ wird herangezogen, sobald wir den bestimmten oder unbestimmten Artikel verwenden, wir das Wort in den Plural setzen und von ›einem Recht‹ oder ›Rechten‹ sprechen oder diese Rechte Personen zuschreiben und von ›deinen Rechten‹ oder ›meinen Rechten‹ sprechen. Dadurch führt man sogenannte ›subjektive Rechte‹ ein. Anstatt zu sagen, dass es falsch ist, mich zu töten, beginnen wir mit der Feststellung, dass ich ein Recht auf Leben habe. Die beiden Formulierungen sind nicht in jeder Hinsicht gleichbedeutend, weil im letzteren Fall die Sicherheit oder Freiheit gewissermaßen als Eigentum von jemandem betrachtet wird. Sie ist nicht länger nur ein Bestandteil des Gesetzes, das gleichermaßen über und zwischen uns allen steht. Dass ich ein Recht auf Leben habe, sagt mehr aus, als dass du mich nicht töten solltest. Es gibt mir eine gewisse Kontrolle über diese Sicherheit. Ein Recht ist etwas, auf das ich im Prinzip verzichten kann.7 Zudem ist es etwas, bei dessen Durchsetzung ich eine Rolle spiele.
Ein Element des subjektiven Rechts findet sich in allen Rechtssystemen. Die Besonderheit des Westens besteht erstens darin, dass das Konzept eine größere Rolle in [14]mittelalterlichen europäischen Gesellschaften spielte als anderswo in der Geschichte, und zweitens, dass es die Grundlage für die Neuschreibung der Naturrechtstheorie darstellte, die das 17. Jahrhundert kennzeichnet. Die frühere Vorstellung, dass die menschliche Gesellschaft unter einem natürlichen Gesetz stehe, dessen Ursprung der Schöpfer sei und daher den menschlichen Willen übersteige, wurde ausgetauscht. Das grundlegende Gesetz wurde so neu konzipiert, dass es aus natürlichen Rechten besteht, die den Individuen bereits vor der Gesellschaft zuerkannt werden. Am Ursprung der Gesellschaft steht ein Vertrag, der die Menschen aus einem Naturzustand herausführt und sie infolge eines Akts der Zustimmung ihrerseits einer politischen Autorität unterstellt.
Subjektive Rechte sind nicht nur von entscheidender Bedeutung für die westliche Tradition; noch bedeutsamer ist die Tatsache, dass sie auf die Natur projiziert wurden und die Grundlage für eine philosophische Auffassung von Menschen und ihrer Gesellschaft bildeten, die die Freiheit des Individuums und sein Recht, den Regelungen, unter denen es lebt, zuzustimmen, stark privilegiert. Diese Auffassung hat sich zu einem bedeutenden Strang in der westlichen Demokratietheorie der vergangenen drei Jahrhunderte entwickelt.
Der Begriff der (subjektiven) Rechte dient sowohl dazu, bestimmte rechtliche Befugnisse zu definieren, als auch dazu, die Blaupause für eine Philosophie der menschlichen Natur, der Individuen und ihren Gesellschaften bereitzustellen. Sie wirkt sowohl als Rechtsnorm als auch als zugrundeliegende Begründung. Darüber hinaus sind diese beiden Ebenen nicht unverbunden. Die Kraft der [15]zugrundeliegenden Philosophie hat zu einer stetigen Förderung der Rechtsnorm in unseren politisch-rechtlichen Systemen geführt, so dass sie nun in einigen zeitgenössischen Gemeinwesen eine vorrangige Stellung einnimmt. Rechtschartas finden sich nunmehr in den Verfassungen mehrerer Staaten und auch in der Verfassung der Europäischen Union verankert. Sie bilden die Grundlage für gerichtliche Überprüfungen, durch die die gewöhnliche Gesetzgebung verschiedener Regierungsebenen für ungültig erklärt werden kann, sollte sie im Widerspruch zu diesen Grundrechten stehen.
Der moderne westliche Rechtsdiskurs umfasst einerseits eine Reihe von Rechtsformen, durch die Sicherheiten und Freiheiten als Rechte verbrieft werden; das hat bestimmte Folgen für die Möglichkeit, auf sie zu verzichten, sowie für die Art, wie sie gewahrt werden können – ob diese Sicherheiten und Freiheiten zu denjenigen gehören, die von Zeit zu Zeit von einer rechtmäßig konstituierten Autorität gewährt werden oder zu jenen, die im Grundgesetz verankert sind. Andererseits umfasst der Diskurs eine Philosophie der Person und der Gesellschaft, die dem Individuum eine große Bedeutung beimisst und wichtige Angelegenheiten von dessen Zustimmungsfähigkeit abhängig macht. In beiderlei Hinsichten steht er im Gegensatz zu vielen anderen Kulturen, darunter auch dem vorneuzeitlichen Westen, und zwar nicht deshalb, weil einige ebensolche Schutzvorkehrungen und Sicherheiten nicht vorhanden gewesen wären, sondern weil sie auf einer ganz anderen Grundlage fußten.8
[16]Wenn Menschen gegen das westliche Rechtsmodell protestieren, dann scheinen sie dieses ganze Paket vor Augen zu haben. Wir können daher verstehen, wie der Widerstand gegen den westlichen Rechtsdiskurs auf mehr als nur einer Ebene auftreten kann. Einige Regierungen widersetzen sich vielleicht deshalb der Durchsetzung von weithin akzeptierten Normen, weil sie selbst Ziele verfolgen, die deren Verletzung beinhaltet (zum Beispiel die gegenwärtige Volksrepublik China). Andere sind jedoch sicherlich bereit und sogar begierig darauf, sich für einige universelle Normen einzusetzen, doch bereitet ihnen die zugrundeliegende Philosophie der menschlichen Person in der Gesellschaft Unbehagen. Diese scheint autonomen Individuen, die entschlossen sind, ihre Rechte einzufordern, einen Vorrang einzuräumen, sogar (gerade) trotz eines weitgehenden gesellschaftlichen Konsenses. Wie passt das mit der konfuzianischen Betonung enger persönlicher [17]Beziehungen zusammen, die nicht nur an sich hochgeschätzt werden, sondern auch als Vorbild für die breitere Gesellschaft? (Vgl. Kap. 9.) Können Menschen, die das westliche Menschenrechtsethos in vollem Umfang übernehmen, das seinen höchsten Ausdruck in dem einsamen mutigen Kampf des Individuums für seine Rechte, gegen alle Kräfte sozialer Konformität findet, jemals gute Mitglieder einer ›konfuzianischen‹ Gesellschaft sein? Wie passt diese Ethik, in der man das einfordert, was einem zusteht, zu der Theravada-buddhistischen Suche nach dem Nicht-Selbst, nach Selbstgebung und dana (Großzügigkeit)?9
Das Rechtspaket als Ganzes zu übernehmen ist nicht unbedingt falsch, weil die Philosophie offenkundig ein Teil dessen ist, was den großen Aufstieg dieser Rechtsform motiviert hat. Doch zeigen Bedenken, wie sie im vorangegangenen Absatz geäußert wurden und nicht leicht von der Hand zu weisen sind, welche möglichen Vorteile es hat, zwischen den Elementen zu unterscheiden und die Verbindung zwischen einer Rechtskultur, die auf die Durchsetzung von Rechten setzt, und den philosophischen Konzeptionen vom menschlichen Leben, die ursprünglich zu ihr geführt haben, zu lösen.
Vielleicht hilft es zur Strukturierung unserer Gedanken, wenn wir eine dreiteilige Unterscheidung vornehmen. Wonach wir suchen, ist ein weltweiter Konsens über [18]bestimmte Verhaltensnormen, die gegenüber Regierungen durchsetzbar sind. Um in einer beliebigen Gesellschaft anerkannt zu werden, müssten diese Normen jeweils auf irgendeiner weithin anerkannten philosophischen Begründung beruhen, und um durchgesetzt zu werden, müssten sie sich in rechtlichen Verfahren niederschlagen. Eine Möglichkeit, unsere zentrale Frage zu formulieren, könnte folgendermaßen lauten: Welche Variationen können wir uns in philosophischen Begründungen oder Rechtsformen vorstellen, die noch mit einem sinnvollen universellen Konsens über das, was uns wirklich wichtig ist, nämlich den durchsetzbaren Normen, vereinbar wären?
Folgt man diesem Gedankengang, könnte es dazu beitragen, besser zu verstehen, worauf genau wir uns in der zukünftigen Weltgesellschaft einigen wollen, wie auch unsere diesbezüglichen Erfolgsaussichten zu bemessen, wenn wir uns Variationen auf den beiden Ebenen getrennt vorstellen. Ich möchte im Folgenden einige Beispiele näher betrachten, in denen es offensichtliche Konflikte zwischen dem gegenwärtigen Menschenrechtsdiskurs und einer oder mehreren bedeutenden zeitgenössischen Kulturen zu geben scheint. Ziel wird der Versuch sein, Möglichkeiten zu erwägen, wie der Konflikt gelöst werden könnte und wie die wesentlichen Normen, die mit dem Anspruch der Menschenrechte einhergehen, bewahrt werden könnten, und zwar entweder durch eine Veränderung der Rechtsformen oder eine Veränderung der Philosophie.
[19]Alternative Rechtsformen
Ich möchte vier Arten von Konflikten näher betrachten. Die erste Art von Konflikt könnte durch rechtliche Neuregelungen gelöst werden, deren Möglichkeit ich kurz erörtern werde, doch lässt sie sich wohl am besten auf philosophischer Ebene bewältigen. Die anderen drei Arten von Konflikten betreffen die grundlegende Begründung von Menschenrechtsansprüchen. Bei ihrer Entwicklung werde ich die Rechtfertigungsgrundlage für westliches Denken und westliche Praxis im Hinblick auf Rechte deutlich weiter ausführen müssen als ich dies in meinen eher knappen Bemerkungen über die Naturrechtstheorie getan habe. Ich werde später darauf zurückkommen.
Nehmen wir die Art von Einwand, die ich zu Beginn erwähnte, die jemand wie Lee Kuan Yew über die westliche Rechtspraxis und ihre vermeintliche Untauglichkeit für andere, insbesondere ostasiatische Gesellschaften, geltend machen könnte. Die Grundidee lautet, dass diese Praxis, die offensichtlich von der im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen zugrundeliegenden Philosophie gestützt wird, annimmt, dass Individuen Besitzer von Rechten sind und sie dazu ermutigt, zu handeln, hinauszugehen und offensiv danach zu streben, ihre Rechte erfolgreich geltend zu machen. Doch das hat eine Reihe negativer Folgen. Erstens führt es dazu, dass sich die Menschen auf ihre Rechte konzentrieren und darauf, was sie von der Gesellschaft und von anderen fordern können, statt auf ihre Verantwortung und darauf, was sie der gesamten Gemeinschaft oder ihren Mitgliedern schulden. Es ermuntert Menschen dazu, egoistisch zu sein, und führt zu einer Verkümmerung des [20]Zusammengehörigkeitsgefühls. Das wiederum verstärkt soziale Konflikte, die zunehmend vielschichtiger werden und schließlich in einen Krieg aller gegen alle zu münden drohen. Die soziale Solidarität wird geschwächt, während die Gefahr von Gewalt steigt.
Dieses Szenario scheint einigen reichlich überzogen zu sein. Für andere, darunter auch Menschen aus westlichen Gesellschaften, scheint es jedoch ein Fünkchen Wahrheit zu enthalten. Das wiederum lässt Zweifel daran aufkommen, dass wir es hier mit einem Unterschied zwischen Kulturen zu tun haben. Tatsächlich hat es lange Tradition im Westen, vor einem reinen Rechtsdiskurs außerhalb eines Rahmens zu warnen, in dem die politische Gemeinschaft einen starken positiven Wert besitzt. Diese ›kommunitaristischen‹ Theorien sind heute aufgrund der Konflikt- und Entfremdungserfahrungen und der bröckelnden Solidarität in vielen westlichen Demokratien, besonders, aber nicht nur in den Vereinigten Staaten, umso dringlicher. Bedeutet das, dass Lee Kuan Yews Programm eine Lösung für das gegenwärtige Amerika bieten könnte?
Die Absurdität dieses Vorschlags führt uns zurück zu den echten kulturellen Unterschieden, die heute bestehen. Doch wenn wir der Logik der ›kommunitaristischen‹ Kritik im Westen konsequent bis zu ihrem Ende folgen, können wir vielleicht einen Rahmen finden, innerhalb dessen sich diese Unterschiede berücksichtigen lassen.
Einer der entscheidenden Punkte bei der Kritik an einer zu ausschließlichen Konzentration auf Rechte besteht darin, dass dadurch die zentrale Bedeutung des politischen Vertrauens vernachlässigt wird. Wie Tocqueville bemerkte, versuchen Diktaturen, das Vertrauen zwischen den [21]Bürgern zu zerstören,10 doch freie Gesellschaften sind auf ein solches Vertrauen dringend angewiesen. Der Preis der Freiheit besteht in einem starken gemeinsamen Bekenntnis zu jenem politischen Programm, das uns bindet, denn ohne dieses Bekenntnis müsste das Programm gewaltsam durchgesetzt werden, was wiederum die Freiheit bedrohen würde. Dieses Bekenntnis löst sich bei jedem Einzelnen von uns sehr schnell auf, sobald das Gefühl entsteht, dass andere es nicht länger teilen oder nicht länger bereit sind, entsprechend zu handeln. Die gemeinsame Treue zum Programm speist sich aus Vertrauen.
Dies gilt sowohl für ein politisches System, das sich auf die Durchsetzung von Rechten konzentriert, als auch für jedes andere. Die Bedingung dafür, dass wir hergehen und versuchen können, unsere eigenen Rechte durchzusetzen, besteht darin, dass das System, in dem dies realisiert wird, die Achtung und Treue aller zum Programm bewahrt. Sobald die Durchsetzung von Rechten diese schwächt, sobald [22]sie zu einem Gefühl tiefer Ungerechtigkeiten führt, das verschiedene Gruppen gegeneinander aufbringt und das Gefühl der gemeinsamen Treue und Solidarität untergräbt, ist das gesamte System der unbeschränkten Durchsetzung von Rechten in Gefahr.
Das Problem hierbei ist nicht der ›Individualismus‹ als solcher. Von diesem existieren viele Formen, und einige haben sich gemeinsam mit modernen demokratischen Formen politischer Gesellschaft entwickelt. Die Gefahr liegt vielmehr in solchen Formen des Individualismus oder der Gruppenidentität, die das Vertrauen untergraben oder unterminieren, dass wir als Bürger dieses Gemeinwesens einander verpflichtet sind.
Ich möchte hier nicht weiter den Bedingungen des politischen Vertrauens in westlichen Demokratien nachgehen, jedenfalls nicht um der Sache selbst willen.11 Ich möchte jedoch diese Voraussetzung als heuristisches Instrument bei der Suche nach einem gemeinsamen Nenner für einen Konsens über Menschenrechte verwenden. Eine Möglichkeit, über eine Behauptung ähnlich der von Lee Kuan Yew nachzudenken, entsprechend der die westliche Konzentration auf Rechte nicht zu einer bestimmten kulturellen Tradition passe, bestünde darin, zu fragen, wie bestimmte grundlegende Freiheiten und Sicherheiten in der betreffenden Gesellschaft in Einklang mit der Aufrechterhaltung des politischen Vertrauens gewährleistet werden könnten. Das [23]bedeutet natürlich, dass man keine Lösung als befriedigend ansehen würde, die nicht diese Freiheiten und Sicherheiten bewahrt. Doch man würde jede mögliche Modifikation in der Rechtsform akzeptieren, die erforderlich ist, um ein Gefühl der allgemeinen Akzeptanz des Verfahrens zu ihrer Gewährleistung in der betreffenden Gesellschaft herzustellen.
Im konkreten Fall von Lee Kuan Yews Singapur würde dies bedeuten, dass seine Behauptung in ihrer gegenwärtigen Form kaum annehmbar ist. Es gibt zu viele Belege dafür, dass in Singapur abweichende Meinungen erstickt werden und der demokratische politische Prozess (gelinde gesagt) eingeengt wird. Dennoch sollten wir diese Art von Behauptung zum Anlass nehmen, weiter darüber nachzudenken, wie Sicherheiten der Art, wie wir sie in Menschenrechtserklärungen anstreben, am besten in ›konfuzianischen‹ Gesellschaften geschützt werden können.
Wenden wir uns wieder den westlichen Gesellschaften zu, so stellen wir fest, dass Richter und Gerichtsverfahren im Allgemeinen ein hohes Maß an Ansehen und Achtung genießen.12 In einigen Ländern gründet sich diese Achtung auf eine lange Tradition, in der eine bestimmte Vorstellung des Grundgesetzes eine wichtige Rolle spielte und in der daher dessen Hüter eine besondere Stellung einnahmen. Gibt es eine Möglichkeit, die Durchsetzung von Rechten in anderen Gesellschaften mit Ämtern und Institutionen zu [24]verbinden, die dort höchstes moralisches Ansehen genießen?
In Anlehnung an eine andere Tradition lässt sich feststellen, dass das enorme moralische Ansehen der Monarchie in Thailand in einigen historisch entscheidenden Momenten dazu verwendet wurde, bestimmten Schritten Legitimität zu verleihen, die auf ein Ende der militärischen Gewalt und Repressionen und auf die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung abzielten. Das war der Fall nach den Studierendenprotesten im Oktober 1973 und erneut im Gefolge der Reaktionen der Bevölkerung auf die Machtübernahme durch General Suchinda Kraprayoonim Mai 1992. Beide Male reagierte die Militärjunta mit Gewalt, musste jedoch alsbald erkennen, dass sie ihre Stellung nicht halten konnte und gezwungen war, das Feld zugunsten einer Zivilregierung und erneuten Wahlen zu räumen. In beiden Fällen spielte König Bhumibol eine entscheidende Rolle.13 Diese Rolle konnte der König aufgrund von Elementen in der Tradition spielen, die zur thailändischen Konzeption von Monarchie beigetragen haben und von denen einige weit zurückreichen. So sieht zum Beispiel die Vorstellung des Königs als dharmaraja, der in der Tradition von Ashoka steht,14 den Herrscher als damit beauftragt, Dharma in der Welt herzustellen.
Vielleicht war es entscheidend für die Unruhen von 1973 und 1992, dass ein König mit einem solchen Stellenwert genau diese Rolle gespielt hat. Das Problem besteht jedoch [25]darin, dass die Macht des königlichen Amtes auch für die entgegengesetzte Richtung verwendet werden kann, wie dies 1976 geschah, als rechtsgerichtete Gruppen die Parole »Nation, König und Religion« als Schlachtruf verwendeten, um demokratische und radikale Führer zu attackieren. Die reaktionäre Bewegung erreichte ihren Höhepunkt mit dem Putsch im Oktober 1976, der die demokratische Verfassung erneut verwarf.15
Aus all dem ergibt sich folgendes Problem: Kann die enorme Macht der thailändischen Monarchie, Vertrauen und Konsens zu schaffen, irgendwie dahingehend stabilisiert, reguliert und kanalisiert werden, dass sie die verfassungsmäßige Ordnung und die Verteidigung bestimmter Menschenrechte, wie etwa solchen, die die Sicherheit der Person betreffen, stützt? In Weber’schen Begriffen: Könnte das Charisma hier ausreichend »routinisiert« werden, um ihm eine stabile Richtung zu geben, ohne ganz verloren zu gehen? Könnte vielleicht dieses königliche Charisma sowie die Legitimation, die einige Individuen mit nachweislichen »Verdiensten« genießen und die, wie etwa in der thailändischen Tradition, mit moralischer Autorität ausgestattet sind, irgendwie dazu genutzt werden, die Unterstützung für eine demokratische Ordnung zu stärken, die solche [26]Sicherheiten und Freiheiten achtet, die wir allgemein als Menschenrechte beschreiben? Falls ja, sollte man der Tatsache, dass sie vielleicht vom westlichen Standardmodell der gerichtlichen Überprüfung abweicht, das von Individuen angestoßen wird, weniger Bedeutung beimessen als der Tatsache, dass dadurch Menschen vor Gewalt und Unterdrückung geschützt werden. Wir hätten dann tatsächlich trotz Unterschieden in der Form eine Übereinstimmung im Hinblick auf den Inhalt der Menschenrechte erreicht.