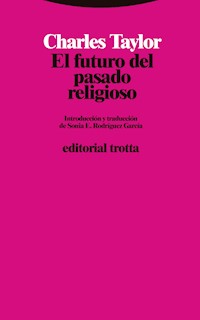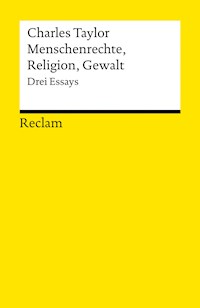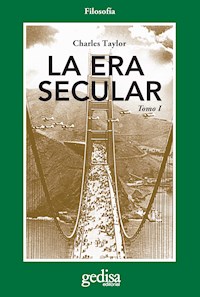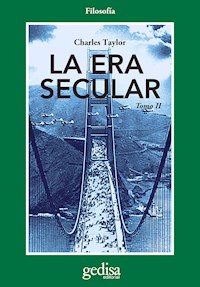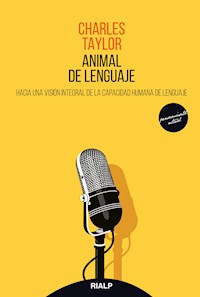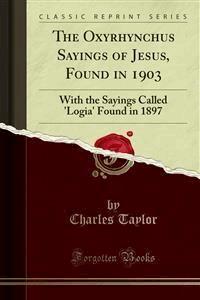47,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was heißt es, daß wir heute in einem säkularen Zeitalter leben? Was ist geschehen zwischen 1500 – als Gott noch seinen festen Platz im naturwissenschaftlichen Kosmos, im gesellschaftlichen Gefüge und im Alltag der Menschen hatte – und heute, da der Glaube an Gott, jedenfalls in der westlichen Welt, nur noch eine Option unter vielen ist? Um diesen Wandel zu bestimmen und in seinen Folgen für die gegenwärtige Gesellschaft auszuloten, muß die große Geschichte der Säkularisierung in der nordatlantischen Welt von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart erzählt werden – ein herkulisches Unterfangen, dem sich der kanadische Philosoph Charles Taylor in seinem mit Spannung erwarteten neuen Buch stellt. Mit einem Fokus auf dem »lateinischen Christentum«, dem vorherrschenden Glauben in Europa, rekonstruiert er in geradezu verschwenderischem Detail die entscheidenden Entwicklungslinien in den Naturwissenschaften, der Philosophie, der Staats- und Rechtstheorie und in den Künsten. Dem berühmten Diktum von der wissenschaftlich-technischen »Entzauberung der Welt« und anderen eingeschliffenen Säkularisierungstheorien setzt er die These entgegen, daß es die Religion selbst war, die das Säkulare hervorgebracht hat, und entfaltet eine komplexe Mentalitätsgeschichte des modernen Subjekts, das heute im Niemandsland zwischen Glauben und Atheismus gefangen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2156
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Charles Taylor
Ein säkulares Zeitalter
Aus dem Englischen vonJoachim Schulte
Suhrkamp
Titel der Originalausgabe: A Secular Age.
Erstmals veröffentlicht 2007.
Die Übersetzung erscheint mit freundlicher Genehmigung von Harvard University Press. © 2007 by Charles Taylor
We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts which last year invested $ 20.1 million in writing and publishing throughout Canada.
Nous remercions de son soutien le Conseil des Arts du Canada, qui a investi 20,1 millions de dollars l’an dernier dans les lettres et l’édition à travers le Canada.
Die Übersetzung wurde gefördert vom Canada Council for the Arts, das die Arbeit kanadischer Autoren im vergangenen Jahr mit 20,1 Millionen Dollar unterstützt hat.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ebook Suhrkamp Verlag Berlin 2010
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2009. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
www.suhrkamp.de
eISBN 978-3-518-74040-8
Für meine Tochter Gretta
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Teil I Reformwerk
1 Bollwerke des Glaubens
2 Die Entstehung der disziplinierenden Gesellschaft
3 Die große Entbettung
4 Soziale Vorstellungsschemata der Neuzeit
5 Das Gespenst des Idealismus
Teil II Der Wendepunkt
6 Providenzieller Deismus
7 Die unpersönliche Ordnung
Teil III Der Nova-Effekt
8 Unbehagen an der Moderne
9 Der dunkle Abgrund der Zeit
10 Das expandierende Universum der Ungläubigkeit
11 Entwicklungslinien im neunzehnten Jahrhundert
Teil IV Erzählungen von der Säkularisierung
12 Das Zeitalter der Mobilisierung
13 Das Zeitalter der Authentizität
14 Religion heute
Teil V Bedingungen des Glaubens
15 Der immanente Rahmen
16 Gegenläufiger Druck
17 Dilemmata 1
18 Dilemmata 2
19 Unruhige Fronten der Moderne
Epilog. Viele Geschichten
Register
Vorwort
Dieses Buch ist aus den Gifford Lectures hervorgegangen, die ich im Frühjahr 1999 in Edinburgh unter dem Titel »Living in a Secular Age?« gehalten habe. Seither ist recht viel Zeit verstrichen, und tatsächlich ist der Bereich der im Buch behandelten Gegenstände umfangreicher geworden. Grob gesprochen, decken sich die 1999 gehaltenen Vorlesungen mit den ersten drei Teilen des vorliegenden Buchs, während sich die Teile IV und V mit Dingen befassen, die ich seinerzeit zwar behandeln wollte, aber nicht angemessen erörtern konnte, da mir die Zeit und die Voraussetzungen fehlten. (In dieser Hinsicht haben sich die inzwischen vergangenen Jahre hoffentlich positiv ausgewirkt.)
Seit 1999 ist das Buch nicht nur umfangreicher geworden, sondern auch seine Reichweite hat zugenommen. Allerdings hat der erste dieser beiden Entwicklungsprozesse nicht mit dem zweiten Schritt gehalten. Die größere Reichweite hätte ein weitaus dickeres Buch als das jetzt vorliegende verlangt. Ich möchte eine Geschichte erzählen: die Geschichte dessen, was man normalerweise die »Säkularisierung« des neuzeitlichen Abendlands nennt. Und indem ich diese Geschichte erzähle, bemühe ich mich zu erläutern, was es mit diesem oft in Anspruch genommenen, aber dennoch nicht sonderlich klaren Prozeß auf sich hat. Um diese Aufgabe angemessen zu erfüllen, hätte ich eine in höherem Maße dichte und kontinuierliche Geschichte erzählen müssen, doch dazu habe ich weder die Zeit noch die Fähigkeit.
Den Leser, der dieses Buch in die Hand nimmt, möchte ich bitten, es nicht als fortlaufende, argumentativ durchgestaltete Erzählung aufzufassen, sondern als eine Reihe ineinander verschränkter Essays, die einander erhellen und einen Kontext wechselseitiger Relevanz bilden. Die allgemeine Stoßrichtung meiner These wird aus dieser skizzenhaften Darstellung hoffentlich deutlich hervorgehen und andere dazu anregen, den Gedankengang auf eigene Weise fortzuführen, anzuwenden, umzugestalten und neu zusammenzustellen. Danken möchte ich dem in Edinburgh für die Gifford Lectures verantwortlichen Komitee, von dessen Einladung der erste Ansporn zu diesem Vorhaben ausging. Zu Dank verpflichtet bin ich ferner dem Canada Council für die von 1996 bis 1998 gewährte Isaac Killam Fellowship, die es mir ermöglicht hat, mit der Arbeit zu beginnen, sowie dem kanadischen Social Science and Humanities Research Council für die 2003 verliehene Goldmedaille. Ein großer Gewinn waren meine Aufenthalte am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen in den Jahren 2000 und 2001. Das Wissenschaftskolleg zu Berlin gab mir von 2005 bis 2006 die Gelegenheit, mein Projekt unter den bestmöglichen Bedingungen abzuschließen, wozu auch die Gespräche mit José Casanova und Hans Joas gehörten, die mit ähnlich gelagerten Projekten beschäftigt waren.
Außerdem geht mein Dank an die Mitarbeiter im Umfeld des Centre for Transcultural Studies. Einige der Schlüsselbegriffe, deren ich mich in diesem Buch bediene, haben sich im Zuge unserer Gespräche erst herauskristallisiert.
Einleitung
1
Was besagt die Behauptung, wir lebten in einem säkularen Zeitalter? Der These, daß es sich so verhält, würde fast jeder zustimmen. Damit meine ich »uns«, die wir im Westen leben oder, anders formuliert, im Nordwesten beziehungsweise in der nordatlantischen Welt. Dabei reicht die Säkularität zum Teil und in unterschiedlicher Weise über diese Welt hinaus. Dem Urteil, diese Welt sei säkular, kann man offenbar kaum etwas entgegenhalten, wenn man diese Gesellschaften mit irgendwelchen anderen Phänomenen der menschlichen Geschichte vergleicht, das heißt mit fast allen übrigen Gesellschaften der Gegenwart (also etwa den islamischen Ländern, Indien oder Afrika) einerseits oder mit der restlichen Menschheitsgeschichte andererseits – einerlei, ob sie sich im atlantischen Raum oder sonstwo abgespielt hat.
Nicht so klar ist hingegen, worin diese Säkularität eigentlich besteht. Um sie zu charakterisieren, kommen vor allem zwei Merkmale oder vielmehr Merkmalsgruppen in Frage. Bei der ersten Gruppe geht es um die gemeinsamen Institutionen und Gebräuche, wobei der Staat besonders hervorsticht, aber durchaus nicht das einzige Merkmal darstellt. Der Unterschied bestünde demnach in folgendem: Während die politische Organisation aller vorneuzeitlichen Gesellschaften in irgendeiner Weise mit dem Glauben an – oder der Loyalität gegenüber – Gott oder einer Vorstellung vom letzten Realitätsgrund zusammenhing, auf einem solchen Glauben beruhte oder durch ihn verbürgt war, gibt es im modernen westlichen Staat keinen derartigen Zusammenhang. Heutzutage ist die Kirche von den politischen Strukturen getrennt. (Es gibt zwar zwei Ausnahmen – nämlich Großbritannien und die skandinavischen Länder –, doch sie sind so unauffällig und halten sich so zurück, daß sie eigentlich gar keine Ausnahmen darstellen.) Die Religion oder ihr Fehlen ist weitgehend Privatsache. Die politische Gesellschaft wird als eine Gesellschaft gesehen, der religiöse Menschen (jeglicher Couleur) genauso angehören wie nichtreligiöse.1
Um es anders zu formulieren: In unseren »säkularen« Gesellschaften kann man sich uneingeschränkt politisch betätigen, ohne je Gott zu begegnen, also ohne an einen Punkt zu gelangen, an dem sich die ausschlaggebende Bedeutung des Gottes Abrahams für dieses ganze Unterfangen eindringlich und unverkennbar bemerkbar macht. Die wenigen heute verbliebenen Momente rituellen Verhaltens oder des Gebets stellen kaum noch eine solche Begegnung dar, während dies in früheren Jahrhunderten des Christentums unumgänglich gewesen wäre.
Diese Formulierung gestattet es uns zu erkennen, daß der Wandel nicht nur den Staat erfaßt hat. Wenn wir in unserer eigenen Zivilisation einige wenige Jahrhunderte zurückgehen, sehen wir, daß Gott auf allen Ebenen der Gesellschaft bei einer Vielzahl sozialer – und keineswegs nur politischer – Vorgänge im oben angedeuteten Sinn präsent war. Das gilt beispielsweise für die Zeit, in der die Kirchgemeinde die funktionierende lokale Regierungsform und die Gemeinde in erster Linie noch eine Gemeinschaft des Gebets war, in der das von den Zünften gestaltete Leben nicht bloß pro forma von religiösen Zeremonien geprägt war und in der religiöse Feste wie etwa die Fronleichnamsprozession die einzige Form waren, in der sich die Gesellschaft in allen ihren Teilbereichen vor sich selbst darstellen konnte. In diesen Gesellschaften war es nicht möglich, sich an irgendeiner öffentlichen Tätigkeit zu beteiligen, ohne im oben angedeuteten Sinn »Gott zu begegnen«. Heute hingegen liegen die Dinge völlig anders.
Wenn man noch weiter in der Menschheitsgeschichte zurückgeht, stößt man auf altertümliche Gesellschaftsformen, auf die sich die ganze Bandbreite unserer auf heutige Gesellschaften bezogenen Unterscheidungen zwischen religiösen, politischen, ökonomischen, sozialen und sonstigen Aspekten gar nicht mehr sinnvoll anwenden läßt. In diesen frühen Gesellschaften war die Religion »überall«.2 Sie war mit allem übrigen verflochten und bildete in keinem Sinn eine eigenständige, abgetrennte »Sphäre«.
Die erste Bedeutung von »Säkularität« ist demnach durch Bezugnahme auf das Öffentliche definiert. In dieser Öffentlichkeit, so heißt es, gibt es keinen Gott mehr und keinen Hinweis auf letzte Realitätsgründe. Oder um es von einer anderen Seite zu betrachten: Wir spielen unsere Rollen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen – im Rahmen der Ökonomie, der Politik, der Kultur, des Bildungswesens, des Berufs und der Freizeit –, doch die Normen und Prinzipien, nach denen wir uns dabei richten, und die Überlegungen, die wir anstellen, verweisen uns im allgemeinen weder auf Gott noch auf irgendwelche religiösen Überzeugungen. Die Erwägungen, die unserem Handeln vorausgehen, bewegen sich innerhalb der »Rationalität« jedes einzelnen Bereichs: Im Wirtschaftsleben geht es um maximalen Profit, auf politischem Gebiet um den größtmöglichen Nutzen für möglichst viele Personen und so weiter. Das steht in auffälligem Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen das Christentum maßgebliche Vorschriften erließ, die – wie etwa das Verbot des Wuchers oder die Pflicht zur Durchsetzung des rechten Glaubens – oft von den Geistlichen verkündet wurden und in keinem dieser Bereiche ohne weiteres außer acht gelassen werden konnten.3
Aber gleichgültig ob wir die Sache im Hinblick aufs Normative oder im Sinne der rituellen oder zeremoniellen Präsenz betrachten – diese Entleerung der sozialen Bereiche von allem Religiösen läßt sich natürlich damit vereinbaren, daß die große Mehrheit der Menschen nach wie vor an Gott glaubt und aktiv ihre Religion praktiziert. Hier kommt uns das Beispiel des kommunistisch regierten Polen in den Sinn. Damit wird jedoch vielleicht eine falsche Fährte gelegt, denn die öffentliche Säkularität war den Menschen dort von einem diktatorischen und unbeliebten Regime aufgezwungen worden. Die Vereinigten Staaten dagegen sind ein in dieser Hinsicht recht frappierendes Beispiel. Sie gehören zu den ersten Gesellschaften, in denen Kirche und Staat voneinander getrennt wurden, und dennoch sind sie laut Statistik in bezug auf religiösen Glauben und religiöse Praxis führend unter allen westlichen Gesellschaften.
Doch genau das ist der Punkt, auf den die Menschen oft hinauswollen, wenn sie unsere Zeit als säkular bezeichnen und sie – sei’s wehmütig oder erleichtert – früheren Zeiten des Glaubens und der Frömmigkeit gegenüberstellen. In dieser zweiten Bedeutung des Wortes besteht Säkularität darin, daß der religiöse Glaube und das Praktizieren der Religion dahinschwinden; daß sich die Menschen von Gott abwenden und nicht mehr in die Kirche gehen. In diesem Sinn sind die Länder Westeuropas größtenteils säkular geworden – auch diejenigen, in denen noch Spuren einer öffentlichen Bezugnahme auf Gott zu finden sind.
Nach meiner Überzeugung lohnt es sich, die Gegenwart als eine in einem dritten Sinn säkulare Zeit zu untersuchen. Diese dritte Bedeutung des Worts steht in enger Verbindung mit der zweiten und ist nicht ohne Zusammenhang mit der ersten. In dieser dritten Bedeutung ginge es vor allem um die Bedingungen des Glaubens. So aufgefaßt, besteht der Wandel hin zur Säkularität unter anderem darin, daß man sich von einer Gesellschaft entfernt, in der der Glaube an Gott unangefochten ist, ja außer Frage steht, und daß man zu einer Gesellschaft übergeht, in der dieser Glaube eine von mehreren Optionen neben anderen darstellt, und zwar häufig nicht die bequemste Option. In diesem Sinn gelten – anders als wenn man von der zweiten Wortbedeutung ausgeht – zumindest viele Milieus in den Vereinigten Staaten als säkular, und ich würde sogar behaupten, daß die Vereinigten Staaten insgesamt säkular sind. Klare Kontrastbeispiele wären heutzutage die Mehrzahl der moslemischen Gesellschaften oder die Milieus, in denen die allermeisten Inder leben. Es wäre ohne Belang, wenn der Nachweis erbracht würde, daß der Kirchen- oder Synagogenbesuch in den USA oder einigen ihrer Regionen statistisch gesehen ähnlich häufig ist wie etwa der Freitagsbesuch der Moschee in Pakistan oder Jordanien (beziehungsweise wie dieser Moscheebesuch plus das tägliche Gebet). Das wäre ein Beleg dafür, diese Gesellschaften als im zweiten Sinn gleich einzustufen. Dennoch scheint es mir auf der Hand zu liegen, daß im Hinblick darauf, was es heißt, gläubig zu sein, zwischen diesen Gesellschaften große Unterschiede bestehen, die zum Teil daher rühren, daß der Glaube in der christlichen (oder »postchristlichen«) Gesellschaft eine Option und in gewissem Sinn eine umkämpfte Option ist, während er dies in den moslemischen Gesellschaften nicht (oder noch nicht) ist.
Ich möchte unsere Gesellschaft als eine in diesem dritten Sinn säkulare Gesellschaft untersuchen. Dieses Unterfangen läßt sich vielleicht wie folgt resümieren: Der Wandel, den ich bestimmen und nachvollziehen möchte, ist ein Wandel, der von einer Gesellschaft, in der es praktisch unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, zu einer Gesellschaft führt, in der dieser Glaube auch für besonders religiöse Menschen nur eine menschliche Möglichkeit neben anderen ist. Es mag mir zwar undenkbar vorkommen, den eigenen Glauben fallenzulassen, doch es gibt andere Menschen, zu denen vielleicht auch solche gehören, die mir überaus nahestehen, deren Lebensweise ich, wenn ich ganz aufrichtig bin, nicht einfach als verkommen, verblendet oder unwürdig abtun kann, obwohl diese Menschen keinen Glauben haben (jedenfalls keinen Glauben an Gott oder das Transzendente). Der Glaube an Gott ist heute keine unabdingbare Voraussetzung mehr. Es gibt Alternativen. Und das wird zumindest in bestimmten Milieus wahrscheinlich auch bedeuten, daß es schwerfallen kann, den eigenen Glauben durchzuhalten. Es wird Menschen geben, die die Notwendigkeit empfinden, ihren Glauben aufzugeben, obwohl sie seinem Verlust nachtrauern. Das ist eine Erfahrung, die sich in unseren Gesellschaften wenigstens seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts nachzeichnen läßt. Daneben wird es viele andere Menschen geben, denen der Glaube nicht einmal eine in Frage kommende Möglichkeit zu sein scheint. Heutzutage gibt es bestimmt Millionen von Menschen, für die das gilt.
In diesem Sinn hängt Säkularität vom gesamten Verstehenskontext ab, in dem sich unsere Erfahrung und unser Streben auf moralischem, spirituellem oder religiösem Gebiet abspielt. Mit »Verstehenskontext« meine ich hier sowohl Dinge, die wahrscheinlich von beinahe jedem ausdrücklich formuliert worden sind (wie zum Beispiel die Vielzahl der Optionen), als auch einige Dinge, die den impliziten, weitgehend unscharfen Hintergrund dieser Erfahrung und dieses Strebens bilden – das »Vorontologische«, um mit Heidegger zu sprechen.
Demnach läge es an den Bedingungen der Erfahrung des Spirituellen und des Strebens nach dem Spirituellen, ob ein Zeitalter oder eine Gesellschaft als säkular gilt oder nicht. Welchen Ort eine Gesellschaft in diesem Rahmen einnimmt, dürfte offensichtlich in hohem Maße davon abhängen, wie säkular sie im zweiten Sinn ist, was wiederum von der Ebene des Glaubens und der Praxis abhängt, ohne daß es – wie das Beispiel der USA zeigt – eine unkomplizierte Korrelation zwischen den beiden gäbe. Was die erste, aufs Öffentliche abhebende Bedeutung des Worts betrifft, gibt es womöglich gar keine Korrelation mit den beiden übrigen Wortbedeutungen (wie man etwa im Hinblick auf das Beispiel Indien geltend machen könnte). Ich werde jedoch die These vertreten, daß der Wandel hin zur öffentlichen Säkularität im Abendland zu einem Entwicklungsprozeß gehört, der dazu beigetragen hat, ein in meinem dritten Sinn säkulares Zeitalter hervorzubringen.
2
Offenbar ist es nicht so leicht, wie man vielleicht gedacht hätte, die Bedingungen der Erfahrung des Spirituellen zu artikulieren. Das liegt zum Teil daran, daß die Menschen geneigt sind, ihr Augenmerk auf den Glauben selbst zu richten. Es ist die zweite Frage (»Was glauben die Menschen und was geschieht damit in der Praxis?«), für die sich die Leute normalerweise interessieren und die viele Sorgen und Konflikte auslöst: Wie viele Menschen glauben an Gott? In welche Richtung geht der Trend? Das Interesse an der öffentlichen Säkularität hängt oft mit der Frage zusammen, was die Menschen glauben oder praktizieren und wie sie infolgedessen behandelt werden: Benachteiligt unser säkulares Regierungssystem die gläubigen Christen (wie in den USA von manchen behauptet wird)? Oder stellt es Gruppen an den Pranger, die bisher nicht anerkannt sind? Afroamerikaner, Hispanos? Oder etwa Schwule und Lesben?
Doch in unseren Gesellschaften ist es üblich, die Hauptfrage bezüglich der Religion mit Hilfe von Glaubensbegriffen zu bestimmen. Zunächst einmal hat sich das Christentum selbst stets durch sein Verhältnis zu Glaubensthesen definiert. Außerdem ist der Säkularismus in der oben angedeuteten zweiten Variante oft als Niedergang des christlichen Glaubens und dieser Niedergang wiederum großenteils als Resultat des Aufstiegs anderer Glaubensformen gesehen worden – als Ergebnis des Glaubens an die Wissenschaft oder die Vernunft beziehungsweise an die Verlautbarungen mancher Einzelwissenschaften, etwa der Evolutionstheorie oder der neurophysiologischen Erklärungen der Funktionsweise des Geistes.
Der Grund dafür, daß ich die Bedingungen des Glaubens, der Erfahrung und des Strebens in den Mittelpunkt rücken möchte, liegt zum Teil darin, daß ich diese Erklärung des Säkularismus 2, wonach die Wissenschaft den religiösen Glauben widerlegt und deshalb verdrängt, unbefriedigend finde, und zwar auf zwei miteinander zusammenhängenden Ebenen: Erstens halte ich die vermeintlichen Argumente, die etwa von den Ergebnissen Darwins zu den angeblichen Widerlegungen der Religion führen sollen, nicht für stichhaltig. Zweitens habe ich – zum Teil eben deshalb – den Eindruck, daß dies keine angemessene Erklärung für den faktischen Glaubensverlust ist, und zwar nicht einmal dann, wenn die Menschen selbst das Geschehen in Worte wie »Darwin hat die Bibel widerlegt« fassen. (Diese Worte soll ein Zögling der Schule Harrow in den 1890er Jahren geäußert haben.4) Natürlich können schlechte Argumente im Rahmen vortrefflicher psychologischer oder historischer Erklärungen eine entscheidende Rolle spielen. Aber wenn schlechte Argumente wie dieses so viele entwicklungsfähige Möglichkeiten zwischen Fundamentalismus und Atheismus unberücksichtigt lassen, schreien sie geradezu nach einer Erklärung dafür,
warum die anderen Wege nicht eingeschlagen wurden. Diese tiefer reichende Erklärung läßt sich nach meiner Auffassung auf der Ebene finden, die ich zu erkunden versuche. Darauf werde ich gleich zurückkommen.
In einer ersten Annäherung an diese Ebene möchte ich Glauben und Unglauben nicht als konkurrierende Theorien behandeln, das heißt als Erklärungen, mit deren Hilfe sich die Menschen durch Bezugnahme auf Gott, etwas Naturgegebenes oder dergleichen Klarheit über Fragen der Existenz oder der Moral verschaffen wollen. Vielmehr werde ich so verfahren, daß ich mein Augenmerk auf die verschiedenen Formen des Erlebens richte, die eine Rolle spielen, wenn man sein Leben auf die eine oder andere Weise begreift, also auf die innere Erfahrung des Lebens als gläubiger oder ungläubiger Mensch.
Um einen ersten ungefähren Hinweis auf die Richtung zu geben, in die meine tastenden Versuche gehen, könnte man sagen, daß es hier, ganz allgemein gesprochen, um alternative Möglichkeiten der Führung unseres moralisch-spirituellen Lebens geht.
Wir alle begreifen unser Leben und/oder den Raum, in dem wir unser Leben führen, als etwas, das eine bestimmte moralisch-spirituelle Form aufweist. Irgendwo – in irgendeiner Tätigkeit oder in irgendeinem Zustand – liegt eine gewisse Fülle, ein gewisser Reichtum. Soll heißen: An diesem Ort (in dieser Tätigkeit oder in diesem Zustand) ist das Leben voller, reicher, tiefer, lohnender, bewundernswerter und in höherem Maße das, was es sein sollte. Vielleicht handelt es sich um einen Ort der Belebung, denn oft fühlt man sich dabei tief bewegt, ja beseelt. Mag sein, daß dieses Gefühl der Fülle etwas ist, das man nur für Augenblicke aus der Ferne wahrnimmt. Man spürt dann ganz eindringlich, was es mit dieser Fülle auf sich hätte, wenn man sich in diesem Zustand befände, beispielsweise im Zustand der Ruhe oder der Ganzheit, oder wenn man dazu fähig wäre, auf dieser Ebene der Integrität oder Großherzigkeit, der Hingabe oder Selbstvergessenheit zu handeln. Manchmal jedoch wird es Augenblicke der erlebten Fülle, der Freude und der Erfüllung geben, in denen wir das Gefühl haben, wirklich dort zu sein. Das folgende Beispiel, das der Autobiographie von Bede Griffiths entnommen ist, möge für viele stehen:
Gegen Ende meiner Schulzeit ging ich eines Abends allein spazieren und hörte den vollen Chorgesang der Vögel, wie man ihn nur bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und nur zu dieser Jahreszeit zu hören bekommt. Noch heute erinnere ich mich an die Überraschung, die ich empfand, als der Klang plötzlich an meine Ohren drang. Mir schien, ich hätte die Vögel noch nie singen gehört, und ich fragte mich, ob sie das ganze Jahr über so sängen, ohne daß ich es gemerkt hätte. Als ich weiterging, stieß ich auf einige voll erblühte Weißdornbüsche, und wieder glaubte ich, noch nie einen solchen Anblick gesehen und niemals solchen Liebreiz empfunden zu haben. Wäre ich plötzlich unter die Bäume des Gartens Eden versetzt worden und hätte dort einen Engelschor singen gehört, hätte ich nicht verwunderter sein können. Sodann erreichte ich eine Stelle, an der man sehen konnte, wie die Sonne über den Sportplätzen unterging. Auf einmal flog eine Lerche neben dem Baum, an dem ich stand, vom Boden auf und ließ ihr Lied über mir erklingen, bis sie nach wie vor singend herabflog, um zu schlafen. Dann wurde alles still, als die letzten Sonnenstrahlen verschwanden und der Schleier der Dämmerung die Erde bedeckte. Ich entsinne mich des Gefühls der Erfurcht, das über mich kam. Ich wollte auf dem Boden niederknien, so als sei ein Engel gegenwärtig. Ich wagte es kaum, zum Himmel aufzublicken, denn es kam mir vor, als wäre er nur ein Schleier vor dem Angesicht Gottes.5
In diesem Fall hat sich das Gefühl der Fülle als ein Erlebnis eingestellt, das unser normales Empfinden des Daseins in der Welt mit ihren vertrauten Gegenständen, Tätigkeiten und Bezugspunkten erschüttert und durchdringt. Dabei handelt es sich vielleicht um Augenblicke, von denen Peter Berger in seiner Beschreibung des Werks von Robert Musil sagt, daß in ihnen »die gewöhnliche Realität ›ausgeschaltet‹ wird und etwas erschreckend anderes durchscheint« – ein Bewußtseinszustand, den Musil als »den anderen Zustand« kennzeichnet.6
Die Feststellung der Fülle kann aber auch ohne ein solches – sei’s erhebendes oder erschreckendes – Grenzerlebnis gelingen. Vielleicht gibt es einfach Augenblicke, in denen die starken Empfindungen der Trennung, Verwirrung, Sorge oder Traurigkeit, die uns offenbar zermürben, zum Verschwinden oder miteinander in Einklang gebracht werden, so daß wir uns geeint fühlen und, plötzlich tatkräftig und voller Energie, vorwärtsstürmen. Unsere höchsten Bestrebungen und unsere Lebenskräfte führen nicht mehr zu psychischem Stillstand, sondern sie sind irgendwie aufeinander abgestimmt und stärken sich gegenseitig. Es sind Erfahrungen dieser Art, die Schiller mit Hilfe seines Begriffs »Spiel« zu verstehen versucht hat.7
Diese Erfahrungen tragen ebenso wie andere, die hier nicht alle aufgezählt werden können, dazu bei, einen Ort der Fülle zu bestimmen,8 an dem wir uns in moralischer oder spiritueller Hinsicht orientieren. Sie können eine Orientierungshilfe sein, weil sie ein Gefühl von ihrem Bezugsgegenstand vermitteln: von der Gegenwart Gottes, der Stimme der Natur, der alles durchströmenden Kraft oder der Harmonisierung von Trieb und Gestaltungsdrang in unserem Inneren. Häufig sind solche Erfahrungen aber auch beunruhigend und rätselhaft, und unsere Ahnungen hinsichtlich ihrer möglichen Herkunft können unklar, wirr und lückenhaft sein. Man ist tief bewegt, aber zugleich verdutzt und erschüttert. Man ringt darum, das Erlebte zu artikulieren. Wenn es gelingt, das Erlebte immerhin teilweise in Worte zu fassen, fühlt man sich erlöst, als sei die Kraft der Erfahrung dadurch gesteigert worden, daß es gelungen ist, das Erlebnis in den Blick zu bekommen, zu artikulieren und daher vollständig zur Existenz kommen zu lassen.
Das kann dazu beitragen, unserem Leben eine Richtung zu geben. Aber das Richtungsgefühl kennt auch seine negative Seite, nämlich die, daß man vor allem Distanz, Abwesenheit, Ausgestoßensein empfindet – ein scheinbar unabänderliches Unvermögen, jemals diesen Ort zu erreichen –, das Gefühl der Ohnmacht, der Verwirrung oder, schlimmer noch, jenes Zustands, der in der Tradition oft als eine Form von Überdruß gekennzeichnet worden ist (Baudelaires »Spleen«). Das Schreckliche an diesem Zustand liegt darin, daß man den Sinn dafür verliert, wo der Ort der Fülle überhaupt ist, ja den Sinn dafür, worin Fülle bestehen könnte. Man hat das Gefühl, vergessen zu haben, wie die Fülle aussähe, oder man hat den Glauben an sie verloren. Aber das Elend der Abwesenheit, des Verlusts, ist nach wie vor da; in manchen Hinsichten ist es sogar noch schlimmer geworden.9
Aus der Überlieferung kennen wir noch andere Formen des Ausgestoßenseins, etwa Formen, bei denen das Gefühl der Verdammnis dominiert, das Gefühl des verdienten und endgültigen Ausgeschlossenseins von der Fülle. Oder es sind Bilder der Gefangenschaft in der Gewalt abscheulicher Formen, von denen die direkte Verneinung der Fülle verkörpert wird, wie etwa von den monströsen Tiergestalten, die auf den Gemälden von Hieronymus Bosch zu sehen sind.
Als dritte Möglichkeit gibt es so etwas wie einen stabilisierten mittleren Zustand, der häufig von uns angestrebt wird. Das ist ein Zustand, in dem man eine Möglichkeit gefunden hat, den Formen der Verneinung, des Ausgestoßenseins und der Leere zu entkommen, ohne jedoch die Fülle erreicht zu haben. Wir finden uns mit der mittleren Position ab, und das gelingt oft durch eine feste, ja routinemäßige Ordnung des Lebens, in deren Rahmen wir Dinge tun, die eine gewisse Bedeutung für uns haben, die beispielsweise zu unserem normalen Glück beitragen, die in der einen oder anderen Hinsicht befriedigend sind oder zu dem beisteuern, was wir für das Gute halten. Häufig sind, wenn das Szenario besonders gut abläuft, alle drei Bedingungen erfüllt, so daß man etwa bemüht ist, glücklich mit Ehepartner und Kindern zusammenzuleben, während man einer als befriedigend empfundenen Tätigkeit nachgeht, die überdies einen offenkundigen Beitrag zum Wohlergehen der Menschen darstellt.
Für diesen mittleren Zustand ist es allerdings unerläßlich, daß erstens die Routine, die Ordnung und die in unseren Alltagstätigkeiten ständig aufrechterhaltene Verbindung zur sinngebenden Instanz das Ausgestoßensein, den Überdruß und die Gefangenschaft im Monströsen irgendwie bannt und in Schach hält; zweitens müssen wir das Gefühl haben, ständig mit dem Ort der Fülle in Verbindung zu sein und uns im Laufe der Jahre langsam auf diesen Ort zuzubewegen. Es ist unmöglich, auf diesen Ort zu verzichten oder völlig die Hoffnung darauf zu verlieren, ohne daß der mittlere Zustand aus dem Gleichgewicht kommt.10
An diesem Punkt könnte es so aussehen, als sei meine Beschreibung dieser vermeintlich allgemeinen Struktur unseres moralischspirituellen Lebens auf den gläubigen Menschen zugeschnitten. Es liegt auf der Hand, daß die letzten Sätze des vorigen Absatzes recht gut zum psychischen Zustand des Gläubigen in der mittleren Position passen. Er fährt fort, an einen oft als Erlösung beschriebenen Zustand größerer Fülle zu glauben; er ist außerstande, diese Hoffnung aufzugeben, und möchte auch das Gefühl haben, daß er zumindest die Möglichkeit hat, dorthin fortzuschreiten, wenn er nicht sogar schon kleine Schritte in diese Richtung getan hat.
Es gibt jedoch bestimmt viele nichtgläubige Menschen, für die das hier als »mittlerer Zustand« charakterisierte Leben schon alles ist. Dieser Zustand ist das Ziel. Es geht darum, ein solches Leben – beispielsweise das eben geschilderte Dreier-Szenario – erfolgreich zu führen und zur Gänze auszukosten. Darüber hinaus hat das menschliche Leben nichts zu bieten. Doch nach dieser Auffassung gilt: (a) das ist gar nicht wenig; (b) wer glaubt, es gebe mehr – zum Beispiel nach dem Tod oder in einem unmöglichen Zustand der Heiligkeit –, läuft vor dem Streben nach diesem hohen menschlichen Wert davon und schädigt ihn.
Es kann also irreführend sein, die Fülle als einen »Ort« zu beschreiben, der von diesem mittleren Zustand verschieden ist. Dennoch besteht hier wirklich eine strukturelle Ähnlichkeit. Der nichtgläubige Mensch möchte jemand sein, für den dieses Leben völlig befriedigend ist, über das er sich mit seinem ganzen Wesen freuen und in dem sein Sinn für Fülle einen angemessenen Gegenstand finden kann. Außerdem ist er noch nicht angekommen. Entweder er kostet die sinnstiftenden Elemente seines Lebens nicht zur Gänze aus – er ist nicht wirklich glücklich in seiner Ehe, sein Beruf befriedigt ihn nicht ganz, er ist nicht sicher, daß sein Beruf tatsächlich dem Wohl der Menschheit dient – oder er ist zwar ziemlich zuversichtlich und glaubt, in allen diesen Hinsichten über das Wesentliche zu verfügen, kann aber im Gegensatz zu seiner erklärten Auffassung in diesem Leben weder den ganzen Seelenfrieden finden noch das Gefühl der Erfülltheit und der Ganzheit. Mit anderen Worten: Sein Streben richtet sich auf etwas, das jenseits des gegenwärtigen Orts liegt. Vielleicht ist es ihm noch nicht ganz gelungen, die Sehnsucht nach etwas Transzendentem zu überwinden. In der einen oder anderen Hinsicht muß er noch ein Stück seines Wegs zurücklegen. Darin liegt der Sinn dieser Ortsmetapher, obschon es sich nicht um einen Ort handelt, der insofern offenkundig »anders« ist, als er grundverschiedene Tätigkeiten oder einen Zustand jenseits dieses Lebens beinhaltet.
Daß diese typischen Bereiche des moralisch-spirituellen Lebens des Menschen als Bestimmungen der Fülle, Formen des Ausgestoßenseins und Arten des mittleren Zustands gekennzeichnet werden, hat den Sinn, daß uns damit die Möglichkeit gegeben wird, Glauben und Nichtglauben nicht bloß als Theorien oder anerkannte Glaubenssysteme, sondern auf angemessenere Weise als Rahmen des Erlebens zu begreifen.
Der offenkundige Grundgegensatz besteht hier darin, daß die Erklärung des Orts der Fülle aus der Sicht der Gläubigen eine Bezugnahme auf Gott verlangt, das heißt auf eine Instanz jenseits des Lebens und/oder der Natur des Menschen, während das bei Ungläubigen nicht der Fall ist. Sie werden die Erklärung offenlassen oder Fülle im Sinne eines naturalistisch verstandenen menschlichen Potentials deuten. Aber bisher scheint diese Beschreibung des Gegensatzes immer noch eine Beschreibung der Überzeugungen zu sein. Was wir benötigen, ist ein gewisses Verständnis für den Unterschied in den Erfahrungen, die gemacht werden.
Die Vielfalt der verschiedenen Formen, die es hier gibt, ist natürlich kaum zu ermessen. Aber vielleicht ist es möglich, einige der stets wiederkehrenden Themen festzuhalten. Gläubige haben oft oder typischerweise das Gefühl, daß die Fülle zu ihnen kommt, daß sie etwas ist, das sie entgegennehmen und das ihnen überdies im Rahmen einer Art persönlicher Beziehung zuteil wird – das sie von einem anderen Wesen empfangen, das lieben und schenken kann. Die Annäherung an die Fülle beinhaltet unter anderem eine Praxis der Verehrung und des Gebets (sowie der Barmherzigkeit und des Gebens). Ferner sind sich gläubige Menschen im klaren darüber, daß sie vom Zustand der uneingeschränkten Verehrung und Hingabe sehr weit entfernt sind. Sie wissen, daß sie in ihr Selbst eingeschlossen, an niedrigere Dinge und Ziele gebunden und außerstande sind, sich selbst zu öffnen und so zu empfangen und zu geben, wie sie es am Ort der Fülle täten. Hier herrscht also folgende Vorstellung: Kraft oder Fülle werden im Rahmen einer Beziehung empfangen; der Empfangende erhält seine Kraft allerdings nicht ohne weiteres im gegenwärtigen Zustand, sondern er muß dafür geöffnet, verwandelt und aus seinem Selbst befreit werden.
Diese Formulierung ist stark christlich geprägt. Um den Gegensatz zur heutigen Irreligiosität zu verdeutlichen, wäre es eventuell hilfreich, eine andere, stärker »buddhistisch« geprägte Formulierung hinzuzufügen. Dabei würde die persönliche Beziehung vielleicht ihre zentrale Stellung verlieren. Statt dessen würde mehr Nachdruck auf die Tendenz zur Selbstüberwindung gelegt werden, auf die Öffnung des Selbst und das Empfangen einer Kraft jenseits unserer selbst.
Für den nichtreligiösen Menschen der Neuzeit liegt die Problematik ganz anders. Die Kraft, zur Fülle zu gelangen, ist eine innere. Dieser Gedanke nimmt verschiedene Formen an. Eine von ihnen stellt unsere Natur als Vernunftwesen in den Mittelpunkt. Die kantianische Variante ist die direkteste Form dieser Auffassung: Als handlungsfähige Vernunftwesen haben wir das Vermögen, die Gesetze zu geben, nach denen wir leben. Das ist, verglichen mit der in Gestalt unserer Triebe gegebenen Kraft der bloßen Natur, soviel höherstehend, daß wir beim ungehinderten Nachdenken darüber gar nicht umhinkönnen, Achtung vor dieser Kraft zu empfinden. Der Ort der Fülle liegt dort, wo es uns schließlich gelingt, dieser Kraft freien Lauf zu lassen und ihr gemäß zu handeln. Wir haben das Gefühl der Rezeptivität, wenn wir im vollen Bewußtsein der uns als Triebwesen eigenen Schwäche und Leidensanfälligkeit mit Bewunderung und Ehrfurcht zur Kraft der Gesetzgebungsfähigkeit aufblicken. Das bedeutet aber nicht, daß hier zu guter Letzt etwas von außen Kommendes entgegengenommen wird. Die Kraft wohnt im Inneren. Und je mehr wir diese Kraft in die Tat umsetzen, desto stärker wird uns bewußt, daß sie im Inneren wohnt – daß Moralität nichts Heteronomes sein darf, sondern etwas Autonomes sein muß.
(Diese Auffassung läßt sich durch eine Entfremdungstheorie à la Feuerbach ergänzen: Wir projizieren Gott, weil wir schon früh eine Vorstellung von dieser ehrfurchtgebietenden Kraft haben, die wir fälschlicherweise außerhalb unseres Selbst ansiedeln. Nun müssen wir sie neuerlich für den Menschen in Anspruch nehmen. Diesen Schritt hat Kant allerdings nicht getan.)
Natürlich gibt es viele stärker naturalistische Varianten der Kraft der Vernunft: Varianten, die sich von der dualistischen und der religiösen Dimension des Kantischen Denkens ebenso absetzen wie von Kants Glauben an die uneingeschränkte Freiheit des moralischen Akteurs, an Unsterblichkeit und Gott – die drei Postulate der praktischen Vernunft. Hier ist eine strengere Form von Naturalismus möglich, die der einerseits vom Instinkt getriebenen und andererseits von Überlebensnotwendigkeiten eingezwängten menschlichen Vernunft nur wenig Spielraum zugesteht. Es kann sein, daß für den Besitz dieser Fähigkeit gar keine Erklärung angeboten wird. Vielleicht besteht die Ausübung dieser Fähigkeit – anders als bei Kant – hauptsächlich in rein instrumentellen Anwendungen der Vernunft. Doch im Rahmen dieser Form von Naturalismus stößt man oft auf eine gewisse Bewunderung für die Kraft der sachlichen, ungebundenen Vernunft mit ihrer Fähigkeit, die Welt und das menschliche Leben ohne Illusionen zu betrachten und zielorientiert im Interesse des menschlichen Gedeihens zu handeln. Dabei wird die Vernunft als kritisches Vermögen nach wie vor mit einer gewissen Ehrfurcht bedacht, insofern sie dazu fähig ist, uns von Täuschungen und blinden Instinktkräften sowie von den Hirngespinsten zu befreien, die aus Angst, Borniertheit und Zaghaftigkeit hervorgehen. Nichts kommt der Fülle näher als dieses Vernunftvermögen, das zur Gänze uns gehört und das, sofern es sich überhaupt entwickelt, ausschließlich durch unser eigenes, häufig heldenhaftes Handeln zur Entfaltung gelangt. (An dieser Stelle werden oft die Giganten der »wissenschaftlichen« Vernunft der Neuzeit beim Namen genannt: Kopernikus, Darwin und Freud.)
Dieses Gefühl, wir seien schwache und zugleich mutige Wesen mit der Fähigkeit, uns furchtlos einem an sich sinnlosen, feindlichen Universum zu stellen und die Herausforderung anzunehmen, unsere eigenen Lebensregeln aufzustellen, kann – wie sich zum Beispiel aus den Schriften Camus’ entnehmen läßt – eine Quelle der Inspiration sein.11 Wenn wir, von diesem Gefühl der eigenen Größe befeuert, mit dieser Herausforderung wirklich fertig werden, kann dieser Zustand, den wir anstreben, aber nur selten, wenn überhaupt je erreichen, im Sinne der obigen Erörterung als eigenständiger Ort der Fülle fungieren.
Im Gegensatz zu diesen Formen des Frohlockens über das unabhängige Vermögen der Vernunft gibt es andere Formen der Irreligiosität, die ähnlich wie religiöse Auffassungen der Ansicht sind, daß wir von einer anderen Instanz als der autonomen Vernunft mit Kraft ausgestattet werden müssen, um zur Fülle zu gelangen. Die Vernunft allein ist borniert, blind gegenüber den Forderungen der Fülle und wird – wenn sie keine Grenzen anerkennt – vielleicht zur Zerstörung der Menschheit und ihrer Umwelt voranmarschieren. Vielleicht wird sie von einer Art von Hochmut – von Hybris – angetrieben. Dies läßt eine religiöse Art der Kritik an der neuzeitlichen, ungebundenen, irreligiösen Vernunft anklingen, außer daß die Ursprünge der Kraft nicht als transzendent gelten, sondern in der Natur, in den Tiefen des eigenen Inneren oder in beiden zu finden seien. Hier können wir Theorien der Immanenz erkennen, die aus der romantischen Kritik an der ungebundenen Vernunft hervorgehen, was vor allem für bestimmte aktuelle Formen der ökologischen Ethik gilt, zumal für die Tiefenökologie. Der rationale Geist müsse sich einer tieferen und volleren Instanz öffnen. Dabei soll es sich (zumindest teilweise) um etwas Inneres handeln, um unsere eigenen tiefsten Gefühle oder Instinkte. Daher müßten wir den Bruch heilen, den die von allen losgelöste, distanzierte Vernunft in unserem Inneren verursacht hat, indem sie das Denken von Gefühl, Instinkt und Intuition getrennt hat.
Wir haben es also mit Auffassungen zu tun, die, wie gerade gesagt, gewisse Ähnlichkeiten mit der religiösen Reaktion auf die irreligiöse Aufklärung aufweisen, insofern sie die Seite des Empfangens stärker betonen als die Seite der Unabhängigkeit. Aber es sind dennoch Auffassungen, die immanent bleiben wollen und die der Religion oft ebenso feindselig gegenüberstehen wie die Verfechter der ungebundenen Vernunft, wenn nicht sogar feindseliger.
Es gibt eine dritte Kategorie der Einstellungen, die ich, obwohl sie schwer einzuordnen ist, an einem späteren Punkt dieser Erörterung zu erläutern hoffe. Gemeint sind Ansichten, wie sie etwa von manchen heutigen Formen der Postmoderne vertreten werden. Sie bestreiten, attackieren oder verhöhnen die Ansprüche der unabhängigen Vernunft, ohne jedoch eine äußere Quelle zu nennen, aus der Kraft zu empfangen wäre. Ihre Entschlossenheit, romantische Vorstellungen vom Trost im Gefühl oder in der wiedergewonnenen Einheit zu untergraben und zu leugnen, geht Hand in Hand mit ihrer Entschlossenheit, den Aufklärungstraum vom reinen Denken unter Beschuß zu nehmen. Und häufig scheinen Auffassungen dieser Art noch stärker darauf bedacht zu sein, ihre atheistischen Überzeugungen zu unterstreichen. Es geht ihnen darum, die Unheilbarkeit des Bruchs, des Fehlens eines Zentrums und die immerwährende Abwesenheit der Fülle herauszustreichen. Diese Fülle sei bestenfalls ein notwendiger Traum – vielleicht eine notwendige Voraussetzung, damit wir unserer Welt immerhin ein wenig Sinn abzugewinnen vermögen, und dennoch zugleich etwas, das stets anderswo ist und grundsätzlich nicht ausfindig gemacht werden kann.
Diese Familie von Auffassungen scheint völlig außerhalb der Strukturen zu stehen, von denen hier die Rede ist. Dennoch kann man meines Erachtens zeigen, daß sie in mehreren Hinsichten auf diese Strukturen angewiesen ist. So läßt sie sich von dem Gefühl ermuntern, daß wir Mut und Größe zeigen, wenn wir dazu in der Lage sind, uns dem Unabänderlichen zu stellen und trotzdem weiterzumachen. Darauf hoffe ich später zurückzukommen.
Wir haben also einige Fortschritte gemacht in puncto Äußerungen über Glauben und Unglauben als Formen des Erlebens oder Erfahrens des moralisch-spirituellen Lebens, wobei wir uns im Rahmen der drei obengenannten Bereiche bewegt haben. Zumindest habe ich einige Gegensätze innerhalb des ersten Bereichs – des Bereichs des Erlebens der Fülle – herausgearbeitet. Hier geht es um den Ursprung der Kraft, die uns auf den Weg zu dieser Fülle bringen kann, sowie um die Frage, ob und in welchem Sinn diese Fülle etwas »Inneres« oder etwas »Äußeres« ist. Entsprechende Unterschiede ergeben sich im Hinblick auf Erfahrungen des Ausgestoßenseins und die Erfahrungen des mittleren Zustands.
Über diese Unterscheidung zwischen Innen und Außen muß mehr gesagt werden, doch ehe ich weiter darauf eingehe, gilt es, eine andere wichtige Facette dieser Erfahrung der irgendwie »ortsgebundenen« Fülle zu erkunden. Wir sind zwar über das bloße Glauben hinausgegangen und dem wirklichen Erleben näher gerückt, aber es gibt nach wie vor wichtige Unterschiede in der Art des Erlebens, die erst deutlich gemacht werden müssen.
Was bedeutet die Behauptung, für mich rühre die Fülle von einer Kraft her, die außerhalb meiner selbst liegt, die ich empfangen muß, und so weiter? Nun, heutzutage wahrscheinlich ungefähr folgendes: Meinen einander widerstreitenden moralischen und spirituellen Erfahrungen läßt sich am besten durch eine entsprechende theologische Sicht der Dinge Sinn abgewinnen. Das heißt, in meiner eigenen Erfahrung, im Gebet, in Augenblicken der Fülle, in der Erfahrung des überwundenen Ausgestoßenseins, durch meine Beobachtungen über die Lebenswege der Menschen in meiner Umgebung – Lebenswege, die sich durch außerordentliche spirituelle Fülle auszeichnen, durch höchste Abgeschlossenheit im Selbst, durch teuflische Bösartigkeit und so weiter – gewinne ich den Eindruck, daß sich dieses Bild herausschält. Aber dennoch bin ich nie – oder nur selten – wirklich sicher, ohne Zweifel oder unirritierbar von einem Einwand – von einer Erfahrung, die nicht paßt, von einem Leben, das auf andere Weise zur Fülle gelangt, von einer andersartigen Form der Fülle, die mich mitunter anzieht, und so weiter.
Das ist typisch für die heutige Situation, und eine ähnliche Geschichte könnte auch von vielen nichtreligiösen Menschen erzählt werden. Unter den jetzigen Lebensverhältnissen ist die Einsicht unausweichlich, daß es eine Vielzahl verschiedenartiger Deutungen gibt, eine Vielzahl von Anschauungen, über die intelligente, einigermaßen illusionslose Menschen guten Willens verschiedener Meinung sein können und tatsächlich verschiedener Meinung sind. Wir können gar nicht umhin, gelegentlich über die eigene Schulter zu blicken, seitwärts zu schauen und auch unter Bedingungen des Zweifels und der Ungewißheit dem eigenen Glauben entsprechend zu leben.
Es ist dieses Anzeichen des Zweifels, das die Menschen dazu bringt, hier von »Theorien« zu sprechen. Denn Theorien sind oft Hypothesen, die letztlich ungewiß sind und auf weitere Belege warten. Aus meinen Ausführungen geht hoffentlich hervor, daß wir dergleichen nicht als bloße Theorien auffassen können: Es gibt eine Hinsicht, in der sich unsere gesamte Erfahrung verändert, wenn wir unsere Lebensführung nach dieser oder jener Spiritualität ausrichten. Aber dennoch sind wir uns heute im klaren darüber, daß man das spirituelle Leben unterschiedlich führen kann. Wir wissen, daß die Kraft, die Fülle, das Ausgestoßensein und so weiter verschiedene Gestalten annehmen können.
Es gibt jedoch offenbar eine andere Möglichkeit, diese Dinge zu erleben; und viele Menschen haben sie tatsächlich so erlebt. Das ist ein Zustand, in dem die unmittelbare Erfahrung der Kraft, eines Orts der Fülle oder des Ausgestoßenseins mit Hilfe von Begriffen geschildert wird, die wir der einen oder anderen der möglichen Alternativen zurechnen würden, während sich für die betreffenden Menschen selbst keine derartige Unterscheidung zwischen dem Erleben und dessen Deutung ergeben hat. Kommen wir beispielsweise auf Hieronymus Bosch zurück. Angesichts seiner Alptraumszenarios der Besessenheit, der bösen Geister und der Gefangenschaft in monströsen Tiergestalten können wir uns vorstellen, daß sie in der Erfahrung vieler damals lebender Menschen keineswegs »Theorien« darstellten, sondern Objekte realer Angst – einer dermaßen schlimmen Angst, daß es gar nicht möglich war, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, sie könnten nicht wirklich sein. Man selbst oder die eigenen Bekannten hatten dergleichen erlebt. Und vielleicht kam niemand in der eigenen Umgebung auch nur auf die Idee, sie könnten nicht real sein.
In ähnlicher Weise waren die Leute, die zur Zeit des Neuen Testaments in Palästina lebten, viel zu unmittelbar am echten Leiden des Nachbarn oder des geliebten Menschen beteiligt, um, wenn sie einen angeblich vom bösen Geist besessenen Menschen sahen, auch nur auf den Gedanken zu kommen, dies sei zwar eine interessante Erklärung eines psychologischen Zustands anhand rein innerpsychologischer Begriffe, aber dieser lasse sich auch durch andere und vielleicht zuverlässigere Entstehungsgeschichten beschreiben.
Ganz ähnlich muß es sich (um ein aktuelleres, diesmal aus Westafrika stammendes Beispiel anzuführen) für die von Birgit Meyer interviewte Celestine verhalten haben,12 »die auf dem Heimweg von Aventile, den sie gemeinsam mit ihrer Mutter angetreten hatte, von einem Fremden begleitet wurde, der mit dem weißen Gewand der Leute aus dem Norden bekleidet war«. Als die Mutter später befragt wurde, leugnete sie, den Mann gesehen zu haben. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Akan-Geist Sowlui, und Celestine wurde dazu gezwungen, ihm zu dienen. In der Welt Celestines wäre es zwar vielleicht möglich gewesen, die Gleichsetzung des Mannes mit diesem Geist als »Annahme« zu bezeichnen, denn sie erfolgte nach der Erfahrung und im Zuge eines Versuchs zu erklären, was es mit dem Erlebnis auf sich hatte; doch der Mann, der sie begleitete, war einfach etwas, was ihr widerfuhr – ein Faktum ihrer Welt.
Es gibt also einen Zustand des Erlebens, in dem das, was wir vielleicht eine Deutung des Moralisch-Spirituellen nennen würden, nicht als Deutung erfahren wird, sondern als eine ebenso unmittelbare Realität wie Steine, Flüsse und Berge. Das gleiche gilt auch für die positive Seite der Dinge, etwa für die Menschen früherer Zeitalter unserer Kultur, für die der Weg zur Fülle nichts anderes bedeutete, als daß sie sich Gott näherten. Die Alternativen, denen sie sich in ihrem Leben gegenübersahen, bestanden darin, daß man entweder ein frommes Dasein führte oder sich weiterhin an geringere Werte hielt und somit auch künftig der Fülle fernblieb. Man war entweder dévot oder mondain, um es in der französischen Sprache des siebzehnten Jahrhunderts auszudrücken, aber man begab sich nicht auf den Weg einer anderen Deutung dessen, was »Fülle« bedeuten könnte.
Teil der Geschichte unserer Zivilisation ist, daß wir solche Formen der unmittelbaren Gewißheit großenteils verschlissen haben. Das heißt, offenbar können wir sie niemals so völlig »naiv« hinnehmen,13 wie es zur Zeit von Hieronymus Bosch der Fall war. Dennoch gibt es nach wie vor etwas Analoges, wenn auch weniger Wirksames. Gemeint ist die Art und Weise, in der das Moralisch-Spirituelle in bestimmten Milieus tendenziell in Erscheinung tritt: Heutzutage muß zwar jeder einsehen, daß es mehr als eine Option gibt, aber dennoch kann es sein, daß sich eine – sei es religiöse oder irreligiöse – Option in unserem Milieu als die weitaus plausiblere darstellt. Man weiß zwar, daß es auch andere Optionen gibt, und wenn man sich dafür interessiert und sich später von einer weiteren angezogen fühlt, kann es gelingen, daß man durch Nachdenken oder mühsames Ringen dorthin gelangt. Vielleicht bricht man mit seiner Religionsgemeinschaft und wird Atheist, oder man schlägt den umgekehrten Weg ein. Doch eine dieser Optionen ist sozusagen vorgegeben.
In dieser Hinsicht hat in unserer abendländischen Zivilisation ein enormer Wandel stattgefunden. Es ist nicht nur so, daß wir den Zustand, in dem sich die meisten Menschen »naiv« verhielten und eine bestimmte (zum Teil aufs Christentum und zum Teil auf die »Geister« heidnischer Prägung bezogene) Deutung als schlicht gegebene Realität hinnahmen, hinter uns gelassen und nun einen Zustand erreicht haben, in dem praktisch niemand mehr dazu in der Lage ist, sondern jetzt begreifen alle die eigene Option als eine unter mehreren. Jeder von uns lernt, zwischen zwei Standpunkten zu manövrieren: zwischen dem »engagierten« Standpunkt dessen, der sich nach besten Kräften an die durch den eigenen Standpunkt ermöglichte Realitätserfahrung hält, und dem »distanzierten« Standpunkt dessen, der sich als Vertreter eines Standpunkts unter mehreren sehen kann, mit denen man sich auf diese oder jene Weise arrangieren muß.
Aber es hat noch ein weiterer Wandel stattgefunden: Von jenem Zustand, in dem das Religiöse nicht nur für naive Menschen die vorgegebene Option war, sondern auch für jene, die den Atheismus kannten, in Betracht zogen und erörterten, zu einer Situation, in der irreligiöse Deutungen für immer mehr Menschen auf den ersten Blick die einzig einleuchtenden zu sein scheinen. Dem Zustand dessen, der ebenso »naiv« Atheist ist, wie seine Vorfahren naiv ihrem halb heidnischen Glauben anhingen, können sie sich zwar nur nähern, ohne ihn jemals wirklich zu erreichen, aber dennoch kommt ihnen diese Deutung als die weitaus plausibelste vor. Es fällt ihnen schwer, Menschen zu verstehen, die sich für eine andere Deutung entscheiden. Das gilt in so hohem Maße, daß sie ohne weiteres, um den religiösen Glauben zu erklären, ziemlich grobschlächtige Irrtumstheorien heranziehen und sagen, solche Menschen hätten Angst vor der Ungewißheit, dem Unbekannten; sie seien intellektuell nicht auf der Höhe, von Schuldgefühlen gelähmt und so weiter.
Natürlich befindet sich nicht wirklich jeder in dieser Lage. Unsere moderne Zivilisation besteht aus einer Vielzahl von Gesellschaften, Teilgesellschaften und Milieus, die sich alle erheblich voneinander unterscheiden. Aber die Vorannahme des Nichtglaubens hat sich in immer mehr Milieus durchgesetzt und ist in einigen maßgeblichen Bereichen vorherrschend, beispielsweise an den Universitäten und in intellektuellen Kreisen, von wo aus sie besonders leicht auf andere Bereiche übergreifen kann.
Um die Auseinandersetzung zwischen Religiosität und Irreligiosität wirklich in unserer Zeit anzusiedeln, müssen wir sie in den Zusammenhang dieser Erfahrung und der diese Erfahrung prägenden Deutungen stellen. Das bedeutet nicht nur, daß man mehr darin sieht als die Gegebenheit verschiedener »Theorien« zur Erklärung der gleichen Erfahrungen. Es bedeutet außerdem, die jeweils charakteristische Position der verschiedenen Deutungen zu verstehen und zu erkennen, in welcher Weise sie »naiv« oder »reflektiert« ins Leben einbezogen werden können und wie die eine oder andere für viele Menschen oder Milieus zur vorgegebenen Option werden kann.
Um die Sache anders zu formulieren: Der Glaube an Gott läuft im Jahre 1500 nicht aufs gleiche hinaus wie im Jahre 2000. Damit beziehe ich mich nicht auf die Tatsache, daß sich sogar das orthodoxe Christentum in wichtigen Hinsichten gewandelt hat (so zum Beispiel was den »Niedergang der Hölle« oder neue Auffassungen über die Buße betrifft). Auch im Hinblick auf identische Glaubenspositionen besteht ein maßgeblicher Unterschied. Dieser Unterschied kommt zum Vorschein, sobald man berücksichtigt, daß alle Überzeugungen in einem Kontext oder Rahmen des Selbstverständlichen vertreten werden. Diese Selbstverständlichkeiten bleiben normalerweise unausgesprochen und sind, da sie nie explizit formuliert werden, von den betreffenden Akteuren bis jetzt gar nicht als solche anerkannt worden. Das ist gemeint, wenn von Wittgenstein, Heidegger oder Polanyi beeinflußte Philosophen von einem »Hintergrund« sprechen.14 Wenn ich Gesteinsformationen erforsche, ist es, wie Wittgenstein sagt,15 selbstverständlich für mich, daß die Welt mitsamt allen Fossilien und Schichten nicht vor fünf Minuten entstanden ist. Dennoch käme es mir nie in den Sinn, das ausdrücklich zu formulieren und anzuerkennen, solange keine verschrobenen, ihr erkenntnistheoretisches Steckenpferd bis zur Besessenheit reitenden Philosophen daherkommen und mich mit dieser Aussage konfrontieren.
Doch nun habe ich mich womöglich anstecken lassen und kann meiner Forschung nicht mehr naiv nachgehen, sondern muß berücksichtigen, worauf ich mich gestützt habe, und vielleicht die Möglichkeit des Irrtums in Erwägung ziehen. Diese Störung der Naivität ist oft der Weg zu mehr Verständnis (wenn auch nicht in diesem speziellen Fall). Es könnte sein, daß man in einem System arbeitet, in dem alle Bewegungen den üblichen Himmelsrichtungen entsprechen beziehungsweise nach oben oder unten ausgeführt werden. Aber um sich in einem Raumschiff zurechtzufinden oder um sich sogar nur eine Vorstellung davon zu machen, muß man einsehen, wie relativ und beschränkt der ursprüngliche Rahmen ist.
Der Unterschied, von dem hier die Rede ist, betrifft den gesamten Hintergrundrahmen, in dem man an Gott glaubt oder sich weigert, an Gott zu glauben. Der Rahmen von früher und der Rahmen von heute verhalten sich zueinander wie das »Naive« und das »Reflektierte«, denn der heutige Rahmen läßt eine Fragestellung zu, die durch die nicht ausdrücklich anerkannte Form des einstigen Hintergrunds ausgeschlossen war.
Die Veränderung des Hintergrunds – oder vielmehr: die Zerrüttung des früheren Hintergrunds – wird besonders deutlich, wenn man sein Augenmerk auf bestimmte Unterscheidungen richtet, die heute üblich sind, wie zum Beispiel die Unterscheidung zwischen dem Immanenten und dem Transzendenten oder die Unterscheidung zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen. Jeder begreift diese Unterscheidungen, einerlei ob er das jeweils zweite Glied dieser Gegensatzpaare bejaht oder verneint. Diese Abtrennung einer unabhängigen, freistehenden Ebene der »Natur«, die vielleicht – aber vielleicht auch nicht – mit etwas darüber Hinausgehendem oder etwas Jenseitigem in Wechselwirkung steht, ist ein entscheidendes Element neuzeitlicher Theoriebildung, das (wie ich weiter unten im einzelnen zu zeigen hoffe) einer konstitutiven Dimension der modernen Erfahrung entspricht.
Es ist dieser Wandel des Hintergrunds – des ganzen Rahmens, in dem wir die Fülle erleben und nach Fülle streben –, den ich als Anbruch eines säkularen Zeitalters (im dritten Sinn von »säkular«) bezeichne. Wie ist es gekommen, daß wir von einem Zustand, in dem die Menschen der christlichen Welt naiv im Rahmen einer theistischen Deutung lebten, zu einem Zustand übergegangen sind, in dem wir uns alle zwischen zwei Haltungen hin- und herbewegen, in dem die Deutung eines jeden als Deutung in Erscheinung tritt und in dem die Irreligiosität überdies für viele zur wichtigsten vorgegebenen Option geworden ist? Das ist die Transformation, die ich in den folgenden Kapiteln beschreiben und (zu einem geringen Teil) vielleicht auch erklären möchte.
Das ist keine leichte Aufgabe, aber nur wenn wir einsehen, daß der Wandel eine Veränderung der Erfahrung darstellt, können wir immerhin die richtigen Fragen aufwerfen und die allseits geäußerten naiven Sprüche vermeiden, denen zufolge Irreligiosität nichts anderes sei als das Verschwinden des Sinns für Fülle beziehungsweise ein Verrat an diesem Vermögen oder Religion nichts anderes als eine Reihe von Theorien, die dem Versuch dienen, uns allen bekannte Erfahrungen zu begreifen, deren Wesen rein immanent zu verstehen sei. (Zu Ansichten der ersten Art lassen sich manchmal die Theisten verlocken, wenn von Atheisten die Rede ist, während Atheisten mitunter zu Meinungen der zweiten Art tendieren, wenn es um Theisten geht.)
Tatsächlich dürfen wir die Unterschiede zwischen diesen Optionen nicht nur im Sinne von Glaubensbekenntnissen verstehen, sondern wir müssen sie auch im Hinblick auf die Unterschiede in der Erfahrung und im Empfinden begreifen. Auf dieser letzteren Ebene müssen wir außerdem die folgenden beiden wichtigen Unterschiede berücksichtigen: Erstens ist da der gewaltige Wandel des gesamten Hintergrunds von Glauben oder Nichtglauben, das heißt das Hinschwinden des »naiven« Rahmens von früher und der Aufstieg unseres »reflektierten« Systems. Zweitens muß uns bewußt sein, inwiefern gläubige Menschen ihre Welt ganz anders erleben können als Menschen ohne Religion. Das Gefühl, Fülle sei an einem jenseitigen Ort zu finden, kann als Erfahrungstatsache über uns hereinbrechen, wie etwa in dem oben zitierten Fall von Bede Griffiths oder in dem Augenblick der Bekehrung, die Paul Claudel zur Vesperstunde in Notre Dame erlebt hat. Anschließend kann diese Erfahrung artikuliert und rationalisiert werden, und sie kann spezifische Überzeugungen hervorrufen. Dieser Vorgang kann Zeit in Anspruch nehmen, und die betreffenden Überzeugungen können sich im Laufe der Jahre verändern, obwohl das Ausgangserlebnis als paradigmatischer Augenblick im Gedächtnis bleibt. So ist es zum Beispiel Bede Griffiths ergangen, der erst einige Jahre später zu einer durch und durch theistischen Lesart dieses ausschlaggebenden Moments gelangte. Eine ähnliche »Verzögerung« läßt sich auch im Falle Claudels feststellen.16 Zur Beschreibung der Säkularität 3 muß daher auf die Frage Bezug genommen werden, ob bestimmte Formen der Erfahrung in unserer Zeit möglich oder unmöglich sind.
3
Oben habe ich mich bemüht, den Begriff »säkular« (oder »Säkularität«) in den Griff zu bekommen. Er scheint zunächst ohne weiteres einzuleuchten, doch sobald man darüber nachsinnt, stellen sich alle möglichen Probleme ein. Einige dieser Probleme habe ich durch die Unterscheidung zwischen drei verschiedenen Bedeutungen des Wortgebrauchs zu bannen versucht. Dadurch gelingt es zwar keineswegs, alle Probleme auszuräumen, aber es genügt vielleicht, um einen gewissen Fortschritt der Untersuchung zu ermöglichen.
Allerdings nehmen alle drei Formen der Säkularität auf »Religion« Bezug: sei es als das, was in der Öffentlichkeit an Bedeutung verliert (1), als ein Typus des Glaubens und der Praxis, der im Rückgang begriffen ist oder nicht (2), oder als eine bestimmte Art des Glaubens oder des Engagements, deren heutige Bedingungen untersucht werden (3). Doch was ist »Religion« eigentlich? Dieser Begriff spottet bekanntlich jeder Definition, und zwar hauptsächlich deshalb, weil die Phänomene, die wir als religiöse bezeichnen möchten, im menschlichen Leben ungeheuer verschiedenartige Rollen spielen. Wenn wir zu erfassen versuchen, welches die Gemeinsamkeiten sind zwischen dem Leben archaischer Gesellschaften, in denen »die Religion überall ist«, und den deutlich abgegrenzten Glaubenssätzen, Gebräuchen und Institutionen, die in unserer Gesellschaft unter diese Rubrik fallen, stehen wir vor einer schweren und vielleicht unlösbaren Aufgabe.
Doch wenn wir uns klug (oder vielleicht feige) verhalten und bedenken, daß wir eine Reihe von Formen und Veränderungen zu verstehen versuchen, die sich in einer bestimmten Zivilisation – nämlich in der neuzeitlichen westlichen Welt und in einer ihrer früheren Verkörperungen, in der vorreformatorischen römischen Kirche – ergeben haben, erkennen wir voller Erleichterung, daß es gar nicht nötig ist, eine Definition aufzustellen, die alles »Religiöse« in allen menschlichen Gesellschaften aller Zeiten abdeckt. Der Wandel, der im Hinblick auf die Stellung der Religion in den drei hier unterschiedenen Dimensionen der Säkularität für die Menschen unserer (nordatlantischen oder »abendländischen«) Zivilisation von Bedeutung war und nach wie vor ist, ist ebenjener Wandel, den ich, was eine seiner besonders wichtigen Facetten betrifft, bereits zu untersuchen begonnen habe. Wir haben nämlich eine Welt verlassen, in der außer Frage stand, daß der Ort der Fülle außerhalb oder »jenseits« des menschlichen Lebens liegt, und ein konfliktreiches Zeitalter betreten, in dem dieser Deutung von anderen Deutungen widersprochen wird, die diesen Ort (in jeweils einer von vielen grundverschiedenen Formen) »ins Innere« des menschlichen Lebens verlagern. Dies ist die Problematik, in deren Umkreis in neuerer Zeit viele der wichtigen Kämpfe ausgefochten worden sind. (Und das steht im Gegensatz zu einer früheren Zeit, in der es bei den auf Leben und Tod ausgetragenen Kämpfen um verschiedene Lesarten der christlichen Auffassung ging.)
Mit anderen Worten, eine auf die Unterscheidung zwischen Transzendenz und Immanenz abhebende Interpretation des »Religiösen« wird den Zwecken, die wir verfolgen, dienlich sein. Das ist der Vorteil des besonnenen (beziehungsweise feigen) Verfahrens, das ich hier vorschlage. Es ist durchaus nicht der Fall, daß sich die Religion generell im Sinne dieser Unterscheidung definieren läßt. Man könnte sogar geltend machen, daß diese spezielle Art der Grundunterscheidung ausschließlich von uns (abendländischen Menschen oder Vertretern des lateinischen Christentums) vorgenommen worden ist – einerlei ob uns das zu intellektuellem Ruhm gereicht oder eher gegen uns spricht (wie ich später dartun werde, ist beides zum Teil zutreffend). Platon zum Beispiel könnte man nicht dafür verantwortlich machen, nicht weil es unmöglich wäre, die Ideen von den sie »nachahmenden« Dingen im Strom des Wandels zu unterscheiden, sondern gerade weil diese sich verändernden Wirklichkeiten nur mit Hilfe der Ideen zu verstehen sind. Die große Erfindung des Abendlands war der Gedanke einer immanenten Ordnung der Natur, deren Wirken mit Hilfe der ihr vorbehaltenen Begriffe systematisch verstanden und erklärt werden könne, wobei die Frage offenbleibt, ob diese ganze Ordnung eine tiefere Bedeutung hat und, wenn ja, ob daraus die Existenz eines transzendenten, jenseitigen Schöpfers gefolgert werden sollte. Diese Vorstellung von »Immanenz« beinhaltet, daß man jede Form von wechselseitiger Durchdringung der Naturdinge einerseits und des »Übernatürlichen« andererseits bestreitet – oder zumindest getrennt behandelt und in Frage stellt –, wobei es unerheblich ist, ob das »Übernatürliche« als der eine transzendente Gott aufgefaßt wird, als Götter und Geister, als magische Kräfte oder sonstwie.17
Die Definition der Religion im Sinne der Unterscheidung zwischen Immanenz und Transzendenz ist also ein Schritt, der ganz auf unsere Kultur zugeschnitten ist. Das kann man zwar als etwas Borniertes, Inzestuöses oder als Nabelschau abtun, doch ich für mein Teil halte es für eine kluge Maßnahme, denn wir versuchen ja, Veränderungen innerhalb einer Kultur zu verstehen, für die diese Unterscheidung grundlegend geworden ist.
Anstatt also (wie weiter oben geschehen) zu fragen, ob der Ursprung der Fülle als etwas Inneres oder etwas Äußeres gesehen oder erlebt wird, könnte man fragen, ob die Menschen etwas anerkennen, das jenseits dieses Lebens liegt oder diesem Leben transzendent ist. Das ist die übliche Formulierung dieser Frage, die ich mir im folgenden zunächst zu eigen machen möchte. Eine etwas ausführlichere Erläuterung des mit dieser Unterscheidung Gemeinten werde ich anbieten, sobald wir einige Kapitel weiter sind und auf moderne Theorien der Säkularisierung zu sprechen kommen. Ich bin mir völlig im klaren darüber, daß ein Wort wie »transzendent« überaus heikel ist, was (wie eben angedeutet) zum Teil daran liegt, daß diese Unterscheidungen im Zuge der Entstehung der Moderne und der Säkularisierung getroffen oder neu formuliert worden sind. Ich bin jedoch der Überzeugung, daß das Wort trotz aller Vagheit in unserem Zusammenhang von Nutzen sein kann.
Doch gerade aus den oben untersuchten Gründen möchte ich die übliche Erklärung des Religionsbegriffs im Sinne des Glaubens an das Transzendente ergänzen und eine Erläuterung hinzufügen, die sich stärker auf unser Gefühl für den eigenen Praxiskontext bezieht. Dieser Gedanke läßt sich zum Beispiel wie folgt erläutern:
Jede Person und jede Gesellschaft lebt mit oder nach einer Vorstellung oder mehreren Vorstellungen vom menschlichen Gedeihen: Was macht ein erfülltes Leben aus? Wodurch wird das Leben wirklich lebenswert? Was würden wir an anderen Menschen am meisten bewundern? In unserem Leben können wir gar nicht umhin, diese Frage und damit zusammenhängende Fragen zu stellen. Und unsere angestrengten Bemühungen, solche Fragen zu beantworten, definieren die Auffassung oder Auffassungen, nach denen wir unser Leben zu führen versuchen oder zwischen denen wir hin- und herschwanken. Auf einer anderen Ebene sind diese Auffassungen kodifiziert – manchmal in Gestalt philosophischer Theorien, manchmal als moralische Regeln und manchmal durch religiöse Gebräuche und frommes Verhalten. Diese Kodifizierungen sowie diverse unzulänglich formulierte Praktiken, die von den Menschen in unserer Umgebung angewendet werden, sind die Mittel, die jedem, der bemüht ist, sein Leben zu führen, von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden.
Eine weitere Möglichkeit, zu einer ähnlichen wie der oben im Sinne von Innen und Außen formulierten Fragestellung zu gelangen, ist die folgende: Setzt das höchste, das beste Leben voraus, daß man einem jenseitigen Wert – also einem vom menschlichen Gedeihen unabhängigen Wert – nachstrebt, Anerkennung zollt oder Folge leistet? In diesem Fall könnte zur höchsten, eigentlichsten, authentischsten oder angemessensten Form menschlichen Gedeihens gehören, daß man im Bereich der Endziele (auch) etwas anderes als das menschliche Gedeihen erreichen will. Ich spreche hier von »Endzielen«, denn auch der selbstgenügsamste Humanismus muß ein instrumentelles Interesse am Zustand einiger außermenschlicher Dinge haben, beispielsweise am Zustand der natürlichen Umwelt. Strittig ist, ob diese Werte auch in letzter Instanz eine Rolle spielen.
Die Antwort auf diese Frage lautet in der jüdisch-christlichen Religionstradition klarerweise »Ja«. Gott lieben und anbeten ist der Endzweck. Natürlich wird Gott im Rahmen dieser Tradition als ein Wesen gesehen, von dem das menschliche Gedeihen gewollt wird, aber die Verehrung Gottes wird nicht als davon abhängig aufgefaßt. Der Befehl »Dein Wille geschehe« ist nicht gleichbedeutend mit »Sorge dafür, daß die Menschen gedeihen«, obwohl wir wissen, daß das menschliche Gedeihen Gottes Wille ist.
Mit dieser Variante sind wir wohlvertraut. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten, jenseits des normalen menschlichen Gedeihens zu gelangen. Ein Beispiel liefert der Buddhismus. In einer Hinsicht könnte man die Botschaft Buddhas als Auskunft darüber deuten, wie man zum wahren Glück gelangt, das heißt, wie man Leid vermeiden und Seligkeit erlangen kann.18 Es liegt jedoch auf der Hand, daß diese Auffassung der Bedingungen der Seligkeit dermaßen »revisionistisch« ist, daß sie auf eine Abweichung von allem hinausläuft, was wir normalerweise unter menschlichem Gedeihen verstehen. Die Abweichung läßt sich hier im Sinne eines extremen Wechsels der Identität formulieren. Normale Auffassungen des Gedeihens setzen ein bleibendes Ich voraus: Es gibt einen Nutznießer des Gedeihens beziehungsweise jemanden, der die Folgen eines Fehlschlags trägt. Die buddhistische Lehre des Anatta verfolgt das Ziel, uns über diese Illusion hinwegzuhelfen. Der Weg zum Nirwana beinhaltet, daß man auf alle Formen erkennbaren menschlichen Gedeihens verzichtet oder sie zumindest überwindet.
Zwischen Buddhismus und Christentum besteht trotz des gewaltigen Unterschieds der Lehren eine gewisse Ähnlichkeit. Die Ähnlichkeit liegt darin, daß der Gläubige oder Fromme