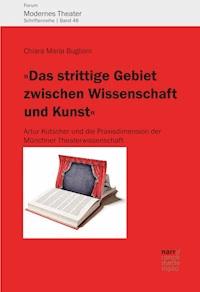
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Forum Modernes Theater
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Band präsentiert die erste wissenschaftliche Untersuchung zur Frühphase der Münchner Theaterwissenschaft und zur Tätigkeit des "Theaterprofessors" Artur Kutscher. Er folgt dabei der Theorie der situierten Kognition, die sich am Vorbild von J. Lave und E. Wenger orientiert (Theorie der Communities of Practice). Kutschers praxisorientierte Forschungsperspektive zeigt noch heute eine erstaunliche Aktualität: Zusammen mit seiner Arbeitsgruppe antizipierte er die Debatte über die Praxis als Hauptgrund für die Theaterforschung und als Hauptgrund für das Lernen im Allgemeinen. Die Publikation richtet sich an alle Theater- und Literaturinteressierten, die gern einen Einblick in die Entwicklung der akademischen Disziplin Theaterwissenschaft und in das Leben und Werk des faszinierenden Professors bekommen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chiara Maria Buglioni
Das strittige Gebiet zwischen Wissenschaft und Kunst
Artur Kutscher und die Praxisdimension der Münchner Theaterwissenschaft
A. Francke Verlag Tübingen
© 2016 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
Vorwort
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Anfängen der Theaterwissenschaft in München und der Rolle des „Theaterprofessors“ Artur Kutscher in der Entwicklung der Disziplin. Als ich zum ersten Mal auf den Namen Artur Kutscher stieß, war es aus reinem Zufall: Für meine Masterarbeit beschäftigte ich mich mit den Ingolstädter Stücken Marieluise Fleißers und erfuhr dabei, die Dichterin hatte 1920 theaterwissenschaftliche Veranstaltungen bei Kutscher belegt. Kurz davor hatte auch Ödön von Horváth an der Münchner Universität Seminare und Vorlesungen des Theaterprofessors besucht; selbst Bertolt Brecht war ein Kutscher-Schüler gewesen. Das war für mich wie eine Erleuchtung: Die kanonisierten Hauptvertreter des kritischen Volksstücks, ja die wichtigsten DramatikerInnen der Zeit gehörten am Anfang ihrer Karriere zur Kutscher-Hörerschaft. Die Figur des Theaterprofessors erregte mein besonderes Interesse und ich fing damit an, Informationen über Kutschers theaterwissenschaftliche Bemühungen zu sammeln. Es stellte sich allerdings sofort heraus, dass so gut wie keine wissenschaftliche Literatur zu Artur Kutscher existierte und dass sein Nachlass noch fast unerforscht war. Aus den Berichten und Erinnerungen von Kutschers Studenten und Freunden gewann man den Eindruck, der Theaterprofessor sei nicht nur eine Legende in der Münchner Kulturwelt, sondern auch einer der Bahnbrecher der deutschen Theaterwissenschaft gewesen. In den Einführungen in die Wissenschaft des Theaters konnte man indessen nur ein paar Zeilen über Artur Kutscher lesen, entweder im Widerspiel mit der Berliner Schule Max Herrmanns oder in Einklang mit Carl Niessens Theorie, das Theater habe im Mimus seinen Ursprung. Das schien mir ein paradoxer Tatbestand zu sein. In München fand ich dann eine städtische Artur-Kutscher-Realschule, einen von Lothar Dietz geschaffenen Artur-Kutscher-Brunnen am gleichnamigen Platz im Herzen Schwabings und sogar eine Bronzebüste des Theaterprofessors im Büro des Direktors des Instituts für Theaterwissenschaft an der LMU. Wenn aber der Name Artur Kutscher gelegentlich vor den Studenten der Münchner Universität erwähnt wurde, merkte ich, dass der „Außerordentliche“ – wie die Kutscher-Schüler ihren Lehrer nannten – heute kaum bekannt ist. Solche offensichtlichen Widersprüche führten mich zur intensiven Beschäftigung sowohl mit der frühen Theaterwissenschaft als auch mit dem heutigen Stand der Disziplin. Ein wesentliches Bindeglied zwischen den Anfängen der Theaterwissenschaft in München und den Fragen, die in den letzten Jahrzehnten ins Zentrum der Debatte über die akademische Kunstforschung gerückt sind, identifizierte ich in der Praxisdimension. Die Theaterforschung geht für Kutscher immer mit der Generierung und Pflege eines nicht nur theoretischen sondern auch praktischen Wissens einher, und die Praxis selbst galt als Forschung. Alle Leistungen der Münchner Theaterwissenschaft lassen sich in den ersten Entwicklungsstufen auf einen Nenner bringen: die Verflechtung zwischen Theorie bzw. Historiographie und Praxis, die Vermittlung zwischen Kunst(forschung) und Leben. Gerade diese Dimension wurde von den anderen Begründern der Disziplin zu Beginn des 20. Jahrhunderts kaum berücksichtigt, sodass die Untersuchung sowie die Entwicklung der Praxisdimension im theaterwissenschaftlichen Bereich als charakteristisches Zeichen der Arbeitsgruppe um Artur Kutscher aufgefasst werden kann.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen geht es in Teil I dieser Arbeit darum, zu zeigen, wie Artur Kutscher im Gegensatz zu seinen Kollegen eine wissenschaftliche praxisbasierte Forschung durchführte; darüber hinaus werden Bedeutung und Benutzung des ‚Praxis‘-Begriffs in der Theaterwissenschaft von den Anfängen bis heute erörtert. Die starre kategoriale Unterscheidung zwischen intellektuellem Wissen und praktischem Verstand wurde erkenntnistheoretisch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgegeben – insbesondere dank des Beitrags von Gilbert Ryle, Michael Polanyi und Pierre Bourdieu – und die Praxis wurde sowohl von der Diskursanalyse als auch von der Interdiskursanalyse in den Vordergrund gerückt. Im ersten Teil wird auch das methodologische Instrumentarium der Untersuchung dargestellt: Als Ansatzpunkt wird die Theorie der situierten Kognition angewandt, die dem Vorbild von Jean Lave und Etienne Wenger folgt und die den individuellen sowie gesellschaftlichen Lernprozess als eine kontextbezogene Transformation des Wissens versteht, welche persönliche Veränderungen mit der Entwicklung von Sozialstrukturen kombiniert. In Laves und Wengers Auffassung hängt das situierte Lernen von der auf verschiedene Weisen legitimierten Teilhabe an Communities of Practice ab.1 Diese Teilnahme ist daher ein konstituierender Bestandteil für den Lerninhalt und für die Identitätskonstruktion im Verhältnis zu den Lerngemeinschaften. Um festzustellen, in welchem Ausmaß Artur Kutscher die Theaterwissenschaft als einen situierten Kontext des Lernens verstand, werden erstens die Grundkonzepte ‚Praxis‘ und ‚Gemeinschaft‘ untersucht; zweitens wird der Begriff ‚soziale Landschaft‘ und die Art und Weise, wie globale Partizipation und lokale Teilhabe aufeinander wirken, zum Gegenstand der Analyse gemacht. Am Ende dieses Teils richtet sich der Blick auf die Entwicklungsstufen einer CoP und auf die Verkoppelung zwischen Lehrtätigkeit und Performativität beim Theaterwissenschaftler Kutscher, denn beim Lernen handelt es sich um den Vollzug bestimmter Aufgaben, Formalitäten und Riten, also um den Zugang zu einer Performance.
Teil II führt in die wichtigsten kulturellen Debatten, Reformversuche der Kunst und Künstlerkreise ein, die in der Prinzregentenzeit die Schwabinger Bohème prägten und welche zur sog. „Theatralisierung der Kultur“ maßgeblich beitrugen. Kutschers kulturelles Engagement bis 1909 bzw. seine Teilnahme an unterschiedlichen Gruppierungen sowie am Meinungsaustausch über das lebendige Theater war die Vorbedingung für die Förderung und Koordination einer praxisorientierten Theaterwissenschaft.
In Teil III geht es um die Darstellung der ersten Entwicklungsphase der von Kutscher geleiteten theaterwissenschaftlichen Arbeitsgruppe. Um die Konturen der neuen Disziplin zu verschärfen, entwarf Kutscher zunächst eine grundlegende Theorie, die den Untersuchungsgegenstand ‚Theater‘ beschrieb und den Modus Operandi der Theaterforschung vorschlug. Zum einen erarbeitete er die Konzepte ‚Kritik‘ und ‚Stilkunde‘ und stellte sich die Frage nach der Objektivität der Untersuchung, zum anderen rechtfertigte er die Anwesenheit eines spezifischen theaterwissenschaftlichen Forschungsbereiches. Der Kutscher-Kreis führte dann die Praxis seiner CoP weiter und versuchte hierzu, eine Balance zwischen Expertise und Erfahrung zu finden. Durch Universitätsvorlesungen und Seminare, Übungen in praktischer Kritik, Autorenabende, Führungen, Studienfahrten, Lehraufführungen und persönliche Kontakte mit Theaterleuten beabsichtigte die Arbeitsgruppe Kutschers, die gemeinschaftsbildenden Aktivitäten zu erweitern, und sie befasste sich auch mit der Festlegung unterschiedlicher Partizipationsstufen. In wenigen Jahren konfigurierte sich der theaterwissenschaftliche Kurs an der LMU als ein gut strukturiertes Lernsystem mit festen Grenzen und produktiven Beziehungen zu anderen Gruppierungen.
Teil IV stellt die Reifephase der Münchner Theaterwissenschaft um Artur Kutscher vor. Ungefähr ab 1919 beschäftigte sich der Kutscher-Kreis mit dem Ursprung des Theaters, was insbesondere angesichts der Steigerung des kulturellen Engagements der Gemeinschaftsmitglieder und der Verstärkung des gemeinsamen Zieles Relevanz bekam. Als Referenzmodell der CoP wurde die Mimustheorie Hermann Reichs verwendet, wobei die Theaterwissenschaft ihren Wissensbereich über die Grenzen der traditionellen Theatergeschichte hinaus ausbaute. Der mimische Ursprung des Theaters ermöglichte die Münchner Lerngemeinschaft, einerseits heimatgebundene Interessen zu wahren und volkstümliche Theaterformen zu berücksichtigen, andererseits transnationale Interaktionen und Einsätze zu fördern. Jenseits aller gesellschaftlichen und historischen Bedingtheiten des theatralen Phänomens suchte Kutschers Lerngemeinschaft kunstspezifische Konstanten, die als Orientierungshilfe in der Forschungsarbeit wirken konnten, und schuf weiterhin ein Beziehungsgeflecht, das zuerst in München und Bayern, dann in Süddeutschland, in Europa und schließlich in der ganzen Welt eine wichtige Rolle für die CoP spielte. Neben globalen Spielräumen öffnete die Münchner Theaterwissenschaft auch intermediäre Räume zwischen Lerngemeinschaften und Fachbereichen, auch wenn die Forschung immer vom Standpunkt der Kunst aus betrieben wurde. Dieser Teil endet mit der Betrachtung der auslösenden Faktoren der frühen theaterwissenschaftlichen Arbeitsgruppe. Obwohl der Theaterprofessor immer noch als Vermittler zwischen den erfolgreichen Künstlergenerationen der vergangenen Jahrzehnte und den aufstrebenden Jugendlichen betrachtet wurde, konzentrierte er seine Energie darauf, ein selbstständiges theaterwissenschaftliches Institut an der LMU einzurichten und eine akademische Auszeichnung für seine Leistungen zu erhalten. Kutschers leitende Rolle reduzierte sich dann schrittweise, die Mitglieder zerstreuten sich in andere Arbeitsgruppen, die Praxis wurde nicht mehr weiterentwickelt und der Zufluss an neuen Themen verringerte sich erheblich. Die Auflösungstendenz der lebenslang von Kutscher koordinierten Lerngemeinschaft wurde allerdings durch die Fortführung des theaterwissenschaftlichen Unternehmens balanciert: Die Bemühungen um die Verkoppelung von Theorie und Praxis, die Vorstellung einer Theaterforschung durch und für die Praxis sowie durch und für das Leben, das Konzept einer universitären Ausbildung für die Identitätsentwicklung der Lernenden, die Anerkennung und Rechtfertigung eines faszinierenden „strittigen Gebiets“ zwischen Wissenschaft und Kunst reizen heute noch Theaterwissenschaftler und Theaterinteressierten. In dieser Hinsicht ist die Aktualität der Tätigkeit und der Struktur der frühen Münchner Theaterwissenschaft anhaltend.
Im Anschluss an die gesamte Diskussion wird ein Exkurs über die Theaterwissenschaft und Artur Kutscher im Nationalsozialismus, eine skizzenhafte Biographie des Theaterprofessors und ein chronologisches Verzeichnis der theaterwissenschaftlichen Vorlesungen Artur Kutschers an der LMU dargeboten.
An dieser Stelle möchte ich allen Personen danken, ohne die meine Arbeit in der vorliegenden Form nicht möglich gewesen wäre. Namentlich danke ich zuerst meinen Betreuern: Prof. Dr. Christopher Balme, der bereits in den ersten Entwurf meines Promotionsprojekts sein Vertrauen demonstrierte, der mich auch in den Bereich der Theaterwissenschaft begleitete, mir das wissenschaftliche Potenzial der Untersuchung bewusst machte und die Begegnung mit Kutscher-Experten vermittelte; und Prof. Marco Castellari, der mich stets mit großer Geduld, unzähligen Ratschlägen und viel Humor unterstützt hat und der mir konkret zeigte, dass die Bedeutung der akademischen Ausbildung und Forschung weit über das Universitätsgebäude hinaus reicht. Bedanken möchte ich mich auch bei den zwei Hochschulen, an denen ich meine Cotutelle-Promotion abgeschlossen habe: die Università degli Studi di Milano, die mein Projekt drei Jahre lang finanzierte, und die Ludwig-Maximilians-Universität, insbesondere das Institut für Theaterwissenschaft, das mich herzlich aufnahm. Mein besonderer Dank gilt Dr. Olaf Laksberg, ohne dessen Berichte und Erinnerungen ich die Anfänge der Theaterwissenschaft in München, Artur Kutschers Charisma und Klaus Lazarowicz’ Tätigkeit nie richtig verstanden hätte; Dr. Carl Klein, der mir über seine Familie und seinen Großvater erzählte und mir freundlich die privaten Fotoalben der Kutschers zeigte; Edgar Reitz, der mir ein ausführliches Interview gewährte; und Prof. Dr. Gabriella Rovagnati, die mir schon viele Jahre eher den Einblick in die deutsche Theatergeschichte verschaffte und die mir von dem Moment an in meinen Bemühungen Beistand leistet. Nicht zu vergessen sind hier außerdem die MitarbeiterInnen des Archivs der Ludwig-Maximilians-Universität München, des Bayerischen Hauptstaatsarchivs München, des Deutschen Literaturarchivs Marbach und des Staatsarchivs München, die mich sachkundig durch ihre Häuser geführt haben. Besonders dankbar bin ich Frank Schmitter, Gabriele Eitzinger und Martin Heidenreich vom Monacensia-Literaturarchiv München, weil sie immer freundlich und hilfsbereit waren. Speziell zu danken habe ich dem Gunter Narr Verlag für die Annahme meines Manuskripts in die Reihe Forum Moderne Theater sowie den Lektorinnen Kathrin Heyng, Vanessa Weihgold und Elena Gastring für ihre gedulidge Hilfe und kompetente Betreuung. Außerdem bin ich der VG Wort und der Associacione Itatliana di Germanistica für die Unterstützung zu Dank verpflichtet. Für die Anregungen und das schöne Beisammensein muss ich noch Dr. Gero Tögl danken, für die aufmerksame Lektüre meiner Arbeit Frau Margit Kohl, und für die wunderbare Freundschaft Tobias Honold, Elizabeth und der ganzen Familie Mittermeier, die zu meiner deutschen Familie geworden ist. Mein Dank gilt weiterhin meinen italienischen Unterstützern und Freunden: Ringrazio di cuore tutti miei compagni di avventura, senza i quali il dottorato a Milano non sarebbe stato lo stesso, in particolare Elisabetta Bevilacqua e Giulia Peroni; gli amici che non mi hanno dimenticato nonostante i mesi trascorsi all’estero e che saranno sempre dalla mia parte, qualunque scelta io faccia: Angelica, Annalisa, Gloria, Fabio, Federica e Marco; gli amici di famiglia, che poi sono la mia famiglia allargata: Marisa, Marco e Andrea, Laura, Flavio e Stefania. Stefania, grazie per esserci sempre stata. Ringrazio poi la persona che ha condiviso con me questi anni, tra sbalzi di umore, viaggi, pensieri a un mondo lontano, delusioni e gioie: senza di te, Andrea, punto fermo in una vita movimentata, non credo ce l’avrei fatta. Infine, non posso che ringraziare i miei genitori: non esisterebbe una riga di questo lavoro se non avessi avuto voi come esempio, esempio di onestà etica e intellettuale, di dedizione totale, di amore incondizionato.
Teil I.Ausgangspunkte
Die Praxisdimension
Ich mußte das sein, was meiner Zeit am meisten fehlte: Systematiker, Methodiker, der von unten auf organischen Zusammenhang suchte, Ganzheit; der ausging von den Elementen, von der Materie des Schaffens, von Sprache, Mimus, bewegtem Foto, Ton; der an Stelle der älteren Kunstbetrachtung nach äußeren Stoffen, Formen die inneren, ureigenen schöpferischen Mächte Gehalt und Gestalt setzte und die stilbildenden Faktoren der Persönlichkeit, der Zeit, der Gattung. Unter diesen Gesichtspunkten lehrte ich Dichtung, Theater, Film, Funk erfassen, jede Kunst für sich würdigen in ihrer stilistischen Reinhaltung. […]
Ein volles, schönes Leben ist mir geschenkt von Gott, in der Familie […]; in Geselligkeit mit guten Freunden, in der Sphäre des alten Schwabing mit all seinen Dichtern, Schriftstellern, bildenden Künstlern, Musikern, Schauspielern, Schlawinern; in Beziehung zu Künstlern, Forschern, Wissenschaftlern weit über Deutschlands Grenzen hinaus; besonders aber in dem berühmt-berüchtigten Kreise meiner Studenten. Dieser Kreis war ein dichtes Gewebe persönlicher, wissenschaftlicher und künstlerischer Beziehung, ein fester, magischer Ring, in welchem einer auf den anderen wirkte, einer den anderen steigerte, formte, ich meine Schüler, und diese mich, den sie tatfreudig erhalten haben und dem sie immer neues Leben zuführten. Wir waren uns gegenseitig menschliche Entwicklungsfaktoren. Die diesem Kreise angehörten, erkennen einander an heimlichen Zeichen und an der Parole Stilkunde, Theaterwissenschaft, Mimus. (Kutscher 1948: 257f.)
In der Dankesrede bei der Feier zu seinem siebzigsten Geburtstag zeigt Artur Kutscher das Hauptmerkmal der von ihm geförderten Disziplin auf: eine Dimension des Lernens, in der die soziokulturellen Quellen des menschlichen Schaffens erkannt, systematisiert und weitergegeben werden. Als „Theaterprofessor“ strebte er danach, einen Lehr- und Lernprozess zu entwickeln, welcher die Kluft zwischen logozentrischer Kunstforschung an Hochschulen und aktivem, dynamischem Erfahrungsaustausch an Ort und Stelle der theatralischen Tätigkeit überbrücken konnte. Wenn man heutzutage in der Münchner Theaterwissenschaft eine Spur der Leistung Kutschers sucht, dann findet man weder eine zeitübergreifende Taxonomie der Gegenstände und Grundbegriffe des Fachgebietes, noch eine umfassende Systematik von dessen Forschungsergebnissen; was sich von jener ersten Phase der Disziplin noch erkennen lässt, ist vielmehr die Praxisdimension, in der die akademische Lehre verwurzelt ist. Kutschers Kunstforschung war mit der Praxis unauflöslich verflochten.
In seiner lebenslangen Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand der neuen, noch zu legitimierenden Disziplin entwickelte Kutscher ein wissenschaftliches praxisbasiertes Untersuchungsverfahren, das avant la lettre viele Fragen problematisierte, die gerade heute im Zentrum der Debatte über die akademische Kunstforschung stehen. Das Konzept Praxis hat sich in der Geschichte der Theaterwissenschaft allmählich herausgebildet und ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fand das praktische Wissen nun auch neben und manchmal vor der theoretischen Erkenntnis in Kunstfragen Beachtung. Deshalb ist es zunächst notwendig, Kutschers Auffassung von Praxis darzulegen und dann die Entwicklung des Konzepts und der ihm verbundenen Problematiken zu beschreiben. Am Ende werden in der früheren Münchner Theaterwissenschaft mehrere Schwerpunkte wieder zu erkennen sein, die auf ein praxisbasiertes Untersuchungsverfahren hinweisen, etwa die Reflexion über das Wesen des Theaters – sowie des Kunstwerkes –, die Frage nach der Objektivität der theaterwissenschaftlichen Forschung ebenso wie die Gedanken über Forschungsmethoden, Anwendung von Materialien, Feldforschung und direkte Partizipation der Forschenden.
Entscheidend für die Auffassung einer Kunstforschung, die nicht nur Forschung über ein künstlerisches Objekt ist, sondern die durch und für die konkrete Kunstpraxis betrieben werden muss, ist zuallererst die Definition des spezifischen Wissensbereichs. Kutscher erklärte wiederholt, das Gebiet der neuen wissenschaftlichen Disziplin umfange nicht nur das Drama, sondern auch Tanz, Schauspielkunst, Regie, Bühne, Dekoration, Technik sowie »Praxis und Gegenwärtigkeit und Lebendigkeit« (1936: 192). Praxis ist in dieser Hinsicht eine Komponente des facettenreichen Forschungsgegenstands, der sich als Aufführung schlechthin bestimmen lässt. Kutscher identifizierte nämlich die Aufführung mit dem Zusammenwirken eines textlichen und eines darstellerischen Elements, die dem Publikum und den Darstellern »genügend Erlebensmöglichkeiten« biete (1936: 10). Als solche entspreche die Aufführung einem Kunstwerk – und zwar einem organischen Lebewesen, Stil und Ausdruck menschlicher Existenz – und die theatralische Kunst einem Kulturfaktor. Kutschers Begriff von Aufführung und Theaterkunst hat in Wilhelm Diltheys Ästhetik seinen Ursprung, deswegen unterschied der Theaterprofessor im Theater zwei Bestandteile: das Universal, d.h. die menschliche Natur, und das Lebensgefühl der Gegenwart. Mit diesem Unterschied erklärte Kutscher die Tatsache, dass das Theater immer einen Prozess innerer Wandlung durchmacht, der sein Wesen nicht verändert, doch zeitgeschichtliche sowie gesellschaftliche Bedingtheiten registriert. In dem aufgeführten Kunstwerk suchte die von Kutscher geförderte Theaterwissenschaft dann sowohl die Gegenwärtigkeit als auch den ewigen Geist; gleichfalls verfolgte sie in der Forschung bzw. im Lernprozess die direkte Erfahrung und die kritische Reflexion über jene Erfahrung. Praxis wurde somit auch als Element des Untersuchungsverfahrens betrachtet. Es sei erst die dynamische, wechselseitige Beziehung zwischen Praxis und wissenschaftlicher Forschung, die zu einem komplexen System von Wissenserwerb und -vermittlung führe: Der Theaterforscher brauche einerseits einen umfassenden theoretischen Apparat, der ihm eine gewisse Vertrautheit mit den Grundelementen des Theaters, inklusive der Technik, gewährt. Andererseits werde eine aktive Teilnahme an der gemeinsamen Praxis benötigt, um die aktuellen Fragen nach den besonderen Bedingungen, den Möglichkeiten und den Grenzen des Theaters überhaupt stellen zu können und zu behandeln. Die Beteiligung an der praktischen Ausführung wird hierdurch zum Korrelat der Analyse und Interpretation der Ausführungen selbst. Diesbezüglich gab Kutscher einen erschöpfenden Überblick über die Stratifizierung der theaterwissenschaftlichen Forschung: Er skizzierte einen Verlauf, in dem sich Historiografie, Stilkunde und Praxis gegenseitig ergänzen. Die Theatergeschichte mache das Wandelbare und das Transitorische klar, obwohl die Quellen nicht immer sicher oder prüfbar sind; die Stilkunde zeige das Bleibende auf, das an den Menschen gebunden ist, und die Praxis veranschauliche die Beziehung zu den Realitäten des Theaters. Während die Theatergeschichte also eine fast objektive Basis für die Kunstbetrachtung garantiere, basiere die Stilkunde immer auf einem subjektiven Urteil. Artur Kutschers Anerkennung und Würdigung der Subjektivität innerhalb der theaterwissenschaftlichen Untersuchung ist in der Frühphase der Disziplin eigentlich außergewöhnlich. Das bedeutet aber nicht, dass Kutscher dem individuellen Charakter jeglicher Kunstbetrachtung und -bewertung freien Raum ließ. Er versuchte hingegen diese Neigung des Zuschauers und des Forschers einzudämmen: Er beschäftigte sich erstens damit, der ästhetischen Erfahrung eine begriffliche Terminologie und eine Grundsystematik zu geben, sodass die Stilkunde als eine Wissenschaft wirken konnte. Zweitens konzentrierte er sich auf die Praxis, weil kreative Prozesse und subjektive Urteile erst zu neuem Wissen werden könnten, wenn sie von einer (sozialen) Praxis, d.h. von der aktiven Teilnahme an einer gemeinsamen, gesellschaftlichen Theaterproduktion und -rezeption eingerahmt würden.1 Das Korrektiv der vermeintlichen Objektivität sowie der interpretierenden Subjektivität sei also die Vermittlung von Kunst und Leben, welcher eine umfassende Kenntnis der Elemente aller Stilbildung vorangeht: Persönlichkeit und Zeit, Gattung und Material. Um jede »Fachsimpelei« zu vermeiden, bedürfe die Theaterwissenschaft einer Balance zwischen Materialität und subjektiver Bewertung, die ständig ausgehandelt werden muss (Kutscher 1960: 75). Die Theaterwissenschaft, wie alle lebendigen Wissenschaften, wandele sich kontinuierlich und spezialisiere sich dem gegenwärtigen Empfinden entsprechend. Kutscher stellte damit die Fixierung der Bühnenkunst durch Artefakte und die Bereicherung des gegenwärtigen Theaters nebeneinander. In diesem Zusammenhang gewann die Praxis gegenüber der Theorie an Bedeutung: Für Kutscher umfasste sie das Anschauen von Materialien – etwa Modelle, Diapositive und Lichtbilder – wie aber auch Theaterbesuche, Studienfahrten, Übungen in praktischer Kritik, persönliche Fühlungnahme mit Theaterleuten und eigene Aufführungen der Studierenden. Objekte und Medien halfen der theaterwissenschaftlichen Betrachtungsweise, aber nur als Prämisse einer konkreten Feldforschung. Alle Materialien konnten dem Forscher nützlich sein, ihm die abstrakte Idee einer bestimmten Form vom Theater oder einer Aufführung zu geben, aber für eine Wissenserzeugung reichten sie nicht aus. Die Verhältnisse in der Wirklichkeit waren dort zu untersuchen, wo das Theater aktiv betrieben wurde. Widersprechende Anschauungen aus den Büchern oder aus den Bildern können nämlich, so Kutschers wissenschaftliches Selbstverständnis, erst durch direkte Betrachtung und direkte Partizipation ersetzt werden. Es ist der Aktivismus, der das ältere, rein spekulative und lebensferne Wissenschaftskonzept von den Vertretern der jüngeren Wissenschaft trennt, die dem tätigen Leben und der gegenwärtigen sowie künftigen Kunst dienen soll. Die theaterwissenschaftliche Lehrtätigkeit sollte folglich Intellektuelle ausbilden, die für stilkundliche, kulturgeschichtliche und zugleich soziale Fragen die Verantwortung übernehmen. Die Praxis – oder das dynamische Merkmal des theaterwissenschaftlichen Unterfangens – entfaltet sich dann in zwei Dimensionen: in einer zeitlichen und in einer geografischen bzw. sozialen. Was die zeitlich-geschichtliche Dynamik der praxisorientierten Theaterwissenschaft betrifft, muss man Kutschers Suche nach dem Ursprung des Theaters und seine besondere Neigung zur volkstümlichen Theaterkunst betrachten. Beide hängen mit seinem Streben zusammen, einen wissenschaftlichen Mittelweg zwischen der stark wechselnden Gestaltung des lebendigen Theaters und dessen kunstspezifischen, konstanten Faktoren zu finden. Die Notwendigkeit, zu den primitiven Ausdrucksformen der Bühnenkunst vorzudringen, führte Kutscher zur Beschäftigung mit Formen wie Bauerntheater und Laientheater, in denen er die Frühstufen der mimischen Kunst sah. Was hingegen die „soziale Landschaft“ der Münchner Theaterwissenschaft angeht, knüpfen die Mitglieder des Kutscher-Kreises Weltbeziehungen, nicht nur um »geistige Brücken« zu schlagen (1960: 193), sondern auch, um lokale, sprich deutsche Erscheinungen durch die Wechselwirkung mit anderen ausländischen Kunstformen zu bereichern. Darüber hinaus ermöglicht das globale und interdisziplinäre Beziehungsgeflecht dem Theater ebenso wie der Wissenschaft vom Theater eine dichte Vernetzung, eine produktive intellektuelle Kooperation. Die Vorteile dieser Kooperation resultieren aus der prägenden Begegnung zwischen Anhänglichkeit an heimatgebundenen Traditionen, Hochschätzung der deutschen Dichtung und Anregung zur Erneuerung lokaler Kunst einerseits, und Öffnung zur Transkulturalität des globalen Phänomens Theater andererseits. Durch die Beteiligung aller Forscher an der gemeinsamen Arbeit und durch den Erfahrungs- und Wissensaustausch in der Theaterpraxis verwischen sich die Grenzen zwischen akademischer Wissenschaft und Praxis. Es gibt also keinen theatralischen Diskurs bzw. keinen Logos, der die Theaterpraxis beherrscht und vorstrukturiert, sondern eine wechselseitige Beeinflussung von Theorie und Praxis. Die Methodologie der von Kutscher angeregten Theaterwissenschaft vermittelt eine anschauliche Vorstellung der geistig-sinnfälligen Struktur jeder praktischen Ausführung2 und anerkennt das direkte, konkrete Experimentieren ebenso wie die Anwendung künstlerischer Mittel in der Forschung überhaupt als wissenschaftlich gültige Methodik.
Darin unterscheidet sich die in München betriebene Theaterwissenschaft von anderen Entwicklungstendenzen der Disziplin, welche sich etwa in Berlin, Leipzig und Köln durchsetzen konnten. Auch wenn es stimmt, dass fast alle Bahnbrecher der Theaterwissenschaft die These vertraten, der Theoriediskurs sei parallel zum Praxisbezug zu entwickeln,3 muss man jedoch Stefan Hulfeld (2007) und Corinna Kirschstein (2009) darin zustimmen, dass die neue Wissenschaft des Theaters schon in ihrer Anfangsphase einen inneren Zwiespalt zwischen theatergeschichtlicher Forschung und erfahrungsnaher Praxis durchmachen sollte. Der sogenannte „Geburtsfehler“ der Disziplin im deutschsprachigen Raum, d.h. die genannte Trennung von Historiographie und Praxis, habe seinen Grund in der Notwendigkeit, im Universitätssystem die Eigenständigkeit der Theaterwissenschaft zu legitimieren und genau deshalb die philologische Methodik anzuerkennen.4 Die Bestrebung, sich auch mit der Praxis wissenschaftlich zu beschäftigen, richte sich also nicht auf die Auseinandersetzung mit dem tatsächlich aufgeführten Theater oder mit ästhetischen Fragen der Gegenwart, sondern auf »technisch-organisatorische Faktoren des Theaterbetriebs wie Theaterrecht, -technik oder Regieübungen (auf einer Probebühne)« (Kirschstein 2009: 91). Erhellend ist hierzu der Vortrag, den Max Herrmann am 14. Januar 1917 vor den Mitgliedern der „Vereinigung künstlerischer Bühnenkunst“ hielt.5 Dem Zweck dienend, die Bedeutung der Theatergeschichte – »im weiteren Sinne dann Theaterwissenschaft« – für die Theaterpraxis zu erklären, führte der Berliner Professor zwei anschauliche Beispiele an: Das erste betraf die Übertragungsaufgabe des Regisseurs in jeder Aufführung, das zweite seine vielberühmten Forschungen über die Hans-Sachs-Bühne. Der Spielleiter sei »gewissermaßen ein Übersetzer«, der oftmals ältere Dichter »in die Bühnensprache« der Gegenwart übertragen muss. Wenn der Regisseur damit ein Kunstwerk herstellen will, müsse er sowohl die Theatersprache der Vergangenheit als auch die der Gegenwart beherrschen:
Da kein Theater mit nur modernem Spielplan auskommen kann, sondern immer auf klassische Stücke zurückgegriffen werden muß, so wird der Spielleiter das jedesmalige innere Verhältnis des Dichters zur Bühne seiner Zeit kennen, geschichtlich erfassen müssen. […] Theatergeschichte […] ist für ihn ebensowenig überflüssig, wie seine Theaterbegabung notwendig.
Man könne den Nutzen der Theatergeschichte anhand der Forschungen weiter beobachten, weil sie eine entscheidende Hilfe für die Regisseure leisten, die in ihren Inszenierungen den »Hans-Sachsischen Theatersinn« treffen wollen. Obwohl solche Ansichten Max Herrmanns Neubestimmung seiner theaterwissenschaftlichen Positionen nach 1920 nicht entsprechen,6 zeigen sie immerhin eine Verengung des Konzepts Praxis innerhalb der Theatertheorie. Herrmanns Rückgriff auf den Praxisbegriff in seiner Darstellung der Aufgaben eines theaterwissenschaftlichen Institutes scheint also weniger der aktiven Partizipation am gegenwärtigen Theaterleben das Wort zu reden, als die Selbstständigkeit der Theaterwissenschaft zu behaupten, die darum ein eigenes Institut braucht: »[D]er Theaterhistoriker soll nicht alles das lernen brauchen, was der Germanist zu lernen hat. / Andererseits muß der Theaterwissenschaftler wieder das lernen, was der Germanist nicht zu lernen braucht«, und zwar muss er in der Lage sein, »alle technischen und künstlerischen Eindrücke« zu beurteilen, die nur von Theaterfachmännern unterrichtet werden können (1974: 353).
In Max Herrmanns Vorstellung ist die Praxis – als ästhetischer Ausdruck und als Verwirklichung eines mehr oder minder idealen Theatermodells – vom historisch-akademischen Wissen beeinflusst, doch umgekehrt übt sie gar keinen Einfluss auf den Theoriediskurs aus. Mit Hulfelds Worten, die praktische Relevanz der neuen theaterwissenschaftlichen Erkenntnisse geht mit der Umsetzung der genetischen Methode verloren (2007: 280). Diesbezüglich sei es nur noch angemerkt, dass Herrmann anders als Kutscher die volkstümlichen Theaterformen sowie das Laientheater negativ bewertete,7 weil sie zur Realisierung des gewünschten dichterischen Theaterideals nicht beitragen könnten, und dass er sich vorwiegend dem alten Theater widmete.8 Ebenfalls überaus skeptisch äußerte sich Carl Niessen gegenüber Dilettantenvereinen und Studentenbühnen, denn der Mangel an künstlerischen Ambitionen hätte die Theaterwissenschaft belasten können.9 Der kulturgeschichtliche Blick des Theaterwissenschaftlers solle sich zwar den mimisch-spielerischen Theaterformen aller Völker hinwenden, zugleich aber mit einem gewissen akademischen Abstand.
Herrmanns und Niessens lediglich theoretische Berücksichtigung der Theaterpraxis, die dann jedoch faktisch ignoriert wurde, fand einige Jahrzehnte später bei Heinz Kindermann und Hans Knudsen ihre Fortsetzung. Der Wiener Germanist Kindermann, der sich erst in den 1940er Jahren der Theaterwissenschaft zuwandte, versuchte bis zum Ende des Krieges eine nationalsozialistische Traditionslinie von Goethe, Klopstock, Hebbel, Raimund bis hin zur Gegenwart – eigentlich: Wagner – herzustellen, wobei der Forschungsfokus ausschließlich auf der Theatergeschichtsschreibung lag. Die Praxis scheint auch später in Kindermanns Auffassung der Theaterwissenschaft keine Rolle zu spielen, da er in seinen Aufgaben und Grenzen der Theaterwissenschaft (1953) den Praxisbezug der Disziplin überhaupt nicht erwähnte. Hans Knudsens »Blick auf die Praxis« verriet seinerseits einen schon bekannten Ansatz: Die »rein theaterwissenschaftliche Ausbildung« an der Universität muss »durch Vermittlung auch der praktischen Lösungen, soweit so etwas lehrbar ist« ergänzt werden (1951: 16f.). »Immer wieder: Begabung für das Theater ist die Voraussetzung alles dessen, was wir hier aussprechen […]. Wir setzen jenes Maß künstlerischer, schöpferischer Fruchtbarkeit für das Theater voraus, das man in der Theaterwissenschaft unter allen Umständen haben muß«. Nach dieser generellen Festlegung erklärte Knudsen näher: »Dieser Vorbereitung für die Praxis, für das lebendige Theater, dienen die Vorlesung und Übungen zur Regie« (17) – mit derartigen Lehrveranstaltungen war der Praxisbezug der Theaterwissenschaft erschöpft.
Wenn man das ganze erörterte Spektrum theaterwissenschaftlicher Positionen berücksichtigt, dann kann man Marvin Carlson nicht zustimmen, der in Anlehnung an Erika Fischer-Lichtes Interpretation von Max Herrmanns Konzept der Theaterwissenschaft feststellt, die im deutschsprachigen Raum geförderte Disziplin habe nie an der Spannung zwischen Theater und Performance bzw. Praxis gelitten, welche in den USA deutlich gespürt wurde und noch heute gespürt wird (Carlson 2008: 4). Die Spuren dieser Spannung waren in den ersten fünfzig Jahren der deutschen theaterwissenschaftlichen Forschung eigentlich beseitigt, denn die eingehende Untersuchung der sogenannten „Wissensverkörperung“ und der Praxis sowie die Erforschung eines Wissensgebietes, das nur durch die ständige Berührung mit anderen Feldern und durch die unmittelbare, sinnliche Erfahrung das theatrale Phänomen erfassen kann, hätte die Etablierung der Disziplin an den Hochschulen verhindert. In Berlin, Leipzig, Köln und Wien sowie an kleineren Instituten für Theaterwissenschaft lag die praxisbezogene Lehre oder das praxisbezogene Lernen nur in programmatischen Reden und Schriften vor. Außer Regieübungen, gelegentlichen Exkursionen und der Sammlungstätigkeit fand die Theaterpraxis keinen Zugang zum Universitätssystem.
Wissenstheorie
Die strenge Unterscheidung zwischen intellektuellem Wissen und praktischer Vernunft wurden erkenntnistheoretisch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stufenweise aufgegeben. Nach der bahnbrechenden Arbeit von Gilbert Ryle auf dem Gebiet der Philosophie des Geistes (The Concept of Mind, 1949), in welcher der Philosoph zwei komplementäre Bestandteile des Wissens erkannte und die Begriffe knowing-what als deklaratives Wissen und knowing-how als prozedurales Wissen bzw. Fertigkeit, soziale Expertise prägte, muss die Lehre von Michael Polanyi erwähnt werden. Aufschlussreich ist in The tacit dimension, dass sich Polanyi auf Dilthey und Lipps beruft, um in der Philosophiegeschichte die ersten Schritte zur Anerkennung und Beschreibung des so genannten taciten Wissens zu finden (Polanyi 1967: 16f.). Mit „tacitem“ oder implizitem Wissen meinte Polanyi ein gesellschaftlich vermitteltes Wissen intuitiver Art, welches immer subjekt- und kontextbezogen bleibt und nicht sprachlich artikulierbar ist – d.h. auch kaum reproduzierbar. Es bilde den komplementären Pol zum expliziten Wissen, welches kognitive Wahrnehmungen, abstrakte Repräsentationen, Theorien und Modelle umfasst. Wilhelm Diltheys Erlebnis ebenso wie Theodor Lipps’ Einfühlung traten sonach als erste Versuche hervor, das zu interpretieren, was Menschen tatsächlich wissen, doch in Worten nicht ausdrücken können. Schon am Anfang des sog. „Zeitalters der Extreme“ hätten Geisteswissenschaftler versucht, das erworbene Erfahrungswissen mit einem theoretischen Wissen zu verbinden. Polanyi stellte aber zum ersten Mal deutlich fest, dass implizites Wissen nicht den Geisteswissenschaften allein angehört, sondern jedem wissenschaftlichen Wissen:
[A] true knowledge of a theory can be constructed only after it has been interiorized and extensively used to interpret experience. Therefore: a mathematical theory can be constructed only by relying on prior tacit knowing and can function as a theory only within an act of tacit knowing, which consists in our attending from it to the previously established experience on which it bears. (1967: 20)
Tacites Wissen sei demzufolge ein unentbehrlicher Bestandteil des menschlichen Lernprozesses, der zur Modell- und Theorieentwicklung beitrage, weil er jeder Erkenntnis oder Entdeckung zugrunde liege: Wissenschaftliches Wissen gleiche insoweit dem Wissen einer sich nähernden Entdeckung, die Menschen dank ihres impliziten Wissens vorhersehen. Dies bedeutet fernerhin, dass jede Entdeckung mit einem subjektiven Engagement gekoppelt ist, was jedes positivistische Ideal der Objektivität in der Forschung zerstört (25). Durch die Einfühlung in das Forschungsobjekt schließt der Mensch die Einzelheiten einer Struktur oder eines Phänomens zu einem übergeordneten Ganzen unmittelbar zusammen, ohne die einzelnen am Prozess beteiligten Details kognitiv wahrzunehmen. Das implizite Wissen artikuliere sich demnach im Handeln, im Können. Implizites und explizites Wissen sind folglich nach Polanyi parallele Dimensionen des Wissenserwerbs, die erkenntnistheoretisch gleichwertig sind – auch wenn der Fokus mehr auf dem „stillschweigenden“ Wissen liegt. Polanyi schuf somit den ersten umfassenden praktischen Wissensbegriff, in dem Handeln und kritische Reflektion einander ergänzen. Der Kunsttheoretiker Carr beschrieb Jahre später das praktische Wissen »as a matter of some interplay between phronesis and techne« (1999: 244), wobei er die aristotelische phronesis zur Basis der Beziehung zwischen ästhetischer Empfindung und künstlerischem Wissen machte. Die phronesis beruhe auf erfahrungsbasierten praktischen Prinzipien, welche menschliche Empfindlichkeiten – oder Prädispositionen – pflegen und entwickeln. Sie sei ein Modus des praktischen erfahrungsbasierten Weltwissens, das sich nicht durch theoretische Aussagen oder Thesen ausdrücken lasse, sondern durch eine gewisse Organisation der Erfahrung im Einklang mit einer bestimmten Anschauung oder Idealvorstellung von Schönheit, Form oder Ausdruck (254). Das ästhetische Wissen wurde hierdurch zu einer Form des praktischen Wissens.
Ein letzter Versuch zur Versöhnung der zwei Erkenntnismodi, d.h. zwischen dem Objektivismus realistischer sowie materialistischer Prägung und dem idealistischen Subjektivismus, wurde in der Sozialwissenschaft von Pierre Bourdieu unternommen. Er plädierte nämlich für eine praxeologische Erkenntnisweise, welche die regulierende Logik des praktischen Wissens, das auf der Primärerfahrung der Subjekten beruhe, und die Eigenlogik des theoretisch-wissenschaftlichen Erkenntnismodus, das hingegen einen konstruktivistischen Charakter aufweise, kombinieren könnte. Erst diese neue Erkenntnisform sei in der Lage, die Welt zu erfassen (2001: 174). Deswegen entwickelte Bourdieu seine nach der Forschungspraxis orientierte Habitustheorie. Mit dem Begriff Habitus verknüpfte er ein dauerhaft wirksames System von unauflöslich miteinander verwobenen, (vor)strukturierten Dispositionen, welche das Subjekt dazu bringen, in einer bestimmten Weise zu agieren: Sie bilden also den praktischen Sinn, befähigen die Menschen, an der sozialen Praxis teilzunehmen und diese zugleich hervorzubringen. Solche Dispositionen werden während der Sozialisation erworben, d.h. als Ergebnis der Inkorporierung gesellschaftlicher Strukturen. Der Habitus generiert Praktiken, wiederkehrende Sozialhandlungen, die ihrerseits gesellschaftliche Regelmäßigkeiten bzw. Strukturen konstituieren. Diese werden vom Subjekt verinnerlicht, in einer Wechselbeziehung, in der der Habitus die Strukturen (re)produziert und die Strukturen den Habitus. Der Habitus wirkt demzufolge als Vermittler zwischen den externen materiellen, kulturellen und gesellschaftlichen Existenzbedingungen – oder den objektiven Strukturen des sozialen Feldes – und den von einzelnen Akteuren ausgeführten Praktiken, die mit ihrer persönlichen Wahrnehmung und Anschauung in die Umwelt verflochten sind. Daraus folgt, dass der Habitus dem Subjekt die Grenzen möglicher Praktiken zur Verfügung stellt, dass das agierende Subjekt nicht vollständig determiniert ist.1 Der Habitus wirkt als »Erzeugungsmodus der Praxisformen« (1987: 136), nicht als Erzeugungsmodus einzelner Praktiken. Besonders wichtig für die Kunstpraxis und -forschung scheint allerdings die Tatsache zu sein, dass die von Bourdieu theorisierte Verinnerlichung von äußerlichen Existenzbedingungen weniger durch die Sprache hindurch geschieht, als vielmehr auf Körperebene: Die soziale Ordnung wird verkörpert, inkorporiert, einverleibt. Sprache und Leib haben beide die Aufgabe, praktische Erfahrungen, Fakten oder Normen zu speichern, wobei sie als treibende Kräfte für die Herausbildung sozialer Praxen fungieren – sie sind sowohl Speicher als auch Träger (1987: 127). Doch ist die praktische Erkenntnis eher an den Körper gebunden, weil sich die Menschen der Eigenschaften ihres eigenen Habitus nicht bewusst sind und in ihrem praktischen Handeln von einer vorbewussten, vorreflexiven Kraft getrieben werden. Der Körper ist ein »Gedächtnis« (1976: 199), das Regungen, Bewegungen oder Handlungen nicht nur ausführt, sondern auch bestimmt. Die Körperlichkeit bestimme die Praxis sowohl im Hinblick auf die Bildung des körperlich verankerten Habitus als auch im Hinblick auf dessen Anwendung: »Einzelne Körperbewegungen bilden die kleinste Einheit jeglicher Praxis. Da sowohl Körper als auch soziale und materielle Welt formbar sind, können sie intensiv miteinander verschränkt sein« (Fröhlich/Rehbein 2009: 201). Auf diese Weise hat jede menschliche Bewegung nicht nur einen sozialen, sondern auch einen individuellen Aspekt; das Äußere wird immer von Menschen in mentalen Repräsentationen verinnerlicht bzw. inkorporiert. Als Folge einer solchen Anerkennung forderte Bourdieu eine neue Wissenschaft, welche auch die Körperlichkeit der Akteure berücksichtigt:
Im Gegensatz zu den scholastischen Welten verlangen bestimmte Universen wie die des Sports, der Musik oder des Tanzes ein praktisches Mitwirken des Körpers und somit die Mobilisierung einer körperlichen Intelligenz, die eine Veränderung, ja Umkehrung der gültigen Hierarchien herbeiführen kann. Man sollte die hier und da, vor allem in der Didaktik dieser Körperpraktiken – des Sports natürlich und insbesondere der Kampfsportarten, aber auch des Theaterspielens und des Musizierens – verstreuten Notizen und Beobachtungen einmal methodisch zusammenstellen; sie würden wertvolle Beiträge zu einer Wissenschaft dieser Erkenntnisform liefern. (Bourdieu 2001: 185)
Diese Wissenschaft habe also die Funktion, die Wissensbestände und -inhalte aus dem jeweiligen sozialen Feld mit denen aus der direkten körperlichen Erfahrung zu ergänzen. Das bedeutet außerdem, dass das Subjekt die soziale Welt erkennen kann, auch wenn es keine objektivierende Distanz zu den Wissensobjekten hat; um eine systematische, sprich wissenschaftliche, Analyse seiner Handlungspraxis durchzuführen, braucht es aber eine kritische (Selbst)Reflexion. Die Reflexivität in der Theorie Bourdieus dringt darauf, »die theoretische Beobachterposition zur zu beobachtenden Praxis zu machen« (Fröhlich/Rehbein 2009: 203f.). Die Verwandlung vom unbewussten Sinnvollen der Praxis in das bewusste, reflexive Sinnvolle der theoretischen Wissenschaft muss sich daher auch in der Kunstforschung vollziehen.
Die Theaterwissenschaft zwischen Theorie und Praxis
Schon in den 1970er Jahren hatte eine vielstimmige Methodendiskussion in der Theaterwissenschaft eingesetzt, welche sich aber mehr auf die semiotische Wende in der Aufführungsanalyse konzentrierte und die theaterwissenschaftliche Verflechtung zwischen Theorie und Praxis kaum betrachtete. Im folgenden Jahrzehnt konnte die Theaterpraxis das Interesse der an den deutschen Hochschulen etablierten Disziplin wecken: 1982 wurde das Institut für Angewandte Theaterwissenschaft an der Universität Gießen gegründet, das unter der Leitung von Andrzej Wirth die theatertheoretische Forschung zusammen mit dem Studium der theatralen Praxis pflegte. Das Ende der 1980er Jahre fällt außerdem mit der Hinwendung der Theaterwissenschaft zu den Paradigmen Theatralität und Performativität zusammen, was eine Neubestimmung der Forschungsstrategien und des Fachbereiches nötig machte.1 In dieser Phase der wissenschaftlichen Re-Konzeptualisierung erlangten der Körper sowie der performative Erzeugungsprozess der Identität große Bedeutung, so dass sich die »Wissenschaft von der Aufführung« (Fischer-Lichte 2005: 351) endlich als produktive Verkopplung von Semiotizität und Theatralität verstehen konnte. Die Entwicklung der Disziplin in dieser Richtung setze sich dabei relativ stabil fort und der Mittelpunkt des Forschungsinteresses »shifted to the processes of making, producing, creating, doing, and to the actions, processes of exchange, negotiation, and transformation as well as to the dynamics which constitute the agents of these processes, the materials they use and the cultural events they produce« (Fischer-Lichte 1999: 168).
Im Bereich der creative and performing arts und der gegenwärtigen Theaterwissenschaft ist die Debatte über die epistemologische Bedeutung des Zusammenhangs von wissenschaftlicher Forschung mit künstlerischer Praxis ab den 1990er Jahren immer lebhafter geworden.2 Der Begriff Praxis wurde dann von den neuen Konzepten „research as cultural practice“ und „practice as research“ maßgeblich geprägt. Praxis ist, so definiert Robin Nelson, »theory imbricated within practice«, und zwar eine Untersuchungsmethode, die an der Schwelle zwischen Rationalität und verkörpertem Wissen operiert (2006: 108). Zugleich ist Praxis ein (Selbst)Verständnismodell, welches unreflektierte, spontane, kreative Prozesse durch das Zusammenwirken von unterschiedlichen Fachleuten sowie Künstlern in einem transdisziplinären Kontext erklärt und interpretiert. An erster Stelle profiliert sich also die Forschungsarbeit als eine kulturelle Praxis, welche rein akademische Bestrebungen überwindet und andere kulturelle Praktiken überschneidet. Gerade diese Überschneidung bildet das Hauptmerkmal jeder Untersuchung, die weit über die Grenzen einzelner Disziplinfelder hinaus geht. Die Forschung ist selbst eine hybride Kulturtätigkeit, weil sie verschiedene Wissenssegmente und Tätigkeiten, die ihrerseits mit anderen soziokulturellen Kenntnissen verkettet sind, zu einem Netz zusammenfasst. Die Besonderheit von „research as cultural practice“ liegt demnach in seiner gesellschaftlichen und kulturellen Einbettung: Das dabei ermittelte Wissen ist nicht absolut, abstrakt, unmarkiert oder delokalisiert, sondern partiell, konkret, verkörpert und verortet – kurzum: situiert. Erst durch die Verkörperung des Wissens, durch die Kontextbedingtheit aller Forschung ebenso wie jedes Untersuchungsprozesses kann die Forschung zu einer generativen Matrix werden. Bezeichnenderweise wird die Reflexion über „research as cultural practice“ von Wolmark und Gates-Stuart (2002) an Donna Haraways’ Konzept des situierten Wissens angeschlossen. Die amerikanische Forscherin hatte Ende der 1980er Jahre im Bereich der feministischen Wissenschaftskritik ihr Plädoyer für eine verkörperte Objektivität und eine kritische Positionierung, eine bewusste Infragestellung des Wissens formuliert. Der naiv gläubigen, vom Sozialkonstruktivismus und von einigen Postmodernisten verbreiteten Darstellung einer „wirklichen“, völlig kodierten Welt und einer „objektiven“ Wissenschaft, die man erst betreiben kann, wenn man eine entkörperte Perspektive von außen, eine Perspektive von oben herab einnimmt, setzte Haraway eine »feministische Objektivität« entgegen, welche zeitlich, gesellschaftlich, örtlich und geschlechtlich markierten Feldern des Wissens entspreche: »[O]nly partial perspective promises objective vision. […] Feminist objectivity is about limited location and situated knowledge, not about transcendence and splitting of subject and object. It allows us to become answerable for what we learn how to see« (1988: 583). Als einzig mögliche Alternative zum Relativismus sowie zur Totalisierung des unmarkierten Blicks betrachtete Donna Haraway die partielle, situierte und kritische wissenschaftliche Perspektive, die allein ein Geflecht von Verbindungen gestatte. Die Positionierung sei also das entscheidende wissensbegründende Vorgehen:
I am arguing for politics and epistemologies of location, positioning, and situating, where partiality and not universality is the condition of being heard to make rational knowledge claims. These are claims on people’s lives. I’m arguing for the view from a body, always a complex, contradictory, structuring, and structured body, versus the view from above, from nowhere, from simplicity. (589)
Die traditionelle Epistemologie stütze sich auf eine Art Gottesstandpunkt, was die Rolle des wissenserzeugenden Subjekts außer Acht lasse. Da aber das Wissen von Menschen erzeugt ist und da jeder Mensch situiert ist, müssen alle Dimensionen der Einbettung in der Umwelt zum Bestandteil des epistemologischen Kontexts werden. Die kontextuelle Betrachtungsweise erlaubt fernerhin, das allgemeine Wissensgut jedes Mal erneut nachzuprüfen, zu interpretieren und letztlich zu übertragen. Das dadurch ausgehandelte Wissen bestehe dann aus einer Vielfalt von Sichtweisen, Standpunkten, sozialen Beziehungen und kulturellen Praktiken, die immer vom Individuum und dessen Umfeld geprägt ist: »Knowledge bears marks of its producer« (Paraviainen 2002: 12). In diesem Forschungs- und Lernprozess sind sowohl das Subjekt als auch das Objekt des Wissens Akteure, Agenten: Das untersuchte Objekt sei also handlungsfähig. Die Wissenschaft hänge daher nicht von einer „Logik der Entdeckung“ ab, d.h. von der Leistung eines Meisters, der Objekte dekodierert, die einfach still darauf warteten, gelesen zu werden, sondern von »a power-charged social relation of „conversation“« (Haraway 1988: 593). In dieser Beziehung findet immer eine Aushandlung statt – eine Aushandlung von Wissensbeständen und -erwerb sowie von Praktiken. Aktive Subjekte in der Forschungsarbeit seien sowohl die Forscher als auch die erforschte Welt. Der Forscher wird somit zum Teilnehmer am Wissensprozess, der das allgemeine Wissensgut aufzeigt und zugleich erweitert.3 Seine Forschungsarbeit bleibt innerhalb des soziokulturellen Beziehungsgewebes ständig verkörpert und das erworbene Wissen ist demzufolge nicht präskriptiv: Kulturelle Hybridität, Netzwerke unterschiedlicher Positionierungen, Zusammenwirkung von Medien und Wissensbereichen, unberechenbare Ergebnisse sind im Forschungsprozess nicht fehl am Platz, sondern Grundsteine der gemeinsamen Praxis. Die situierte Perspektive und die gemeinsame Praxis befähigen die Individuen, das ausgehandelte Wissen in einer dynamischen Umwelt zu nutzen und zu bereichern. Transdisziplinäre Arbeitsweisen, transkulturelle Verbindungen, Experimente als wissenserzeugende Praktiken bringen Wissenschaftler und Künstler immer näher zueinander: Wissenschaftler erzeugen Wissen, indem sie andauernd durch die konkrete Partizipation an ihrem Umfeld, durch ihre vielfältigen Beziehungen Kenntnisse erwerben, sammeln und markieren. Aus ihrer Position heraus positionieren sich die Künstler in der performativen Praxis als Forscher unter der Bedingung, dass sie eine »critical meta-practice« ausüben (Melrose 2002). Der practitioner muss, anders gesagt, sowohl die Konventionen seiner eigenen Aktivität und Disziplin berücksichtigen als auch einige von ihm angewandte Praktiken infrage stellen. Als aktiver Untersuchungsprozess verkörpert der kreative Schaffensprozess selbst das Wissen, das der Künstler durch seine Arbeit erworben hat und das er in einer erfassbaren Form ausdrückt.4 Künstler und deren Kunst werden zu Wissenssubjekten, insofern die Praktiker den subjektiven Prozess verstehen, durch den sie Wissen erzeugen und verwenden.5 Wissensobjekte stellen nur Gegenstände dar, über die man Untersuchungen vornimmt und dadurch Wissen erweitert; dagegen sind Wissenssubjekte »subjects both in the sense of being subject to and shaped by the social forces constituting particular forms of knowledge, and in the sense of intentionally creating and using new forms of knowledge to transform those social forces« (Crowley/ Himmelweit 1992: 1).
Das Forschungsverfahren durch die Praxis hindurch ist unter dem Namen „practice-based research“ (PBR) bekannt, während der Begriff „practice-as-research“ (PAR) eine gründliche Untersuchung zur performativen Praktik bezeichnet.6 Die Verwandtschaft beider Namen und Forschungsmethoden verweist natürlich auf ihre gegenseitige Abhängigkeit: Erst die Verbindung beider Ansätze kann kognitive und ästhetische Bereiche in Kontakt bringen und neues Wissen produzieren. Angela Piccini formuliert eine Definition von „practice-as-research“, welche die zwei wissenschaftlichen Perspektiven umfasst:
It is perhaps more useful to think of practice as research as formalizing an institutional acceptance of performance practices and processes as arenas in which knowledges might be opened. Practice as research acknowledges fundamental epistemological issues that can only be addressed in and through practice […]. (2002: 2)
Künstlerische, kreative Tätigkeiten und die wissenschaftliche Reflexion finden in PAR eine Balance: Praxis im Sinne eines hybridisierten, dynamischen und situierten Forschungsprozesses bedeutet mithin Wissenserzeugung und zugleich Wissensaustausch, weil sie die inneren Vorgänge, die Instrumente, die soziale Einbettung einer Kunstpraxis aufzeigt und ständig neu bestimmt. Sie produziert und vermittelt Wissen. Akademische Institutionen konnten folglich die Funktion nicht mehr ignorieren, welche die kontextuelle, praxisorientierte Kunstforschung für den Lern- und Wissensprozess hat: Von Beginn der 1990er Jahre an haben zuerst britische, dann australische, skandinavische und US-amerikanische Hochschulen die Gültigkeit praxisbasierter Forschungsprojekte anerkannt.7 Die Legitimierung dieser Form des verkörperten Wissens stellt allerdings eine doppelte Herausforderung an das akademische Wissenssystem des Abendlandes dar: Zum einen verliert der Geist, der menschliche Verstand seine Bedeutung als einziger locus der sicheren Kenntnis, weil der Körper zum gleichberechtigten Mittel des Wissens wird; zum anderen werden das geschriebene Wort und die Publikation als einzig anerkannte Methoden hinterfragt, die Ergebnisse einer Forschungsarbeit zu speichern und zu verbreiten. Was die praxisorientierte Kunstforschung darüber hinaus in Frage stellt, ist der Auftrag an die Forschung, unbedingt zu festen Ergebnissen zu führen. Jede performative Praktik ist in die aktuellen Fragen derart eingespannt, dass sie einen fundamentalen Beitrag dazu leistet, die Strukturen und Abläufe der Gegenwart zu interpretieren. Die »immanente und performative Perspektive« dieser Art von Kunstforschung bringt aber ein offensichtliches Paradox für die etablierte wissenschaftliche Forschung mit sich: Es handelt sich um eine Untersuchung, »die nicht von einer Trennung zwischen Subjekt und Objekt ausgeht und folglich keine Distanz des Forschenden zur Kunstpraxis voraussetzt. Stattdessen ist die künstlerische Praxis ein wesentlicher Bestandteil sowohl des Forschungsprozesses als auch der Forschungsergebnisse« (Borgdorff 2009: 30). Der practitioner ist derjenige Wissenschaftler, der aus seiner pragmatischen Perspektive die Probleme identifiziert, die in der Praxis selbst entstanden sind, und der dafür Lösungen sucht, die ihrerseits von der Praxis geprägt sind. In einer von Praktikern-Wissenschaftlern betriebenen Forschung werden Aspekte wie Subjektivität, Selbstreflexivität und Interaktion mit Forschungsmaterialien zur Kenntnis genommen und Wissen ergibt sich als ausgehandelt, kontextbezogen und intersubjektiv. Henk Borgdorff erklärt diesen Ansatz näher, indem er die Übereinstimmung von Theorie und Praxis in der Kunst ins Gedächtnis ruft: Die direkte Interdependenz von Konzepten, Denk- und Interpretationssystemen, Erfahrungen und Auffassungen in Kunstpraktiken findet in PAR ihr Pendant, denn diese Kunstforschung versucht, »einen Teil dieses im kreativen Prozess oder im Kunstobjekt enthaltenen Wissens zu artikulieren« (Ebd.). Das Ziel der praxisbasierten Forschung unterscheidet sich also nicht prinzipiell von dem der akademischen Forschung, weil sie immer einen Wissens- und Erkenntnisgewinn in verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens anstrebt. PAR geht jedoch ein antipodisches Verhältnis zum Logozentrismus der Forschung im Universitätsbereich ein: Der Versuch zur Legitimierung der Praxis an Hochschulen kollidiert einerseits mit dem Konzept des wissenschaftlichen Wertes der Forschung und andererseits mit dem Dokumentationsbedarf. Der traditionelle Forschungsbegriff ist von bestimmten akademischen Standards, Gebräuchen und Protokollen geprägt, welche am Ende zu einem schriftlichen Text zusammenfließen. Der Wert einer Forschungsarbeit lässt sich anhand der Originalität des Beitrags zum kollektiven Wissen sowie anhand der Beweisbarkeit der Forschungsergebnisse durch ein kohärent angewandtes theoretisch-methodologisches Instrumentarium abschätzen. Im Falle von praxisbasierten Untersuchungen gelten jedoch andere Gesetze, die die Kunstforschung leiten, weil die Infragestellung der Forschungsprozesse, das Hervorbringen von unerklärtem, nicht-begrifflichem Wissen und die bewusste Reflektion über schon etablierte Kunstpraxen hier viel wichtiger als empirisch überprüfbare Ergebnisse sind.
Implizites Wissen und reflektierende Praxis/Reflexion bilden tatsächlich den Fokus von zwei für die Diskussion um PAR bedeutenden Theorien, die zu einer neuen Epistemologie der Praxis beigetragen haben. Die erste ist die bereits erwähnte Position von Michael Polanyi, während sich die zweite in Donald Alan Schöns Werk The Reflective Practitioner artikuliert. 1983 hat Schön den Begriff „reflective practice“ eingeführt, welcher den Zusammenhang von Wissen und Handeln in der Tätigkeit von Praktikern zu verdeutlichen versucht und nach einer neuen, auf der Praxis basierenden Verschmelzung von Kunst und akademischer Lehre strebt. Von unterschiedlichen Fallstudien ausgehend stellt Schön fest, dass die Art und Weise, wie Praktiker Aufgaben stellen und Probleme lösen, von einem impliziten personalen Wissen abhängt, das oftmals nicht ausgesprochen ist und das auf die in der Praxis gelernte Improvisationsfähigkeit setzt. Doch diese statische Wissensform sei nicht in der Lage, mehr Wissen im Praxisfeld zu konstruieren, weil Praktiker die Instrumente für die Artikulation ihres intuitiven, im Handeln inhärenten Wissens und folglich für die Wissensvermittlung nicht beherrschen. Der Bereich der Praxis bleibt hier von dem der wissenschaftlichen Untersuchung getrennt. Unter bestimmten Umständen können sich Praktiker allerdings auf eine „reflektierende Praxis“ konzentrieren, welche die Beziehung zwischen Praxis und Forschung wiederherstellt. Der natürliche Austausch zwischen diesen Bereichen wird durch die „Reflexion im Handeln“, d.h. das Reflektieren über das Handeln während des Handelns selbst, und die „Reflexion über das Handeln“, d.h. eine rückschauende Reflexion über die abgeschlossene Handlung, implementiert. Der Praktiker wird zum Erforscher seiner eigenen Praxis, wenn er über sein eigenes Wissen in der Praxis reflektiert – mitten in der kreativen Handlung wie auch danach.8 Christopher Crouchs Kritik an Schöns reflektierender Praxis (2007) gipfelt aber in der Feststellung, Reflection sei ein Prozess, durch welchen sich das Individuum an einem schon vorhandenen Wissensbestand beteilige, ohne sich zu fragen, wie und inwiefern er seine Forschung beeinflusst und was letztendlich als Forschung angenommen wird. Crouch plädiert stattdessen für die Wichtigkeit von reflexive practitioners, die sich kritisch mit ihren kreativen Werken oder Artefakten beschäftigen. Reflexivität bezeichnet demnach einen dynamischen Lernprozess, der die interne Perspektive mit der externen verbindet. Im Kunstbereich bzw. in der Kunstforschung wird ein solcher Lernprozess entweder in Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Akademikern oder von Kunstpraktikern selbst durchgeführt, die aber ihre eigenen auf der Praxis basierenden Kenntnisse mit kritischem Blick untersuchen und in der Öffentlichkeit verbreiten können. Praxis bzw. reflexives Handeln erzwingt den Einsatz der Einzelnen für die Aushandlung eher gesellschaftlicher als akademischer Prinzipien und Werte:
When the creative practitioner adopts praxis, it encourages the act of reflecting upon, and reconstructing the constructed world. Adopting praxis assumes a process of meaning making, and that meaning and its processes are contingent upon a cultural and social environment. Because praxis is not self-centred but is about acting together with others, because it is about negotiation and is not about acting upon others, it forces the practitioner to consider more than just the practicalities of making. Praxis encourages a move away from the pitfalls of introspective narcissism and towards an analytical engagement with human interaction, and emphasizes the necessity to clarify the inter-subjective circumstances of the communicative act. (111f.)
So ist es nicht überraschend, dass die Situiertheit des Wissens und des Lernprozesses als heutiges Bewertungskriterium von PAR am meisten zählt. Sie betrifft die Art und Weise, wie die practitioners ihre Arbeit kontextualisieren – d.h. situativ platzieren –, welche Probleme sie durch ihre Arbeit untersuchen und welche Methoden sie anwenden, um die Fragen ihrer Kunstforschung zu behandeln und, wenn möglich, zu beantworten. Es besteht in dieser Hinsicht kein entscheidender Unterschied zwischen situiertem und erfahrungsbasiertem Wissen, soweit nach Sutherland und Krzys (2007) die praktische, kontextbezogene und relationale Aktivität des Lernens betroffen ist. Wenn sie behaupten: »[R]ather than metaphors of location, creative practice demonstrates the need to use metaphors of embodiment and tacit knowledge in order to understand the nature of experiential knowledge« (133), dann übersehen sie die Bedeutung von Situiertheit sowie die ganze Debatte über die Praxis als Hauptgrund für das Lernen. Doch die Fokussierung auf das Erfahrungswissen und auf die Konstituierung des Kunstwerks durch die direkten Kontakte der Subjekte zur Kunst beleuchtet das Problem der Re-präsentation von praxisorientierten Forschungsarbeiten.
Da jede wissenschaftliche Forschung auf »sustained and structured reflection« basiert, welche das unausgesprochene, implizite Wissen eines Kunstprozesses explizit macht (Nelson 2006: 112), muss Praxis sowohl im Kunstwerk als auch in einer damit verbundenen Dokumentation artikuliert und kommuniziert werden. Diese Doppelartikulation der Kunstpraxis im wissenschaftlichen Bereich wird aber in zweifacher Hinsicht kritisch gesehen: Wenn einige Wissenschaftler argumentieren, gewisse Kunstpraktiken und die Erschaffung von Kunst selbst seien als ernsthafte wissenschaftliche Forschung zu betrachten, »or at least as an integral aspect of the research, because it is an indispensable part of the research« (Dallow, 2003: 55), beklagen andere die akademische Betonung auf Zweck und Ziel der Kunstschöpfung, was das Kunstwerk und dessen Wert in den Hintergrund drängt. Anna Pakes (2004) spricht ihr tiefes Bedauern über den für PAR typischen systematischen Versuch aus, die Konturen von Kunstwerken festzulegen, sie als Lösung einer externen Infragestellung aufzuweichen und somit ihre Polysemie zu verweigern: »The problem is that exercising such control may also undercut the value of artworks as able to speak to a multiplicity of interests and a variety of viewers […]«. Erschwerend kommt hinzu, dass die etablierte akademische Weise, die Struktur einer Forschungsarbeit zu evaluieren, gerade dem epistemologischen Wert der Kunst entgegensteht: Neben der objektiven wissenschaftlichen Erkenntnis spielen die äußerst produktive Verflechtung von Beziehungen und Erfahrungen, die intime und innige Beschäftigung mit dem eigenen Werk ebenso wie die hohe Interpretationsoffenheit von Kunstwerken eine Rolle. Gerade wegen dieses zweimal verkörperten Wissens – einmal im kreativen Prozess, einmal im Kunstwerk – ist die Frage nach einer angemessenen Dokumentation vor allem in den praxisorientierten performative arts entscheidend: Die Flüchtigkeit von Aufführungen und die von ihnen untrennbare leibliche Ko-Präsenz von Zuschauern und Akteuren entziehen sich jeder Übertragung in andere Formen. Hier kommt es zu einem Bruch zwischen Wissensproduktion und Wissensvermittlung: Die effektive Übersetzung einer Performance in ein anderes Medium, wodurch die Kriterien der etablierten akademischen Forschung allein befriedigen werden könnten, untergräbt die Forschungsmethode selbst.9 Eine solche Forschungsarbeit kann sich nämlich gerade mit den medialen Bedingungen oder mit der besonderen Erscheinung der Materialität einer Aufführung beschäftigen – und zwar mit Aufführungsmerkmalen, die auf ein verkörpertes Wissen hindeuten und per definitionem in einer Video- oder Audioaufzeichnung weder eingebettet noch artikuliert werden können (Rye 2003). Eine derartige Kunstforschung wird folglich entweder durch spezifische Dokumentationsmodi betrieben, die über ihr immanentes Paradox Auskunft geben: »that is, documents that do not suggest an unproblematic transparency between the live event and its record and therefore that the two cannot be conflated« (Ebd.); oder durch eine anti-akademische Praxis sensu stricto, die statt Sicherheit, Kontrolle oder Archivierungszwang gerade Zweifel, Verlust und Verschwinden kultiviert, um alle möglichen Interpretationen der transformierenden bzw. produktiven Triebkraft zwischen Realem und Repräsentation immer zu zulassen und aufzuführen (Phelan 1993: 173; 180). Als Antwort auf die bisher aufgezeigte Debatte über Methodologie und Validität der Forschung schlug Brad Haseman 2006 vor, ein neues Paradigma in der Kunstwissenschaft einzuführen – das Paradigma der Performative Research. Damit sind alle Untersuchungsformen gemeint, bei denen die symbolischen Fakten selbst performativ wirken: »It not only expresses the research, but in that expression becomes the research itself«. Performative Research könne also die Sozialstruktur und den kulturellen Kontext der Kunstpraxis erklären, gerade weil sie sich auf persönliche Narrative als situierte Praxis konzentriere: »Performative research represents a move which holds that practice is the principal research activity – rather than only the practice of performance – and sees the material outcomes of practice as all-important representations of research findings in their own right«. Schließlich lässt sich festhalten, dass die kritische Hinterfragung der Methoden und des Dokumentationsverfahrens,10 das Experimentieren ebenso wie die direkte Teilnahme der Forschenden an der praktischen Durchführung ihrer Forschungspläne die Bestandteile der praxisbasierten Forschung bzw. der künstlerischen Praxis bilden. Sowohl Nelson (2006: 115) als auch Borgdorff (2009: 43f.) setzen sich darum für die Verwendung des umfassenden Begriffs „arts research“ / „Kunstforschung“ ein, deren Hauptmethodik auf der Praxis beruht und die das implizite Wissen verkörpert, welches durch Experimente und Interpretationen ermittelt und vermittelt wird.
Vor diesem Hintergrund kann Artur Kutschers wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Objekt Theater als eine sehr frühe Anerkennung der grundlegenden Praxisdimension im Untersuchungsverfahren und als eine erste Eingrenzung des Problems „Praxis als Forschung“ im akademischen Horizont betrachtet werden. Kutscher lehnte jedes praxisferne Untersuchungsverfahren im Bereich der Theaterwissenschaft ab, weil er die Praxis als Ausgangspunkt und Zielpunkt11 aller Kunstforschung betrachtete. Er war außerdem davon überzeugt, die Binarität zwischen Praxis und Theorie sei nur ein Konstrukt des etablierten akademischen Denksystems, welches das Wissenspotential der metakritischen Theaterpraxis nicht gebührend schätzte. Da diese für Kutscher und dessen Schüler typische Forschungsperspektive in anderen zeitgenössischen theaterwissenschaftlichen Abteilungen oder Instituten kein Analogon fand, erscheint es nicht richtig, von der Entstehung einer einheitlichen, monolithischen Disziplin im deutschsprachigen Raum zu reden,12 sondern von der Entwicklung unterschiedlicher Facetten eines Wissenschaftsgebiets, die die Tätigkeit unterschiedlicher Forschungsgemeinschaften aus unterschiedlichen Orten widerspiegeln. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, welches methodologische Instrumentarium dem Spezifikum der von Kutscher betriebenen Theaterforschung bzw. der Praxisdimension gerecht wird. Das theoretische Modell sollte zum einen den spezialisierten Wissenszweig „Theaterwissenschaft“ nicht als isolierte Erscheinung untersuchen, die Bedingungen der Möglichkeit prüfen, wie dieses neue Gebiet sich im universitären Wissenschaftsbetrieb von anderen Fächern abgrenzen, bzw. akademische Anerkennung erfahren konnte. Mit anderen Worten: Die Analyse muss im Hinblick auf den Modernisierungsprozess und auf den Betätigungsdrang der Intellektuellen im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich durchgeführt werden, welche aus unterschiedlichen Gründen und in unterschiedlicher Weise die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts charakterisierten. Zum anderen sollte es die Bestrebungen des „Theaterprofessors“, durch die Etablierung eines neuen Fachgebietes den Wissenserwerb und die Wissenserzeugung seiner Lerngemeinschaft anzuregen, in einen breiteren gesellschaftlichen Rahmen stellen.
Wissenschaftlicher Diskurs und ausgehandelte Praxis
Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft kann keine gründliche Beschäftigung mit materiellen und/oder institutionellen Bedingungen des wissenschaftlichen Diskurses von Foucaults Diskursanalyse absehen. Doch Foucaults Diskursbegriff stellt hinsichtlich der Praxis ein großes Dilemma dar: das Verschwinden des Einzelakteurs in der Praxis selbst und daher die Negation direkter Interaktionen sowie produktiver Austauschprozesse zwischen Subjekten.1
Besonders am Anfang seiner theoretisch-methodologischen Reflexion (1968–1970) versucht Michel Foucault wiederholt, den Überbegriff „regulierte Praxis“ bzw. „Diskurs“ zu beschreiben. Diskurs und Praxis bilden lediglich ein Analyseinstrument, um die Konstitution von Wissen und Wirklichkeit zu erfassen.2 Er erkennt eine diskursive Praxis einerseits und eine nicht-diskursive Praxis andererseits. Die erste sei »eine Gesamtheit von anonymen, historischen, stets im Raum und in der Zeit determinierten Regeln, die in einer gegebenen Epoche und für eine gegebene soziale, ökonomische, geographische oder sprachliche Umgebung die Wirkungsbedingungen der Aussagefunktion definiert haben« (Foucault 1973: 171), während sich die zweite auf eine zu errichtende Systematik des Machbaren – also nicht des Aussagbaren oder des Denkbaren – bezieht.3 Die funktionale Verkettung dieser zwei Praktiken erschafft ein allgemeines System von Regeln, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums der Wissensproduktion zugrunde liegen. Es stellt sich hier natürlich die Frage, wer oder was diese Regeln determiniert. Als reglementierende Instanz fungiert eine Art anonyme historische Macht, die der Praxis sowie dem sprechenden und handelnden Subjekt vorausgesetzt ist, eine aus Beziehungsbündeln bestehende Matrix. Die Praxis entspricht in Foucaults Theorie einem System von Strukturen oder Mustern, die alle Gegenstände, Begriffe und sprachlichen Äußerungen sowie die Position des Aussagesubjekts hervorbringen. Im Rahmen dieser Praxis gestalten Subjekte ihre Welt, »wie sie dabei von den Regeln des Diskurses geleitet, beschränkt und dezentriert werden« (Sarasin 2005: 107). Die Praxis regelt alles, was man denken, sagen und tun kann, und zwar organisiert sie die wahrgenommene Wirklichkeit. Die Individuen, die mit einer bestimmten diskursiven und nicht-diskursiven Praxis vertraut sind, teilen dieselben begrenzten Möglichkeiten, sich in einer gewissen Weise auszudrücken und zu handeln. Subjekte stehen mithin nicht im Zentrum des Lern- und Erkenntnisprozesses, sondern am Rande der Wissenserzeugung und der Wirklichkeitskonstitution: Durch die Subjekte bekommen gegebene Äußerungen eine festgelegte Funktion innerhalb der Praxis bzw. des Diskurses. Das Individuum als Subjekt, als Akteur stellt in Bezug auf die Praxis ein transparentes, amorphes und regungsloses Wesen dar, durch welches eine Äußerung erst konkret ausgesprochen werden kann. Das Subjekt existiert also nur, um Diskursinhalte zu vermitteln; es wurde vom Diskurs selbst konstituiert und legitimiert, sodass keine Aussage und kein Handeln außerhalb des Normierungssystems des Diskurses möglich sind. Der Diskurs allein bringt Wissen hervor, indem seine Prozesse die Handlungsmöglichkeiten der Menschen beschränken.4 Gerade in der Produktion von materiellen und diskursiven Bedingungen – und nicht zuletzt in der Produktion von Wissen – wird die Rolle des persönlichen Beitrags, der individuellen Leistung überaus fragwürdig: Wenn die Praxis einen Denkraum und zugleich einen Tätigkeitsbereich bezeichnet, dann erscheint die Vorstellung fragwürdig, dass der Akteur nur ein Epigone sei, der auf eigene Interessen, Intentionen und Entscheidungen verzichtet und der die ihm äußerlichen Strukturen einfach inkorporiert und reproduziert. Foucault erkennt zwar einen subjektiven Anteil in der Art und Weise, wie der Einzelakteur Aussagen nachvollzieht, insistiert zugleich aber auf dem Konzept, das Subjekt sei nur ein kontingentes Produkt einer historischen, kontextabhängigen, regulierten Praxis.
In der letzten Phase der Konstituierung seiner Theorie der Macht (1971–1984





























