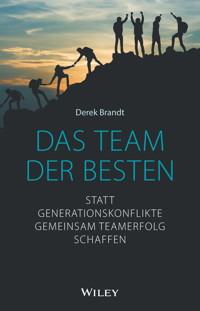
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Buch von Derek Brandt zeigt anhand von Geschichten und konkreten Tipps aus der umfangreichen Berufspraxis des Autors auf, wie eine positive Arbeitsatmosphäre und eine authentische Führung zur Transformation von Unternehmen beitragen können.
Mithilfe von Analysen und Erfahrungsberichten erläutert der Autor einen neuen Weg - weg von hierarchischen Strukturen hin zu teamorientierter Führung und selbstbestimmten Mitarbeitenden, um eine neue Dynamik in der Organisation zu schaffen. Gerade die nachrückenden jüngeren Generationen bzw. die Berufseinsteiger erwarten etwas anderes als die Babyboomer. Sie fordern mehr Selbstbestimmung. Darauf muss in der Teamführung und Zusammenarbeit eingegangen werden.
Der Autor ermuntert deshalb dazu, althergebrachte Sichtweisen nicht nur zu hinterfragen, sondern komplett zu verwerfen. Stattdessen bietet er eine Anleitung, wie Führung heute besser gelingen kann.
Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der verstehen möchte, wie man als Organisation und in Teams in einer sich ständig verändernden Welt agil reagieren und einen nachhaltigen Erfolg erzielen kann.
Durch die Umsetzung der im Buch vorgestellten Strategien können die Leser die Zufriedenheit und Bindung ihrer Mitarbeitenden erhöhen, was zu einer höheren Produktivität führt. Abgesehen von beruflichen Vorteilen, fördert das Buch auch persönliches Wachstum und Selbstvertrauen, indem es die Bedeutung von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung betont. Außerdem bietet es auch Tools und Techniken zur effektiven Bewältigung und Lösung von Konflikten am Arbeitsplatz. Dies kann dazu beitragen, das allgemeine Arbeitsklima zu verbessern und die Teamarbeit zu stärken.
Derek Brandt liefert damit einen Leitfaden, der ein Aufruf zum Handeln, eine Aufforderung zur Veränderung und eine Vision für eine bessere Zukunft ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alle Bücher von WILEY-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
© 2024 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Print ISBN: 978-3-527-51190-7ePub ISBN: 978-3-527-84766-2
Umschlaggestaltung: Susan BauerCoverbild: Love the wind - adobe.stock.com
Ich danke meiner Frau und meinen beiden Töchtern, die – nicht nur bei diesem Buchprojekt – so viel Geduld mit mir hatten und immer noch haben. Ich weiß wirklich nicht, ob ich diese Geduld für mich an ihrer Stelle auch nur ansatzweise aufgebracht hätte!
»Das Menschengeschlecht befindet sich im besten Zustand, wenn es möglichst frei ist!«
(Dante Alighieri)
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Hingabe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Anmerkungen
1 Die Consultants
Anmerkungen
2 Die Ziele
Der Ursprung des Wortes Führung
Ziele in einer Organisation setzen und einhalten
Anmerkungen
3 Das Team
Anmerkungen
4 Der M&A-Prozess
5 Der Co-Founder
6 Das Großraumbüro
7 Der Fehler
8 Das Fahrrad
9 Der Anzug
Anmerkungen
10 Der Handschlag
Gastbeitrag von Lars Birkmann
Anmerkungen
11 Der Umzug
12 Das Auto
Notiz
13 Das Orchester
Anmerkungen
14 Die Dachbox
Anmerkungen
15 Gehalts-Frustration
Anmerkungen
16 Auf Vertrauen vertrauen
17 Tun oder Nicht-Tun?
Notiz
18 Wandel in Wirtschaft und Umfeld
Notiz
19 Gedanken zur Organisationsentwicklung
Beispiele zur Organisationsentwicklung
Anmerkungen
20 Erwartungen der Arbeitnehmenden
Beispiel einer gelungenen Transformation
Beispiel für schlechtes Arbeitsklima
Wie kann eine nicht-hierarchische Teamarbeit zum Erfolg führen?
Anmerkungen
21 Wichtige Elemente für eine erfolgreiche Transformation
Zusammenfassung
Der Autor
Literaturverzeichnis
End User License Agreement
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Hingabe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Zusammenfassung
Der Autor
Literaturverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
157
158
159
160
161
163
164
165
167
168
169
170
171
Einleitung
Wenn man sich morgens in einem Zug die Menschen betrachtet, wie sie zur Arbeit fahren, dann kann man in viele müde und unmotivierte Augen sehen. Nur 16 Prozent der Mitarbeitenden fühlen sich ihrem Unternehmen verbunden und jeder Sechste hat bereits innerlich gekündigt, dies geht aus dem Gallup Engagement Index1 hervor. Aber warum ist das so und warum schaffen es die Unternehmen nicht, ihren Mitarbeitenden einen sicheren und spannenden Ort zu bieten, bei dem es sich »lohnt« zu arbeiten und bei dem man am Morgen mit einem Lachen aufsteht und mit Spaß zur Arbeit geht?
In rund 25 Jahren in Führungspositionen in Start-ups, aber auch größeren Organisationen habe ich umfangreiche Erfahrungen mit klassisch-hierarchischen Organisationsstrukturen und Matrixorganisationen gesammelt. Das schreibe ich nicht, um Sie mit Zahlen zu beeindrucken, sondern um Ihnen aufzuzeigen, dass das, was ich in diesem Buch erläutern werde, nicht aus der Luft gegriffen ist. In diesen vielen Jahren meiner Tätigkeit als CEO, Investor und Sparringspartner ist mir immer wieder aufgefallen, dass das Management die Mitarbeitenden nicht so behandelt, wie sie es verdienen. Außerdem erkannte ich, dass wir als Führungskräfte im täglichen Geschäft nicht genug oder, wenn man ehrlich ist, eigentlich fast gar nicht auf sie gehört haben, obwohl sie ja die Spezialisten und Fachleute in ihrem Gebiet sind. Aus dieser – ich nenne es jetzt provokant »Expertenignoranz« – resultierte häufig eine unterschwellige Unzufriedenheit des Teams, die immer wieder mit der Bitte um mehr Kommunikation und Transparenz von einzelnen Mitarbeitenden zum Ausdruck kam.
In der Geschäftsleitung haben wir infolgedessen diverse Maßnahmen ergriffen, um die Organisation anzupassen, haben die Wertelandschaft mit den Mitarbeitenden zusammen neu definiert und mit Workshops und Informationsmaterial implementiert. Wir haben versucht, mit einer neuen Art, wie wir Meetings gestaltet haben, den Informationsgrad innerhalb der Projekte und der Organisation als Ganzes zu verbessern und die Mitarbeitenden besser einzubinden. Wir führten SCRUM und agile Entwicklungsmethoden ein, um die Flexibilität innerhalb der Projekte zu fördern und alle Beteiligten mehr in die Prozesse einzubinden.
Ich war zufrieden mit diesen Veränderungen. Denn ich erkannte Fortschritt statt Stillstand. Schließlich übernahmen mein Führungsteam und ich Verantwortung und entwickelten die Organisation weiter. Aber mir wurde im Laufe der Zeit immer klarer, dass all diese Maßnahmen nur eine Bekämpfung der Symptome waren und keine Veränderung an den eigentlichen Ursachen darstellten. Wir behandelten Kopfschmerzen mit einer Schmerztablette, ohne zu verstehen, woher die Kopfschmerzen eigentlich kommen. Einige Mitarbeitende wagten trotz unserer Bemühungen den Absprung, gründeten eigene Firmen oder wechselten in sehr kleine Organisationen. Wenn wir mit ihnen über die Gründe des Weggangs sprachen, wurde immer wieder klar, dass die unflexiblen und verkrusteten Strukturen und oft nicht nachvollziehbaren Entscheidungswege eine der Hauptursachen für deren Unzufriedenheit und damit Wechsel waren. Denn je erfolgreicher die Firma wurde und je mehr sie wuchs, umso komplexer wurden Prozesse und Abstimmungen.
2018 verkauften wir dann dieses Unternehmen, das ich, seitdem es mit vier Ingenieuren in einem Hinterhof gestartet war, geleitet hatte, an einen Großkonzern. Die Entwicklung war damit im Grunde eine Erfolgsgeschichte – doch mit dem Verkauf trafen wir auf eine große, über viele Jahrzehnte gewachsene und sehr komplexe Organisation mit über 10 000 Mitarbeitenden und einigen Königreichen. Die Komplexität der Abstimmungen und Entscheidungsprozesse nahm nach der Übernahme noch weiter und fast schon exponentiell zu. Ich kam mir von einem Tag auf den anderen nicht mehr vor wie auf einem Speedboot, sondern arbeitete auf einem Supertanker. Anstatt schnell und wendig den Kurs zu bestimmen und das Unternehmen an die Bedürfnisse des Marktes und der Kunden anzupassen, galt es nun für meine Kolleginnen und Kollegen des ehemaligen Speedbootes, neue Werte und Hierarchien kennenzulernen.
»Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.«
Henry Ford
Welche Werte das waren, lernte ich bereits kurz nach der Akquisition meiner Firma kennen. Mir wurde das »Buch« Car Policy überreicht, in dem bis ins letzte Detail beschrieben war, welches Auto mit welcher Ausstattung man in der jeweiligen Funktionsstufe fahren durfte. Sogar das Nummernschild, respektive was darauf stehen durfte und was nicht, waren vorgeschrieben. Konnte das wirklich sein? Es gab im Unternehmen hervorragend ausgebildete Mitarbeitende und Akademiker, die täglich unzählige Herausforderungen lösen mussten und deren Gedanken sich primär darum drehten, was für ein Auto jemand anderes fährt und ob ihr Titel jetzt »Global Director« oder »Senior Global Director« ist?
Zwei Jahre nach dem Verkauf der Firma schied ich aus dem Konzern aus. Zwar hatte ich die kleine Organisation irgendwie in den Konzern integriert, aber eine Symbiose und ein gegenseitiges Verständnis hatten wir aus meiner Sicht nicht geschaffen. Doch warum war das nicht gelungen? Ich stellte mir infolge dieses Erlebnisses diverse Fragen:
Wie kann ich eine Organisation aufbauen, in der wir gemeinsam als Team das Potenzial aller ausschöpfen und gleichzeitig ein Umfeld schaffen, in dem die Mitarbeitenden Spaß haben, motiviert sind, zu arbeiten und auch mal die Extrameile zu gehen?
Wie können wir gemeinsam diesen Schatz des ungenutzten Potenzials und des Mehrwerts durch wirkliche Zusammenarbeit heben und zum Nutzen der Firma, aber auch der Mitarbeitenden nutzen?
Wie können wir die Verantwortung auf mehr Schultern verteilen und gleichzeitig eine Organisation realisieren, die Ziele verfolgt und erfolgreich ist?
Wie können wir in einer Organisation Vision und Ziele abstimmen, damit alle wissen, wo es hingehen soll?
Wie schaffen wir es, dass ich am Morgen mehrheitlich lachende Gesichter sehe, wenn ich in die Firma komme?
Es stand für mich fest, dass ich in einer zukünftigen Firma so nicht mehr arbeiten wollte, wie ich es während der zwei Jahre auf dem Supertanker erlebt hatte.
Durch die Erfahrungen in den Start-ups und den größeren Firmen hatte ich vielleicht auch die Gelassenheit, es niemandem mehr beweisen zu müssen. Ich fing kurz nach meinem Exit an, in einer Stiftung zu arbeiten, die sich mit Technologien für die Behandlung von Diabetes beschäftigt. Da ich seit meiner Jugend selbst Diabetiker bin, war dies zum einen eine Herzensangelegenheit für mich, zum anderen eine neue Chance, Dinge anders zu machen als bisher. Ich wollte nicht die gleichen Fehler wie in den früheren Start-ups machen. Aus Zeit- und Effizienzgründen hatte ich die Ziele und die Vision der Start-ups oft selbst definiert. Auch hatte ich bei früheren Gelegenheiten den Businessplan ganz allein geschrieben, ohne wirklich das Feedback der Spezialisten einzuholen. Nun war es an der Zeit, aus diesen Fehlern zu lernen.
Also fingen wir ganz am Anfang der Zusammenarbeit und innerhalb der ersten beiden Wochen mit einem Workshop mit allen Mitarbeitenden an und definierten, was und wer wir sind, also Vision, Mission und unsere gemeinsamen Werte. Danach legten wir gemeinsam die Fünfjahresziele fest und brachen diese auf die Ziele für das nächste Jahr herunter. Basierend auf dem Buch Tasks & Teams2 von Heinz-Walter Große und Bernadette Tillmanns-Estorf formten wir Teams, die sich um exakt definierte Jahresziele kümmerten. Innerhalb der Teams existierten keine hierarchischen Strukturen. Stattdessen bestimmte das Team, wie und von wem die einzelnen Tasks abgearbeitet werden sollten. Weiterhin gab es innerhalb der Organisation keine Chefs im klassischen Sinne, sondern eher Mentoren und Coaches, die diesen Teams dabei halfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auf Kurs zu bleiben. Das Unternehmen agierte damit wie eine Art größerer Organismus, der aus kleineren Einheiten zusammengesetzt war. Das hatte den Vorteil, dass wir jederzeit einfach neue Teams erstellen und in den Organismus einbeziehen konnten – eine Art Schwarm hatte sich geformt.
Mit diesem Buch möchte ich Ihnen anhand meiner Erfahrungen und Geschichten, die ich im Laufe der Zeit erlebt habe, meinen Ansatz weg von der strukturierten Organisationsform zu einer für mich sehr dynamischen Art und Weise der Zusammenarbeit beschreiben – hin zu leistungsstarken Teams über verschiedene Generationen hinweg.
Unterschiedliche Generationen haben andere Vorstellungen vom Miteinander und von der Rolle einer Führung. Zum Beispiel verändert sich mit dem Eintreten der Generation Z in die Arbeitswelt einiges für Führungskräfte, Mitarbeitende und die Arbeitskultur als Ganzes. Die jungen Teammitglieder bringen frische Vorstellungen mit, sind individuell und beherrschen digitale Kommunikation aus dem Effeff.
Führungskräften fällt es oft leicht, Mitarbeitende und Teams zu managen, die die gleichen Werte und einen ähnlichen Erfahrungshorizont teilen wie sie selbst. Doch heute treffen am Arbeitsplatz Babyboomer auf Millennials und Gen Z – alle unter einem Dach, in einem Team, in einer Organisation.
Basierend auf den sich immer schneller ändernden Rahmenbedingungen und Anforderungen des Marktes, ist es meiner Meinung nach unerlässlich, eine agile und dynamische Struktur aufzubauen, die auch den Anforderungen und Erwartungen der unterschiedlichen Generationen gerecht wird. Gleichzeitig fördert eine nicht hierarchische Zusammenarbeit die Identifikation der Mitarbeitenden mit den Zielen und der Vision der Organisation beziehungsweise des Unternehmens.
Die Erläuterungen und Tipps in meinem Buch sind kein Universalrezept. Bitte sehen Sie meine Hinweise und Learnings als Denkanstöße, wie Sie sich und Ihr Unternehmen für die Zukunft agil und dynamisch aufstellen und die Mitarbeitenden aktiv in die Prozesse einbinden können. Mir ist bewusst, dass die Strukturen, die ich Ihnen vorschlagen werde, zum Beispiel in der Produktion nur schwer zu realisieren sind. Aber auch hier gibt es eventuell die Möglichkeit, in einem ambidexteren Ansatz, also einem Ansatz von strukturiertem Arbeiten und flexiblen, agilen Zeiten, die Organisation zu formen. Lassen Sie uns nun direkt eintauchen.
Ich habe in diesem Buch einige Beispiel aus meinem Berufsleben beschrieben. Diese Anekdoten sollen zum einen dazu dienen, darüber nachzudenken, wie man es wenn möglich nicht machen sollte oder wie Prozesse und Dinge schieflaufen können. Zum anderen sollen sie aber auch als Anstoß dafür dienen, wie man die Bedürfnisse und Erwartungen der unterschiedlichen Generationen besser in die eigenen Arbeitswelten und die Firmenvision und Wertelandschaft einbauen kann.
Ich wünsche Ihnen neben neuen Erkenntnissen vor allem viel Spaß beim Lesen. Denn Spaß ist, neben dem Sinn des Tuns, eines der wichtigsten Dinge im Leben – im Büro und auch im Privaten!
Anmerkungen
1
Marco Nink
, Engagement Index, Redline Verlag, 2018, ISBN 978-3-86881-706-5
2
H.-W. Große & B. Tillmanns-Estorf
, Tasks & Teams. Die neue Formel für bessere Zusammenarbeit, Murmann Verlag Oktober 2018, ISBN 978-3-86774-622-9
1Die Consultants
Vor allem in größeren Organisationen werden immer wieder Berater zu Hilfe gerufen, um mit Analysen und Konzepten die eigenen Entscheidungen abzusichern. Dies mit dem Ziel der Manager, keine eigenen Fehler zu machen und sich hinter den Dossiers der Berater verstecken zu können. Wenn nämlich die Entscheidung falsch war, kann man immer sagen, dass dies ja auf der Analyse der Berater beruht, respektive von ihnen genauso gesehen wurde. Aber eigentlich bräuchte es diese nicht. Man hat ja ein Team von internen Spezialisten und Fachleuten und auch junge Mitarbeitende, die neuen Wind und neue Ideen mitbringen würden, nutzt diese aber nicht wirklich.
Deshalb möchte ich mich zu Beginn des Buches im folgenden Kapitel mit den Consultants auseinandersetzen und aufzeigen, wie sinn- oder nicht sinnvoll ihr Einsatz für Unternehmen sein kann …
Kennen Sie Berater? Vermutlich zur Genüge, denn wir alle haben schon Menschen erlebt, die diesen Titel im Namen tragen, doch nicht alle haben ihn verdient. Vor einiger Zeit habe ich einen Spruch gehört, der eine schöne Erläuterung dafür gibt, was ein Berater ist: Ein Berater kennt das ganze Kamasutra, hat aber keinen Partner. Oft werden in kritischen Phasen oder wenn Entscheidungen getroffen werden sollen, die eine gewisse Tragweite haben, Berater hinzugezogen. In den wenigsten Fällen sind diese beraterbasierten Entscheidungen aber besser und vor allem nicht fundierter als diejenigen, die durch das Wissen, das in der Organisation eigentlich schon vorhanden ist, getroffen wurden.
»Sollen wir die uns angebotene Technologie, die eigentlich in unser Portfolio passt, kaufen oder ist das Risiko zu hoch?« Vor einigen Jahren stellte sich diese Frage – erneut – wieder einmal im Konzern. Eigentlich war das Investitionsvolumen überschaubar und das Risiko für die Organisation gering, aber keiner der Verantwortlichen wollte die Entscheidung treffen und sich damit exponieren. Um jedoch die Entscheidung, die getroffen werden musste, auch bei einem Scheitern des Projektes rechtfertigen zu können, wurde schnell eine der großen Beratungsfirmen dazu angefragt, ob sie eine entsprechende Analyse machen könnte. Wenige Tage später tauchten hochmotivierte Jungakademiker im Hauptsitz auf.
Ich habe diese Art von Menschen immer gerne als Pinguine bezeichnet – dunkler Anzug, weißes Hemd, rote Krawatte und randlose Brille. Im Hintergrund agierte, souverän und die wichtigen Kontakte pflegend, der Partner. Die Herbeigerufenen erstellten dann eine sehr umfangreiche Analyse der Technologie, des Marktes (den sie eigentlich gar nicht wirklich kannten) sowie der Chancen und Risiken der Akquisition. Bei dieser Analyse wurden nur sehr wenige Mitarbeiter aus der Organisation eingebunden. Anstatt vorhandenes Know-how einzubeziehen, war es ihnen vor allem wichtig, engen Kontakt zum Topmanagement zu halten, damit sich im abschließenden Bericht auf jeden Fall berücksichtigt fand, was alle C-Level-Beteiligten gerne hätten.
Mit diesem Dossier ging es dann ins Board, um sich die Zustimmung abzuholen. Auch hier wurde das von der so renommierten Beratungsfirma erstellte Dossier nicht hinterfragt und einstimmig angenommen. Danach ging es an die konkrete Umsetzung. Ohne Wenn und Aber wurde genau das umgesetzt, was von den Beratern vorgeschlagen worden war. Die eigenen Spezialisten und Know-how-Träger innerhalb der Organisation wurden zu keinem Zeitpunkt einbezogen oder nach ihrer Meinung gefragt. Vielleicht hatte man Angst, dass sie ein »Non-Invented-Here«-Syndrom haben oder aber der ganzen Sache aus logischen Gründen kritisch gegenüberstehen könnten. Das Gefühl könnte in solchen Fällen entstehen, dass gar kein Wert auf die hauseigene Expertise gelegt wird. Oder vielleicht realisierte das Management gar nicht, dass die Expertise eigentlich im Haus vorhanden war.
Ich habe immer wieder den Eindruck, dass bei Firmen auf die interne Expertise kein Wert gelegt wird oder man dieser nicht vertraut. Lieber nimmt man eine externe Beratungsfirma, die einem dann sagt, was man ja eigentlich schon weiß!
Also wurde an der ganzen Organisation vorbei und basierend auf dem Papier der sehr klugen, jedoch vollkommen unerfahrenen Juniors einer Consultingfirma eine Entscheidung getroffen und umgesetzt. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Natürlich haben diese Talente eine hervorragende Ausbildung genossen und sind wahre Arbeitstiere, aber das ersetzt oder kompensiert doch auf keinen Fall die langjährige Fachexpertise von Menschen, die täglich in dem Unternehmen, das eine Entscheidung zu treffen hat, ein und aus gehen. Initial führte diese Art der Entscheidungsfindung also bei den internen Spezialisten zu Kopfschütteln und Unverständnis.
Doch damit nicht genug, denn je länger das Projekt lief, umso mehr schlich sich ein passiver Widerstand in der Organisation dagegen ein. Es fanden sich immer weitere und neue Argumente, warum dieses Projekt nicht funktionieren könne. Auch führte der Widerstand zu deutlichen Projektverzögerungen, was wiederum als Argument dafür galt, das Projekt totzureden. Und schlussendlich blieb es nicht bei Worten: Das Projekt stagnierte mehr und mehr, bis es zum völligen Stillstand kam und als Misserfolg abgeschrieben wurde. Das Management hatte mit diesem Ergebnis aber kein wirkliches Problem, da man ja eine renommierte Consultingfirma für eine unabhängige Analyse zurate gezogen hatte und diese alles in ihrer Macht Stehende getan hatte, um die Risiken zu analysieren und das Projekt zu durchleuchten. War die Kommunikation zwischen Management und Consultants am Anfang noch enthusiastisch und vollumfänglich gewesen, so reduzierte sich auch dies über die Zeit und das Ende und damit Scheitern des Projektes wurde gar nicht mehr kommuniziert, sondern man hoffte, dass einfach niemand mehr nachfragen würde, was aus den vielen Stunden Analyse und den zahlreichen Maßnahmenplänen geworden war.
Neben dem tiefen Frust durch die fehlende Einbindung der Organisation tat diese immer schwächer werdende Kommunikation ihr Übriges, um den »Gesamtfrustlevel« auf die Spitze zu treiben.
Dies ist nur eine Geschichte von vielen, die täglich in Unternehmen aller Art und Größe wieder und wieder passieren. Je öfter so etwas stattfindet, umso mehr entfernt sich das Management von der Organisation. Eine solche mangelnde Kommunikation lässt sich mit einer Fußballmannschaft vergleichen. Wenn der Kontakt zwischen Team und Trainer nicht mehr besteht, respektive wenn die Mannschaft nicht mehr versteht, was der Trainer von ihr will, dann wird nicht das Team ausgetauscht, sondern der Trainer! Dann wird oftmals ein Trainer geholt, der bekannt dafür ist, einen guten Kontakt zum Team zu haben und das Maximum aus jedem Einzelnen herauszuholen.
Allen, nicht nur dem Trainer, ist bewusst: Das Ziel muss jedem im Team klar sein und die Arbeit jedes Einzelnen trägt dazu bei, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Der Trainer allein kann kein Spiel gewinnen – er braucht die Fachleute: den Libero, die Verteidigung, den Torwart, die Stürmer. Gehen Sie doch mal voran und trauen Sie den eigenen Fachkräften etwas zu. Geben Sie ihnen die Möglichkeit, zu beweisen, dass sie die gesteckten Ziele allein oder im Team erfolgreich realisieren können.
»In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.«
Augustinus Aurelis
Warum um Himmels Willen vertraut das Management mehr auf externe Berater als auf die eigenen Fachleute innerhalb der Organisation? Es ist doch keine schwere Aufgabe, ein kleines Team von internen Fachleuten zusammenzustellen, das sich das Thema sehr genau ansieht und die Aufgabe hat, eine Entscheidungsgrundlage für das Management und das Board auszuarbeiten. Natürlich werden die Mitarbeitenden eine sehr gründliche Arbeit leisten und man muss als Manager sicherstellen, dass die Angst vor Fehlern nicht im Vordergrund der Arbeit steht, sondern dass diese Arbeit sehr geschätzt wird und die Mitarbeitenden DIE Spezialisten zu dem Thema sind, auf die man gerne hören möchte. Einziger Nachteil hierbei ist, dass man dann das Risiko eines Fehlers nicht wegschieben kann, sondern als Manager zeigen muss, dass Fehler zum Geschäft nun mal dazugehören. Wie sagte Oliver Kahn einmal: »Eier, wir brauchen Eier!«
Wenn die Angst vor Fehlern schon von ganz oben vorgelebt wird, dann kann man in einer Organisation keine bahnbrechenden Erfindungen machen und die Innovation bleibt auf der Strecke. Niemand wird sich trauen, Neues auszuprobieren und verrückte Ideen zu verfolgen, da Impulsgeber und Ideengeber immer damit rechnen müssen, für etwaige Fehler bestraft oder zumindest verbal angegangen zu werden. Ein souveräner Umgang mit Kritik innerhalb der ganzen Organisation ist eines der Schlüsselthemen, wie man Innovation, aber auch ganz allgemein komplexe Entwicklungen unterstützen und zum Ziel bringen kann. Gehen Sie doch einfach mal zusammen ein Bier trinken und feiern Sie gemeinsam das »FuckUp«, das Ihnen und Ihrem Team passiert ist. Nehmen Sie das Gelernte mit und versuchen Sie es noch einmal, dann wird es schon klappen. Sicher ist: Die Fehler, die Sie beim ersten Anlauf gemacht haben, werden Sie nicht noch einmal machen! Wir alle wollen und können aus unseren Fehlern lernen. Und das ist gut so.
Es gibt immer wieder Aspekte und Informationen, die für eine Entscheidung relevant sind, aber vom Vorgesetzten nicht in das Team kommuniziert werden. Sei es, weil der Chef dies nicht konnte oder nicht wollte oder schlicht vergessen respektive die Notwendigkeit der Weitergabe nicht erkannt hat! Um diesbezüglich Klarheit zu erhalten, wäre eine Feedback-Kultur hilfreich, in der die Mitarbeitenden, die die Entscheidung nicht nachvollziehen können, das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen können.





























