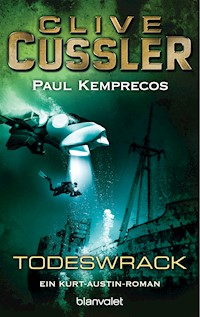
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kurt-Austin-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Die junge Meeresforscherin Nina Kirov ist in hellster Aufregung: Vor der Küste Marokkos wurde ein riesiges Steingesicht entdeckt! Bevor Nina diesen brisanten Fund jedoch auswerten kann, werden alle Teilnehmer der Expedition ermordet. Nur Nina gelingt mit Hilfe von Kurt Austin, einem Kollegen des berühmten Agenten Dirk Pitt, die Flucht. Um kurz darauf prompt in eine tödliche Verschwörung zu geraten ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 805
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
Paul Kemprecos
Das Todeswrack
Roman
Übersetzt von Thomas Haufschild
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die englische Originalausgabe erschien unter
dem Titel »Serpent« bei Pocket Books, a division
of Simon & Schuster, Inc., New York.
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe 1999 by Clive Cussler.
Copyright © der Originalausgabe 2007 by Sandecker RLLLP.
All rights reserved throughout the world.
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613 New York, NY 10176 – 0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2000 by Blanvalet
Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Alexander Groß
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-15184-3V003
www.blanvalet.de
Ich möchte Sie mit einem Freund bekannt machen …
Als ich gebeten wurde, Kurt Austin, Joe Zavala und ihre Freunde von der National Underwater and Marine Agency vorzustellen, habe ich dieser Bitte mit großem Vergnügen und voller Begeisterung entsprochen. Ich kenne Kurt und Joe nun schon seit vielen Jahren. Unser erstes Treffen fand statt, als die beiden sich auf Admiral Sandeckers Initiative hin der NUMA anschlossen, nicht lange nachdem Al Giordino und ich an Bord gekommen waren. Obwohl sich uns bislang nie die Gelegenheit geboten hat, zusammen an einem Projekt zu arbeiten, haben Kurts und Joes Eskapaden über und unter Wasser oftmals meine Fantasie beflügelt und mich wünschen lassen, ich wäre selbst dabei gewesen.
Kurt und ich haben einige Gemeinsamkeiten. Er ist ein paar Jahre jünger, und wir sehen uns wohl kaum ähnlich, aber er wohnt in einem alten umgebauten Bootshaus am Potomac und sammelt antike Duellpistolen, was, verglichen mit den alten Autos in meinem Flugzeughangar, eine weise Wahl darstellt, wenn man berücksichtigt, wie viel einfacher diese Pistolen sich instand halten und unterbringen lassen. Außerdem rudert und segelt er gern, während ich schon bei dem bloßen Gedanken daran außer Atem gerate.
Kurt ist einfallsreich und scharfsinnig, und er hat mehr Schneid als ein weißer Hai, der eine Schachtel Aufputschmittel verschluckt hat. Darüber hinaus ist Kurt ein wirklich netter und absolut integrer Kerl, zu dessen moralischen Werten die Nationalflagge, Mütter und Apfelkuchen gehören. Zu meinem Leidwesen finden die Damen ihn äußerst attraktiv, sogar noch attraktiver als mich. Der einzige, wenngleich mir völlig unbegreifliche Schluss, den ich daraus ziehen kann – und dies fällt mir zugegebenermaßen schwer –, ist die Tatsache, dass er von uns beiden anscheinend besser aussieht.
Ich bin froh, dass Kurts und Joes Heldentaten aus den Archiven der NUMA nun endlich publik gemacht werden. Zweifellos werden Sie, werte Leser, die Lektüre als einen unterhaltsamen und fesselnden Zeitvertreib empfinden. Mir zumindest ist es so ergangen.
Dirk Pitt
Prolog
25. Juli 1956
Südlich von Nantucket Island
Das bleiche Schiff kam dermaßen schnell in Sicht, als wäre es von einem Moment auf den anderen unvermutet aus der Tiefe emporgestiegen. Im Licht des nahezu vollen Mondes glitt es wie ein Geist über das silbern schimmernde Wasser und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in östlicher Richtung durch die warme Nacht. Entlang seiner knochenweißen Flanken funkelte ein Diadem aus leuchtenden Bullaugen, und der steile Bug zerteilte das glatte Meer so mühelos, als schnitte ein Stilett durch schwarzen Satin.
Hoch oben auf der dunklen Brücke des schwedisch-amerikanischen Linienschiffs Stockholm, sieben Stunden und 130 Meilen östlich von New York City, suchte der zweite Offizier Gunnar Nillson den mondbeschienenen Ozean ab. Dank der großen rechteckigen Fenster, die sich rund um das Ruderhaus zogen, konnte er in alle Richtungen bis zum Horizont blicken. Abgesehen von vereinzelter unregelmäßiger Dünung, war die Wasseroberfläche ruhig. Die Temperatur betrug etwas über zwanzig Grad Celsius und bedeutete eine wohltuende Abwechslung von der schweren, feuchten Luft, die an jenem Morgen über der Stockholm gelegen hatte, als der Liner vom Pier an der 57. Straße in See gestochen und dem Lauf des Hudson River gefolgt war. Einige letzte flaumige Wolken schoben sich in zerfetzten Schleiern vor den Porzellanmond. An Steuerbord betrug die Sichtweite ein halbes Dutzend Meilen.
Nillson richtete den Blick nach backbord, wo die schmale dunkle Horizontlinie sich in einem trüben Dunst verlor, der die Sterne verschleierte und Himmel und Wasser verschmelzen ließ.
Einen Moment lang war er von diesem dramatischen Anblick völlig überwältigt. Der Gedanke an die riesige pfadlose Leere, die noch vor ihnen lag, raubte ihm schier den Atem. Dieses Gefühl kam bei Seeleuten häufig vor, und es hätte auch noch länger angehalten, wäre da nicht das Kribbeln in seinen Fußsohlen gewesen. Die Kraft der gewaltigen Zwillingsdiesel mit ihren 14 800 Pferdestärken schien sich vom Maschinenraum durch das vibrierende Deck und in seinen Körper fortzupflanzen, der sich kaum wahrnehmbar neigte, um das leichte Rollen auszugleichen. Furcht und Erstaunen ließen nach und wichen dem Gefühl der Allmacht, das sich beinahe zwangsläufig einstellte, wenn man am Ruder eines schnellen Liners stand, der mit Höchstgeschwindigkeit über den Ozean schoss.
Die Stockholm maß 160 Meter von vorn bis achtern und 21 Meter in der Breite. Damit war sie das kleinste Linienschiff auf der Transatlantikroute. Dennoch handelte es sich bei ihr um ein ganz besonderes Schiff, schnittig wie eine Jacht und mit schwungvollen Konturen, die sich dynamisch von ihrem langen Vorderdeck bis zum Heck zogen, das so sanft gerundet war wie ein Weinglas. Ihre glänzende Außenhaut war vollständig weiß, abgesehen von einem einzelnen gelben Schornstein. Nillson genoss das Gefühl der Kontrolle. Er brauchte nur mit den Fingern zu schnippen, und die drei wachhabenden Matrosen würden herbeieilen, um seine Befehle entgegenzunehmen. Wenn er einen der Hebel an den Schiffstelegrafen umlegte, würden Glockensignale ertönen und Männer an die Arbeit hasten.
Er lachte in sich hinein, denn seine Hybris war ihm durchaus bewusst. Seine vierstündige Wache bestand im Wesentlichen aus einer Reihe von Routineaufgaben, die dafür sorgen sollten, dass das Schiff auf einer imaginären Route blieb, an deren Ende es auf einen imaginären Punkt in der Nähe des gedrungenen roten Feuerschiffs treffen würde, das vor Nantuckets tückischen Untiefen warnte. Dort würde die Stockholm auf einen nordöstlichen Kurs einschwenken, der ihre 534 Passagiere an Sable Island vorbei und geradewegs quer über den Atlantik bringen würde, an der Nordküste Schottlands entlang und schließlich in den Hafen von Göteborg.
Zwar war Nillson nur achtundzwanzig Jahre alt und hatte erst knappe drei Monate zuvor seinen Dienst auf der Stockholm angetreten, doch zur See gefahren war er schon seit frühester Jugend. Als Teenager hatte er auf mehreren Ostseefischkuttern gearbeitet, später dann als Hilfsmatrose bei einer großen Reederei. Danach folgten die schwedische Seefahrtsakademie sowie ein kurzer Abstecher zur schwedischen Kriegsmarine. Die Stockholm war ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Erfüllung seines Traums: Herr über ein eigenes Schiff zu sein.
Nillsons Aussehen entsprach nicht dem üblichen Klischee des großen blonden Skandinaviers. Er wirkte nicht wie ein Wikinger, sondern eher wie ein Venezianer, denn er hatte die italienischen Gene seiner Mutter geerbt und dazu ihr kastanienbraunes Haar, den olivfarbenen Teint, die schmächtige Statur und das sonnige Gemüt. Dunkelhaarige Schweden waren nichts Ungewöhnliches. Manchmal fragte sich Nillson, ob die mediterrane Wärme seiner großen braunen Augen auch nur das Geringste mit der eisigen Kälte seines Kapitäns zu tun hatte. Vermutlich handelte es sich eher um eine Mischung aus skandinavischer Reserviertheit und der strengen schwedischen Seefahrttradition strikter Disziplin. Wie dem auch sei, Nillson arbeitete härter, als er musste. Er wollte dem Kapitän keinen einzigen Anlass zur Kritik geben. Sogar in dieser friedlichen Nacht ohne Schiffsverkehr, bei kaum merklichem Seegang und idealem Wetter, schritt Nillson von einem Ende der Brücke zum anderen, als würde das Schiff sich inmitten eines Orkans befinden.
Die Brücke der Stockholm war in zwei Bereiche unterteilt: vorn das sechs Meter breite Ruderhaus und dahinter der gesonderte Kartenraum. Die seitlichen Türen, die hinaus auf Deck führten, standen offen und ließen die leichte Südwestbrise hinein. Auf jeder Seite der Brücke befanden sich ein RCA-Radargerät und ein Schiffstelegraf. In der Mitte des Ruderhauses stand der Steuermann auf einer hölzernen Plattform einige Zentimeter über dem gebohnerten Deck. Sein Rücken wies zu der Trennwand, seine Hände umschlossen das Steuerrad, und sein Blick ruhte auf dem Kreiselkompass zu seiner Linken. Unmittelbar vor dem Ruder, unterhalb des mittleren Fensters, befand sich eine Kursanzeige. Die drei hölzernen Würfel in dem Anzeigekasten waren mit Ziffern versehen, damit der Steuermann stets die Fahrtrichtung im Auge behielt.
Die Würfel standen auf 090.
Nillsons Schicht begann um acht Uhr dreißig abends. Er war einige Minuten früher nach oben gekommen, um einen Blick auf die Wetterberichte zu werfen. Für die Gegend um das Feuerschiff vor Nantucket wurde Nebel vorhergesagt. Das war keine Überraschung. Die warmen Gewässer der Nantucket-Untiefen stellten praktisch eine Nebelfabrik dar. Der Offizier, dessen Schicht jetzt endete, teilte ihm mit, dass die Stockholm sich ein wenig nördlich des Kurses befand, den der Kapitän gesetzt hatte. Wie weit nördlich, konnte er nicht sagen. Die Funkbaken waren zu weit entfernt, um eine exakte Positionsbestimmung vornehmen zu können.
Nillson lächelte. Auch das war keine Überraschung. Der Kapitän nahm immer den gleichen Kurs, zwanzig Meilen nördlich der nach Osten weisenden Fahrrinne, die nach internationaler Übereinkunft empfohlen wurde. Diese Empfehlung war nicht verbindlich, und so bevorzugte der Kapitän die nördlichere Route, denn er sparte auf diese Weise Zeit und Treibstoff.
Skandinavische Kapitäne leisteten normalerweise keine Wachschichten auf der Brücke, sondern überließen das Schiff einem ihrer Offiziere. Nillson nahm sogleich eine Reihe von Aufgaben in Angriff. Er durchschritt die Brücke. Überprüfte das rechte Radar. Musterte kurz die Maschinentelegrafen auf jeder Seite der Brücke, um sicherzugehen, dass beide »Volle Fahrt voraus« anzeigten. Spähte vom seitlichen Deck aufs Meer hinaus. Vergewisserte sich, dass die beiden weißen Positionslichter am Masttop brannten. Kehrte wieder ins Ruderhaus zurück. Kontrollierte den Kreiselkompass. Ermahnte den Steuermann zur Aufmerksamkeit. Durchquerte abermals die Brücke.
Gegen neun Uhr kam der Kapitän herauf, nachdem er in seiner Kabine direkt unterhalb der Brücke das Abendessen eingenommen hatte. Er war ein wortkarger Mann Ende fünfzig, aber er sah älter aus. Sein kantiges Profil wirkte an den Rändern abgenutzt, wie ein felsiges Kliff, das von der unerbittlichen See geglättet worden war. Seine Körperhaltung war noch immer kerzengerade, und die Bügelfalten seiner Uniform schienen wie mit dem Lineal gezogen. Zwischen den wettergegerbten Falten seines rötlichen Gesichts funkelten wachsame eisblaue Augen. Zehn Minuten lang schritt er hinter der Brücke auf und ab, starrte auf den Ozean und sog die warme Luft ein, wie ein Hühnerhund, der die Witterung eines Fasans aufnahm. Dann ging er ins Ruderhaus und studierte die Navigationskarte, als suche er nach einem Vorzeichen.
»Kurs auf siebenundachtzig Grad ändern«, sagte er kurz darauf.
Nillson drehte die übergroßen Würfel in dem Anzeigekasten auf 087. Der Kapitän blieb so lange, bis der Steuermann den Kurs angepasst hatte. Dann kehrte er in seine Kabine zurück.
Hinten im Kartenraum radierte Nillson die Neunzig-Grad-Linie aus, trug mit Bleistift den neuen Kurs des Kapitäns ein und schätzte die Position des Schiffs. Er verlängerte die Routenlinie gemäß der anliegenden Geschwindigkeit und der verstrichenen Zeit und zeichnete ein X ein. Der neue Kurs würde sie in ungefähr fünf Meilen Entfernung an dem Feuerschiff vorbeiführen. Nillson ging davon aus, dass starke nördliche Strömungen das Schiff bis auf zwei Meilen herandrücken würden.
Nillson ging zu dem Radar neben der rechten Tür und schaltete die Reichweite von fünfzehn auf fünfzig Meilen um. Der dünne gelbe Abtaststrahl erhellte den schmalen Arm von Cape Cod und die Inseln Nantucket und Martha’s Vineyard. Bei diesem Radius waren Schiffe zu klein, um vom Radar erfasst zu werden. Nillson stellte die ursprüngliche Reichweite ein und nahm seine Kontrollgänge wieder auf.
Ungefähr um zehn Uhr kehrte der Kapitän auf die Brücke zurück. »Ich bin in meiner Kabine und kümmere mich um den Papierkram«, verkündete er. »In zwei Stunden werde ich auf nördlichen Kurs wechseln lassen. Rufen Sie mich auf die Brücke, falls Sie das Feuerschiff vor diesem Zeitpunkt entdecken.« Er warf einen verstohlenen Blick zum Fenster hinaus, als würde er etwas spüren, das er nicht sehen konnte. »Oder falls es Nebel oder irgendwie schlechtes Wetter gibt.«
Die Stockholm befand sich nun vierzig Meilen westlich des Feuerschiffs. Das war nah genug, um das Signal von dessen Funkbake auffangen zu können. Der Peilempfänger zeigte an, dass die Stockholm um mehr als zwei Meilen in nördliche Richtung vom Kurs des Kapitäns abgewichen war. Nillson folgerte, dass eine Strömung die Stockholm nach Norden drückte.
Wenige Minuten später erbrachte eine weitere Peilung, dass das Schiff sich inzwischen beinahe drei Meilen nördlich der Route befand. Es bestand nach wie vor kein Anlass zur Beunruhigung; er musste die Lage lediglich genau im Auge behalten. Genau genommen lautete der Dauerbefehl, dass bei jeder Kursabweichung der Kapitän zu verständigen war. Nillson stellte sich die Miene des zerfurchten Seemannsgesichts vor, die kaum verhohlene Verachtung in den Augen des Kapitäns. Und deshalb haben Sie mich aus meiner Kabine hergerufen? Nillson kratzte sich nachdenklich am Kinn. Vielleicht lag es am Peilempfänger. Womöglich waren die Funkbaken für eine exakte Positionsbestimmung noch zu weit entfernt.
Nillson wusste, dass er sich strikt an die Maßgaben des Kapitäns zu halten hatte. Gleichwohl war er immerhin der befehlshabende Brückenoffizier. Er traf eine Entscheidung.
»Kurs neunundachtzig«, wies er den Steuermann an.
Das Ruder drehte sich nach rechts und lenkte das Schiff ein wenig nach Süden, näher an den ursprünglichen Kurs heran.
Die Brückenmannschaft wechselte die Posten, wie es alle achtzig Minuten üblich war. Lars Hansen kam aus der Bereitschaft und übernahm das Ruder.
Nillson verzog das Gesicht, denn dieser Wechsel gefiel ihm ganz und gar nicht. Ihm war stets unbehaglich zumute, wenn Hansen in seiner Schicht Dienst tat. In der schwedischen Seefahrt galten strikte Regeln. Offiziere sprachen nur dann mit den Matrosen, wenn sie ihnen Befehle erteilten. Plaudereien fanden schlichtweg nicht statt. Nillson setzte sich manchmal über diese Gewohnheit hinweg und äußerte einem Matrosen gegenüber unauffällig einen Scherz oder brachte eine sarkastische Bemerkung an. Niemals jedoch bei Hansen.
Dies war Hansens erste Fahrt auf der Stockholm. Man hatte ihn in letzter Minute als Ersatz an Bord genommen, weil der eigentlich angeheuerte Mann nicht erschienen war. Laut seiner Papiere hatte Hansen bereits auf einer ganzen Reihe von Schiffen gearbeitet. Dennoch kannte ihn niemand, was schwer vorstellbar schien. Hansen war hohlwangig, groß, breitschultrig, und sein blondes Haar war kurz geschoren. Bis hierhin traf die Beschreibung auch auf einige Millionen anderer Skandinavier Anfang zwanzig zu. Aber es würde schwierig sein, Hansens Gesicht zu vergessen. Eine tiefe weiße Narbe verlief von seinem vorstehenden Wangenknochen bis kurz vor den rechten Mundwinkel, so dass seine Lippen auf einer Seite zu einem grotesken Lächeln aufgeworfen schienen. Hansen hatte zumeist auf Frachtern gearbeitet, was eine Erklärung für seine Anonymität sein mochte. Nillson vermutete jedoch, dass dieser Umstand eher im Verhalten des Mannes begründet lag. Er mied Gesellschaft, redete nur, wenn man ihn ansprach, und auch dann nicht viel. Niemand fragte ihn je nach seiner Narbe.
Wie sich herausstellte, war er ein guter Matrose, der Befehle prompt und ohne zu murren ausführte, das musste Nillson zugeben. Deshalb war Nillson auch verwirrt, als er den Kompass überprüfte. Während früherer Schichten hatte sich Hansen als fähiger Steuermann erwiesen. Heute Abend aber ließ er das Schiff treiben, als wäre er mit den Gedanken nicht bei der Sache. Nillson wusste, dass es eine Zeit lang dauerte, ein Gefühl für das Ruder zu bekommen. Abgesehen von der Strömung war der Dienst am Steuerrad heute allerdings nicht besonders anspruchsvoll. Kein tosender Wind. Keine riesigen Wellen, die über das Deck hereinbrachen. Lediglich ein paar kleine Bewegungen des Ruders in die eine oder andere Richtung.
Nillson musterte den Kreiselkompass. Kein Zweifel. Das Schiff gierte ein wenig. Er trat dicht neben den Steuermann. »Halten Sie sich streng an den Kurs, Hansen«, sagte er freundlich. »Wir sind hier schließlich nicht auf einem Kriegsschiff.«
Hansens Kopf drehte sich auf dem muskulösen Hals. Die schimmernde Kompassanzeige spiegelte sich in seinen Augen und verlieh ihnen einen animalischen Glanz. Gleichzeitig betonte sie seine tiefe Narbe. Sein stierer Blick schien Hitze auszustrahlen. Nillson spürte, wie ihm stumme Aggressivität entgegenschlug, und wäre beinahe reflexartig einen Schritt zurückgewichen. Er blieb jedoch standhaft und wies auf die Kursanzeige.
Der Steuermann starrte ihn einige Sekunden ausdruckslos an und nickte dann unmerklich.
Nillson versicherte sich, dass jetzt ein gleichmäßiger Kurs anlag, murmelte zustimmend und floh dann in den Kartenraum.
Hansen jagte ihm eine Gänsehaut ein, und er nahm eine weitere Funkpeilung vor, um die Auswirkungen der Abdrift zu ermitteln. Irgendwas hier ergab keinen Sinn. Trotz der Korrektur um zwei Grad nach Süden befand sich die Stockholm drei Meilen nördlich des Kurses.
Er ging zurück ins Ruderhaus. »Zwei Grad nach rechts«, befahl er, ohne Hansen eines Blicks zu würdigen.
Hansen richtete das Steuerrad auf einundneunzig Grad aus.
Nillson stellte die Kursanzeige um und blieb neben dem Kompass, bis er sicher war, dass Hansen das Schiff auf den neuen Kurs gebracht hatte. Dann beugte er sich über das Radar. Das Glühen der Anzeige verlieh seiner dunklen Haut einen gelblichen Ton. Der Abtaststrahl erhellte einen Echoimpuls am linken Rand des Schirms, in ungefähr zwölf Meilen Entfernung. Nillson hob eine Augenbraue.
Die Stockholm hatte Gesellschaft.
Nillson wusste nicht, dass im selben Moment unsichtbare elektronische Wellen auf Rumpf und Aufbauten der Stockholm trafen und zu einer rotierenden Radarantenne reflektiert wurden, die sich hoch über dem Deck eines Schiffs befand, welches sich mit hoher Geschwindigkeit aus entgegengesetzter Richtung näherte. Auf der geräumigen Brücke des italienischen Linienpassagierschiffs Andrea Doria hatte der Offizier am Radarschirm sich wenige Minuten zuvor an einen stämmigen Mann gewandt, der eine weiße Marinemütze und eine nachtblaue Uniform trug.
»Kapitän, ich sehe ein Schiff, siebzehn Meilen entfernt, vier Grad an Steuerbord.«
Das Radar war auf eine Reichweite von zwanzig Meilen eingestellt und wurde seit drei Uhr nicht mehr aus den Augen gelassen, als Kapitän Piero Calamai auf das Oberdeck getreten war und über den westlichen Gewässern graue Dunstschwaden entdeckt hatte, die dort wie die Seelen Ertrunkener schwebten.
Sofort hatte der Kapitän befohlen, das Schiff für eine Nebelfahrt klarzumachen. Die 572 Mann starke Besatzung befand sich in ständiger Alarmbereitschaft. Das Nebelhorn gab alle hundert Sekunden ein automatisches Signal ab. Der Ausguck wurde vom Krähennest zum Bug geordert, von wo aus er eine bessere Sicht haben würde. Die Mannschaft des Maschinenraums hielt sich bereit, um im Notfall sofort reagieren zu können. Die Schotten zwischen den elf isolierten Kammern des Schiffs wurden geschlossen.
Die Andrea Doria befand sich auf dem letzten Stück einer 4000 Meilen langen, neuntägigen Reise, die in ihrem Heimathafen Genua begonnen hatte. Das Schiff trug 1134 Passagiere und 401 Tonnen Fracht an Bord. Trotz des dichten Nebels, der sich auf ihre Decks legte, fuhr die Doria beinahe mit Höchstgeschwindigkeit. Ihre riesigen Zwillingsturbinen schoben das große Schiff mit der Kraft von 35 500 Pferdestärken und einer Geschwindigkeit von zweiundzwanzig Knoten durchs Meer voran.
Die italienische Schifffahrtsgesellschaft setzte weder ihre Schiffe noch das Leben ihrer Passagiere aufs Spiel. Aber sie bezahlte ihre Kapitäne auch nicht dafür, mit Verspätung einzutreffen. Zeit war Geld. Niemand wusste dies besser als Kapitän Calamai, der die Andrea Doria auf allen Atlantiküberfahrten kommandiert hatte. Er war fest entschlossen, dass das Schiff bei der Ankunft in New York nicht eine Sekunde mehr Verspätung haben würde als jene Stunde, die es zwei Nächte zuvor in einem Sturm verloren hatte.
Als die Doria um zwanzig nach zehn das Feuerschiff passiert hatte, hatte die Besatzung es mit dem Brückenradar orten und das einsame Klagen seines Nebelhorns hören können, aber sein Lichtsignal blieb unsichtbar, obwohl die Entfernung weniger als eine Meile betrug. Nachdem das Feuerschiff hinter ihnen lag, befahl der Kapitän der Doria einen westlichen Kurs nach New York.
Der Echoimpuls fuhr in östliche Richtung, direkt auf die Doria zu. Calamai beugte sich stirnrunzelnd über den Radarschirm und beobachtete den Kurs des anderen Schiffs. Das Gerät konnte dem Kapitän nicht verraten, um welche Art von Schiff es sich handelte oder wie groß es war. Er wusste nicht, dass er einen schnellen Ozeandampfer vor sich hatte. Mit der vereinten Geschwindigkeit von vierzig Knoten kamen die beiden Schiffe sich alle drei Minuten um zwei Meilen näher.
Die Position des Schiffs war verwirrend. Schiffe mit östlichem Kurs sollten eigentlich einer Route folgen, die zwanzig Meilen südlich lag. Vielleicht ein Fischerboot.
Nach den allgemeinen Gepflogenheiten auf See fahren sich begegnende Schiffe mit den Backbordseiten aneinander vorbei, linke Seite an linker Seite, wie Autos, die sich auf der Straße treffen. Falls hierzu gefährliche Kreuzmanöver erforderlich sind, kann man sich auch Steuerbord an Steuerbord begegnen.
Nach der Radaranzeige zu urteilen würde das andere Schiff problemlos zur Rechten der Doria passieren, sofern beide Beteiligten ihren jetzigen Kurs beibehielten. Wie die Autos auf einer Straße in England, wo Linksverkehr herrscht.
Calamai wies seine Mannschaft an, das andere Schiff ständig im Auge zu behalten. Es konnte nie schaden, vorsichtig zu sein.
Die beiden Schiffe waren noch ungefähr zehn Meilen voneinander entfernt, als Nillson das Licht unter dem Kartentisch neben dem Radargerät einschaltete und sich anschickte, die veränderliche Position des Echoimpulses auf Papier zu übertragen.
»Welcher Kurs liegt an, Hansen?«, rief er.
»Neunzig Grad«, erwiderte der Steuermann ruhig.
Nillson zeichnete einige Kreuze auf der Karte ein und verband sie mit Linien, überprüfte abermals den Radarimpuls und wies dann den Reserveausguck an, Position auf der Backbordseite der Brücke zu beziehen. Seine Berechnung hatte ergeben, dass das andere Schiff sich mit hoher Geschwindigkeit auf einem parallelen Kurs näherte, der ein Stückchen links von ihnen verlief. Er trat hinaus auf Deck und suchte die Nacht mit einem Fernglas ab. Von einem anderen Schiff war nichts zu sehen. Er wechselte fortwährend zwischen der linken und rechten Seite der Brücke hin und her und hielt jedes Mal kurz beim Radar an. Dann fragte er erneut nach dem Kurs.
»Nach wie vor neunzig Grad, Sir«, sagte Hansen.
Nillson überprüfte den Kreiselkompass. Selbst die kleinste Abweichung konnte sich als kritisch erweisen, und er wollte sichergehen, dass der Kurs korrekt war. Hansen griff nach oben und zog an der Leine über seinem Kopf. Die Schiffsglocke ertönte sechsmal. Elf Uhr. Nillson liebte es, das Zeitsignal des Schiffs zu hören. Während einer Nachtschicht, wenn Einsamkeit und Langeweile zusammenkamen, rief das Läuten der Schiffsglocke genau jene romantischen Gefühle in ihm wach, die er als kleiner Junge für das Meer empfunden hatte. Später würde er sich an dieses Geräusch als an den Vorboten des Verhängnisses erinnern.
Nillson wurde von seinem ursprünglichen Vorhaben abgelenkt, warf einen Blick auf den Radarschirm und nahm einen weiteren Eintrag am Kartentisch vor.
Elf Uhr. Zwischen den beiden Schiffen lagen noch sieben Meilen.
Nillson berechnete, dass die Schiffe mit mehr als genug Abstand Backbord an Backbord aneinander vorbeifahren würden. Er ging wieder nach draußen und suchte mit dem Fernglas die linke Seite ab. Es war zum Verrücktwerden. Wo laut des Radars ein Schiff sein musste, herrschte völlige Dunkelheit. Vielleicht waren die Positionslichter defekt. Oder es handelte sich um ein Kriegsschiff im Manöver.
Er schaute nach rechts. Der Mond schien hell aufs Wasser. Zurück nach links. Immer noch nichts. Befand sich das Schiff womöglich in einer Nebelbank? Unwahrscheinlich. Kein Schiff würde in dichtem Nebel so schnell fahren. Er erwog, die Geschwindigkeit der Stockholm zu verringern. Nein. Der Kapitän würde das Klingeln des Schiffstelegrafen hören und herbeigerannt kommen. Er würde diesen eiskalten Mistkerl erst rufen, nachdem die Schiffe einander sicher passiert hatten.
Um 23.03 Uhr zeigte das Radar auf beiden Schiffen einen Abstand von vier Meilen.
Noch immer keine Lichter.
Abermals zog Nillson in Betracht, den Kapitän zu rufen, und verwarf den Gedanken wieder. Auch erteilte er keinen Befehl, mit dem Nebelhorn Warnsignale zu geben, wie das internationale Seerecht es vorsah. Reine Zeitverschwendung. Sie befanden sich auf offener See, der Mond stand am Himmel, und man konnte bestimmt fünf Meilen weit sehen.
Die Stockholm eilte weiterhin mit achtzehn Knoten durch die Nacht.
»Lichter an Backbord!«, rief der Mann im Krähennest.
Endlich.
Später würden die Fachleute verwirrt die Köpfe schütteln und sich fragen, wie es geschehen konnte, dass zwei mit Radar ausgestattete Schiffe auf offener See wie Magneten voneinander angezogen wurden.
Nillson trat aus der linken Tür der Brücke heraus auf Deck und las die Lichtsignale des anderen Schiffs. In der Dunkelheit leuchteten zwei weiße Punkte, der eine oben, der andere unten. Gut. Die Anordnung der Lichter ließ erkennen, dass das Schiff sie auf der linken Seite passieren würde. Das rote Backbordlicht kam in Sicht und bestätigte, dass das Schiff sich von der Stockholm weg bewegte. Die Schiffe würden Backbord an Backbord aneinander vorbeifahren. Laut Radar betrug der Abstand mehr als zwei Meilen. Er warf einen Blick auf die Uhr. Es war 23.06 Uhr.
Soweit der Kapitän der Andrea Doria auf dem Radarschirm erkennen konnte, würden die beiden Schiffe problemlos rechts aneinander vorbeifahren können. Als der Abstand weniger als dreieinhalb Meilen betrug, befahl Calamai eine Wende um vier Grad nach links, um die Lücke zwischen ihnen zu vergrößern. Kurz darauf erschien ein gespenstisches Glühen im Nebel, und nach und nach wurden weiße Positionslichter sichtbar. Kapitän Calamai rechnete damit, das grüne Licht auf der Steuerbordseite des anderen Schiffs zu Gesicht zu bekommen. Es musste jeden Moment so weit sein. Eine Meile Abstand.
Nillson fiel ein, dass jemand mal gesagt hatte, die Stockholm könne auf einem Strandtuch wenden und trotzdem noch genug Platz für Badegäste lassen. Es war an der Zeit, sich diese Gewandtheit zunutze zu machen.
»Zwei Strich steuerbord«, befahl er. Genau wie Calamai wollte er mehr Manövrierraum.
Hansen drehte das Ruder zwei volle Umdrehungen nach rechts. Der Bug des Schiffs schwenkte zwanzig Grad nach steuerbord.
»Mittschiffs ausrichten und Kurs halten.«
Das Wandtelefon klingelte. Nillson ging hinüber und nahm den Hörer ab.
»Brücke«, sagte Nillson. Er war überzeugt, dass die Vorbeifahrt problemlos verlaufen würde, und stand jetzt mit dem Gesicht zur Wand und den Fenstern im Rücken.
Am Apparat war der Ausguck im Krähennest. »Lichter zwanzig Grad backbord.«
»Danke«, sagte Nillson und legte auf. Er ging zum Radar und überprüfte die Anzeige. Den neuen Kurs der Doria bemerkte er nicht. Die Echoimpulse befanden sich jetzt so dicht nebeneinander, dass die Anzeige für ihn keinerlei Sinn mehr ergab. Er ging zur Backbordseite, hob in aller Seelenruhe das Fernglas an die Augen und richtete es auf die Lichter.
Er zuckte zusammen.
»Mein Gott.« Ihm stockte der Atem. Zum ersten Mal bemerkte er, dass die Topplichter sich geändert hatten.
Die oberen und unteren Lichter hatten sich umgekehrt. Das Schiff wandte ihm nicht länger die rote Backbordseite zu. Das Licht war grün. Die Steuerbordseite. Seitdem er das letzte Mal nachgesehen hatte, schien das andere Schiff eine scharfe Linkskehre vollzogen zu haben.
Jetzt schoben sich drohend die strahlenden Decklichter eines riesigen schwarzen Schiffs aus der dichten Nebelbank, die alle Blicke abgeschirmt hatte. Die rechte Seite lag direkt in der Bahn der rasend schnellen Stockholm.
Nillson brüllte die Kursänderung heraus. »Hart steuerbord!«
Er fuhr herum, packte die Hebel des Schiffstelegrafen mit beiden Händen, riss sie auf »Stopp« und dann bis ganz nach unten, als könnte er das Schiff allein durch einen flehentlichen Wunsch zum Stehen bringen. Ein ohrenbetäubendes Klingeln erfüllte die Luft.
Volle Fahrt zurück.
Nillson wandte sich zum Ruder um. Hansen stand dort wie ein steinerner Götze vor einem heidnischen Tempel.
»Verflucht, ich habe gesagt hart steuerbord!«, schrie Nillson mit heiserer Stimme.
Hansen begann das Ruder zu drehen. Nillson traute seinen Augen nicht. Hansen riss das Ruder nicht etwa nach steuerbord herum, was ihnen die – wenngleich nur kleine – Chance eröffnet hätte, eine Kollision zu vermeiden. Er drehte das Steuerrad langsam und bedächtig nach links.
Der Bug der Stockholm schwang in einer tödlichen Kehre herum.
Nillson hörte ein Nebelhorn. Es musste zu dem anderen Schiff gehören.
Im Maschinenraum herrschte Chaos. Die Mannschaft kurbelte wie wild an dem Rad, mit dem sich der Steuerbordmotor anhalten ließ. Sie versuchte verzweifelt, die Ventile zu öffnen, die den Schub umkehren und den Backbordmotor stoppen würden. Das Schiff erzitterte, als der Bremsvorgang einsetzte. Zu spät. Die Stockholm flog wie ein Pfeil auf das wehrlose Schiff zu.
Auf der Backbordseite der Brücke klammerte sich Nillson weiterhin verbissen am Schiffstelegrafen fest.
So wie Nillson hatte auch Kapitän Calamai die Topplichter auftauchen sehen. Dann hatten sie sich umgekehrt, so dass nun das rote Backbordlicht wie ein Rubin auf schwarzem Samt glühte. Er erkannte, dass das andere Schiff eine scharfe Rechtskurve vollführt hatte, die es genau in die Bahn der Doria brachte.
Keine Warnung. Kein Nebelhorn, keine Signalpfeife.
Bei dieser Geschwindigkeit war an ein Anhalten nicht zu denken. Das Schiff würde mehrere Meilen benötigen, um zum Stillstand zu kommen.
Calamai musste innerhalb von Sekunden reagieren. Er konnte eine Rechtskurve befehlen, direkt auf die Gefahr zu, in der Hoffnung, dass die Schiffe sich nur streifen würden. Vielleicht konnte die schnelle Doria das angreifende Schiff abhängen.
Calamai traf eine verhängnisvolle Entscheidung.
»Hart links«, rief er.
Ein Brückenoffizier fragte nach. Wollte der Kapitän, dass die Maschinen abgestellt wurden? Calamai schüttelte den Kopf. »Volle Fahrt beibehalten.« Er wusste, dass die Doria bei höherer Geschwindigkeit besser reagierte.
Der Steuermann riss mit beiden Händen das Ruder nach backbord herum, so dass die Speichen des Rades wirbelten. Die Pfeife gellte zweimal auf, um die Linkskehre anzuzeigen. Das große Schiff stemmte sich eine halbe Meile lang gegen seinen Vorwärtsimpuls, bis es sich gemächlich in die Kurve legte.
Der Kapitän wusste, dass er ein großes Risiko einging, indem er die Breitseite der Doria schutzlos preisgab. Er hoffte inständig, dass das andere Schiff gerade noch rechtzeitig abdrehen würde. Er konnte noch immer nicht glauben, dass die beiden Schiffe sich auf einem Kollisionskurs befanden. Das alles wirkte wie ein Traum.
Der Zuruf eines seiner Offiziere holte ihn unsanft in die Realität zurück. »Es hält direkt auf uns zu!«
Der Kurs des herannahenden Schiffs zeigte auf die Steuerbordseite der Brücke, wo Calamai ihm fassungslos entgegenstarrte. Der spitze, nach oben gerichtete Bug schien genau auf ihn zu zielen.
Der Skipper der Doria war bekannt für seine Härte und Abgeklärtheit. Aber in jenem Moment machte er, was jeder vernünftige Mensch an seiner Stelle getan hätte. Er rannte um sein Leben.
Der verstärkte Bug des schwedischen Schiffs durchstieß die Metallhaut der schnellen Andrea Doria so mühelos wie ein Bajonett und drang fast zehn Meter in den siebenundzwanzig Meter breiten Rumpf des Linienschiffs ein, bevor er zum Stillstand kam.
Der italienische Liner wog 29 100 Tonnen und damit mehr als doppelt so viel wie die Stockholm. Er zog das Schiff mit sich und drehte sich dabei um den Aufschlagpunkt unterhalb und achtern der Steuerbordseite der Brücke. Als die angeschlagene Doria weiterstampfte, riss der zerdrückte Bug der Stockholm sich los und schlitzte sieben der zehn Passagierdecks des Liners auf, als würde der Schnabel eines Raubvogels Stücke aus dem Leib seiner Beute reißen. Mit einem hellen Funkenregen schrammte der Bug an dem langen schwarzen Rumpf entlang.
Das klaffende, keilförmige Loch, das in der Flanke der Doria gähnte, war am oberen Rand zwölf Meter breit und verengte sich unterhalb des Wasserspiegels bis auf zwei Meter.
Tausende Liter Seewasser strömten in die riesige Wunde und füllten die leeren Außenbordtreibstofftanks, die bei der Kollision aufgerissen worden waren. Unter dem Gewicht von fünfhundert Tonnen Meerwasser, die den Kesselraum fluteten, krängte das Schiff nach rechts. Durch einen Gang und mehrere Luken ergoss sich ein öliger Strom und stieg durch die Bodenroste des Maschinenraums empor. Die verzweifelten Matrosen rutschten auf den ölverschmierten Decks aus, als wären sie Zirkusclowns, die eine Nummer einstudierten.
Immer mehr Wasser schoss herein, umspülte die unversehrten leeren Treibstofftanks auf der Backbordseite und hob sie empor, als wären es Seifenblasen.
Innerhalb weniger Minuten nach dem Zusammenprall hatte die Doria schwere Schlagseite.
Nillson hatte eigentlich erwartet, dass der Aufprall ihn zu Boden schleudern würde. Der Stoß war überraschend sanft, allerdings heftig genug, um ihn aus seiner Erstarrung zu reißen. Er rannte vom Ruderhaus in den Kartenraum und schlug auf den Alarmknopf, der die wasserdichten Schotten der Stockholm schließen würde.
Der Kapitän kam auf die Brücke gerannt. »Um Gottes willen, was ist passiert?«, brüllte er.
Nillson wollte antworten, doch die Worte blieben ihm im Halse stecken. Er wusste nicht, wie er die Lage beschreiben sollte. Hansen, der seinen Befehl ignorierte, nach steuerbord zu lenken. Das verschwommene Drehen des Ruders nach backbord. Hansen, der sich nach vorn auf das Steuerrad stützte, die Hände fest um die Speichen geklammert, als würde die Zeit stillstehen. Keine Angst, kein Entsetzen in seinen Augen. Nur eine eisige blaue Kälte. Nillson hielt es im ersten Moment für eine Lichtspiegelung, für die Lampe am Gehäuse des Kreiselkompasses, deren Schein auf die hässliche Narbe fiel. Aber es gab kein Vertun. Während die Schiffe in die sichere Katastrophe rasten, lächelte dieser Mann.
Nillson hatte nicht den geringsten Zweifel. Hansen hatte das andere Schiff absichtlich gerammt und dabei die Stockholm zur Waffe gemacht, als würde er einen Torpedo abschießen. Es bestand allerdings auch kein Zweifel daran, dass niemand, weder der Kapitän noch sonst jemand auf dem Schiff, jemals glauben würde, dass so etwas überhaupt möglich war.
Nillsons gequälter Blick löste sich vom wütenden Gesicht des Kapitäns und richtete sich auf das Ruder, als würde dort die Antwort liegen. Das verlassene Steuerrad drehte sich haltlos hin und her.
In all dem Durcheinander war Hansen plötzlich verschwunden.
Jake Carey wurde durch einen unheilvollen metallischen Donnerschlag aus dem Schlaf gerissen. Der hohle Knall hielt nur für den Bruchteil einer Sekunde an und wurde zunächst von einem gequälten Kreischen abgelöst, als Stahl auf Stahl traf. Dann kam ein furchterregendes Splittern und Knirschen, als würde die Oberdeckkabine implodieren. Carey riss die Augen auf und starrte angsterfüllt auf etwas, das wie eine bewegliche grauweiße Wand aussah und sich nur ein kurzes Stück vor ihm befand.
Carey war erst vor wenigen Minuten eingeschlafen. Er hatte seiner Frau Myra einen Gutenachtkuss gegeben und war unter die kühlen Laken seines Einzelbetts in ihrer Erste-Klasse-Kabine geschlüpft. Myra hatte noch ein paar Seiten in ihrem Roman gelesen, bis ihre Lider immer schwerer wurden. Sie schaltete das Licht aus, zog sich die Decke bis zum Kinn empor und seufzte wohlig. Die angenehmen Erinnerungen an die sonnenverbrannten Weinberge der Toskana waren noch ganz frisch.
Früher am Abend hatten sie und Jake im Speisesaal der ersten Klasse mit Champagner auf den Erfolg ihres Italienaufenthalts angestoßen. Carey hatte einen Schlummertrunk in der Belvedere Lounge vorgeschlagen, aber Myra hatte erwidert, dass sie auf ewig den Spaghetti abschwören würde, wenn sie auch nur noch einmal hören musste, wie die Band »Arrivederci Roma« spielte. Kurz vor halb elf zogen sie sich zurück.
Nachdem sie Hand in Hand an den Geschäften auf dem Foyerdeck vorbeigeschlendert waren, nahmen sie den Aufzug eine Etage nach oben und gingen nach vorn zu ihrer großen Oberdeckkabine auf der Steuerbordseite. Sie stellten ihr Gepäck hinaus auf den Flur, wo die Stewards es rechtzeitig vor ihrer morgigen Ankunft in New York abholen würden. Das Schiff schlingerte ganz leicht, denn es war immer topplastiger geworden, je mehr Treibstoff aus den großen Tanks im Rumpf aufgebraucht wurde. Es fühlte sich an, als würde man in einer riesigen Wiege geschaukelt werden, und so schlief auch Myra Carey schnell ein.
Jetzt erhielt das Bett ihres Mannes einen heftigen Stoß. Er wurde in die Luft geschleudert, als hätte man ihn mit einem Katapult abgeschossen. Dann stürzte er eine halbe Ewigkeit im freien Fall nach unten, bevor er klatschend aufschlug. Es wurde dunkel um ihn.
Auf den Decks der Andrea Doria ging der Tod um.
Er streifte von den feudalen Kabinen auf den oberen Ebenen zu den Quartieren der Touristenklasse unterhalb der Wasserlinie. Zweiundfünfzig Leute wurden unmittelbar durch den Zusammenstoß getötet oder tödlich verwundet. Auf dem Erste-Klasse-Deck, wo das Loch am breitesten war, wurden zehn Kabinen zerstört. Am unteren Ende war das Loch am schmalsten, aber die Kabinen unter der Wasserlinie waren kleiner und dichter belegt, so dass die Folgen sogar noch verheerender ausfielen.
Leben oder Tod der Passagiere hing von den Launen des Schicksals ab. Ein Gast in der ersten Klasse, der sich gerade die Zähne geputzt hatte, lief zurück in sein Schlafzimmer, dessen Wand auf einmal fehlte. Seine Frau war verschwunden. Auf dem luxuriösen Foyerdeck wurden zwei Leute augenblicklich getötet. Sechsundzwanzig italienische Immigranten in den kleineren, billigeren Kabinen auf dem untersten Deck, darunter eine Frau und ihre vier kleinen Kinder, befanden sich direkt im Zentrum der Kollision und starben in einem Gewirr aus zermalmtem Stahl. Aber es gab auch Wunder. Ein kleines Mädchen wurde aus einer Erste-Klasse-Kabine gehoben und wachte im zerdrückten Bug der Stockholm auf. In einer anderen Kabine stürzte die Decke auf ein Paar herab, aber es gelang ihnen, hinaus auf den Gang zu kriechen.
Die Leute auf den beiden untersten Decks hatten es am schwersten und mussten sich ihren Weg nach oben durch die schrägen, von Rauch erfüllten Korridore bahnen, während ihnen öliges schwarzes Wasser entgegenströmte. Nach und nach erreichten die Menschen die Sammelpunkte und warteten auf Anweisungen.
Kapitän Calamai befand sich nach dem Zusammenprall auf der entlegenen Seite der unbeschädigten Brücke. Er erholte sich von seinem anfänglichen Schock und zog den Hebel des Schiffstelegrafen auf »Stopp«. Schließlich kam das Schiff im dichten Nebel zum Stillstand.
Der zweite Offizier eilte zum Inklinationskompass, jenem Gerät, mit dem die Neigung des Schiffs gemessen wurde.
»Achtzehn Grad«, sagte er. Wenige Minuten später meldete er sich erneut: »Neunzehn Grad.«
Dem Kapitän rann ein kalter Schauder über den Rücken. Die Schlagseite durfte eigentlich nicht mehr als fünfzehn Grad betragen, auch wenn zwei Kammern geflutet waren. Eine seitliche Neigung von mehr als zwanzig Grad würde zu viel für die Trennwände sein.
Sein Verstand sagte ihm, dass die Lage hoffnungslos war. Die Konstrukteure sicherten zu, dass das Schiff im Gleichgewicht bleiben würde, sofern nicht mehr als zwei beliebige Kammern geflutet waren. Der Kapitän forderte Schadensberichte von jedem Deck an, vor allem hinsichtlich des Zustands der wasserdichten Schotten, und befahl, einen SOS-Ruf mit der Positionsangabe des Schiffs auszusenden.
Die Offiziere kamen mit den Schadensberichten zur Brücke zurück. Die Mannschaft des Maschinenraums versuchte, die Steuerbordkammern auszupumpen, aber das Wasser strömte zu schnell nach. Der Kesselraum war geflutet, und zwei weitere Kammern meldeten einen Wassereinbruch.
Das Problem war das A-Deck, das eigentlich als stählerner Deckel über den Querschotten dienen sollte, mittels derer das Schiff in einzelne Kammern unterteilt wurde. Über die Passagiertreppen floss Wasser in die anderen Kammern.
Der Offizier gab die neueste Anzeige bekannt. »Zweiundzwanzig Grad.«
Kapitän Calamai brauchte keinen Blick auf den Inklinationskompass zu werfen, um zu wissen, dass die Schlagseite zu heftig war, um wieder ausgeglichen werden zu können. Der schräge, mit Karten übersäte Boden zu seinen Füßen war Beweis genug.
Das Schiff starb.
Er war wie betäubt vor Kummer. Bei der Andrea Doria handelte es sich nicht einfach um irgendein Schiff. Die neunundzwanzig Millionen Dollar teure Königin der italienischen Schifffahrtsgesellschaft war das prächtigste und luxuriöseste Passagierschiff auf See. Sie war kaum vier Jahre alt, und ihr Stapellauf hatte der Welt beweisen sollen, dass die italienische Handelsmarine nach dem Krieg wieder im Geschäft war. Mit dem anmutigen schwarzen Rumpf, den weißen Aufbauten und dem schnittigen grünweißroten Schornstein wirkte der Liner eher wie die Arbeit eines Bildhauers als die eines Schiffbauingenieurs.
Außerdem war dies sein Schiff. Er hatte die Doria auf ihren Probefahrten und bei hundert Atlantiküberquerungen befehligt. Er kannte ihre Decks besser als die Zimmer seines eigenen Hauses. Er wurde dessen nie überdrüssig, wie der Besucher eines Museums von einem Ende zum anderen zu schlendern, die Arbeit von einunddreißig der besten Künstler und Handwerker Italiens in sich aufzunehmen, sich an der Renaissancepracht der Spiegel zu erfreuen, der Vergoldungen, des Kristalls, der edlen Hölzer, erlesenen Gobelins und Mosaiken. Umgeben von den riesigen Wandgemälden, die an Michelangelo und andere italienische Meister gemahnten, würde er im Foyer der ersten Klasse vor der massiven Bronzestatue Andrea Dorias verharren, dessen Größe nur von der des Kolumbus übertroffen wurde. Der alte genuesische Admiral stand hier allzeit bereit, beim ersten Anzeichen eines feindlichen Piratenschiffs das Schwert zu ziehen.
All das würde verloren gehen.
Die Passagiere standen für den Kapitän an erster Stelle. Er wollte gerade den Befehl zum Verlassen des Schiffs erteilen, als ein Offizier ihm den Zustand der Rettungsboote meldete. Die Boote auf der Backbordseite konnten nicht zu Wasser gelassen werden. Somit blieben acht Boote auf der Steuerbordseite. Sie hingen weit draußen über dem Meer. Selbst wenn man sie hinablassen konnte, boten sie nur der Hälfte der Passagiere Platz. Er wagte es nicht, den Befehl zu geben. In Panik würden die Passagiere auf die Backbordseite eilen, und es würde ein völliges Chaos ausbrechen.
Er hoffte inständig, dass in der Nähe befindliche Schiffe ihr SOS aufgefangen hatten und sie im Nebel ausfindig machen konnten.
Es blieb ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten.
Angelo Donatelli hatte soeben einer Tischrunde fröhlicher New Yorker, die ihre letzte Nacht an Bord der Doria feierten, ein Tablett Martinis serviert, als er einen Blick aus einem der mit Stoff behängten Fenster warf, die in drei Wände der eleganten Belvedere-Lounge eingelassen waren. Ihm war so, als habe er irgendeine merkwürdige Bewegung gesehen.
Die Lounge befand sich vorn auf dem Bootsdeck mit der offenen Promenade, und normalerweise hatten die Passagiere der ersten Klasse tagsüber und in klaren Nächten einen herrlichen Ausblick auf das Meer. Heute jedoch hatten die meisten Gäste es inzwischen aufgegeben, hinaus in die weiche graue Wand zu starren, die die Lounge umgab. Es war reiner Zufall, dass Angelo aufschaute und die Lichter und Relings eines großen weißen Schiffs sah, das durch den Nebel glitt.
»Dio mio«, murmelte er.
Er hatte die Worte kaum ausgesprochen, da gab es auch schon einen Knall, der sich wie ein riesiger Feuerwerkskörper anhörte. Die Lounge wurde in Dunkelheit gehüllt.
Ein heftiger Ruck ging durch das Deck. Angelo kam ins Stolpern, bemühte sich vergeblich, das Gleichgewicht zu halten, und sah mit dem runden Tablett in seiner Hand dabei aus wie eine leidliche Imitation der berühmten griechischen Statue eines Diskuswerfers. Der stattliche Sizilianer aus Palermo war ein geborener Athlet, dessen Gewandtheit infolge der täglichen Slalomläufe zwischen den Tischen und des fortwährenden Balancierens der Drinks aufs Höchste geschärft war.
Als er sich wieder aufrappelte, ging die Notbeleuchtung an. Die drei Paare an seinem Tisch waren von ihren Stühlen zu Boden geschleudert worden. Er half zunächst den Frauen auf. Niemand schien ernstlich verletzt zu sein. Er sah sich um.
Die wunderschöne Lounge mit ihren gedämpft beleuchteten Wandteppichen, den Gemälden, Holzschnitzereien und der glänzenden hellen Täfelung hatte sich in ein einziges Durcheinander verwandelt. Die schimmernde Tanzfläche, auf der sich noch Sekunden zuvor Paare zu den Klängen von »Arrivederci Roma« gewiegt hatten, war ein Knäuel sich windender Körper. Die Musik hatte abrupt ausgesetzt, und stattdessen wurden Schmerzens- und Angstschreie laut. Die Bandmitglieder krochen unter ihren Instrumenten hervor. Überall lagen zerbrochene Flaschen und Gläser, und es stank nach Alkohol. Die Blumenvasen hatten ihren Inhalt über den Boden verschüttet.
»Um Gottes willen, was war das denn?«, fragte einer der Männer.
Angelo sagte nichts. Selbst jetzt war er sich immer noch nicht sicher, was er eigentlich gesehen hatte. Er schaute abermals aus dem Fenster und sah bloß den Nebel.
»Vielleicht haben wir einen Eisberg gerammt«, bot die Frau des Mannes zaghaft eine mögliche Erklärung an.
»Ein Eisberg? Meine Güte, Connie, wir sind hier vor der Küste von Massachusetts. Im Juli.«
Die Frau schmollte. »Tja, dann war es vielleicht eine Mine.«
Er schaute zur Band hinüber und grinste. »Was auch immer es war, es hat sie dazu gebracht, mit diesem gottverdammten Lied aufzuhören.«
Alle lachten über den Witz. Die Tänzer klopften sich den Staub von der Kleidung, und die Musiker überprüften, ob ihre Instrumente Schaden genommen hatten. Barmixer und Kellner liefen aufgeregt umher.
»Kein Grund zur Sorge«, sagte ein anderer Mann. »Einer der Offiziere hat mir erzählt, dieses Schiff sei so konstruiert worden, dass es nicht sinken kann.«
Seine Frau kontrollierte gerade ihr Make-up im Spiegel ihrer Puderdose. Plötzlich hielt sie inne. »Das hat man von der Titanic auch behauptet«, sagte sie beunruhigt.
Drückendes Schweigen. Dann wechselseitig ein paar schnelle ängstliche Blicke. Als hätten sie ein lautloses Signal vernommen, liefen die drei Paare hastig auf den nächsten Ausgang zu, wie Vögel, die von einer Wäscheleine aufstoben.
Im ersten Moment wollte Angelo die Gläser wegräumen und den Tisch abwischen. Er lachte leise auf. »Du bist schon zu lange Kellner«, murmelte er.
Die meisten Leute im Raum waren inzwischen wieder auf die Beine gekommen und bewegten sich auf die Ausgänge zu. Die Lounge leerte sich schnell. Falls Angelo sich ihnen nicht anschloss, würde er allein zurückbleiben. Er zuckte mit den Achseln, warf sein Geschirrtuch zu Boden und ging dann zur nächsten Tür, um herauszufinden, was eigentlich passiert war.
Schwarze Wogen drohten Jake Carey ein für alle Mal unter sich zu begraben. Er kämpfte gegen die dunkle Strömung, die an seinem Körper zerrte, packte den letzten schlüpfrigen Zipfel seines Bewusstseins und klammerte sich erbittert daran fest. Er hörte ein Stöhnen und erkannte, dass es von seinen eigenen Lippen stammte. Er stöhnte erneut, diesmal absichtlich. Gut. Tote stöhnten nicht. Der nächste Gedanke galt seiner Frau.
»Myra!«, rief er.
Er hörte eine schwache Bewegung in der grauen Dunkelheit. Hoffnung brandete in ihm auf. Er rief erneut den Namen seiner Frau.
»Hier drüben.« Myras Stimme klang gedämpft, als käme sie aus einiger Entfernung.
»Gott sei Dank! Bist du in Ordnung?«
Eine Pause. »Ja. Was ist passiert? Ich habe geschlafen …«
»Keine Ahnung. Kannst du dich bewegen?«
»Nein.«
»Ich komme und helfe dir«, sagte Carey Er lag auf der linken Seite, den Arm unter seinem Körper begraben. Auf seine rechte Seite drückte eine schwere Last. Er konnte die Beine nicht bewegen. Ein eisiger Schreck durchfuhr ihn. Womöglich war sein Rückgrat gebrochen. Er versuchte es abermals. Angestrengter. Der heftige Schmerz, der von seinem Knöchel zur Hüfte hinaufschoss, trieb ihm Tränen in die Augen, aber er wusste jetzt, dass er nicht gelähmt war. Er stellte seine Bemühungen ein. Zuerst musste er in Ruhe nachdenken. Carey war Ingenieur und hatte ein Vermögen beim Brückenbau verdient. Dieses Problem war genau wie jedes andere und konnte durch die Anwendung von Logik und Ausdauer gelöst werden. Und obendrein würde er eine Menge Glück brauchen.
Er bewegte seinen rechten Ellbogen und stieß gegen etwas Weiches. Er lag unter der Matratze. Er verstärkte den Druck und drehte dabei seinen Körper, um die Hebelwirkung zu verstärken. Die Matratze gab ein Stück nach und rührte sich dann nicht mehr. Verdammt, unter Umständen lag die ganze verfluchte Decke auf ihm. Carey atmete tief ein, und dann drückte er erneut, unter Aufbietung jedes Quäntchens Kraft in seinem muskulösen Arm. Die Matratze rutschte nach unten auf den Boden.
Er hatte jetzt beide Arme frei, streckte sie nach unten und ertastete etwas Festes, das auf seinem Knöchel lag. Er befühlte die Oberfläche des Gegenstands und kam zu dem Schluss, dass es sich um die Kommode handeln musste, die zwischen den beiden Betten gestanden hatte. Die Matratze hatte ihn vermutlich vor den Bruchstücken der Wand und der Decke abgeschirmt. Mit beiden Händen hob er die Kommode um wenige Zentimeter an und zog nacheinander beide Beine darunter hervor. Vorsichtig massierte er sich die Knöchel, um die Blutzufuhr wieder in Gang zu bringen. Er hatte Schmerzen und blaue Flecken, aber es schien nichts gebrochen zu sein. Langsam erhob er sich auf Hände und Knie.
»Jake.« Das war wieder Myras Stimme. Schwächer.
»Ich komme, mein Schatz. Halt aus.«
Irgendetwas stimmte hier nicht. Myras Stimme schien von der anderen Seite der Kabinenwand zu kommen. Er knipste einen Lichtschalter an. Es blieb dunkel. Desorientiert kroch er durch die Trümmer. Seine tastenden Finger trafen auf eine Tür. Ein Geräusch drang an seine Ohren. Es klang wie die Brandung an einem Strand, mit schreienden Möwen im Hintergrund. Schwankend kam er auf die Beine, schob das Gerümpel vor der Tür beiseite und öffnete sie. Es war wie in einem bösen Traum.
Der Korridor war voller drängelnder und schubsender Passagiere, die von der Notbeleuchtung in ein bernsteinfarbenes Dämmerlicht getaucht wurden. Männer, Frauen und Kinder, manche vollständig bekleidet, manche unter den Mänteln in ihrer Nachtwäsche, manche mit leeren Händen, andere mit schweren Taschen – sie alle bahnten sich schiebend und stoßend, teils auf den Beinen, teils auf Händen und Knien, einen Weg zum Oberdeck. Staubwolken und dichter Rauch hingen in der Luft, und der ganze Gang war stark geneigt, als würden die Leute sich in einem dieser skurrilen Häuser auf einem Jahrmarkt befinden. Einige Passagiere versuchten, zu ihren Kabinen zu gelangen, und mühten sich gegen den Menschenstrom ab, wie Lachse, die flussaufwärts schwammen.
Carey schaute zu der Tür zurück, durch die er soeben getreten war, und erkannte an der Nummer, dass es sich um die Kabine neben seiner eigenen handelte. Er musste von einem Raum in den nächsten geschleudert worden sein. An jenem Abend hatten er und Myra sich im Salon mit den Bewohnern dieser Kabine unterhalten, einem älteren italienisch-amerikanischen Ehepaar, das sich auf dem Heimweg von einem Familientreffen befand. Er hoffte inständig, dass die beiden nicht wie üblich früh zu Bett gegangen waren.
Carey schob sich durch die Menge zu seiner Kabinentür. Sie war abgeschlossen. Er ging zurück in die Kabine, die er gerade erst verlassen hatte, und arbeitete sich durch den Schutt zu der Wand vor. Er musste einige Male innehalten, um Möbelstücke zu verrücken und Teile der Decke oder der Wand wegzuräumen. Manchmal kroch er über die Trümmer, manchmal wand er sich unter ihnen hindurch. Er hatte es jetzt doppelt eilig. Die Neigung des Gangs bedeutete, dass das Schiff leckgeschlagen war. Er erreichte die Wand und rief ein weiteres Mal den Namen seiner Frau. Sie antwortete von der anderen Seite. Hektisch tastete er nach irgendeinem Durchlass in der Barriere und stellte fest, dass sich die Wand am anderen Ende vom Boden gelöst hatte. Er zerrte so lange, bis die Öffnung groß genug war, dass er sich auf dem Bauch hindurchquetschen konnte.
Seine Kabine lag im Halbdunkel. Alle möglichen Formen und Gegenstände zeichneten sich in dem schwachen Schimmer ab. Er stand auf und schaute in Richtung der Lichtquelle. Eine kühle salzige Brise wehte ihm in das verschwitzte Gesicht. Er traute seinen Augen nicht. Die äußere Kabinenwand war verschwunden! Stattdessen klaffte dort ein riesiges Loch, durch das er sehen konnte, wie sich das Mondlicht auf der Wasseroberfläche spiegelte. Er arbeitete sich fieberhaft voran, und wenige Minuten später hatte er seine Frau erreicht. Mit einem Zipfel seiner Pyjamajacke wischte er ihr das Blut von Stirn und Wangen und küsste sie zärtlich.
»Ich kann mich nicht bewegen«, sagte sie beinahe entschuldigend.
Was auch immer ihn in die nächste Kabine geschleudert hatte, es hatte außerdem Myras stählernes Bettgestell vom Boden abgerissen und gegen die Wand gepresst, als wäre es der Klappbügel einer Mausefalle. Myra befand sich in einer fast aufrechten Position, und glücklicherweise schützte die Matratze sie vor dem Druck der verhedderten Bettfedern, aber der Rahmen zwang sie gegen die Wand. In ihrem Rücken befand sich der metallene Schacht eines der Schiffsaufzüge. Myras rechter Arm war frei und baumelte neben ihr herab.
Carey packte die Kante des Rahmens und zog. Zwar war er bereits Mitte fünfzig, aber dank seiner Zeit als Arbeiter besaß er noch immer beträchtliche Kraft. Er legte das ganze Gewicht seines massigen Körpers in die Anstrengung. Der Rahmen gab ein kleines Stück nach, schnellte aber sofort wieder in die Ausgangsstellung zurück, sobald Jake losließ. Er versuchte, den Rahmen mit einem Stück Holz aufzubiegen, besann sich jedoch sogleich eines anderen, weil Myra einen Schmerzensschrei ausstieß. Entmutigt ließ er das Holz fallen.
»Liebling«, sagte er und bemühte sich, möglichst ruhig zu wirken. »Ich hole Hilfe. Ich muss dich kurz allein lassen. Es dauert nicht lange. Ich komme zurück. Versprochen.«
»Jake, du musst dich retten. Das Schiff …«
»So leicht wirst du mich nicht los, meine Liebe.«
»Um Gottes willen, sei kein Dummkopf.«
Er küsste sie ein weiteres Mal. Ihre Haut, die sonst immer so warm war, fühlte sich klamm an. »Denk an die Sonne der Toskana, während du wartest. Ich bin gleich wieder da. Ganz sicher.« Er drückte ihre Hand, entriegelte von innen die Tür und trat auf den Korridor. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, was er machen sollte. Ein kräftig wirkender, stämmiger Mann kam auf ihn zu. Jake packte ihn an der Schulter und wollte ihn um Hilfe bitten.
»Aus dem Weg!« Mit weit aufgerissenen Augen stieß der Mann Jake einfach beiseite, obwohl Carey alles andere als schmächtig war.
Verzweifelt sprach Jake einige andere Männer an. Dann gab er auf. Keine Samariter hier. Es war, als würde er versuchen, einen einzelnen Stier aus einer vor Durst halb wahnsinnigen Viehherde zu angeln, die auf ein Wasserloch zustürmte. Er konnte es den Leuten nicht verübeln, dass sie um ihr Leben rannten. Seine Mitpassagiere würden ihm nicht helfen, so viel war klar. Es musste ihm gelingen, jemanden von der Besatzung aufzutreiben. Mühsam darauf bedacht, auf dem schrägen Boden nicht den Halt zu verlieren, reihte er sich in die Menge ein und machte sich auf den Weg zu den höher gelegenen Decks.
Angelo hatte sich einen flüchtigen Überblick über die Lage verschafft. Was er da sah, gefiel ihm ganz und gar nicht, vor allem auf der Steuerbordseite, die sich immer mehr dem Wasserspiegel entgegenneigte.
Man hatte fünf Rettungsboote zu Wasser gelassen, die ausschließlich mit Besatzungsmitgliedern gefüllt waren. Dutzende verängstigter Kellner und Küchenhilfen sprangen in die gefährlich überladenen Boote und ruderten auf ein weißes Schiff zu. Ein einziger Blick auf den zerdrückten Bug des Schiffs und das klaffende Loch in der Flanke der Doria verriet Angelo, was passiert war. Gott sei Dank hatten viele der Passagiere sich beim Zusammenprall nicht in ihren Kabinen aufgehalten, sondern den letzten Abend an Bord gefeiert.
Er machte sich auf den Weg nach backbord. Es war nicht ganz einfach, das schräge Deck emporzuklettern, denn Öl und Wasser von den Schuhen der Passagiere und Besatzungsmitglieder hatten es mit einem rutschigen Film überzogen. Zentimeter für Zentimeter zog er sich an den Handläufen und Türpfosten einen Korridor entlang und erreichte schließlich das Promenadendeck. Die meisten Passagiere hatten sich instinktiv auf die Seite begeben, die weiter vom Wasser entfernt lag. Sie warteten auf Verhaltensmaßregeln. Im Schein der Notbeleuchtung klammerten sie sich an den Liegestühlen fest, die mittels Bolzen auf dem Deck befestigt waren, oder drängten sich besorgt zwischen die Gepäckstapel, die man zuvor als Vorbereitung auf die Ankunft dort aufgeschichtet hatte. Die Besatzungsmitglieder kümmerten sich so gut wie möglich um die Versorgung der Arm- und Beinbrüche. Prellungen und Quetschungen würden warten müssen.
Manche der Leute trugen Abendgarderobe, andere ihre Nachtwäsche. Sie waren erstaunlich ruhig, außer wenn das Schiff von neuem erzitterte. Dann hallten Angstschreie und Flüche durch die feuchte Luft. Angelo wusste, dass diese Gemütsruhe sehr schnell in Hysterie umschlagen würde, falls bekannt wurde, dass einige Besatzungsmitglieder sich in den einzigen Rettungsbooten absetzten und die Passagiere auf einem sinkenden Schiff zurückließen.
Das Promenadendeck war so entworfen, dass die Passagiere durch die Schiebefenster in die Rettungsboote klettern konnten, die vom Bootsdeck herabhingen. Die Schiffsoffiziere und der Rest der Mannschaft bemühten sich vergeblich, die Rettungsboote loszuhaken. Die Davits waren nicht dafür konstruiert worden, in einem steilen Winkel zu funktionieren, und so war es unmöglich, die Boote frei zu bekommen. Angelos Mut sank. Das war der Grund, warum die Passagiere nicht aufgefordert worden waren, das Schiff zu verlassen. Der Kapitän hatte Angst vor einer Panik!
Da die eine Hälfte der Boote von der Besatzung benutzt wurde und die andere Hälfte nutzlos war, blieb keine Rettungsmöglichkeit für die Passagiere übrig. Wie es schien, standen nicht einmal genug Schwimmwesten zur Verfügung. Falls das Schiff sank, gab es für die Passagiere kein Entrinnen. Einen flüchtigen Moment lang erwog Angelo, zurück auf die Steuerbordseite zu schlittern und mit den anderen Besatzungsmitgliedern abzuhauen. Er schob den Gedanken beiseite, nahm stattdessen einem anderen Matrosen einen Stapel Schwimmwesten ab und begann, sie zu verteilen. Verdammter sizilianischer Ehrenkodex. Eines Tages würde er ihn noch mal das Leben kosten.
»Angelo!«
Ein blutiges Gespenst bahnte sich einen Weg durch das Gewühl und rief seinen Namen.
»Angelo, ich bin’s, Jake Carey.«
Der große Amerikaner mit der hübschen Frau. Mrs. Carey war alt genug, um seine Mutter zu sein, aber mamma mia, die großen schönen Augen und die Art und Weise, wie ihre einst jugendlichen Kurven durch das eine oder andere zusätzliche Pfund an reifer Sinnlichkeit gewonnen hatten! Angelo hatte sich sofort in sie verliebt, das unschuldige Begehren eines jungen Mannes. Die Careys hatten ihm ein großzügiges Trinkgeld gegeben und, was noch viel wichtiger war, sie hatten ihn mit Respekt behandelt. Andere Leute, sogar manche seiner italienischen Kameraden, schauten auf seine dunkle sizilianische Haut herab.
Dieser Jake Carey verkörperte den Inbegriff amerikanischen Wohlstands. Er war Mitte fünfzig, mit kurzem grauem Haar und braun gebranntem Gesicht, und er war noch immer durchtrainiert, so dass seine breiten Schultern sein Sportsakko bequem ausfüllten. Doch der gut gekleidete Passagier, den Angelo früher an jenem Abend gesehen hatte, war verschwunden. Der Mann, der mit wildem Blick auf ihn zulief, trug einen zerrissenen, von Staub und Schmutz verkrusteten Pyjama, auf dessen Vorderseite ein großer roter Schmierfleck prangte. Er erreichte Angelo und packte ihn so fest am Arm, dass es wehtat.
»Gott sei Dank, jemand, den ich kenne«, sagte er erschöpft.
Angelo ließ den Blick über die Menge schweifen. »Wo ist Signora Carey?«
»In unserer Kabine gefangen. Ich brauche Ihre Hilfe.« Seine Augen funkelten flehentlich.
»Ich komme«, erwiderte Angelo, ohne auch nur zu zögern.
Er veranlasste einen Steward, ihm die Schwimmwesten abzunehmen. Dann folgte er Carey zum nächsten Treppenaufgang. Carey senkte den Kopf und drängte sich durch den Menschenstrom, der sich aufs Deck ergoss. Angelo ergriff einen Zipfel von Careys besudelter Pyjamajacke, damit er ihn nicht verlor. Sie stürmten die Stufen zum Oberdeck hinunter, wo sich die meisten Erste-Klasse-Kabinen befanden. Inzwischen waren auf den Gängen nur noch wenige ölbedeckte Nachzügler unterwegs.
Angelo war erschüttert, als er Mrs. Carey zu Gesicht bekam. Sie sah aus, als würde sie in einem mittelalterlichen Foltergestell hängen. Ihre Augen waren geschlossen, und einen Moment lang dachte er, sie wäre tot. Aber als ihr Mann sie zärtlich berührte, zitterten ihre Lider.
»Ich habe dir doch gesagt, ich komme zurück, Liebling«, sagte Carey »Schau mal, Angelo hier ist mitgekommen, um zu helfen.«
Angelo nahm ihre Hand und küsste sie galant. Sie lächelte ihn liebevoll an.
Die beiden Männer packten den Bettrahmen und zerrten daran. Sie ächzten und stöhnten, allerdings mehr aus Frustration als vor Anstrengung, und ignorierten den Schmerz infolge der scharfen Metallkante, die sich in ihre Handflächen grub. Der Rahmen gab ein paar Zentimeter mehr nach als zuvor. Sobald sie wieder losließen, schnellte er zurück in die ursprüngliche Position. Bei jedem Versuch schloss Mrs. Carey die Augen und presste die Lippen zusammen. Carey fluchte. Er hatte sich schon so oft mittels simpler Kraftanstrengung durchgesetzt, dass er sich daran gewöhnt hatte, auf diese Weise zum Ziel zu kommen. Aber nicht dieses Mal.
»Wir brauchen mehr Leute«, sagte er keuchend.
Angelo zuckte verlegen mit den Schultern. »Der Großteil der Besatzung ist bereits in den Rettungsbooten.«
»O Gott«, flüsterte Carey Es war schon schwierig genug gewesen, Angelo zu finden. Carey hielt einen Moment lang inne und überdachte das Problem aus dem Blickwinkel des Ingenieurs.
»Wir könnten es schaffen, nur wir beide«, sagte er schließlich. »Wenn wir einen Heber hätten.«
»Was?« Der Kellner wirkte verwirrt.
»Einen Heber.« Carey suchte nach einem anderen Begriff, gab auf und machte Pumpbewegungen mit der Hand. »Wie für ein Auto.«
Angelos dunkle Augen hellten sich auf. Er hatte verstanden. »Ah«, sagte er. »Einen Wagenheber.«
»Genau«, erwiderte Carey mit wachsender Erregung. »Sehen Sie, wir könnten ihn hier ansetzen und den Rahmen von der Wand wegdrücken, so dass die Lücke groß genug ist, um Myra herauszuziehen.«
»Si. Die Garage. Bin gleich wieder da.«
»Ja, stimmt, die Garage.« Carey warf einen Blick auf das schmerzverzerrte Gesicht seiner Frau. »Aber Sie müssen sich beeilen.«
Carey hatte sich angewöhnt, nichts als selbstverständlich zu betrachten. Vielleicht würde Angelo sofort zum nächsten Rettungsboot laufen, kaum dass er die Kabine verlassen hatte. Carey könnte es ihm nicht verübeln. Er packte Angelo am Ellbogen.
»Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, Angelo. Sobald wir wieder in New York sind, werde ich dafür sorgen, dass Sie eine Belohnung erhalten.«
»Hey, Signore. Ich mache das nicht wegen des Geldes.« Er grinste, warf Mrs. Carey eine Kusshand zu und verschwand aus der Kabine. Auf dem Weg nach draußen schnappte er sich eine Schwimmweste.
Er lief den Flur entlang, stieg eine Treppe aufs Foyerdeck hinab und kam nicht weiter. Der Bug der Stockholm





























