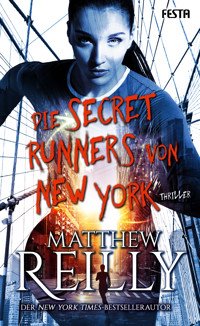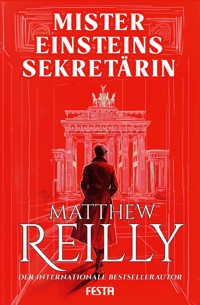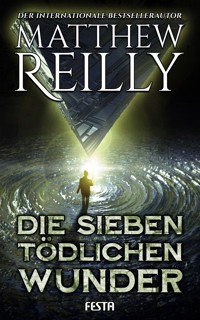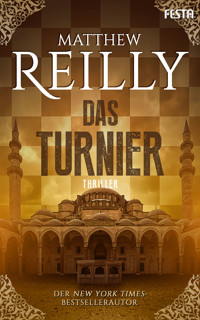
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1546 ruft Sultan Süleyman der Prächtige alle Könige Europas auf, an einem nie dagewesenen Wettstreit teilzunehmen: In einem großen Turnier soll der beste Schachspieler der Welt gefunden werden … Unter den Tausenden Reisenden, die in Konstantinopel eintreffen, reihen sich auch der Gelehrte Roger Ascham und seine Schülerin Elisabeth ein, Tochter von Heinrich VIII. Bald überschlagen sich die Ereignisse: Schon vor Beginn des Turniers wird ein christlicher Kardinal ermordet und grässlich verstümmelt. Es folgen weitere barbarische Todesfälle. Elisabeth und Ascham erkennen bald, dass sie selbst die eigentlichen Figuren in einem verderbten Spiel sind, in dem es ums nackte Überleben geht ... Ein historischer Action-Thriller, der an DER NAME DER ROSE und die Abenteuer von Sherlock Holmes erinnert. Publishers Weekly: »Die 13-jährige Prinzessin Elisabeth Tudor ist die Erzählerin dieses herrlichen, gut geschriebenen Thrillers. Als Teil ihrer politischen Erziehung hat sie u. a. eine unvergessliche Begegnung mit dem arroganten jungen Iwan dem Schrecklichen (…) Reilly bleibt den Realitäten seiner historischen Charaktere treu.« Elisabeth I., auch bekannt unter den Namen Gloriana, Good Queen Bess oder The Virgin Queen (Die jungfräuliche Königin), war von 1558 bis an ihr Lebensende 1603 Königin von England.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Aus dem Englischen von Manfred Sanders
Impressum
Die australische Originalausgabe The Tournament
erschien 2014 im Verlag Pan Macmillan Australia Pty. Ltd.
Copyright © 2013 by Karanadon Entertainment Pty. Ltd.
Zeichnungen der Karten: David Atkinson, Hand Made Maps Ltd.
Foto der Hagia Sophia: Juanjo González
Copyright © dieser Ausgabe 2017 by Festa Verlag, Leipzig
Titelbild: Dean Samed
eISBN 978-3-86552-565-9
www.Festa-Verlag.de
www.Festa-Action.de
Inhalt
Impressum
Prolog — 1603
1546
I — TURM
England, September 1546
Die Reise, Oktober 1546
Im Reich der Habsburger
Durch die Walachei
Die osmanische Hauptstadt
II — BAUER
Byzanz
Der Palast des Sultans
Die Stadt Konstantins
Der Sultan
Das Eröffnungsbankett
Die Spieler
III — LÄUFER
Die Stunden nach dem Bankett
Ein Ausflug in die Nacht
Das Wasserbecken und der Kerker
Des nachts im Palast des Sultans
Das Turnier beginnt
Die Auslosung
Die erste Paarung
Zwei weitere Opfer
Der Kardinal und der Bordellbesitzer
Eine weitere Nacht im Palast
Eine Diskussion unter Titanen
Die Botschaft
IV — DAME
Ein sehr ungewöhnlicher Morgen
Die unglaubliche Menagerie des Sultans
Der Tod eines Schachspielers
Die zweite Runde beginnt
Der Sultan
Die Königin
Der Favorit des Sultans strauchelt
Mr. Giles gegen Dragan
Die Unterwelt
Die Bewohner der Unterwelt
Eine Bewegung in der Nacht
Die Wölfe des Topkapi-Palastes
Elsie und der Kronprinz
V — SPRINGER
Das Halbfinale
Pietro
Der Diener des Kardinals
In die Höhle des Kardinals
Der Kampf mit dem Wahnsinnigen
Der letzte Abend in Konstantinopel
VI — KÖNIG
Der letzte Tag
Epilog — 1603
Nachwort
Ausgewählte Quellen
Matthew Reilly
Entdecke die Festa-Community
Dieses Buch ist Cate Paterson, Jane Novak und Tracey Cheetham gewidmet.
VORBEMERKUNG DES AUTORS
Das vorliegende Buch ist ein Produkt der Fantasie. Auch wenn darin Personen und Organisationen vorkommen, die wirklich existiert haben, entspringen ihre Handlungen allein der Vorstellungskraft des Autors.
Darüber hinaus enthält der Roman Szenen gewalttätiger und sexueller Natur. Er ist daher für minderjährige Leser ungeeignet.
Als erstes internationales Schachturnier der Geschichte gilt gemeinhin das Turnier, das 1851 in London ausgetragen wurde und das der Deutsche Adolf Anderssen gewann. 16 Schachspieler aus ganz Europa kamen zusammen, um den besten Spieler der Welt zu bestimmen. (Zuvor hatte es immer nur unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit abgehaltene Zweikämpfe gegeben.)
Doch in der Schachwelt hält sich das hartnäckige Gerücht von einem Turnier, das lange vor dem in London stattgefunden haben soll, nämlich im 16. Jahrhundert in der Stadt Konstantinopel, die heute Istanbul heißt.
Leider existieren keinerlei Aufzeichnungen über dieses Ereignis, und solange keine dokumentierten Belege für das Turnier auftauchen, muss es wohl als dem Reich der Legende zugehörig betrachtet werden.
Aus: A History of Chess, Boris Ivanov (Advantage Press, London 1972)
Prolog — 1603
Meine Königin ist tot. Meine Freundin ist tot. Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Sie ist ein Stück dunkler geworden.
Wie sie sich in dieser chaotischen Welt so gut zu behaupten verstand, wird mir immer ein Rätsel bleiben. In einem Leben inmitten eines Hexenkessels aus Höflingen, Bischöfen und Feldherren gelang es ihr immer, ihren Willen durchzusetzen. Oft erreichte sie das durch ihren Charme, häufig durch Gerissenheit und in seltenen Fällen durch die Hinrichtung derer, die sich ihr in den Weg stellten.
Sie hatte ein feines Gespür für ihre Wirkung nach außen. Ich habe keinen Zweifel, dass oft, wenn sie einen armen Teufel in den Tower verdammte, es ebenso sehr des Spektakels wie seiner Verbrechen wegen geschah. Herrscher müssen manchmal unerbittlich sein und Exempel statuieren.
Oft wurde betont, dass ihre außergewöhnliche geistige Regsamkeit das Ergebnis ihrer Erziehung durch den großen Schulmeister Roger Ascham gewesen sei. Da ich selbst oft Zeugin ihrer Unterweisung war, kann ich bestätigen, dass ihr Unterricht den höchsten Ansprüchen genügte.
Als Kind einer Angehörigen ihrer Dienerschaft und von ähnlichem Alter wie sie, war ich die bevorzugte Spielgefährtin der jungen Prinzessin. Später im Leben sollte ich die Stellung ihrer Kammerfrau einnehmen, aber als junges Mädchen war es mir schon dank der räumlichen Nähe gestattet, an einigen ihrer Unterrichtsstunden teilzunehmen und auf diese Weise selbst ein Maß an Bildung zu erwerben, das mir sonst verwehrt geblieben wäre.
Als Elisabeth sieben war, sprach sie fließend Französisch, leidlich Spanisch und konnte Latein und Griechisch sprechen und lesen. Als William Grindal 1544 ihre Erziehung übernahm – unter Aufsicht des großen Ascham –, hatte sie dieser Liste noch Italienisch und Deutsch hinzugefügt. Während Grindal für die alltäglichen Lektionen zuständig war, wachte Ascham immer im Hintergrund als großer Architekt ihrer Gesamtbildung. Er übernahm den Unterricht, wenn wichtige Themen auf dem Lehrplan standen: Sprachen, Mathematik und Geschichte, sowohl alte als auch neue. Als entschiedener Fürsprecher regelmäßiger körperlicher Aktivitäten lehrte er sie sogar das Bogenschießen in den Gärten von Hatfield.
Und – das sollte ich nicht unerwähnt lassen – er brachte der jungen Prinzessin Elisabeth das Schachspielen bei.
Ich sehe sie noch vor mir als 13-Jährige, dicht über das Schachbrett gebeugt, ihr elfenhaftes Sommersprossengesicht von den wilden Locken ihres möhrenfarbenen Haars eingerahmt, den Blick in einem tödlichen Starren auf die Figuren fixiert, verbissen darauf konzentriert, den besten Zug zu finden, während Ascham ihr gegenübersaß, dem Anschein nach vollkommen desinteressiert am Verlauf der Partie, und sie beim Denken beobachtete.
Als Kind verlor Bess mehr Spiele, als sie gewann, und nicht wenige im königlichen Haushalt in Hatfield empfanden es als skandalös, dass Ascham fortwährend die Tochter des Königs besiegte, noch dazu häufig vernichtend.
Mehr als einmal warf Bess sich nach einer Schachpartie tränenüberströmt in meine Arme. »Oh Gwinny, Gwinny! Er hat mich schon wieder geschlagen!«
»Er ist ein grausames Ungeheuer«, sagte ich dann tröstend.
»Ja, das ist er, nicht wahr?« Aber dann fasste sie sich wieder. »Eines Tages werde ich ihn schlagen. Ganz sicher werde ich das!« Und natürlich tat sie es am Ende auch.
Der große Lehrer seinerseits entschuldigte sich nie für seine brutale Spielweise, auch nicht, als Bess’ Gouvernante sich in einem Brief an den König darüber beschwerte.
Von einem Abgesandten des Königs darauf angesprochen, rechtfertigte Ascham sich damit, dass man nicht lernen könne, wenn man nicht verliere. Und seine Aufgabe, so sagte er, sei es, dafür zu sorgen, dass die Prinzessin lerne. Der König akzeptierte seine Begründung, und die Niederlagen im Schach durften weitergehen. Als Erwachsene verlor Elisabeth nur selten im Schach, und auf dem weitaus gefährlicheren Schachbrett des Lebens – bei Hofe in London und auf hoher See gegen das Haus Kastilien – verlor sie nie.
Aus dem Schachspiel, so Ascham, könne man vieles lernen: seinen Gegner in Sicherheit zu wiegen, Fallen zu stellen und gestellte Fallen zu entdecken, draufgängerisch zu sein und seine Neigung zum Draufgängertum zu bändigen, naiv zu erscheinen, während man in Wahrheit wachsam sei, die Zukunft viele Züge im Voraus zu berechnen – und die Tatsache, dass Entscheidungen immer Konsequenzen haben.
Ascham war meiner jungen Herrin ein guter Lehrer.
Doch nun habe ich zu meiner tiefsten Erschütterung erfahren, dass Ascham seine wichtigste Lektion möglicherweise nicht in unserem kleinen Schulzimmer in Hertfortshire, sondern weit fort von England erteilte.
Denn in der letzten Woche, als ihre Gesundheit sie im Stich ließ und ans Bett fesselte, rief meine Herrin mich an ihre Seite und befahl dann allen anderen Bediensteten, ihr Schlafgemach zu verlassen.
»Gwinny«, sagte sie. »Meine liebe, teure Gwinny. Jetzt, da das Licht sich trübt und das Ende naht, gibt es etwas, das ich dir zu erzählen wünsche. Es ist eine Geschichte, die ich nun seit beinahe 60 Jahren für mich behalten habe.«
»Ja, Euer Majestät.«
»Bitte nenne mich Bess, so wie früher, als wir Kinder waren.«
»Ja, sicher. Bitte fahrt fort … Bess …« So hatte ich sie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr genannt.
Sie öffnete die Augen und blickte an die Decke. »Viele haben sich über das Leben gewundert, das ich geführt habe, Gwinny: eine Königin, die niemals heiratete oder Erben gebar; eine Frau ohne militärische Ausbildung, die Philipps Armada zurückschlug; eine protestantische Herrscherin, die immer wieder Ignatius von Loyolas katholische Missionare hinrichten ließ und mehr als einmal die Heiratsanträge des russischen Zaren Iwan ausschlug.
Mein Werden zu einer solchen Frau – geschlechtslos und Männern gegenüber distanziert, misstrauisch gegen Höflinge und Botschafter, erbarmungslos im Umgang mit Feinden – ist das Ergebnis einer Vielzahl von Dingen, doch insbesondere eines ganz bestimmten Erlebnisses, eines Erlebnisses aus meiner Jugend, einer Reise, die ich unter absoluter Geheimhaltung unternahm. Es war ein Ereignis, von dem ich niemandem etwas zu sagen wagte, aus Furcht, der Fantasterei beschuldigt zu werden. Dieses Erlebnis ist es, von dem ich dir nun erzählen will.«
Während der nächsten zwei Tage sprach meine Königin und ich hörte zu.
Sie erzählte mir von einem Ereignis in ihrer Jugend, während des Herbstes 1546, als Hertfordshire von einem plötzlichen Ausbruch der Pest heimgesucht wurde und Roger Ascham sie für einen Zeitraum von drei Monaten aus Hatfield House fortbrachte.
Ich kann mich noch sehr lebhaft an die Zeit erinnern, und zwar aus mehreren Gründen.
Zum einen schlug die Pest 1546 besonders grausam zu. Die Flucht vor dieser gefürchteten Seuche war für königliche Nachkommen durchaus üblich – einen jungen Erben vom Ausbruchsort einer Krankheit zu entfernen, war der beste Weg, eine Unterbrechung der königlichen Blutlinie zu vermeiden –, und in jenem Jahr flohen viele Bewohner Hertfordshires aus dem Bezirk.
Zweitens war es für Elisabeth selbst eine besonders gefährliche Zeit. Obwohl ihr durch das Thronfolgegesetz von 1543 wieder der Platz in der Thronfolge zuerkannt worden war, stand sie 1546, im Alter von 13 Jahren, nur an dritter Stelle hinter ihrem jüngeren Halbbruder Edward, damals neun Jahre alt, und ihrer älteren Halbschwester Mary, damals 30. Dennoch stellte ihre bloße Existenz für die Thronansprüche beider eine Gefahr dar, und sie schwebte in der durchaus realistischen Gefahr, im Dunkel der Nacht verschleppt und einem blutigen Ende im Tower zugeführt zu werden – einem Ende, das man bequem der Pest zuschreiben konnte.
Der dritte und letzte Grund sagt vielleicht mehr über mich als über meine Herrin aus. Ich erinnere mich auch deshalb so gut an jene Zeit, weil Elisabeth, als sie in den Osten ging, sich dafür entschied, mich nicht mitzunehmen.
Stattdessen wurde sie von einem anderen jungen Mitglied unseres Haushalts begleitet, einem lebensfrohen älteren Mädchen namens Elsie Fitzgerald, das, wie ich eingestehen muss, weit hübscher und weltgewandter war als ich.
Nach ihrer Abreise weinte ich tagelang. Und ich verbrachte jenen Herbst elend und allein bei Verwandten in Sussex, sicher vor der Pest, aber schmerzlich die Gesellschaft meiner Freundin vermissend.
Als meine Herrin ihre Erzählung beendet hatte, war ich sprachlos vor Schrecken und Entsetzen.
In den Jahren nach jenem verlorenen Herbst 1546 hatte sie immer behauptet, ihre Reise sei vollkommen ereignislos verlaufen, nur eine langweilige Exkursion auf den Kontinent mit Ascham. Auch wenn sie allem Anschein nach ostwärts gereist waren, um sich irgendein Schachturnier anzusehen, hatte Elisabeth nach ihrer Rückkehr nie über Schach oder ein solches Turnier gesprochen, und ihre Freundschaft mit Elsie war nie wieder so wie zuvor.
Nachdem ich ihren Bericht gehört habe, weiß ich auch warum.
Ihre Reise war alles andere als ereignislos verlaufen.
Ascham hatte sie nicht nur tief in den Osten mitgenommen – über die Grenzen der Christenheit hinaus ins Herz der moslemischen Länder, in die gewaltige Stadt Konstantinopel –, er hatte die zukünftige Königin auch vielen schrecklichen Gefahren ausgesetzt, während die beiden einem bemerkenswerten Ereignis beiwohnten, das nie Eingang in die Geschichtsschreibung fand.
Als sie ihre Erzählung beendet hatte, lehnte meine Königin sich in ihre Kissen zurück und schloss die Augen. »Lange habe ich mit mir gerungen, ob ich jemandem von damals berichten soll, aber nun sind alle anderen Beteiligten tot, und ich werde es auch bald sein. Wenn es dir beliebt, Gwinny, so schreibe meine Worte nieder, damit andere erfahren mögen, wodurch eine Königin wie ich geformt wird.«
Und so mache ich dies zu meiner Aufgabe, meiner letzten Aufgabe für meine Königin: ihre genauen Worte niederzuschreiben und Euch, geneigtem Leser, die wundersamen Dinge – die schrecklichen Dinge, die entsetzlichen Dinge – zu schildern, deren Zeugin sie im Laufe jener geheimen Reise im Jahre 1546 wurde.
1546
I — TURM
Im modernen Schach werden die Türme häufig als Burgen oder Festungen dargestellt, welche die vier Ecken des Brettes bewachen, doch das war nicht immer so.
Tatsächlich waren die Türme ursprünglich Streitwagen – im Persischen als ruhk bezeichnet, was heute noch im englischen Wort für den Turm, »rook«, anklingt. Die Bauern waren Fußsoldaten, die Läufer Elefanten, die Springer berittene Soldaten, und an den Rändern des Brettes eilten die schnellen und tödlichen Streitwagen auf und ab.
Doch als die Zeiten sich wandelten und das Spiel sich von Persien nach Europa ausbreitete, spiegelten die Schachfiguren immer mehr die gesellschaftliche Hierarchie des mittelalterlichen Westeuropa wider. Und so wurde aus dem Streitwagen eine Burg. Sie war noch immer eine mächtige Figur, die in einem einzigen Zug das gesamte Brett überqueren und ganze Feldreihen beherrschen konnte, aber der ursprüngliche Grund für die Flinkheit dieser Figur war verloren gegangen.
Und doch bleibt der Turm bzw. die Burg ein exzellentes Beispiel für Schachfiguren, welche die mittelalterliche Gesellschaft widerspiegeln, denn so mancher König jener Zeit wurde nach der Stärke und Erhabenheit seiner Burgen beurteilt.
Aus: Chess in the Middle Ages, Tel Jackson (W. M. Lawry & Co., London 1992)
Ich danke Gott, dass er mich mit solcherlei Fähigkeiten gesegnet hat, dass ich, müsste ich in meinem Unterkleide aus dem Land fliehen, an jedem Ort der Christenheit leben könnte.
– Königin Elisabeth I.
England, September 1546
Ich wohnte auf Hatfield House in Hertfordshire, als die Einladung am Hof in London ankam. Einen Tag später wurde sie nach Hatfield weitergeleitet, begleitet von einer charakteristisch knappen Nachricht meines Vaters an Mr. Ascham.
Die Einladung war eine staunenswerte Kuriosität.
Gedruckt war sie auf edelstem Papier, einem kräftigen Karton mit goldenen Rändern. Mit leuchtend goldener Tinte (und auf Englisch) stand darauf geschrieben:
SEINE ERHABENSTE MAJESTÄT
SULEIMAN DER PRÄCHTIGE,
KALIF DER SÖHNE UND TÖCHTER ALLAHS,
SULTAN DER LÄNDER DER OSMANEN,
HERRSCHER ÜBER DIE REICHE DER RÖMER,
DER PERSER UND DER ARABER,
HELD DER GANZEN WELT,
STOLZ DER GLORREICHEN KAABA
UND DER ERLEUCHTETEN MEDINA,
DES EDLEN JERUSALEM UND
DES THRONES VON ÄGYPTEN,
HERRSCHER UND GEBIETER ÜBER ALLE LÄNDEREIEN,
SO WEIT SEIN AUGE REICHT,
ERBIETET EUCH SEINE WÄRMSTEN GRÜSSE.
ALS HOCHVEREHRTER KÖNIG VON ENGALAND
SEID IHR EINGELADEN, EUREN BESTEN SPIELER
JENES SPIELES, DAS BEKANNT IST ALS SHATRANJ, LUDOS SCACORUM, ESCHECS, SCACCHI, SZACHY, CHESS ODER SCHACH, ZUR TEILNAHME AN EINEM TURNIER ZU ENTSENDEN, UM DEN MEISTER DER BEKANNTEN WELT ZU ERMITTELN.
Ich schnaubte verächtlich. »Für einen großen Sultan und Herrscher und Gebieter über alle Ländereien, so weit sein Auge reicht, ist sein Englisch bejammernswert schlecht. Er kann nicht einmal England richtig schreiben.«
Mr. Ascham blickte von dem Einladungsschreiben auf. »Ist das so? Sag mir, Bess, sprichst du seine Sprache? Sprichst du Arabisch oder Türkisch-Arabisch?«
»Ihr wisst, dass ich es nicht tue.«
»Dann spricht er, so bejammernswert schlecht sein Englisch auch sein mag, doch immerhin deine Sprache, während du die seine nicht beherrschst. So wie ich es sehe, verleiht ihm das einen beträchtlichen Vorteil dir gegenüber. Denke immer erst nach, bevor du jemanden kritisierst, und kritisiere niemals jemanden ungerechtfertigterweise für seine Bemühungen bei etwas, das du noch nicht einmal versucht hast.«
Ich sah meinen Lehrer finster an, aber es war unmöglich, ihm böse zu sein, selbst wenn er mich zurechtwies. Er hatte so eine gewisse Art – wie er auftrat, wie er sprach, wie er mich belehrte: sanft, aber nachdrücklich.
Mr. Roger Ascham war damals 31, und in jenen Tagen – lange bevor er The Schoolmaster schrieb, das Werk, für das er nach seinem Tode zu Recht berühmt wurde – war er bereits einer der angesehensten Lehrer in Cambridge für klassisches Griechisch und Latein.
Und dennoch – wenn ich ihm eines hätte wünschen können, dann eine ansprechendere äußere Erscheinung. Er war von durchschnittlicher Statur und durchschnittlicher Größe und in einer Welt reicher, schneidiger Jünglinge mit breiten Schultern, kantigen Gesichtern und dem herrischen Auftreten geerbten Wohlstands wirkte er dadurch unweigerlich klein, weich und harmlos. Er hatte eine große, runde Nase, braune Hundeaugen und etwas zu große Ohren, die sich unter einem Wuschelkopf aus dichtem braunem Haar versteckten. Ich hörte einmal, wie jemand sagte, dass kürzlich bei einem Ball nicht eine einzige der anwesenden jungen Damen seine höfliche Einladung zum Tanz angenommen habe. Ich weinte für ihn, als ich das hörte. Wenn diese törichten Damen nur wüssten, was ihnen entging!
Doch während ich deswegen Tränen für ihn vergoss, schien es ihn selbst nicht zu kümmern. Er war mehr an der Kunst des Lernens interessiert, und dieser Leidenschaft folgte er mit einer wahrhaft verbissenen Hingabe. In der Tat legte er eine intensive Konzentration bei fast allem, was er tat, an den Tag, ob es nun die Ausübung seiner geliebten Bogenschießkunst war, die Diskussion staatlicher Angelegenheiten, das Lesen eines Buches oder mein Unterricht. Das Lernen war, soweit es Roger Ascham betraf, die edelste aller Betätigungen und obendrein eine aktive.
Er war, schlicht gesagt, der neugierigste Mensch, der mir je begegnet ist.
Mr. Ascham verfügte über alle möglichen Arten obskuren Wissens, von Theorien über die uralten Steinkreise auf der Ebene von Salisbury bis hin zu den neuesten wissenschaftlichen Methoden der Medizin und Mathematik. Und was er nicht wusste, bemühte er sich herauszufinden. Ob es der zu Besuch weilende Hofastronom war, der Leibarzt des Königs oder ein reisender Kesselflicker, der ein Wunderheilmittel verkaufte – Mr. Ascham stellte sie immer mit kniffligen Fragen auf die Probe, indem er etwa den Hofastronomen fragte, ob an Amerigo Vespuccis Behauptung, man könne mittels des Mondes und des Mars den Längengrad berechnen, etwas dran sei, oder den Leibarzt meines Vaters, warum bestimmte Pflanzen bestimmte Arten von Hautausschlägen hervorriefen, oder den Kesselflicker, ob er wisse, dass er ein Quacksalber sei.
So umfassend war Mr. Aschams Wissen auf einer solchen Vielzahl von Gebieten, dass es während seiner Zeit in Cambridge nicht selten vorkam, dass Professoren anderer Disziplinen ihn in seinen Räumen aufsuchten, um sich mit ihm über Fragen ihres eigenen Spezialgebiets auszutauschen.
Denn in einer Welt, in der die Menschen glaubten, eine höhere Weisheit in Gott oder der Bibel zu finden, verneigte sich mein geliebter Lehrer vor den Zwillingsaltären des Wissens und der Logik. »Alles«, sagte er einmal zu mir, »geschieht aus einem logischen Grund, seien es das Abwärtsfließen von Wasser, das Entstehen von Krankheiten oder die Handlungen der Menschen. Wir müssen diesen Grund nur finden. Die Aneignung von Wissen, die reine Freude daran, den Dingen auf den Grund zu gehen, ist das größte Geschenk im Leben.«
In einem auch in weiteren Kreisen bekannt gewordenen Fall, als ein Knabe aus der hiesigen Gegend, der zu schweren Anfällen mit Schaum vor dem Mund neigte, starb und der Abt des örtlichen Klosters die Teufelsbesessenheit des Jungen dafür verantwortlich machte, verlangte Mr. Ascham das Gehirn des Jungen zu sehen. Ganz recht, sein Gehirn! Der Schädel des Toten wurde geöffnet, und tatsächlich fand Mr. Ascham einen weißen Fremdkörper von der Größe eines Apfels im Gehirn des Unglücklichen. In Anspielung auf dieses Geschehnis sagte Mr. Ascham später zu mir: »Bevor wir dem Übernatürlichen die Schuld geben, Bess, sollten wir es zunächst mit allen natürlichen Erklärungen versuchen.« Der Abt sprach danach ein Jahr lang nicht mehr mit ihm. Nicht jeder teilte Mr. Aschams Freude daran, den Dingen auf den Grund zu gehen.
Und dann, auf dem Höhepunkt seiner Universitätslaufbahn, kam er, um mich zu unterrichten, mich, ein Kind, die Dritte in der Thronfolge. Selbst mir in meinem zarten Alter war klar, dass der bemerkenswerte Mr. Roger Ascham bei Weitem überqualifiziert war, um als Lehrer für ein 13-jähriges Mädchen zu dienen, selbst wenn sie eine Prinzessin war. Ich fragte mich, warum er es tat. Was sah er in mir, das sonst niemand sah?
Jedenfalls war dieser kurze Wortwechsel zwischen uns über die Englischkenntnisse des Sultans nicht ungewöhnlich. Ich hatte unrecht und er hatte recht – wieder einmal.
Wir wandten unsere Aufmerksamkeit wieder der Einladung zu. Der Text verriet noch, dass das Turnier in einem Monat in der Hauptstadt des Sultans, der uralten Stadt Konstantinopel, stattfinden sollte.
Begleitet wurde die Einladung von einer Nachricht meines Vaters, adressiert an Mr. Ascham.
Ascham,
soweit ich weiß, war Euer Kollege Mr. Gilbert Giles der beste Schachspieler in Cambridge. Erkundigt Euch bitte, ob das noch der Fall ist, und wenn dem so ist, so schickt ihn sofort zu mir. Nichts Geringeres als der Ruf des corpus christianum erfordert unseren besten Mann bei diesem Turnier.
Heinrich, Rex
Übrigens meine Anerkennung zu Euren Bemühungen in der Angelegenheit von Cumberlands Sohn. Sie blieben nicht unbemerkt.
In jenen Tagen stand mehr als nur der Ruf der Christenheit auf dem Spiel: Der moslemische Sultan bedrohte die Christenheit auch in militärischer Hinsicht.
Seine Herrschaft erstreckte sich von Persien im Osten bis nach Algier im Südwesten und hatte kürzlich sogar die Donau überschritten. Vor acht Jahren, im Jahre 1538, hatte die Flotte des Sultans unter der Führung des brillanten Barbarossa etwas bislang Undenkbares geschafft: Sie hatte bei Preveza eine europäische Flotte besiegt – eine »christliche Allianz«, die von Papst Paul III. höchstselbst zusammengerufen worden war. Über 40 Schiffe gingen verloren, mehr als 3000 Gefangene und – nachdem man 300.000 Golddukaten Entschädigung an den osmanischen Sultan gezahlt hatte – auch ein großer Teil des europäischen Stolzes.
Und dann hatte Suleimans Armee die Stadt Buda eingenommen und stand nun vor den Toren Wiens. Suleimans nächster europäischer Nachbar, Erzherzog Ferdinand von Österreich, soll vor Wut getobt haben, als er vom Eindringen des Sultans in seine Gebiete erfuhr, aber außer dass er noch mehr Spione ausschickte, um über die Bewegungen der moslemischen Armeen informiert zu sein, konnte Ferdinand nicht viel unternehmen. Suleimans Imperium war doppelt so groß wie die ganze Christenheit zusammen, und es wurde jeden Tag größer.
Aber mindestens ebenso beeindruckend war der Sultan selbst. Es hieß, Suleiman sei ein weiser und geschickter Herrscher und spreche nicht weniger als fünf Sprachen. Er sei ein begabter Poet und ein Förderer der Künste, ein gerissener Stratege, und anders als sein erbitterter Feind Erzherzog Ferdinand und viele andere europäische Monarchen werde er aufrichtig von seinem Volk geliebt.
Mehr als einmal hatte mein Lehrer mir gesagt, dass sich, während die Königshäuser von England, Frankreich und Spanien untereinander um die Vorherrschaft stritten, ein großer drohender Schatten im Osten erhob. Wenn man nichts dagegen unternahm, mochten unsere königlichen Familien eines Tages von ihrem Gezänk aufblicken und feststellen, dass sie unversehens einem moslemischen Lehnsherrn Tribut zahlten.
Die nicht offen ausgesprochene Herausforderung in diesem vergoldeten Einladungsschreiben war der unausweichliche Wettstreit zwischen den Religionen, den dieses Turnier darstellen würde. Genau wie er es bei Preveza getan hatte, forderte Suleiman einen Kampf zwischen seinem Gott und unserem heraus, und bei Preveza hatte seiner gewonnen.
»Sir, ist dieser Mr. Giles immer noch der beste Schachspieler Englands?«, fragte ich.
»Und ob er das ist«, antwortete mein Lehrer. »Ich spiele regelmäßig gegen ihn. Er schlägt mich in neun von zehn Partien, aber gelegentlich schaffe ich es, ihm ein Schnippchen zu schlagen.«
»Das klingt genau wie unsere Bilanz.«
Mr. Ascham lächelte mich an. »Ja, aber ich habe das Gefühl, dass diese Bilanz sich schon bald umkehren wird. Giles hingegen wird immer stärker sein als ich. Aber das hier …« Er hielt die Einladung hoch. »… das hier ist etwas Bedeutsames. Giles wird begeistert sein, dem Ruf des Königs zu folgen.«
Und Mr. Giles war begeistert.
Mr. Ascham schickte ihn zu meinem Vater, der (wieder einmal charakteristisch für ihn) einen Beweis für Mr. Giles’ Fähigkeiten verlangte: ein Spiel gegen meinen Vater persönlich. Natürlich verlor Mr. Giles diese Partie.
Wie jeder in England war Mr. Giles nicht gerade erpicht darauf, einen König zu besiegen, der nicht nur zwei seiner Ehefrauen hatte enthaupten lassen (von denen eine meine Mutter war), sondern auch Thomas Cromwell, weil dieser ihn mit einer von ihnen zusammengebracht hatte. Es war gar nicht so unüblich, dass Leute, die meinen Vater in anderen Spielen schlugen, als aufgespießte Köpfe über der London Bridge endeten.
Zu meiner Überraschung jedoch soll mein Vater nach dem Gewinn dieser Partie verärgert ausgerufen haben: »Spielt nicht absichtlich schwach gegen mich, Giles! Ich brauche als Repräsentanten Englands und der Überlegenheit Christi und des christlichen Glaubens bei diesem Turnier keinen Speichellecker. Ich brauche einen Schachspieler!«
Sie spielten noch einmal und Mr. Giles schlug meinen Vater in neun Zügen.
Von da an ging alles sehr schnell.
Ein kleiner Trupp wurde für die Reise quer durch die Christenwelt zusammengestellt, mit Wagen, Pferden und Wachleuten.
Doch gerade als Mr. Giles Hertfordshire verlassen wollte, suchte ein schrecklicher Pestausbruch die Region heim.
Mein Halbbruder Edward, der Thronerbe, wurde schleunigst in Sicherheit gebracht. Meine Schwester Mary folgte kurz darauf.
Mich betrachtete man offensichtlich als nicht so wertvoll; niemand legte einen sonderlichen Eifer an den Tag, meine Abreise aus Hatfield House zu arrangieren, daher setzte ich unverändert meine Studien mit Elsie und mit dir, meiner lieben Freundin Gwinny Stubbes, fort.
Und dann gab es eines Tages einige Unruhe im Nebenzimmer.
Wir saßen in meinem Studierzimmer und lasen Livius’ Bericht über den jüdischen Massenselbstmord in Masada. Elsie, die ein paar Jahre älter war als wir, saß in der Ecke vor ihrem Spiegel und bürstete sich müßig das Haar. Oh, erinnerst du dich an sie, Gwinny? Ich erinnere mich noch gut. Mit ihren 17 Jahren war sie eine echte Schönheit, und sie hatte die gertenschlanke Figur der guten Tänzerin, die sie auch war. Mit ihrer schmalen Taille und ihrem kecken Busen, mit ihren prächtigen blonden Haaren, die wie ein Wasserfall über ihre Schultern fielen, zog sie den Blick jedes vorbeigehenden Gentlemans auf sich.
Mit dem sorglosen Selbstvertrauen, wie es vielen schönen Menschen zu eigen ist, war sie davon überzeugt, dass ihre Schönheit allein schon ausreichen würde, um ihr einen Gemahl von angemessenem Stand zu verschaffen, und hielt es daher nicht für nötig zu lernen – sie verbrachte mehr Zeit vor ihrem Spiegel als über ihren Büchern, und ich muss gestehen, dass ich in dieser Hinsicht ein bisschen neidisch auf sie war. Ich musste viele langweilige Unterrichtsstunden über mich ergehen lassen, dabei war ich von königlichem Blut. (Außerdem war ich, das sollte ich noch hinzufügen, eifersüchtig auf ihre Weiblichkeit, denn mich selbst fand ich hässlich wie eine Vogelscheuche: Ich schien nur aus knorrigen Knien und knochigen Beinen zu bestehen, mit einer Brust so flach wie die eines Knaben und einem grässlichen Schopf aus lockigem erdbeerrotem Haar, das ich hasste.) Die meiste Zeit betete ich Elsie an, bezaubert von ihrer Anmut, begeistert von ihrer Schönheit und eingeschüchtert von ihrer welterfahrenen 17-jährigen Weisheit.
Während wir also solcherart beschäftigt waren, vernahm ich die erwähnte Unruhe: Meine Gouvernante Miss Katherine Ashley erhob im Nebenzimmer ihre Stimme.
»Ihr werdet nichts dergleichen tun, Mr. Ascham!« Es musste etwas Ernstes sein; Mr. Ascham nannte sie ihn nur, wenn sie verärgert über ihn war.
»Aber eine solche Gelegenheit, ihre Bildung zu erweitern, wird sie nie wieder …«
»Sie ist erst 13 Jahre alt …«
»Sie ist die hellste 13-Jährige, die ich je unterrichtet habe, und an Reife ihrem Alter weit voraus. Grindal ist meiner Meinung.«
»Sie ist ein Kind, Roger.«
»Das denkt der König nicht. Letzten Monat, als man ihn informierte, dass Bess ihre erste Blutung hatte, sagte König Heinrich: ›Wenn sie alt genug ist, um zu bluten, ist sie auch alt genug, um zum Wohle Englands verheiratet zu werden. Töchter müssen doch für etwas gut sein.‹« Ja, das klang nach meinem Vater.
»Ich weiß nicht«, meinte Miss Katherine. »Das Reich der Moslems ist bestimmt ein gefährlicher Ort für sie …«
Mr. Ascham senkte die Stimme, aber ich konnte ihn trotzdem noch verstehen. »London ist ein gefährlicher Ort für sie, Kat. Die Zeiten sind unruhig. Der König wird von Tag zu Tag kränker und launischer, und der Hof ist in seiner Loyalität zwischen Edward und Mary gespalten. Unsere Elisabeth hat den schwächsten Anspruch auf den Thron, und dennoch bedroht ihre Anwesenheit in England die Ansprüche ihrer beiden Geschwister. Ihr wisst selbst, wie oft konkurrierende Erben auf mysteriöse Weise während Seuchenausbrüchen sterben …«
Hinter dem Türrahmen, an dem ich heimlich lauschte, schnappte ich leise nach Luft.
Miss Katherine schwieg für einen langen Moment.
»Sie wird auf der Reise gut behütet werden«, fuhr Mr. Ascham fort. »Der König stellt uns sechs seiner besten Soldaten als Eskorte zur Verfügung.«
»Es ist nicht nur ihre körperliche Sicherheit, die mir Sorgen bereitet. Ihre Moral muss auch beschützt werden. Sie wird eine Anstandsdame benötigen«, sagte Miss Katherine naserümpfend. »Es ist schon skandalös genug, dass sie mit zwei unverheirateten Männern wie Euch und Mr. Giles reisen soll – aber auch noch Soldaten!«
»Nun gut, wie wäre es dann mit Euch und John?«
»Seid nicht töricht. Ich bin viel zu alt und viel zu dick, um eine solche Reise zu unternehmen.« Miss Katherine war, das muss man zugeben, eine recht stämmige Person. Sie hatte erst im letzten Jahr im fortgeschrittenen Alter von 40 Jahren den freundlichen John Ashley geheiratet (obwohl sie immer noch wollte, dass ich sie als Miss ansprach, weil es sie, wie sie meinte, jünger machte).
»Gut, dann …«, überlegte Mr. Ascham.
»Eine verantwortungsbewusste Anstandsdame, Roger, verheiratet oder zumindest verlobt. Eine Person, die ein moralisches Beispiel für Elisabeth sein kann. Nicht irgendeine dumme Metze, die in Versuchung gerät, in einem exotischen Land umherzustreunen oder sich auf der Reise dorthin mit den Soldaten einzulassen – wartet, ich weiß jemanden! Primrose Ponsonby und ihr Gemahl Llewellyn!«
Mein Lehrer stöhnte leise. »Die Ponsonbys …«
»Sie sind vorbildliche Christen«, beharrte Miss Katherine, »tragischerweise kinderlos, aber immer bereit, dem König zu Diensten zu sein. Wenn sie Euch begleiten, Roger, werden meine Sorgen zumindest zum Teil beschwichtigt sein.«
»Nun gut, dann sei es so.«
Einen Moment später betraten die beiden unser Studierzimmer.
Mr. Ascham nickte mir zu. »Was meinst du, Bess, da wir diesen Ort ohnehin verlassen müssen – hättest du Lust, auf ein Abenteuer auszuziehen?«
»Wohin, Sir?«, fragte ich, Unwissenheit heuchelnd.
»Du weißt genau, wohin, junge Lady. Du hast hinter der Tür gelauscht.« Er lächelte. »Du musst lernen, leiser nach Luft zu schnappen, wenn du eine Meisterspionin werden willst, meine Kleine. Wir fahren zum Schachturnier in Konstantinopel. Um zuzusehen, wie Mr. Giles sich schlägt.«
Mit einem strahlenden Lächeln sprang ich auf. »Was für eine prächtige Idee! Dürfen Gwinny und Elsie auch mitkommen? Bitte!«
Mr. Ascham runzelte die Stirn und warf Miss Katherine einen Seitenblick zu. »Ich fürchte, ich beuge schon zu viele Regeln, indem ich dich mitnehme, meine junge Prinzessin. Es wäre von deiner Anstandsdame zu viel verlangt, drei von euch zu hüten, aber zwei sollten akzeptabel sein. Du darfst eine Freundin mitnehmen.«
Ich zögerte und sah meine beiden Freundinnen an. Da warst du, Gwinny, schüchtern und brav, ein Mauerblümchen, wie es im Buche stand, und schautest mich mit stiller Hoffnung an, während Elsies gesamtes Wesen vor Aufregung erstrahlte – ihre Augen waren weit aufgerissen, ihre Fäuste in erregter Vorfreude geballt. Sie liebte romantische Geschichten über verwegene Prinzen in funkelnden Palästen. Mit einer Reise in eine exotische Stadt fern im Osten würde ein Traum für sie in Erfüllung gehen. Ich genoss ihre ungeteilte Aufmerksamkeit, und das gefiel mir.
»Ich nehme Elsie mit!«, rief ich, und Elsie quiekte und warf begeistert ihre Arme um mich. Während sie mich beinahe erdrückte, muss ich gestehen, dass ich nicht bemerkte, wie du enttäuscht den Kopf senktest.
Wenn man jung ist, macht man Fehler. Das gehört nun einmal dazu. Und im Hinblick auf die furchtbaren Dinge, die sich in Byzanz ereigneten, war diese Wahl vielleicht ein Fehler.
Aber andererseits, wenn ich die aufrichtige und dauerhafte Freundschaft bedenke, die sich im Laufe unseres Lebens zwischen uns entwickelt hat, Gwinny – und glaube mir, Königinnen brauchen aufrichtige Freunde –, dann ist ein Teil von mir froh über diesen Fehler, denn indem ich mich für Elsie entschied, ersparte ich dir die zerrüttende Erfahrung, persönlich die Ereignisse mitzuerleben, deren Zeuge ich am Hofe des moslemischen Sultans wurde.
Die Reise, Oktober 1546
Wir verließen Hertfordshire am ersten Tag des Oktober im Jahre unseres Herrn 1546 mit einer kleinen Karawane aus zwei Wagen und sechs berittenen Soldaten als Eskorte.
Mr. Ascham ritt voran auf seinem geliebten Ross, einer großen Stute, die als Turnierpferd kläglich versagt hatte. Meinem Lehrer war das egal; er hatte sie wegen ihres sanften Gemüts gekauft. Mit seinem Langbogen über der Schulter führte er unseren Trupp an. Mr. Ascham hatte ein Buch über die Kunst des Bogenschießens geschrieben, in dem er seiner Meinung Ausdruck verlieh, dass jeder männliche Engländer, der das Erwachsenenalter erreicht hatte, verpflichtet werden sollte, sich regelmäßig in der Benutzung des Langbogens zu üben. Er selbst trug, wann immer er reiste, seinen ledernen Daumenring am rechten Daumen und einen Armschutz am linken Unterarm, für den Fall, dass er einmal schnell einen Pfeil abschießen musste.
In der Hauptkutsche fuhr mit Elsie und mir Mrs. Primrose Ponsonby, die selbst in dem schaukelnden Gefährt mit perfekter Haltung saß, den Rücken durchgedrückt, die Hände züchtig im Schoß gefaltet. Sie war 26 Jahre alt, verheiratet, aber kinderlos, und frommer als eine Nonne. Die Haube ihres himmelblauen Reiseumhangs war perfekt geplättet (die Farbe beschwor vor meinem geistigen Auge Bilder der Jungfrau Maria herauf, und ich fragte mich, ob das wohl auch ihre Absicht war); der Puder auf ihrem Gesicht war makellos aufgetragen; und ihre Lippen waren, wie immer, zu einem Ausdruck der Missbilligung gekräuselt. Alles erregte Anstoß bei ihr: der tiefe Ausschnitt von Elsies Mieder (ein Zeichen für die lockere Moral der heutigen Zeit), die schlammbespritzte Rüstung unserer berittenen Begleiter (Mangel an Disziplin) und natürlich die Moslems (»gottlose Heiden, die in der Hölle brennen werden«). Manchmal dachte ich, dass Mrs. Ponsonby bewusst nach Dingen suchte, die Anstoß erregten.
Elsie konnte sie nicht ausstehen. »Scheinheilige, prüde Kuh«, murmelte sie, wenn Mrs. Ponsonby wieder einmal verlangte, dass sie ihr Dekolleté mit einem Schal bedeckte. »Wir hätten mehr Spaß mit Papst Paul als Anstandsdame!«
Mrs. Ponsonbys Gemahl Llewellyn – ein kleiner, rotgesichtiger Mann, ebenso fromm wie seine Frau, aber nach allem, was ich sah, mehr ihr Diener als ihr Gefährte – ritt auf einem Esel neben unserer Kutsche her. Er wieselte immer diensteifrig um seine Frau herum und überschlug sich fast in seiner Hast, ihre Befehle auszuführen, die immer mit dem schrillen Ruf »Llewellyn Ponsonby!« angekündigt wurden.
Ich seufzte. Die beiden waren nicht gerade ein leuchtendes Beispiel für die Freuden und Vorteile der Ehe, und als Anstandspersonen – nun ja, ich befürchtete, dass Elsie recht hatte.
Auf dem Weg nach Dover kamen wir durch London. Dort sprachen Mr. Ascham und Mr. Giles kurz in Whitehall vor, um etwas bei meinem Vater abzuholen: einen prächtigen scharlachroten Umschlag mit vergoldeten Rändern wie auf dem Einladungsschreiben des Sultans. Dieser Umschlag war mit einem Wachssiegel verschlossen, das in der Mitte den Abdruck des Ringes meines Vaters trug. Eine private Nachricht von König zu König. Mein Lehrer würde den Umschlag während der gesamten Dauer der Reise bei sich tragen.
Ich wusste nicht, welche Nachricht oder Nachrichten der Umschlag enthielt. Wie ich später erfuhr, wusste mein Lehrer es auch nicht.
So gern ich es auch gewollt hätte, begleitete ich meinen Lehrer nicht in den Palast von Whitehall. Nur selten sah ich meinen Vater, und nie im kalten Licht des Hofes. Er thronte irgendwo an den Rändern meiner Welt, eine gottähnliche Gestalt, auf die ich nur gelegentlich einen Blick erhaschen konnte, die ich aber nie vollständig zu Gesicht bekam.
Natürlich wurde jeden Tag über ihn gesprochen. Er wurde geliebt und gefürchtet, bewundert und gefürchtet, respektiert und gefürchtet. Es hieß allgemein, mein Vater habe mehr Menschen hinrichten lassen als jeder andere englische Monarch vor ihm. Aber er war auch bekannt für seinen scharfen, gebildeten Verstand, für sein Geschick in jeder Art von körperlicher Betätigung, für seine musikalische Begabung – und für seine Zuneigung zu jedem hübschen Ding, das einen Rock trug, selbst wenn sie mit einem anderen verheiratet war.
Sein Umgang mit mir war normalerweise sehr oberflächlich und geschäftsmäßig. Ich war ein Nebenprodukt seines Königseins, und noch dazu ein lästiges: eine Tochter. Wirklich väterlich hatte er sich mir gegenüber vielleicht drei Mal verhalten, und bei jeder dieser Gelegenheiten hatte ich ihn vergöttert. Seine jüngste Bemerkung, ich sei »alt genug, um zu bluten«, entsprach schon eher der Regel – meine Befähigung, für England zu heiraten und Kinder zu bekommen, machte mich plötzlich nützlich.
Elsie und ich warteten vor dem Palast unter den wachsamen Blicken unserer beiden Anstandspersonen, der sechs Wachen und der sieben Köpfe von erst kürzlich hingerichteten Verrätern, die aufgespießt über den Toren thronten.
Das wütende Gebrüll eines gereizten Bären erklang aus einer benachbarten Gasse, gefolgt von den Anfeuerungsrufen einer Menschenmenge. Ich warf einen Blick um die Gebäudeecke und sah das arme Tier: eine mächtige Bestie, angekettet an einen Pfahl im Boden und in ohnmächtiger Wut brüllend, während zwei große Doggen sie angriffen und ganze Büschel aus ihrem Fell herausbissen. Es gelang dem Bären, einen der Hunde mit einem mächtigen Tatzenhieb zu erwischen, woraufhin dieser mit einem gequälten Kläffen an eine Mauer geschleudert wurde und tödlich verwundet zu Boden sackte. Während der Hund starb, wurde eine neue Dogge freigelassen, die seinen Platz einnahm. Die Menge jubelte daraufhin noch lauter.
Mrs. Ponsonby war verständlicherweise angewidert. »Ich hätte gedacht, Engländer wären aus einem anderen Holz geschnitzt. Kommt, Mädchen. Wendet die Blicke ab.«
In diesem Fall war ich tatsächlich einmal einer Meinung mit ihr.
Nach unserem kurzen Halt in Whitehall reisten wir rasch nach Dover weiter und dann über den Kanal nach Calais.
Dort wechselten wir auf Mr. Aschams Anraten die Kleidung und zogen etwas weniger Farbenfrohes an als das, was wir im Süden Englands getragen hatten. Elsie und ich trugen schlichte Gewänder ohne Reifröcke (was, wie ich sagen muss, die Bewegung sehr erleichtert). Mit ihrem anmutigen Hals, ihrem blonden Haar und ihrem jugendlichen Körper schaffte Elsie es, auch in diesem groben Kittel wie ein Engel auszusehen.
Mrs. Ponsonby schürzte verärgert die Lippen, als Mr. Ascham sie zwang, einen schlichten braunen Reisemantel anzuziehen. Ihr blauer Reiseumhang, sagte er, sei nicht das Richtige für eine Reise quer durch den Kontinent – damit werde sie mit ziemlicher Sicherheit die Aufmerksamkeit von Straßenräubern erregen. Elsie konnte ihre Schadenfreude über diesen Wortwechsel kaum verhehlen.
Mr. Ascham kleidete sich für unsere Reise auf eine Weise, die, wie ich finde, eine genauere Beschreibung rechtfertigt.
In Hertfordshire trug er immer die steife, formelle Garderobe eines Mannes von Stand: Halskrause, Robe, Kniehosen und lange Strümpfe an den Füßen. Jetzt jedoch legte er eine Kleidung an, die sich grundlegend davon unterschied: eine lange braune Hose aus derbem Stoff, kniehohe Reitstiefel und ein braunes Wams aus robustem spanischem Leder. Darüber trug er einen langen schwarzen Mantel aus gefettetem, grobem Leinen, der ihm bis zu den Knöcheln reichte. Auf seinen Kopf setzte er einen weitkrempigen braunen Hut, der unempfindlich gegen Regen zu sein schien.
All das verlieh meinem geliebten Schulmeister ein weitaus raubeinigeres Aussehen als das, was ich von ihm gewohnt war. Er wirkte mehr wie ein Entdecker oder Abenteurer als wie der Lehrer eines kleinen Mädchens aus Hertfordshire.
Er sah härter und rauer aus, und vielleicht auch ein bisschen verwegen.
Durch Frankreich kamen wir zügig voran.
Auch wenn mein Vater nominell der König von Frankreich war, schien das für die Bewohner des Landes doch ein wunder Punkt zu sein, deshalb reisten wir inkognito durch die Länder der Franken, ja wir gingen sogar so weit, dass wir nicht einmal bei königlichen Verwandten übernachteten.
Stattdessen kehrten wir in Schenken und Wirtshäusern ein, für gewöhnlich übel riechende und abstoßende Spelunken, die selbst für Hunde zu schäbig waren, ganz zu schweigen von menschlichen Wesen. Ein paarmal – ja, es ist wirklich wahr! – schliefen wir sogar in unseren Wagen am Wegesrand, während unsere Soldaten im Schein eines Lagerfeuers Wache hielten.
Während mich der grausame Zeitvertreib meiner englischen Landsleute in Whitehall sehr traurig gemacht hatte, war ich schockiert von den Sitten der französischen Landbevölkerung, insbesondere von ihrem ausschweifenden Trinken und Feiern und ihrer mangelhaften Körperhygiene. Einmal sah ich, wie ein Mann in den Rinnstein urinierte und sofort anschließend mit seinen ungewaschenen Händen nach einem Hühnerbein griff, um es zu essen.
Ich erwähnte es meinem Lehrer gegenüber und fragte ihn, was der Anblick solcher Szenen wohl zu meiner königlichen Erziehung beitragen sollte.
»Bess«, sagte er. »Die meisten bei Hofe glauben wohl nicht daran, dass du jemals auf dem Thron von England sitzen wirst, aber wenn es um die Thronfolge geht, sollte man niemals auch nur den entferntesten Erben außer Acht lassen. Sollte Edward die Pocken bekommen und Mary mit ihrem Glaubenseifer den Hof gegen sich aufbringen, wärst du unversehens Königin von England, Irland und Frankreich. Und wenn das der Fall wäre, dann würde die Erziehung, die du durch mich erhältst, darüber entscheiden, ob du eine gute Königin von England wirst oder nicht. Diese Reise wird die müheloseste Unterrichtslektion sein, die ich dir je erteile, denn alles, was du zu tun hast, ist zuzusehen. Zuzusehen und die Gebräuche, Aktivitäten und Vorlieben realer Menschen zu beobachten, denn es sind reale Menschen, über die ein König oder eine Königin herrscht.«
Auch wenn ich nicht ganz überzeugt war, glaubte ich es ihm.
Jeden Abend, ganz egal, wo wir übernachteten, spielten Mr. Ascham und Mr. Giles Schach. Meistens gewann Mr. Giles, aber in der Regel erst, nachdem das Spiel sich über eine geraume Zeit erstreckt hatte und nur noch ein paar Bauern und der König auf dem Brett verblieben waren. Oft ging ich zu Bett, bevor sie fertig waren.
Einmal fragte ich meinen Lehrer, warum denn Mr. Giles, wenn er doch ein so starker Schachspieler war, jeden Abend spielen müsse.
Mr. Ascham antwortete: »Es ist von besonderer Bedeutung, dass Giles seinen Verstand frisch und wach erhält. Schachspielen ist nicht anders als jeder andere Sport. Genau wie beim Lanzenstechen oder Bogenschießen muss man seine Muskeln trainieren und vorbereiten.«
»Sport? Ihr nennt Schach einen Sport?«
»Aber natürlich!« Mr. Ascham wirkte schockiert. »Es ist der erhabenste Sport von allen, denn der Spieler tritt gegen seinen Gegner unter absolut gleichen Voraussetzungen an. Körperliche Größe ist kein Vorteil im Schach. Ebenso wenig Alter oder – junge Dame – das Geschlecht. Beide Spieler verfügen über die gleichen Figuren, die sich nach denselben Regeln bewegen. Schach ist die Königin aller Sportarten.«
»Aber Sport ist doch eine körperliche Aktivität. Gehört zur Definition von Sport nicht, dass ein Spieler sich durch seine Anstrengungen erschöpft oder zumindest ins Schwitzen gerät? Schach ist nur ein Gesellschaftsspiel, bei dem beides nicht zutrifft.«
»Ein Gesellschaftsspiel! Ein Gesellschaftsspiel!«, rief Mr. Ascham entrüstet. Aber statt das Thema weiter mit mir zu diskutieren, nickte er nur nachdenklich. »Also gut. Akzeptieren wir deine Definition für den Augenblick, und dann lass uns anhand deiner Beobachtungen beim bevorstehenden Turnier entscheiden, ob Schach diesen Kriterien einer Sportart genügt.«
Während sie ihre abendlichen Partien spielten, plauderten Mr. Ascham und Mr. Giles miteinander – über die Ereignisse des Tages oder den Aufstieg Martin Luthers oder über andere Themen, die sie gerade interessierten.
Ich bewunderte die Ungezwungenheit, mit der sie sich unterhielten. Sie waren schlicht und einfach gute Freunde, die sich in der Gegenwart des anderen so wohlfühlten, dass sie über alles reden konnten, ob es nun gut gemeinte Ratschläge oder ernste Kritik waren. Einmal, als ich mit Mr. Ascham auf seinem Pferd ritt, fragte ich ihn, wie und wann er und Mr. Giles Freunde geworden waren.
Mein Lehrer lachte leise. »Wir waren beide hoffnungslos in dasselbe Mädchen verliebt.«
»Ihr wart Rivalen und seid jetzt die besten Freunde? Das verstehe ich nicht.«
»Sie war Debütantin und das schönste Mädchen in ganz Cambridge.« Mr. Ascham schüttelte den Kopf. »Schön, aber auch eigensinnig. Giles und ich waren Studenten, ungestüm und jung. Wir konkurrierten schamlos um ihre Zuneigung – ich mit grässlichen Liebesgedichten, er mit Blumen und Witz –, und sie akzeptierte bereitwillig unserer beider Avancen, bis sie mit dem Erben eines riesigen Anwesens davonlief, der sich später als Trunkenbold und Dummkopf erwies und schließlich sein gesamtes Land an einen Geldverleiher verlor. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist, aber im Verlauf unseres gemeinsamen Scheiterns wurden Giles und ich enge Freunde.«
»Und er lehrt jetzt in Cambridge?«
»Ja. Säkulare Philosophie. Wilhelm von Ockham, Thomas von Aquin, Duns Scotus und dergleichen.«
»Und er ist unverheiratet, so wie Ihr, nicht wahr?«, fragte ich und versuchte, so unschuldig wie möglich zu klingen. Das Thema interessierte Elsie besonders. Sie fand Mr. Giles recht anziehend »auf eine intellektuelle Weise«.
»In der Tat«, erwiderte Mr. Ascham, »aber im Gegensatz zu mir nicht freiwillig. Giles war einmal verheiratet – mit der Tochter seines Philosophieprofessors, einer sehr klugen und entzückenden jungen Frau namens Charlotte Page. Charlottes Vater erlaubte ihr, seinen Vorlesungen beizuwohnen, versteckt im hinteren Teil des Raumes, und so lernte sie alles, was auch die jungen Männer lernten. An Bildung konnte sie es mit jedem von ihnen aufnehmen, und Giles vergötterte sie. Sie heirateten, aber ein Jahr nach der Hochzeit erkrankte sie an der Pest und starb mit 21 Jahren. Seither hat Giles nie wieder Interesse am anderen Geschlecht gezeigt.«
Ich schaute zu Mr. Giles, der nicht weit von uns auf seinem Pferd ritt und gedankenverloren in die Landschaft blickte, und ich fragte mich, ob er wohl gerade an sie dachte. »Armer Mr. Giles.«
Mr. Ascham lächelte düster. »Ja. Aber andererseits – ist es besser, für eine kurze Weile tief und wahrhaftig zu lieben, als niemals zu lieben?«
Ich wusste es nicht. In jener Phase meines Lebens waren Knaben oder junge Männer noch eine große Unbekannte für mich. Während ich sie nur ein Jahr zuvor noch als lästig und störend empfunden hatte, fand ich sie jetzt faszinierend. Die Vorstellung jedoch, einmal einen wirklich zu lieben, war bestenfalls eine vage Ahnung.
»Ist das der Grund, weshalb Ihr unverheiratet seid?«, fragte ich. »Wartet Ihr auf eine ähnliche allumfassende Liebe?«
»Das mag vielleicht sein«, antwortete mein Lehrer. »Aber der eigentliche Grund ist, dass ich noch einige Projekte beenden möchte, bevor ich mich irgendwo häuslich niederlasse.«
»Als da wären?«
»Nun, du zum Beispiel.«
Im Reich der Habsburger
Schließlich durchquerten wir Burgund und die Rheinebene und gelangten in das Reich der Habsburger.
In einem weiten Bogen reisten wir um die Berge herum, von denen die Schweizerische Eidgenossenschaft beschützt wird, wir durchquerten dichte Wälder und eindrucksvolle Täler und erblickten die hoch aufragenden Burgen der deutschen Adligen.
Ich vermute, dass ich mit einem ständigen Ausdruck des Erstaunens auf meinem Gesicht reiste – jeder Tag unserer Reise brachte neue Eindrücke, neue Menschen, neue Kulturen.
Im Reich der Habsburger wurden auch unsere Unterkünfte besser. Durch ein labyrinthisches Netz von ehelichen Verbindungen, das nicht einmal der Hofastronom hätte berechnen können, besaß die Familie meines Vaters zahlreiche entfernte Verwandte in diesem Teil der Welt, und es war deren Gastfreundschaft, die wir genossen. (Mir blieb nicht verborgen, dass wir in Frankreich, dessen König mein Vater offiziell war, mit Heimlichkeit und Vorsicht gereist waren, während wir in den deutschen Regionen, wo mein Vater keinen derartigen Titel besaß, frei und offen unterwegs waren.)
Wir übernachteten in prächtigen Landhäusern und manchmal in Burgen oder Schlössern, die auf Hügeln thronten, und wir aßen auch wieder standesgemäß: gebratenes Wild, feines Weizenbrot, Rotwildpastete und einige der köstlichsten Lebkuchen, die ich je probieren durfte. Unter der offenkundigen Missbilligung unserer Anstandspersonen genehmigten sich Mr. Ascham und Mr. Giles einmal einige Gläser Rheinwein, ein kräftiger deutscher Wein (und ich weiß, dass es Elsie ebenfalls gelang, schnell und heimlich ein Glas davon zu trinken).
Am nächsten Morgen klagten alle drei über stechende Kopfschmerzen. Die frommen Ponsonbys tranken nur Birnenmost und hatten keine solchen Beschwerden.
Je weiter wir jedoch nach Osten reisten, desto häufiger übernachteten wir in den Gasthäusern und Bierhallen der Bergwerksstädte in Bayern. Hier spielte Mr. Giles oft gegen starke einheimische Schachspieler, während wir anderen zusahen oder aßen.
Ich verfolgte diese Partien aufmerksam und mit großer Begeisterung, während Mrs. Ponsonby ruhig neben mir saß und strickte, äußerlich desinteressiert, aber in Wirklichkeit immer wachsam.
Elsie hingegen – und ich muss sagen, dass ihr schnell langweilig wurde – sah zwar auch manchmal zu, aber öfter noch zog sie sich in unsere Gemächer zurück oder an andere Orte, von denen ich nichts wusste. Und genauso wie Elsie sich nicht um Mrs. Ponsonby scherte, scherte diese sich auch nicht um Elsie.
»Meine Aufgabe ist es, auf dich und nur auf dich achtzugeben, Elisabeth«, sagte sie einmal zu mir. »Ich überlasse es Gott, unserem Herrn, die Seele dieser kleinen Schlampe zu retten.«
Auf jeden Fall genoss ich es sehr, Mr. Giles beim Schachspiel zuzusehen. Er war ein überaus einfallsreicher und gerissener Spieler.
An manchen Abenden gab er mir Unterricht im Schach. Wie viele unerfahrene Spieler setzte ich immer meine Dame ein, um große Lücken in die Reihen seiner Figuren zu sprengen, aber immer wieder schlug er unweigerlich meine blutrünstige Dame mit einem Springer, den ich nicht kommen sah. Oftmals nahm er sie, nachdem er meinem König mit dem gleichen Springer Schach geboten hatte, ein Manöver, das er als Gabel bezeichnete.
»Der Springer ist der größte Feind der Dame«, erklärte er mir in einem Wirtshaus, »denn obwohl die Dame die Züge aller anderen Figuren beherrscht, bleibt ihr die Zugweise des Springers verschlossen. Deshalb müsst Ihr immer, wenn Ihr Eure Dame bewegt, nach einer Springergabel Ausschau halten. Setzt sie niemals auf ein Feld, das einem gegnerischen Springer ermöglicht, gleichzeitig sie und den König anzugreifen. Das ist der häufigste Fehler, den Amateurspieler machen.«
Nachdem ich ihn viele Partien hatte spielen sehen, fiel mir auf, dass Mr. Giles vor allem zwei Arten von Eröffnungen benutzte, von denen er nur selten abwich. Als ich meinen Lehrer danach fragte, erklärte er mir, dass Mr. Giles »das Zentrum des Brettes kontrolliert« und »eine Basis für spätere Angriffe schafft«. Mir machte es mehr Spaß, Figuren zu schlagen.
Wenn er gegen mich spielte, sagte Mr. Giles oft: »Miss Bess, im Schach spielt man nie die Figuren, man spielt den Gegner. Beobachtet seine Augen, haltet Ausschau nach den Momenten, in denen er viel und rasch blinzelt oder wenn er den Atem anhält, denn das sind die Momente, in denen Euer Gegner etwas plant. Und andererseits unterdrückt Eure eigenen Gefühle, denn im Leben genauso wie im Schach können sie Eure Absichten verraten.« Als er das sagte, warf er mir einen bedeutungsvollen Blick zu. »Das gilt ganz besonders für Königinnen und Prinzessinnen.«
Er lächelte. Ich lächelte zurück. Ich mochte Mr. Giles.
Mr. Giles stellte seinen Gegnern gern teuflische Fallen, und auch das konnte ich allmählich erkennen, nachdem ich ihm oft genug beim Spielen zugesehen hatte. Dann wartete ich gespannt darauf, dass er seine Falle zuschnappen ließ (und seinem eigenen Ratschlag getreu verriet sein Gesicht niemals seine Absichten).
Seine bevorzugte Falle kam zum Einsatz, wenn sein Gegner rochierte. Wenn er das sah, positionierte Mr. Giles wie beiläufig seine Dame vor einem seiner Läufer und wartete auf seine Gelegenheit.
Und dann, gerade wenn der Gegner dachte, das Spiel trete in eine neue Phase ein, schlug Mr. Giles zu wie eine Kobra. Seine Dame schnellte diagonal quer über das Brett, bis sie, gedeckt von ihrem treuen Läufer weit hinter ihr, Nase an Nase mit dem gegnerischen König stand und Mr. Giles ruhig sagte: »Schachmatt.«
Einmal in einem Wirtshaus machte Mr. Giles genau diesen Zug und erzürnte damit seinen Gegner, einen Arbeiter eines Salzbergwerks, der sich für einen meisterhaften Spieler hielt und in seinem Heimatort angeblich ungeschlagen war. Als er sah, dass er verloren hatte, sprang der Bergmann auf, wobei er seinen Stuhl umwarf, und versetzte Mr. Giles einen heftigen Stoß vor die Brust.
Mr. Ascham, der danebenstand, bewegte sich mit überraschender Schnelligkeit und fing Mr. Giles auf, bevor dieser auf dem Boden aufschlug.
Der Bergmann ragte drohend vor den beiden auf, ein kräftiger Bursche, dessen Gesicht noch schmutzig von der Arbeit unter Tage war.
»Ihr habt betrogen!«, knurrte er.
»Ich entschuldige mich, dass ich Euch geschlagen habe, mein Herr, aber ich habe nicht betrogen«, erwiderte Mr. Giles in versöhnlichem Ton.
»Wir spielen noch einmal!«, dröhnte der Riese.
Mr. Ascham trat vor. »Ich denke, das reicht für den Abend. Vielleicht können wir Euch zu einem Krug Bier einladen, als Dank für eine gut gespielte Partie.«
»Oder vielleicht breche ich Euch beiden alle Knochen, besorge es Eurem kleinen Mädchen und kaufe mir selbst was zu trinken!«, schnaubte der Bergmann. Einige seiner Freunde lachten drohend.
»Das wird nicht geschehen«, sagte Mr. Ascham mit ruhiger Stimme.
Der bullige Bergmann erstarrte. Im ganzen Wirtshaus wurde es totenstill. Ich schaute mich um und sah, dass die Anwesenden mit großem Interesse die Konfrontation beobachteten.
Der Bergmann funkelte meinen Lehrer an. »Ich weiß, dass Ihr mit einer Eskorte reist, Fremder, aber Eure Wachen sind draußen. Ich werde Euch zu Brei geschlagen haben, bevor sie durch diese Tür hereingekommen sind.«
Und dann, mit einer schockierenden Plötzlichkeit, schlug der Bergmann mit seiner mächtigen Faust nach dem Gesicht meines Lehrers.