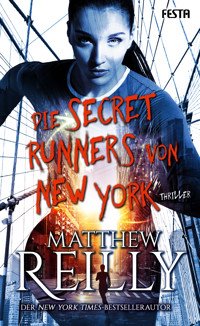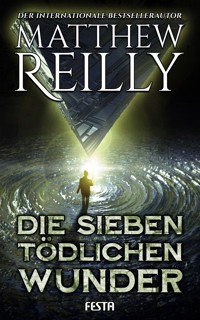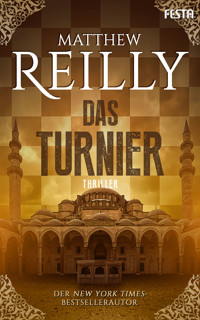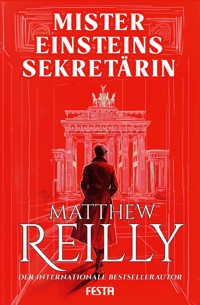
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1919 wird das Leben der jungen Studentin Hanna Fischer plötzlich auf den Kopf gestellt. Als Sekretärin und Spionin von Albert Einstein muss sie um ihr Leben kämpfen. In den gefährlichsten Zeiten des letzten Jahrhunderts wird sie einigen der berühmtesten und berüchtigtsten Menschen der Geschichte begegnen: Hitler, Nazis, Gangsterbossen in New York City … Aber Vorsicht: Vielleicht ist nicht alles so, wie es scheint! Ein Action-Epos von Matthew Reilly, das uns durch 40 brutale Jahre der Geschichte katapultiert. Guardian: »Ein spannendes, actiongeladenes Abenteuer von der ersten bis zur letzten Seite.« Sydney Morning Herald: »Action, die einem Lee Child würdig ist.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus dem australischen Englisch von Heiner Eden
Impressum
Die australische Originalausgabe Mr. Einstein’s Secretary
erschien 2023 im Verlag Macmillan.
Copyright © 2023 by Karanadon Entertainment Pty Ltd.
Published by arrangement with Rachel Mills Ltd.
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by
Festa Verlag GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 10
04451 Borsdorf
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Titelbild: @difrats
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-200-1
www.Festa-Verlag.de
www.Festa-Action.de
Für Kate Freeman, CFA
Die Physiker der 1920er und 1930er waren die Hexenmeister ihres Zeitalters, die genialen Hüter einer neuen Art der Hexerei – der des Atoms. Und ihr Hohepriester war Einstein.
Aus: Das Nuklearzeitalter von Scott Sollers
(W. M. Lawry & Co., London, 2010)
Die mustergültige Sekretärin sollte so viel Sorgfalt auf ihre äußere Erscheinung wie auf das Schreiben mit einer Schreibmaschine legen. Letztendlich besteht ihre Arbeit darin, ihren Chef gut aussehen zu lassen und all die eintönigen Pflichten zu erledigen, damit ihr Chef seinen Verstand auf solche Geschäftsangelegenheiten verwenden kann, für die das männliche Gehirn bekanntermaßen besser geeignet ist.
Aus: Die moderne Sekretärin
(Merkblatt, ca. 1939 veröffentlicht)
Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, muss man in Bewegung bleiben.
Albert Einstein
1948
PRINCETON, ÖFFENTLICHER FRIEDHOF
20. JANUAR 1948
Der große Einstein ist der Erste, der zu meiner Beerdigung kommt, und das trotz seines Alters, seiner schlechten Gesundheit und der beißenden Kälte eines Wintertages in New Jersey.
Es ist wahrlich eine seltsame Sache, die eigene Beerdigung zu beobachten.
Zu sehen, wer kommt. Zu sehen, wie viele kommen. Zu hören, was sie über dich sagen.
Meine ist eine trostlose Angelegenheit.
Es lassen sich nur vier Leute blicken.
New Jersey im Winter ist ein rauer Ort, doch am Tag meiner Beerdigung ist es besonders schlimm: Der Himmel ist grau, es fällt Schnee, der gefrorene Boden knirscht unter den Sohlen.
Ich rede mir ein, dass vielleicht das Wetter für die dürftige Anteilnahme verantwortlich ist.
Oder vielleicht ist es nun mal so bei Spionen. Der einzige Grund für mein geheimes Leben war der, dass niemand wusste, was ich tat, sogar wenn es gefährlich, entsetzlich und hin und wieder geschichtsträchtig war.
Mehr als alles andere regt es zum Nachdenken an, die eigene Beerdigung zu sehen.
Es weckt Erinnerungen.
Einstein dabei zuzusehen, wie er durch das Tor wankt und sich schwer auf seinen Gehstock stützt, lässt mich daran denken, wie er als jüngerer Mann war: so quicklebendig, so rege, so tatkräftig, sowohl geistig als auch körperlich. Niemand – wirklich niemand – hatte mehr Enthusiasmus als Einstein: für die Physik, fürs Entdecken, fürs Leben, für das schiere Streben nach Freude.
Am Tag meiner Beerdigung war er 68.
In ein paar Jahren würde er tot sein.
An seiner Seite, seinen Ellbogen haltend und ihn stützend, war wie immer Helen Dukas, seine treue Erste Sekretärin.
Seit 1928 – gleich nachdem ich das zweite Mal für Einstein gearbeitet hatte – war sie seine Tagebuchführerin, Haushälterin und Türhüterin.
Es war dieses letzte Aufgabenfeld – als Türhüterin –, in dem sie sich besonders auszeichnete.
Anders als ich war Helen so unnachgiebig wie Eisen. Sie war so streng, wie Einstein leutselig war, und so organisiert wie er chaotisch. Sie war imstande, die Einladung eines Königs abzulehnen, ohne mit der Wimper zu zucken, was sie auch mehr als einmal tat.
Es war nicht ihre Aufgabe, Einstein zu behüten, sondern seine Zeit. Das machte sie zweifellos zu einer der besten Sekretärinnen in der Geschichte.
Mrs. Katherine Graham-Coulson hätte ihren Segen gegeben. (Regel Nr. 1: »Ihr Job ist es, Ihrem Chef zu helfen, seinen Job zu machen!«)
Während ich das Schauspiel beobachte, ertappe ich mich dabei, an mein eigenes Leben zurückzudenken.
Es erscheint in Bruchstücken vor meinem geistigen Auge; aufblitzende Zeitabschnitte der letzten vier Jahrzehnte.
Es sind Abschnitte, in denen ich mich in der Gegenwart von echten Genies wie Einstein, Curie und Bohr wiederfand, in der von falschen Genies wie Speer und Heisenberg und den schlimmsten aller Monster wie Heydrich, Bormann und sogar Hitler höchstpersönlich.
Oder an die Wettrennen mit Horden von Nazis, um Dokumente, die die neue Wissenschaft des Atoms betrafen, in Sicherheit zu bringen. Oder an die Zeit, als ich dem tödlichsten Mörder-Spion der Sowjetunion gegenübertrat.
Seltsamerweise sind es die Gerüche, an die ich mich am besten erinnere; die Düfte meines Lebens.
Das liebste Parfüm meiner Mutter, die einzige wertvolle Sache, die sie je besaß.
Menschliche Scheiße in einer russischen Folterkammer.
Einsteins Aftershave, hauptsächlich deshalb, weil er es so selten benutzte. (»Es ist nur für besondere Anlässe!«, hatte er vergnügt angemerkt. »Wie ein Treffen mit Staatsoberhäuptern und meiner Schwiegermutter.«)
Die Aromen New Yorks in den 1920ern: durchgebrannte elektrische Kabel in der U-Bahn; Zigarrenrauch in den Spelunken; die Brylcreem in den Haaren von Gangstern wie Baby Face Mancino; Leichen in einer Lagerhalle für Fische; und der Geruch der Zementschuhe, die ein Kerl trug, der seine Schulden bei Baby Face nicht begleichen konnte.
Das frische Farbband in einer Model No. 5 Underwood-Schreibmaschine.
Kirschblüten, die den Frühling in Berlin verkünden.
Der Geruch von Bombenexplosionen in Berlin.
Der Gestank der panischen Angst, als die Rote Armee die Stadt einnahm und nach Deutschen suchte, die man töten oder vergewaltigen oder essen konnte.
Die fürchterlichen Ausdünstungen der Öfen in Auschwitz.
Man vergisst den Geruch von verbranntem Menschenfleisch niemals.
Fanny kommt mit ihrem treuen Ehemann Raymond an ihrer Seite auf die Minute genau an. (Regel Nr. 3: »Seien Sie immer pünktlich!«)
Am Grab gesellt sie sich zu Einstein, und sie schütteln sich vertraut die Hände.
Wie Fanny sich doch verändert hat. Sie ist nun so selbstsicher, so beherrscht. Ich bin sehr froh, sie so zu sehen.
Mit nur diesen vier Anwesenden – Einstein, Helen Dukas, Fanny und Raymond – ist die ganze Sache eher zwanglos.
Was für eine armselige Darbietung, denke ich.
Einstein blickt sich um, zuckt die Schultern und beginnt, dort in dem fallenden Schnee, mit der Grabrede.
»Ich lernte Hanna Fischer in Berlin kennen, als sie noch ein kleines Mädchen war«, sagt er. »Sie war ein reizendes Ding und zeigte schon in einem ganz frühen Alter Anzeichen ihrer Genialität. Wir waren Nachbarn, und ich war mit ihrem Vater befreundet …«
Nicht schlecht für den Anfang, Albert.
Da er mich schon als Kind kannte, und später dann auch eine Zeit lang als Erwachsene, wusste er eine Menge über mich.
Aber nicht alles.
Er kann nicht die ganze Geschichte erzählen.
So kann er zum Beispiel nicht schildern, was ich in Deutschland vor und während des Krieges durchmachen musste. Auch weiß er nichts von den drei Verhören, die ich zu ertragen hatte, eines in Amerika, eines in Nazideutschland und eines in sowjetischer Gefangenschaft.
Und während ich Einstein zusehe, diesem unglaublichen Wissenschaftler, meinem ehemaligen Chef und der gütigsten Seele, die mir je begegnet ist, und er eine feierliche Rede auf meiner kleinen Beerdigung zum Besten gibt, ertappe ich mich dabei, an diese Verhöre zurückzudenken. Aus irgendeinem Grund gelingt es mir durch sie, die bruchstückhaften Erinnerungen in meinem Kopf zu einem Ganzen zusammenzusetzen.
ERSTES VERHÖR
NEW JERSEY, USA
1933
Nicht viele wissen, dass die Nazis ein Kopfgeld auf Einstein ausgesetzt hatten.
Bei drei Gelegenheiten verübten die Nazis Mordanschläge auf ihn. Der erste geschah im Jahre 1933 in der Nähe von Princeton, während Einstein die Vereinigten Staaten besuchte …
Aus Einstein von Thomas McMahon
EWING TOWNSHIP, BEZIRKSGEFÄNGNIS
TRENTON, NEW JERSEY
12. FEBRUAR 1933, 3:05 UHR
Die beiden amerikanischen Cops, die mich bewachten, sahen mich in völliger Verwirrung an.
Es war schwer einzuschätzen, was sie von mir hielten: eine schmale 31 Jahre alte deutsche Frau in einem Sommerkleid und mit Blut an der Stirn, die Hände eng mit Handschellen gefesselt.
»Bitte«, sagte ich. »Wenn Sie doch nur Mr. Einstein anrufen würden. Mr. Albert Einstein. Er wird Ihnen alles erklären.«
»Halten Sie uns vielleicht für dämlich, Lady?«, sagte der fettere der beiden Polizisten. »Wenn Sie Albert Einstein kennen, dann esse ich heute mit Franklin Roosevelt zu Abend.«
Ich wusste nicht, was ich tun sollte.
In all dem Trubel in Princeton war Einstein von Agent Kesslers Leuten vom Finanzministerium weggeschafft worden, und ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, wohin sie ihn gebracht hatten.
Mich hatten sie hierher verfrachtet, in eine kalte graue Arrestzelle im örtlichen Bezirksgefängnis – zusammen mit den beiden Attentätern.
Genau in jenem Augenblick saßen die beiden gescheiterten Attentäter in der Zelle neben mir, nur von einem Dutzend Eisengitter getrennt.
Wenn Beamte der deutschen Botschaft – Bedienstete der Nazis – hier waren, bevor die Leute von der Finanzbehörde kamen, würden die beiden nationalsozialistischen Meuchelmörder in die Nacht verschwinden und auf ein Schiff nach Europa gebracht und nie wieder gesehen werden.
»Also gut«, sagte ich. »Dann rufen Sie Special Agent Daniel Kessler – Dan Kessler – vom Finanzministerium an. Er wird Ihnen alles sagen.«
Die beiden Cops starrten mich verdutzt an.
»Keine Sorge, Schätzchen«, sagte einer von ihnen. »Wir haben schon jemanden angerufen. Sie werden ein paar nette Bundesbeamte kennenlernen, bevor all das hier vorbei ist, Sie verfluchte Krautfresserin.«
Ich seufzte und wandte mich ab.
Ich wusste, wie es aussah.
Obwohl ich schon seit Jahren in Amerika lebte, sprach ich noch immer mit einem deutschen Akzent, und hier war ich zusammen mit zwei echten deutschen Spionen, die versucht hatten, Albert Einstein während eines Besuchs der Princeton University zu töten.
Und mir war es unmöglich, meine Unschuld zu beweisen.
30 Minuten später trat ein Mann, der eine Uniform der US-Army trug und behauptete, dem militärischen Geheimdienst anzugehören, an meine Zelle und machte sich daran, mich die nächsten eineinhalb Tage lang mit nur einigen Unterbrechungen zu verhören.
Während er es tat, bewachten zwei bewaffnete Soldaten die Tür.
Er sagte, er sei Major Gil Willis, und er fragte mich über alle möglichen Dinge aus.
Mein jüngstes Leben in Amerika. Meine Jugendzeit davor in Deutschland.
Wenn ich ihn anflehte, Einstein anzurufen – was ich ziemlich häufig machte –, sagte er nur, dass er das tun werde, sobald der richtige Zeitpunkt dafür gekommen sei.
Und dann, nachdem ich 36 Stunden lang in dieser Zelle seinen Fragen ausgesetzt gewesen war, ließ ein Tumult im äußeren Empfangsbereich meinen Vernehmungsbeamten herumwirbeln, und dann –
Paff!
– flog die Zellentür auf und Einstein rauschte herein, gefolgt von Special Agent Kessler.
»Wo ist sie …?«, rief Einstein, bevor er mich sah und zu mir herübereilte. Er schloss mich in seine Arme und drückte mich erleichtert ganz fest an sich.
»O Hanna, meine Liebe, geht es dir gut?« Er berührte die Verletzung an meiner Stirn. »Bist du verletzt?«
»Mir geht es gut«, sagte ich. »Es ist nur ein Kratzer.«
Mein Vernehmungsbeamter saß nur sprachlos da.
Die örtlichen Cops starrten den berühmtesten Wissenschaftler der Welt mit offenen Mündern an.
Für sie war es wahrscheinlicher, dass sie zum Mond fliegen würden, als Albert Einstein zu treffen, und doch war er hier, dieser großartige Mann höchstpersönlich, und umarmte mich in dieser kalten, kahlen Gefängniszelle.
Und dann, was sie noch mehr verdutzte, sprach er sie direkt an: »Gentlemen, bitte nehmen Sie ihr die Handschellen ab.«
Fassungslos schweigend löste mein Vernehmungsbeamter die Handschellen um meine Handgelenke und machte einen Schritt zurück.
Ich erhob mich von meinem Stuhl.
»Grundgütiger, du frierst ja«, sagte Einstein und legte seinen Mantel um mich.
»Ich habe versucht, es ihnen zu erklären«, sagte ich. »Ich bat sie, Sie anzurufen, Sir, doch sie weigerten sich …«
Agent Kessler warf Major Willis einen finsteren Blick zu. »Ist das so? Kommen Sie, Hanna. Wir bringen Sie hier raus.«
Kessler ging voran, und Einstein führte mich, in seinen Mantel gekleidet und einen Arm schützend um meine Schultern gelegt, aus dem Raum mit den Betonwänden.
An der Tür hielt er inne und wandte sich Major Willis zu.
»Sie sollten dieser jungen Frau eine Medaille verleihen. Sie hat mein Leben gerettet! Sie hat sich auf die Attentäter gestürzt, als sie versuchten, mich in ihren Truck zu zerren.«
Erst jetzt fand Major Willis seine Stimme wieder.
»Aber, Sir … Wer ist sie?«
Einstein sagte: »Sie ist meine Sekretärin!«
ZWEITES VERHÖR
BERLIN, DEUTSCHLAND
1942
Heydrich (Chef der Gestapo) war so grausam, dass sogar Hitler ihn einst als den »Mann mit dem eisernen Herz« beschrieb.
Aus Deutschland und der Zweite Weltkrieg von Guy Longworth
REICHSSICHERHEITSHAUPTAMT
PRINZ-ALBRECHT-STRASSE
BERLIN, DEUTSCHLAND
JANUAR 1942, 2:45 UHR
NEUN JAHRE SPÄTER.
Mein zweites Verhör fand ebenso mitten in der Nacht und auch in einer Zelle statt, nur dass sich diese im Hauptsitz der Gestapo in Berlin befand.
Es roch nach Angst und Urin.
Die Ziegelwände der Zelle waren mit Einschusslöchern übersät. Getrocknetes Blut klebte an ihren Rändern. Die Gestapo machte sich nicht die Mühe, dich nach draußen zu bringen, um dich zu erschießen. Sie taten es einfach hier.
Ich saß gefesselt auf einem Stuhl.
Neben mir saß Gertrude Schneider, Bormanns Sekretärin, Geliebte und Informantin. Sie war eine überzeugte Nationalsozialistin und obendrein noch ein richtiges Biest.
Sie verachtete mich fast so sehr, wie sie Speer, meinen Chef, verachtete.
Gertrude hatte solche Nazis am liebsten, die groß gewachsen, brutal und zäh waren, so wie Bormann. Ein ruhiger, intellektueller Mann wie Speer entsprach überhaupt nicht ihrem Typ.
Speer stand außerdem in der Gunst des Führers, was bedeutete, dass Bormann ihn als Rivalen betrachtete. Da ich Speers Sekretärin war, sah Gertrude auch mich als ihre Rivalin an.
Der Mann, der uns verhören sollte, betrat die Zelle.
Er bewegte sich langsam wie eine Katze, die um eine in der Falle sitzende Maus kreiste.
Er war ein verschlagen dreinblickender Kerl mit eingefallenen Wangen und leeren Augen. In jeder anderen normalen Nation hätte er im Gefängnis gesessen, doch in Nazideutschland arbeitete er für die Geheimpolizei.
In seiner Hand hielt er einen silbernen Aktenkoffer aus Stahl.
»Frau Schneider, Fräulein Fischer«, sagte er. »Willkommen im Reichssicherheitshauptamt. Ich habe einen Namen, doch ich sehe keinen Grund, ihn zu nennen. Wahrscheinlich wundern Sie sich, warum Sie hergebracht wurden.«
Ich wunderte mich keineswegs.
Ich wusste genau, warum.
Sie waren mir schließlich doch auf die Schliche gekommen.
Der Mann lächelte und warf einen Blick hinunter auf seinen Aktenkoffer. »Mein Kollege und ich würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, das ist alles.«
Daraufhin öffnete sich die Tür, und ein zweiter Mann, von oben bis unten in eine schwarze SS-Uniform gekleidet, betrat die muffige Zelle. An seinem Kragen prangten ein Totenkopf-Emblem, die beiden Siegrunen der SS sowie ein paar silberne Lorbeerkränze.
Ich erkannte ihn sofort.
Gertrude auch. Ihr stockte bei seinem Anblick sogar der Atem.
In einem Regime, das sich aus Personen zusammensetzte, die allesamt Angst und Schrecken verbreiteten, war er der Gefürchtetste. Sein Gesicht mit der langen Nase, der hohen Stirn und den stechenden blassen Augen war jedem Deutschen vertraut.
Sogar Speer verkrampfte sichtbar, wann immer dieser Mann einen Raum betrat, und Speer stand unter Hitlers Schutz.
Er war Obergruppenführer Reinhard Heydrich, Leiter des Reichssicherheitshauptamtes und Chef der Gestapo.
Er war der Mann, der damals im Jahre 1933 den Anschlag auf Einstein angeordnet hatte.
Und nun war er hier, mitten in der Nacht, bei Gertrude und mir.
Das war besonders beunruhigend.
Reinhard Heydrich ließ sich nicht bei üblichen Folterungen oder wahllosen Verhören blicken.
»Meine Damen«, sagte er freundlich, als er uns gegenüber Platz nahm.
Seine Augen blinzelten nicht ein einziges Mal, sein Blick wandte sich nie von unseren Gesichtern ab. Er war ein Raubtier, das nach den kleinsten Anzeichen für Geheimnisse, Lügen oder Schwäche Ausschau hielt.
»Wir haben eine Menge zu besprechen«, sagte er. »Und es wird eine Weile dauern. Sogar ein paar Tage. Und ich fürchte, wir werden Sie während dieser Zeit kaum schlafen lassen.«
Wieder keuchte Gertrude.
Heydrich hob einen Finger. »Keine Sorge, Fräulein. Wir gehen zivilisiert vor, nicht so wie die Russen. Um Gottes willen, nein. Die würden Ihnen schon jetzt alle möglichen schrecklichen Dinge zufügen.«
Gertrude fiel fast in Ohnmacht.
Ich ertappte mich dabei, den Atem anzuhalten.
Heydrich fuhr fort: »Doch um es richtig zu machen und sicherzustellen, dass ich nicht meine Zeit mit Ihnen beiden verschwende, fürchte ich, dass Sie ehrlich zu mir sein müssen.«
Er nickte seinem Assistenten zu, der den stählernen Aktenkoffer aufspringen ließ. Darin befanden sich mehrere Reihen mit grausam funkelnden Gerätschaften: Messer, Skalpelle, Zangen, ein Hammer und etliche entsetzlich aussehende Zwingen.
»Nun …« Heydrich lächelte. »Wollen Sie das für mich tun? Werden Sie ehrlich zu mir sein? Denken Sie daran, es könnte schlimmer sein. Wir könnten es wie die Russen machen.«
DRITTES VERHÖR
SOWJETISCHER KOMMANDOSTAND
BERLIN, DEUTSCHLAND
MAI 1945
SOWJETISCHER MOBILER KOMMANDOSTAND
BERLIN
4. MAI 1945
Mein drittes Verhör findet in einem Kommandostand der Roten Armee in den Ruinen Berlins nicht weit von der Reichskanzlei entfernt statt.
Hitler ist tot und Deutschland hat augenscheinlich kapituliert, doch hier in Berlin ist der Krieg für diejenigen, die von den gefürchteten Russen gefangen genommen wurden, noch nicht vorbei.
Diese Zelle ist die reinste Horrorshow. Das Blut an den Wänden ist frisch. Menschliche Eingeweide liegen in Klumpen auf dem Boden. Der Gestank ist unbeschreiblich.
Die Russen haben uns vor drei Tagen geschnappt.
Sie haben uns Säcke über die Köpfe gezogen und uns hierhergebracht: ein ausgebombtes Gebäude mit vergitterten Zellen, die erstaunlicherweise noch intakt sind. Es sieht aus wie auf einem Polizeirevier, und schlagartig wird mir zu meinem Entsetzen bewusst, dass ich diesen Ort kenne.
Ich bin in der Prinz-Albrecht-Straße. Im Hauptquartier der Gestapo.
Nur dass das Gebäude nun von den Russen verwaltet wird.
Wieder bin ich nicht allein.
Wieder bin ich mit Handschellen gefesselt.
Aber dieses Mal bin ich an einen Mann gefesselt, der eine Nazi-Uniform trägt und ein bandagiertes Bein hat.
Doch er ist kein Nazi.
Er ist ein amerikanischer Agent.
Im Raum ist ein dritter Gefangener. Eristein Nazi. Er ist gedrungen und kahlköpfig und ein sehr hochrangiger Vertreter des früheren Regimes.
Als ich erwache, sehe ich, dass ihm seine Hose um die Knöchel hängt und dass er gerade von einem hünenhaften russischen Soldaten vehement vergewaltigt wird. Der fette Nazi winselt bei jedem Stoß.
Drei andere dreckige russische Soldaten halten ihn nieder. Kurz darauf wechseln sie sich ab.
Doch aus irgendeinem Grund wird weder meinem amerikanischen Freund noch mir ein Leid angetan.
Mit einem schrillen, rostigen Quietschen öffnet sich die Zellentür.
Zwei russische Vernehmungsbeamte treten ein. Es sind Offiziere.
Sie sagen nichts zu den vier dreckigen Soldaten, die nicht aufhören, den wimmernden Nazi anal zu missbrauchen.
Sie nehmen Platz.
»Hallo, Hanna«, sagt der ranghöhere Vernehmungsbeamte zu mir. »Meine Güte, du hattest viel zu tun.«
AUS DEM ERSTEN VERHÖR
NEW JERSEY, 1933
VERNEHMUNGSBEAMTER (MAJ. WILLIS, US-ARMEE): Miss Fischer. Sie müssen meine Lage verstehen: Wir haben Sie, eine deutsche Staatsbürgerin, zusammen mit zwei deutschen Attentätern in der Nähe von Professor Einstein aufgegriffen.
FISCHER: Ich bin nur eine Halbdeutsche, Sir. Meine Mutter stammt aus Brooklyn.
VERNEHMUNGSBEAMTER: Was haben Sie in Princeton gemacht?
FISCHER: Wie ich schon sagte, ich arbeite für Professor Einstein. Ich bin seine Zweite Sekretärin. Ich begleite ihn auf dieser dreimonatigen Amerika-Reise zum Caltech und nach Princeton.
VERNEHMUNGSBEAMTER: Wie lange sind Sie schon für Professor Einstein tätig?
FISCHER: Ungefähr zwei Jahre, die Zeit, als ich ihm während der Solvay-Konferenz 1927 assistierte, nicht mitgerechnet. Doch ich kenne ihn schon viel länger.
VERNEHMUNGSBEAMTER: Wie lange?
FISCHER: Schon fast mein ganzes Leben lang. Als ich ein Kind in Berlin war, war Albert Einstein unser Nachbar.
TEIL I
1912 BERLIN
Es gibt immer einen Moment in der Kindheit, in dem die Tür sich öffnet und die Zukunft hereinlässt.
Graham Greene
Bevor er weltweiten Ruhm erlangte, ging Albert Einstein seiner Arbeit in einer bescheidenen Wohnung in einem sehr bescheidenen Viertel von Berlin nach.
Aus Einstein von Thomas McMahon
HABERLANDSTRASSE NR. 7
BERLIN, DEUTSCHLAND
1. JANUAR 1912
Zu meinem zehnten Geburtstag bekam ich eine Puppe von meiner Tante, einen Armreif von meinem Vater und ein Modell des Sonnensystems von unserem Nachbarn Mr. Einstein.
Ich hasste die Puppe genauso sehr, wie ich meine Tante Olga hasste.
Ich vergötterte den Armreif so sehr, wie ich meinen Vater vergötterte.
Und was das Modell von Einstein betraf, so fand ich, dass es einfach atemberaubend war.
Mein Vater sah voller Stolz zu, als ich das riesige Ding aus seiner Schachtel holte und vor Staunen große Augen machte.
Das waren die guten Jahre: vor dem ersten Krieg, vor den Demütigungen, die wir währenddessen erlitten, vor Deutschlands Schmach an seinem Ende und bevor mein Vater an ihm zugrunde ging.
1912 war Deutschland eine aufsteigende Nation, das bevölkerungsreichste Land in Europa, ein vor Kraft strotzender Industriestandort, von einem Stolz erfüllt, der an Arroganz grenzte, ein frischgebackenes Reich, das von dem pompösen, kriegslustigen Kaiser Wilhelm II. regiert wurde.
Natürlich wusste ich mit zehn Jahren noch nichts von internationalen Angelegenheiten oder Einsteins intellektueller Reputation, auch wenn er fairerweise gesagt zu jener Zeit noch nicht weltberühmt war.
Sein Ruhm beschränkte sich im Jahre 1912 auf die Subkultur der deutschsprachigen Physiker an den europäischen Universitäten.
Britische Physiker – die immer noch empört über seinen Angriff auf die Newton’schen Gesetze von vor sieben Jahren waren – taten ihr Bestes, um ihn zu ignorieren und als »Prüfer am Patentamt« abzutun.
Ich wusste schon, dass er ein bemerkenswerter Gelehrter war, doch für mich war er in erster Linie nur der schrullige kleine Mann, der mit seiner freundlichen Frau im Haus nebenan lebte.
Schon damals war sein Haar ein wild zerzaustes Durcheinander, auch wenn es kürzer und noch nicht so grau war, wie es in seinen späteren Jahren sein sollte. Sein Schnurrbart jedoch war genau derselbe. Er hing herab wie bei einer Zeichentrickfigur und sah aus wie ein süßes, buschiges Tierchen, das es sich auf seiner Oberlippe gemütlich gemacht hatte.
Doch es waren seine Augen, die einen packten.
Die einen vereinnahmten.
Und nicht mehr losließen.
Funkelnd, aber sanft, mit schweren Lidern, aber hellwach, stechend, aber freundlich und von einer einzigartigen Gastlichkeit beseelt, die einem das Gefühl gab, seine völlige, ungeteilte Aufmerksamkeit zu haben.
Albert Einstein war der beste Zuhörer, den ich je kannte.
Doch zurück zu seinem Geburtstagsgeschenk.
Ganz entfaltet maß Einsteins Nachbildung des Sonnensystems gewaltige ein Meter 20. Es war fast größer als ich.
Was es besonders entzückend machte, war die Tatsache, dass Herr Einstein es selbst gebaut hatte. Die Vorstellung, dass er gütig und sanft und mit seinem albernen Schnurrbart in einer kleinen Holzwerkstatt schuftete und wie ein echter Geppetto Spielzeug anfertigte, war eine, die zu ihm passte.
Heute würde man es ein Mobile nennen: Die Planeten – vom kleinen Merkur bis zum gigantischen Jupiter – waren Holzkugeln, die mit Fäden an einer Reihe von konzentrischen Messingringen hingen und um eine Sonne in ihrer Mitte kreisten.
Für die Augen einer Zehnjährigen war es einfach überwältigend.
Einstein hatte jede der kleinen Kugeln in der Farbe bemalt, die dem tatsächlichen Farbton des jeweiligen Planeten entsprach: ein Rot für den Merkur, ein blasses Blau für die Venus, ein dunkles Orange für den Mars. Der Saturn – eine viel größere Kugel – war von dramatischen, aus lichtdurchlässigen Mullbinden gemachten Ringen umgeben.
Ich drehte mich zu meinem Vater um. »Papa, wird Ooma auch Geschenke bekommen, obwohl sie im Krankenhaus ist? Es ist auch ihr Geburtstag.«
Ooma war meine Zwillingsschwester. Ihr eigentlicher Name lautete Norma, doch als ich noch sehr klein gewesen war, hatte ich ihn immer als »Ooma« ausgesprochen, und dieser Spitzname war hängen geblieben.
»Aber natürlich«, antwortete Papa. »Doch fürs Erste braucht deine Schwester ein wenig Ruhe.«
Ich kannte nicht alle Einzelheiten, die den neuerlichen Aufenthalt meiner Schwester im Krankenhaus betrafen. Ich wusste nur, dass es etwas mit dem Vorfall aus der Woche zuvor zu tun hatte, als Papa sie im Garten mit der Ratte gefunden hatte.
Einstein, vom Unbehagen meines Vaters alarmiert, wechselte das Thema.
»Und, kleines Fräulein?«, sagte er zu mir. »Wie kommst du mit dem Physikunterricht voran?«
Er sprach mit einem ausgesprochen deutschen Rhythmus: flink, gestutzt, effizient.
Ich antwortete nicht. Ich war zu sehr in mein neues Spielzeug vertieft.
»Hanna?«, sagte Papa. »Was sagst du?«
»Was? Oh, danke, Herr Einstein. Vielen lieben Dank.«
»Nein«, sagte Papa. »Was sagst du zu Herrn Einsteins Frage?«
Ich blinzelte und versuchte mich zu erinnern, was er gesagt hatte.
Physik …
»Nun, vielen Dank, Herr Einstein«, sagte ich. »Wissen Sie, ich beabsichtige, die größte Physikerin aller Zeiten zu werden.«
Ja, das war es, was ich zum größten Physiker aller Zeiten sagte. Ich war in der fünften Klasse und nur mit den einfachsten Grundlagen der Naturwissenschaften vertraut.
»Und die größte Ballerina, Ärztin und Fußballspielerin«, fügte ich hinzu.
Einstein kicherte.
Ich runzelte mürrisch die Stirn. »Aber ich bin in Fräulein Zoellers Physikklasse, und sie ist ja so pingelig. Und sie verteilt viele Hausaufgaben. Mein Freund Wolfgang, er ist in der Klasse von Herrn Stuber, gleich auf der anderen Seite vom Flur, Wolfgang sagt, dass Herr Stuber immer Späße mit seinen Schülern macht und mit ihnen Spiele spielt. Und er gibt ihnen so gut wie gar keine Hausaufgaben auf.«
»Ich verstehe«, sagte Einstein. »Du hast also eine strenge Lehrerin, wie?«
»Ja.«
Er beugte sich vor und sah mir geradewegs in die Augen. »Kleine Hanna, vertraue mir: Es ist immer besser, den strengen Lehrer zu haben. Denn bei einem strengen Lehrer lernt man etwas. Ich bin mir sicher, dass Herr Stubers Schüler eine Menge Spaß haben, doch es werden Fräulein Zoellers Schüler sein, die die Welt verändern. Halte dich an die strengen Lehrer, ganz egal ob in der Wissenschaft, der Literatur oder sogar beim Ballett. Genau genommen solltest du dir bei jeder Art des Studiums einen strengen Lehrer suchen. Es wird dir zum Vorteil gereichen.«
Ich nickte, sagte aber nichts. Das war etwas, über das mein zehn Jahre alter Kopf erst noch nachdenken musste.
Einstein lächelte. »Dein Vater sagt, dass du dich in der Schule sehr gut machst. Es freut mich, das zu hören. Lerne fleißig, lese fleißig, und du wirst Erfolg haben, in der Wissenschaft, als Ballerina oder wofür auch immer du dich entscheidest.«
»Das will ich tun, Herr Einstein«, sagte ich. »Darf ich Sie etwas fragen?«
»Gewiss.«
»Ich habe neulich von Madame Marie Curie und ihrer Arbeit gelesen. Sie hat soeben einen zweiten Nobelpreis gewonnen, wussten Sie das?«
»Ja, das wusste ich«, antwortete Einstein sanft.
»Sie ist der erste Mensch, der jemals zwei Nobelpreise gewonnen hat, wussten Sie das?«
»Das stimmt tatsächlich.«
»Haben Sie einen Nobelpreis gewonnen, Herr Einstein?«, fragte ich.
Einstein räusperte sich ein wenig. »Äh, nein, habe ich nicht.«
»Ist Madame Curie klüger als Sie?«
Mein Vater unterdrückte ein Lachen. Er warf Einstein einen Blick zu und grinste. »Oh, das geht auf Sie, Albert.«
Einstein wandte sich mir zu. »Ohne den geringsten Zweifel ist Marie viel klüger als ich. Sie ist eine brillante Frau mit einem außergewöhnlichen Geist.«
Ich runzelte die Stirn. »Aber Herr Einstein, Fräulein Schmidt, meine Klassenlehrerin, sagt, dass Männer viel klüger als Frauen sind. Sie sagt, dass das männliche Gehirn größer als das weibliche ist und sich deshalb besser für die Wissenschaft, die Politik und das Geschäft eignet. Sie sagt, Gott hat Frauen dazu gemacht, Kinder zu bekommen und ihren Ehemännern zu huldigen. Wenn sie arbeiten wollen, dann nur als Krankenschwestern oder Grundschullehrerinnen. Und sobald eine Frau heiratet, muss sie ihre Anstellung aufgeben.«
Als ich zu reden aufhörte, sah ich, dass mich mein Vater und Einstein mit offenem Mund anstarrten.
»Das hat deine Lehrerin gesagt?«, fragte Einstein.
Das Gesicht meines Vaters hatte sich verfinstert, was mich ein wenig verstörte, da er sonst fast immer ein unbeschwertes Lächeln auf den Lippen trug.
»Das hat Fräulein Schmidt wirklich gesagt?«, sagte er leise.
»Ja, Papa.«
»Ich schätze, ich werde am Montag deiner Schule einen Besuch abstatten müssen, um mich ganz in Ruhe mit Fräulein Schmidt zu unterhalten.«
Ich wusste nicht, warum das notwendig war, nickte aber trotzdem.
»Meine liebe Hanna«, sagte Einstein und beugte sich vor. »Ich bin mir sicher, dass deine Lehrerin mit vielen Dingen recht hat, aber was diese Sache betrifft, könnte sie nicht mehr im Unrecht sein. Frauen sind Männern intellektuell ebenbürtig. Viele Frauen, so wie Madame Curie, sind uns sogar überlegen. Lies du nur weiter über Madame Curie, meine Kleine. Du wirst kein besseres Vorbild als sie finden.«
»Jawohl, Sir, das werde ich tun.«
Mein Vater wandte sich mir zu. »Hanna, hast du Herrn Einstein davon erzählt, dass du und ich seine spezielle Theorie zur Relativität gelesen haben?«
»O ja, das haben wir«, sagte ich aufgeregt. »Aber ich habe eine Frage.«
»Sprich nur«, sagte Einstein.
(Ich sollte noch eines über Einstein sagen: Er war niemals zu irgendwem herablassend. In jedem Raum, in dem er sich befand, war er der brillanteste Kopf, doch wann immer ihm jemand eine Frage stellte, gab er sein Bestes, genau zuzuhören und eine Antwort zu geben.)
»Ihre Theorie scheint sich auf solche Systeme zu beschränken, in der es keine Beschleunigung gibt«, sagte ich. »Was geschieht, wenn es doch eine Beschleunigung gibt, die sich auf Zeit und Raum auswirkt? Ich meine, so etwas wie die Schwerkraft?«
Wieder warf Papa Einstein einen Blick zu, doch dieses Mal musste er kein Lachen unterdrücken. Dieses Mal zog er nur schweigend seine Augenbrauen in die Höhe.
Einstein sagte: »Kleine Hanna, dein Verständnis für die Physik ist für jemanden in deinem Alter äußerst bemerkenswert. Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem ich mich gerade in meinen Studien auseinandersetze.«
Er drehte sich zu meinem Vater um. »Holen Sie sie aus dieser Schule und bringen Sie sie unverzüglich an ein wissenschaftliches Gymnasium, Manfred. Dieses Mädchen hat Talent.«
»Glauben Sie mir, ich arbeite daran«, sagte mein Vater.
Ich hielt das Mobile in die Höhe. »Vielen lieben Dank, Herr Einstein, für dieses Geschenk. Ich bin sehr an den Planeten und ihren Bewegungen interessiert. Es wird mich dazu anhalten, noch mehr darüber zu lesen, als ich es schon getan habe.«
Einstein lächelte. »Dann hat es seinen Zweck erfüllt.«
Ich beäugte mein neues Spielzeug.
»Papa? Darf ich auf mein Zimmer gehen und mit meinem neuen Solarsystem spielen?«
»Natürlich, meine Zaubermaus. Verschwinde schon.«
Ich schloss erst Einstein und dann meinen Vater kurz in meine Arme und huschte in mein Zimmer.
Ich stellte das Mobile über meinem Bett auf, legte mich auf den Rücken und blickte staunend zu ihm hinauf. Ich träumte von Planeten und vom Weltraum und von der Zeit und der Schwerkraft.
Das machte ich ungefähr zehn Minuten lang, bevor ich mich an Papas Geschenk erinnerte.
Der Armreif.
Ich eilte zurück ins Wohnzimmer, schnappte ihn mir und rannte wieder hinauf in mein Zimmer.
Ich nenne es einen Armreif, doch in Wahrheit waren es zwei dünne Holzringe, die von einer silbernen Kette zusammengehalten wurden, um ein einziges Stück Schmuck zu bilden.
Es war ein Ersatz für einen alten Armreif, für den ich zu groß geworden war.
Papa hatte einen der Ringe blau und den anderen rosa bemalt, genau wie das Original. Er hatte auch die beiden Inschriften aus dem alten Stück auf das neue übertragen.
Ich lächelte traurig, als ich die beiden kurzen Botschaften las. Eine war von Papa, die andere von meiner längst verstorbenen Mutter.
Da ich erst zehn war, warf ich den Armreif auf meinen Nachtschrank und vergaß ihn umgehend. Dann wandte ich mich wieder Einsteins unglaublichem Solarsystem zu.
Es ist schon komisch, wie leicht Kinder sich von großen, glänzenden Dingen ablenken lassen und die wirklich wichtigen übersehen.
Der Geist ist wie ein Eisberg. Er fließt mit einem Siebtel seiner Masse über Wasser.
Sigmund Freud
Mein Verhältnis zu meiner Zwillingsschwester bedarf einer besonderen Erwähnung.
Schon von Kindesbeinen an legte Ooma ein eigentümliches Verhalten an den Tag, ein Verhalten, das von »leidlich befremdlich« bis hin zu »unverhohlen bizarr« reichte.
Ab und zu wohnte sie mit uns zusammen.
Erst als ich das Teenager-Alter erreichte, wurde mir bewusst, dass das Krankenhaus, in dem sie sich aufhielt, wenn sie nicht zu Hause war – es lag in einem Wald in der Nähe von Potsdam, eine gute Stunde südlich von Berlin –, in Wahrheit ein von der protestantischen Kirche geleitetes Irrenhaus war.
Äußerlich glichen wir uns wie ein Ei dem anderen, doch unsere Gehirne taten es nicht.
Das von Ooma war nicht in Ordnung.
An manchen Tagen war sie aufgeweckt und vergnügt, eine lächelnde Elfe, die mitten auf der Straße tanzte und den ganzen Verkehr aufhielt.
An anderen Tagen war sie ein düsteres, schweigsames Monster mit gesenktem Blick und nach unten gezogenen Mundwinkeln.
An solchen Tagen hörte sie vielleicht zu, gab aber niemandem Antwort. Sie konnte stundenlang eine Wand anstarren.
Ooma konnte fast ein Jahr früher als ich lesen. Und sie war ein mathematisches Naturtalent.
Sie konnte das Klavier wie eine Konzertpianistin spielen, während ich schon mit einfachen Liedchen überfordert war. Sie musste eine Melodie nur ein Mal hören und war in der Lage, sie fehlerfrei nachzuspielen.
Nichtsdestotrotz konnte sie auch den ganzen Tag lang am Klavier sitzen und wie besessen ein und dasselbe Stück immer und immer wieder in die Tasten hämmern.
Sie konnte Zuneigung zeigen – auf ihre ganz eigene Weise –, aber auch das war von ihrem Gemütszustand abhängig. An guten Tagen überschüttete sie uns alle mit ihrer Liebe. An schlechten schrie und wütete sie und trat um sich und schlug Gegenstände entzwei.
Einmal, als Ooma sieben Jahre alt war – sieben! – und meine Mutter uns verboten hatte, zu den Schaukeln im Park zu gehen, holte Ooma eine Schere aus der Anrichte, ging seelenruhig in das Schlafzimmer meiner Eltern und schnitt deren Kissen in einem Anfall von Raserei in Stücke, was einen Schneesturm aus Federn verursachte, der den ganzen Raum füllte.
Daher die Anstalt im Wald, wo Ooma von einer ganzen Reihe von Ärzten, die auf Geisteskrankheiten spezialisiert waren, und protestantischen Geistlichen behandelt wurde.
Wenn sie in der Anstalt war, ließen mich meine Eltern bei Mr. Einstein – dem überqualifiziertesten Babysitter in der Geschichte –, während sie mit dem Zug nach Potsdam fuhren, um sie zu besuchen.
Meist waren sie den ganzen Tag unterwegs und kehrten oft erst weit nach Einbruch der Dunkelheit zurück, wenn ich schon auf dem Sofa der Einsteins eingeschlafen war. Manchmal bemerkte ich murmelnd und verschlafen, dass mein Vater mich aufhob und nach nebenan in mein eigenes Zimmer trug.
Als ich schließlich acht Jahre alt war, nahmen mich Mom und Papa mit zu Ooma, da sie fanden, dass ich alt genug war, um meine Schwester in der Anstalt zu besuchen.
(Wie bereits erwähnt, verbrachte Ooma unseren zehnten Geburtstag – den, an dem ich das Solarsystem von Einstein bekam – in der Anstalt, nachdem mein Vater sie dabei erwischt hatte, wie sie im Garten eine Ratte, die sie an kleine Pfähle gebunden hatte, bei lebendigem Leib sezierte.)
Die Anstalt war ein trostloses rotes Backsteingebäude mit einem wenig einladenden Bogeneingang. Sie lag auf einem beträchtlichen Gelände, das an einen großen Wald grenzte, durch den ein Bach strömte.
Neben dem Hauptgebäude stand eine sehr alte Kirche – sie waren durch eine noch recht neue geschlossene Kolonnade miteinander verbunden –, um den spirituellen Bedürfnissen der Geisteskranken gerecht zu werden.
Überall stank es nach Karbolsäure.
Doch was ich während meines ersten Besuchs als Achtjährige dort sah, als ich Ooma erblickte, war ein schmächtiges kleines Mädchen, das aussah wie ich, nur ein bisschen magerer, und mit leerem Blick in die nicht allzu weite Ferne starrte.
Mein Vater las ihr vor, irgendein Märchen der Gebrüder Grimm. Ooma schien nichts davon mitzubekommen – sie starrte ins Nichts, die ganze Zeit –, bis er innehielt und sie schweigend ihren Kopf neigte, als würde sie sagen wollen: »Warum hat dieser Mann aufgehört vorzulesen?«
Papa las weiter, und sie nahm wieder ihre reglos lauschende Haltung ein.
Als es Zeit war aufzubrechen, versuchte meine Mutter – ganz sanft, in einer langsamen Bewegung –, sie zu umarmen.
Ooma ließ meine Mutter gewähren, erwiderte ihre Umarmung aber nicht.
Sie starrte über die Schulter meiner Mutter ins Leere und flüsterte etwas, das ich nicht verstehen konnte.
Meine Mutter reagierte sofort. Sie kniff die Augen zusammen und schluchzte. Ihr ganzer Körper zitterte.
Im Zug zurück nach Berlin hörte ich Mom zu Papa sagen: »Hast du gehört, was sie gesagt hat, Manny? Sie sagte: ›Es tut mir leid, dass ich dir wehtue. Ich weiß nicht, was mich manchmal überkommt.‹«
Papa legte seinen Arm um Mom.
Ich war verwirrt. »Mom? Papa? Ist Ooma böse?«
Mom sagte: »O nein, Hanna, nein. Ihr Geist funktioniert einfach nicht so wie bei anderen, und darum braucht sie etwas Hilfe. Wie einen ruhigen Ort zum Leben, weit weg von dem Trubel und den Ablenkungen Berlins.«
Papa strich mir über den Kopf. »Vor allem, Zaubermaus, braucht Ooma unsere Geduld. Sie ist unsere Tochter und deine Schwester, also ist es unsere Aufgabe, uns um sie zu kümmern.«
Nachdem er das gesagt hatte, drückte er Moms Hand.
Als der Zug losschaukelte, legte sie ihren Kopf auf seine Schulter.
»Sie sagte, es tut ihr leid, Manny!«
Ein paar Monate später wurde meine Mutter ermordet.
Die Erinnerung an diese Zugfahrt weckt noch eine andere, eine an New York in den 1920ern.
Ich drücke ein Kind fest an meine Brust, während ich verzweifelt an den Schienen einer Hochbahn – einer »el«, wie sie damals genannt wurden – entlanghastete, bewaffnete Männer mir dicht auf den Fersen.
Sie schießen. Ihre Kugeln prallen von den Schienen vor meinen Füßen ab und lassen Funken sprühen, gerade als ich um eine Kurve komme und mich hinter einem Backsteingebäude aus der Schusslinie begebe. Kugeln schlagen in das Mauerwerk.
Noch eine Erinnerung an Züge.
Zehntausende überglückliche Deutsche schlendern durch die Drehkreuze der Bahnstation in der Nähe des Reichssportfelds, dieser gewaltigen Ansammlung von Sportplätzen in Berlin, wo die Olympischen Spiele 1936 stattfinden werden.
Die Fans strömen in Speers gigantisches Olympiastadion.
Es bietet 110.000 Zuschauern Platz.
Speer ist sehr stolz darauf.
Freude liegt in der Luft, eine gespannte Erwartung.
Diese glücklichen Deutschen bemerken die vielen Nazi-Flaggen nicht, die das Stadion umgeben.
Von dem Zirkus abgelenkt, ignorieren sie, zu welch einem Land ihre Nation geworden ist.
1945.
Ich werde zusammen mit anderen Gefangenen in einen stinkenden Viehwaggon gepfercht.
Mein Mund ist mit einem Lederknebel bedeckt, damit ich die Wachen nicht beißen kann.
Dieser Zug fährt nach Mauthausen, dem schlimmsten Lager von allen.
Die Person, sei sie ein Gentleman oder eine Lady, die keine Freude an einem guten Roman empfindet, muss unerträglich dumm sein.
Aus Die Abtei von Northanger von Jane Austen
Meine Mutter starb 1910.
Sie existiert als vage Vorstellung in meinem Kopf: eine blonde Frau mit einem warmen Lächeln.
Sie war eine Physik-Dozentin an der Preußischen Akademie der Wissenschaften, eine Stelle, zu der Einstein ihr verhalf, nachdem er eine ihrer Abhandlungen gelesen hatte.
Und sie war Amerikanerin – aus einem Ort namens Brooklyn in New York City. Das war eine Tatsache, die ihre angeheirateten Verwandten stets in Unmut versetzte.
Einmal hörte ich meine Tante Olga sagen: »Genau wie alle Amerikaner ist sie vulgär und hat keine Manieren. Sie vergisst, wo sie hingehört.«
Dr. Sandra Rose Martin war aus Brooklyn, New York, nach Europa gekommen, mit einem Doktortitel in Physik frisch in ihrer Tasche, um mit den besten wissenschaftlichen Denkern ihrer Zeit zusammenzuarbeiten, und war als Mrs. Manfred Fischer in Berlin gelandet.
Sie hatte meinen Vater – einen Karrierebeamten in der Regierung – auf einer von der amerikanischen Botschaft ausgerichteten Party kennengelernt und ihn, was alle, die sie kannten, in Erstaunen versetzte, innerhalb eines Jahres geheiratet.
Die Familie meines Vaters war darüber besonders perplex.
Meine Mutter war eine schlanke, große blonde Schönheit, die sofort ins Auge fiel. Mein Vater war ein kurz gewachsener Bücherwurm und trug eine Brille mit dicken Gläsern.
Wieder Tante Olga: »Sie ist so lebhaft, wie Manfred langweilig ist. Ich habe keinen Schimmer, was sie an ihm findet.«
Vielleicht hatte sie nicht ganz unrecht.
Meiner Mutter, das muss gesagt sein, mangelte es nie an männlicher Aufmerksamkeit. Bauarbeiter pfiffen ihr hinterher, wenn sie die Straße entlanglief. In der U-Bahn boten ihr Männer in Anzügen spontan an, ihr einen Drink zu spendieren, wenn sie sie nur begleiten würde.
Doch es war Papa, den sie heiratete.
Und sie hatte nur Augen für ihn.
Als ich vier Jahre alt war, fragte ich sie, aus welchem Grund sie ihn geheiratet hatte.
»Weil er, als ich ihn bei dieser Party in der Botschaft zum ersten Mal sah, das Buch beäugte, das ich in meiner Handtasche trug, und mich höflich fragte, was ich gerade las.«
Ich runzelte die Stirn. »Warum hat dir das gefallen?«
»Er war der einzige Mann, den ich je getroffen habe, der nicht als Erstes eine Bemerkung über mein Aussehen machte. Viele Männer schmeicheln Frauen, und Frauen, die sich schmeicheln lassen, sind Närrinnen, die sich von ihrer eigenen Eitelkeit blenden lassen. Sie sind Lämmer inmitten von Wölfen.
Doch hier war ein Mann, den es wirklich interessierte, was ich las. Als ich es ihm sagte – es waren Die Memoiren des Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle –, leuchteten seine Augen, und er sagte, dass er das Buch auch schon gelesen hatte, und fragte mich nach meiner Meinung darüber.
Das war sein zweiter Pluspunkt: Er wollte wissen, was ich über das Buch dachte. Viele Männer werden dir nur allzu gern ihre Meinung zu einem Thema darlegen. Dieser Mann wollte meine Meinung hören.
Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge – von Romanen über die Wissenschaften bis hin zum Zustand des aufkommenden Deutschen Reiches. Während ich mit ihm sprach, wurde mir klar, dass Manfred Fischer – der kleine Manny mit seiner sanften Stimme und der runden Brille – mich nicht besitzen, nicht als seine Trophäe zur Schau stellen wollte. Er erkannte, wer ich in meinem Inneren war. Er war ein Gentleman im reinsten Sinne.
Du wirst eines Tages eine sehr schöne Frau sein, meine Maus. Hüte dich vor den Charmeuren, den Schmeichlern und vor allen, die dich nur deines Aussehens wegen bewundern. Denn was werden sie an dir lieben, wenn du alt und faltig bist?«
Dann sah sie mich streng an. »Dein Vater mag nicht besonders groß sein, doch zweifle nie an seiner Courage, wenn es um die Dinge geht, die wirklich zählen. Eine Frau sollte solch einen Mann heiraten, und zwar unversehens. Und das habe ich getan.«
Später bat ich meinen Vater um seine Version ihrer Geschichte, und er bestätigte mir jede Einzelheit.
Er fügte hinzu: »Zaubermaus, wenn du jemals jemandem begegnest und du siehst, dass er oder sie ein Buch dabeihat, sag: ›Wunderbar!‹ und freue dich. Es gibt keinen besseren Anlass auf dieser Welt, ein Gespräch anzufangen, als ein Buch. Mit einem Fremden über ein Buch zu diskutieren, ist eine echte Unterhaltung und kein banales Geplauder. Noch besser ist es, wenn das Buch eines ist, das du selbst schon gelesen hast oder das von einem Autor stammt, den du auch bewunderst, denn dann hast du schon etwas mit dieser Person gemeinsam – so wie ich mit deiner Mutter.
Ein Buch verschafft dir außerdem einen Einblick in den Charakter einer Person: Zuallererst einmal ist diese Person neugierig, denn nur die Neugierigen lesen. Die Tölpel und die Überheblichen lesen nicht, denn sie glauben, dass sie schon alles wissen.«
Er warf einen Blick zu meiner Mutter hinüber und sah, dass sie den Roman, den sie gerade las, beiseitegelegt hatte und uns beobachtete.
»Oh, bitte hör jetzt nicht auf, Cowboy«, sagte sie. »Du kommst gerade erst in Fahrt.«
Papa sagte: »Deine Mutter zum Beispiel las ein Sherlock-Holmes-Buch. Das verriet mir sofort, dass ich es mit einer Lady zu tun hatte, die einfach eine gut erzählte Kriminalgeschichte zu schätzen wusste. Manche Leser rümpfen wegen solcher Bücher die Nase und erachten sie als zu niveaulos. So jemand bin ich nicht. Jemand, der solche Bücher liest, liest sie zum Genuss, zum Vergnügen. Das Buch verriet mir auf den ersten Blick, dass ich es mit einer Frau zu tun hatte, die eine pure Lust auf Freude besaß. Und ich wollte solch eine Seele kennenlernen.«
Das Lächeln, mit dem meine Mutter meinen Vater nach seiner Bemerkung bedachte, sehe ich noch heute vor mir.
Zwar existiert sie nur noch als ein verschwommenes Bild in meinen Träumen, doch an ihren Duft erinnere ich mich noch genau.
Der einzige Luxus, den sie sich gönnte, war ein Parfüm namens Californian Poppy.
Es hatte ein umwerfendes zitronenartiges Aroma: frisch und temperamentvoll – genau wie sie es war.
»Mir gefällt einfach der Name. Californian Poppy«, sagte meine Mutter, als ich ihr eines Abends dabei zusah, wie sie ihren eleganten Hals damit betupfte. Sie benutzte es nur sehr sparsam.
»Jedes Mal wenn ich es auftrage, denke ich an zu Hause. Man kann ein Mädchen aus Amerika herausholen, aber niemals Amerika aus einem Mädchen«, fügte sie grinsend hinzu.
Als ich zur Frau heranwuchs, sollte ich dasselbe Parfüm tragen, um mich an sie zu erinnern.
Juden sind eine Plage, die die Menschheit auf die eine oder andere Weise loswerden muss. Ich denke, Gas wäre das Beste!
Kaiser Wilhelm II.
Die Ehe meiner Eltern ist auch der Grund dafür, dass ich nicht nur einen, sondern zwei Pässe habe, einen deutschen und einen amerikanischen. Zugegeben, Pässe waren zu jener Zeit nicht das, was sie heute sind. Man könnte sie eher als Reisepapiere bezeichnen, und in jenen weniger argwöhnischen Tagen war es viel einfacher, an sie heranzukommen, als es nun der Fall ist.
Trotzdem, viele Menschen – so wie meine Tante Olga – sahen nur die Unterschiede zwischen meinen Eltern.
Meine Mutter war eine ausgebildete Physikerin. Mein Vater war Anwalt.
Meine Mutter tanzte im Regen. Mein Vater bekam kaum einen Fuß vor den anderen.
Meine Mutter trug farbenfrohe, moderne Kleider. Mein Vater trug ausschließlich einen dunkelgrauen Wollanzug.
Meine Mutter erforschte die unbekannten Größen des Universums. Mein Vater brütete über jede Zeile eines Regierungsauftrags.
Sie war »Mom«. Er war »Papa«.
(»Ich lebe zwar in Deutschland«, sagte sie, »aber ich werde verdammt noch mal keine Mama sein. Ich bin eine amerikanische Mom, vielen Dank auch.«)
Soweit mir bekannt ist, war der einzige Mensch, der ihre Verbindung mit Wohlwollen betrachtete, unser schrulliger Nachbar Einstein.
Einmal sagte er zu mir, dass es ebenjene Unterschiede waren, die sie zu solch einem großartigen Paar machten. Sie ergänzten einander.
Später sagte er: »Dein Vater hielt die Anwandlungen deiner Mutter im Zaum, und deine Mutter sorgte dafür, dass dein Vater Spaß hatte.«
So wie damals, im Jahre 1910, als sie ihn dazu nötigte, sich an einem verregneten Sonntagnachmittag mit mir zusammenzusetzen, obwohl er, wie er sagte, noch einen Haufen Arbeit wegen irgendeines Regierungsauftrags oder so etwas hatte.
Meine Mutter war eine wahre Meisterin darin, sich spaßige Dinge auszudenken. Sie konnte mich stundenlang in ihren Bann ziehen.
Es waren ihre wissenschaftlichen Experimente, die ich am meisten liebte.
Um mir die Physik zu erklären, legte sie einmal ein gekochtes Ei auf die Öffnung einer Milchflasche und entzündete dann eine Flamme unter dem Flaschenboden. Mit einem feuchten Schlürfen zog die folgende Saugwirkung das Ei in die Flasche.
Ich war begeistert.
»Das ist Physik«, sagte sie. »Und das ist, was Mommy als Beruf macht.«
Meine Augen waren so groß wie Untertassen.
»Mach es noch einmal!«, rief ich.
An jenem verregneten Nachmittag im Jahre 1910 bastelten Mom und ich, während Papa an seinem Schreibtisch hockte.
Sie hatte mehrere einfache Holzringe gekauft, dazu noch Kleber und buntes Papier und Bindfaden. Wir fertigten Armreife füreinander an und personalisierten sie auf verschiedenste Arten: Wir bemalten sie in grellen Farben, beklebten sie überall mit roten Papierherzchen und gelben Papiersternen und behängten sie mit Papieranhängern.
Nach einer Weile war die Küchenbank mit einem wundersamen Wirrwarr aus bunten Schnipseln, Farbe und Kleberresten bedeckt.
Ich hatte einen Riesenspaß.
Mom rief Papa zu uns herüber, als wir den letzten Schliff an unsere Armreife legten.
»Komm schon, Manny«, sagte sie. »Du musst auch einen Armreif für Hanna machen. Sie sollte von jedem von uns einen haben. Schreib eine Botschaft drauf. Du kannst ihn später bemalen.«
»Also gut«, sagte er und nahm sich den übrig gebliebenen, unbemalten Armreif.
Ich zeigte Mom den Armreif, den ich angefertigt hatte.
Er war sehr rosa und, wenn ich darüber nachdenke, wirklich hässlich und völlig übertrieben. Wie jede andere Achtjährige es auch getan hätte, hatte ich viel zu viele Sterne, Kreise und Anhänger daran befestigt.
Mom legte sich den kindischen rosa Armreif unverzüglich um ihr Handgelenk. »Das ist jetzt ganz offiziell mein liebstes Schmuckstück. Ich werde es jeden Tag tragen.«
»Ich bin dran!«, quiekte ich.
Sie gaben mir ihre Armreife.
Der von Mom war mit goldenen Sternen geschmückt und elegant mit bunten Fäden umwickelt. Darauf hatte sie geschrieben:
ICH WERDEIMMERSTOLZ AUF DICH SEIN.
Papas schmuckloser Holzring trug folgende Aufschrift:
GANZ EGAL WO DU BIST ODER WAS DU TUST,DU BIST IMMER GROSSARTIG.
Mir gefiel das von Mom besser.
Doch ich nahm sie trotzdem beide in den Arm.
Als ich Papa an mich drückte, hörte ich ihn zu Mom sagen: »Danke, Sandy.«
Zwei Wochen später wurde meine Mutter von einem 17-jährigen Strolch namens Gunther Groethe erschossen, während sie eine Vorlesung an der Akademie hielt.
Groethe war nicht in den Hörsaal gekommen, um meine Mutter zu töten. Er war gekommen, um die vielen jüdischen Studenten umzubringen, die ihre Vorlesung besuchten, da die Akademie eine der wenigen Universitäten war, die Juden aufnahm.
Groethe war ein zorniger, arbeitsloser bayerischer Mann, der kaum lesen und schreiben konnte und einer anti-semitischen Organisation in München beigetreten war, die ihm unentwegt eingeschärft hatte, dass die Juden für seine missliche Lebenslage verantwortlich seien.
In einer Wirtschaft, die die zweitgrößte nach der der Vereinigten Staaten war, in einem Kaiserreich, das sich anschickte, die Welt zu beherrschen, gehörte Groethe zu den Verlierern.
Und so stahl er das Armeegewehr seines älteren Bruders, ging in die Vorlesung meiner Mutter und erschoss wahllos vier jüdische Studenten und meine Mutter, bevor er sich wie ein Narr grinsend der Polizei ergab.
In seiner Jackentasche fand man ein Exemplar der Protokolle der Weisen von Zion, des berüchtigten Manifests der jüdischen Weltherrschaft-durch-Manipulation, das 1921 als Fälschung entlarvt werden sollte.
Im Jahre 1910 jedoch bahnte es sich seinen Weg durch Europa und in antijüdische Zirkel, wo es zahlreiche Verschwörungsstrategien und düstere Ahnungen bestätigte.
Groethe wurde zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt.
Meine Mutter hatte einen Doktor in Physik, ein Diplom in Chemie und sprach drei Sprachen. Sie wurde von einem rassistischen Rabauken aus dem Leben gerissen.
An dem Tag ihres Todes war sie 29 Jahre alt.
Und sie trug den kitschigen rosa Armreif, den ich ihr gebastelt hatte.
Als sie Papa den Armreif zusammen mit ihrem blutverschmierten Kleid zurückgaben, haftete noch immer der Duft des Californian-Poppy-Parfüms daran.
1933.
Ein anderes Mal.
Ein anderes Berlin.
Die Flammen schlagen in den Nachthimmel empor, als ich an der Preußischen Akademie der Wissenschaften vorübereile, den Kopf gesenkt, um nicht von der johlenden Meute gesehen zu werden.
Die Akademie steht im Schein des Feuers.
Wütende Studenten schleudern Bücher in die Flammen, Werke von Autoren, die nun als undeutsch, als anstößig oder unmoralisch erachtet werden.
Brecht. Schnitzler. Marx. Hemingway.
Und natürlich Einstein.
Ich bin nun 31.
Seit dem Tod meiner Mutter habe ich nicht mehr in Berlin gelebt. Viele dieser Jahre habe ich weit weg von Deutschland zugebracht.
Der Mann, der die Bücherverbrennung leitet, ist ein SA-Offizier namens Gunther Groethe.
Der Strolch, der meine Mutter ermordete, ist nun ein Teil des herrschenden Regimes.
1945.
Noch ein anderes Mal.
Noch ein anderes Berlin.
Ein anderes Ich.
Ganz Berlin steht in Flammen.
Bomben schlagen mit monströsem Donnern ein, während die nächsten schon durch die Luft pfeifen.
Die Deutschen laufen in alle Richtungen davon; auch die, die im Führerbunker unter der Reichskanzlei hockten.
Wir versuchen verzweifelt, den russischen Streitkräften zu entkommen, die durch Osteuropa gestürmt sind, um sich an der Nation zu rächen, die versuchte, sich ihr Land als Lebensraum einzuverleiben.
Ich renne, so schnell ich kann, ganz dicht hinter Bormann her, raus aus dem Führerbunker und quer durch den Innengarten der Reichskanzlei.
Ich komme an dem kleinen Krater im Boden vorbei, in dem Hitlers und Eva Brauns verkohlte und verzerrte Leichen liegen.
Der Ausbruch hat begonnen.
Die männliche Trauer neigt dazu, stiller und weniger sichtbar zu sein, weniger mit der Vergangenheit und mehr mit der Zukunft verbunden.
Thomas R. Golden, Trauertherapeut
Ich war zu jung, um wirklich zu verstehen, was geschehen war.
Mom war zur Arbeit gegangen – um noch mehr Eier in Milchflaschen zu saugen, nahm ich an – und war nicht zurückgekehrt.
Mein Vater trauerte sehr, doch er war fest entschlossen, es nicht in meiner Gegenwart zu tun. Manchmal erhaschte ich einen Blick auf ihn in seinem Schlafzimmer, auf der Bettkante sitzend und leise schluchzend.
Er nahm mich auch weiterhin mit zu der Anstalt in Potsdam, um Ooma zu besuchen.
Ich erinnere mich noch, wie wir das erste Mal ohne meine Mutter dort waren.
»Wo ist Mutter?«, fragte Ooma.
»Ooma«, sagte Vater sanft, »deine Mutter ist tot.«
Ooma nickte gleichgültig. »Oh.«
Albert Einstein und seine Frau kamen mit Braten und einem einfühlsamen Lächeln in unsere Wohnung. Einstein blieb oft bis spätabends da, um sich leise mit meinem Vater bei einem Glas Portwein zu unterhalten.
In den darauffolgenden Jahren hat mein Vater niemals andere Frauen auch nur angesehen.
Er ging einfach und ohne viel Aufhebens zurück an seine Arbeit im Reichstag, den Kopf gesenkt – ein belesener Anwalt in einem grauen Wollanzug, der neun wundervolle Jahre mit einer Göttin verbracht hatte.
Einmal, ungefähr sechs Monate nach dem Tod meiner Mutter, als ich vorgeblich schon ins Bett gegangen war, hörte ich, wie er sich im Wohnzimmer Einstein anvertraute.