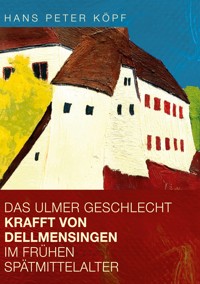
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch erforscht die Situation einer Patrizierfamilie in Ulm im frühen Spätmittelalter, ihre Verwandtschaft, ihre Besitzverhältnisse und ihren auch daraus resultierenden Wirkungskreis. Felix Fabri, Dominikanermönch in Ulm im 15. Jhrh., hat sich mit dem Herkommen dieser Familie in seinem "Tractatus de civitate Vlmensi" beschäftigt und berichtet. Hans Peter Köpf nimmt den Faden auf und Fabri beim Wort. Im Laufe der Arbeit werden Lebensumstände und Auseinandersetzungen der Zeit geprüft und dargestellt. Krafto Scriba, Kraft der Schreiber, +1298, begegnet uns mit seinen Brüdern und ebenso in seinen Ämtern und Handlungen, die die Urkunden bezeugen. Otto am Steg ist die seit langem bekannte Gestalt seiner Jahrzehnte, die bisher nicht genau einzuordnen gelungen war. HPK hinterfragt Namen, Sprache (Steg) und Standorte in Ulm, Wappen und Amt und eröffnet einen Teppich von weitreichenden Verknüpfungen. Gleichzeitig wird auch die Augsburger Vogtei in Zusammenhang mit Ulm betrachtet. Nicht ohne Bedeutung ist die Erzählung Fabris, wenn man die handgreifliche Auseinandersetzung um Amt und Würde verstehen soll. HPK benennt deshalb in einem Exkurs grundsätzlich den Aufbau eines Wappens in seinen entscheidenden Teilen und ebenso die Nutzung und Wirkung des mittelalterlichen Wappens und der Amtssiegel. Dazu sind ca. 160 Wappendarstellungen fotografisch mit Angaben dokumentiert. Seine umfangreiche Personenkartei und die Kartei zur Bauhütte des Ulmer Münsters befinden sich im Stadtarchiv Ulm. Im Fragment zu Kraft von Nau, sind seine Bemühungen, um den frühen Weg eines Namens auf der Landkarte anzuzeigen, über die Jahrhunderte von Verwandtschaft getragen, nachzuvollziehen. Hierzu hält das Kreisarchiv Calw weitere Unterlagen bereit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Seinen Lesern gewidmet,
die sich in die
öffentliche Verantwortung
einbringen
Das Ulmer Geschlecht Krafft von Dellmensingen
im frühen Spätmittelalter
Der Edle Kraft von Nau
Fragment
Als Doktorarbeit bei Prof. Hansmartin Decker-Hauff, Tübingen, konzipiert, bisher nicht veröffentlicht,
geschrieben Ende der sechziger Jahre und präzisiert bis 2019. Hrsg. Verena Kraft 2022
Epitaph, Kraft der alte Schreiber 1298, Foto HPK
Hans Peter Köpf im Südturm des Ulmer Münsters, 1966
Vorwort
Hans Peter Köpf habe ich in meiner ersten Lehrveranstaltung bei Prof. Dr. Hansmartin Decker-Hauff 1968 in Tübingen kennen gelernt. In den langen Jahrzehnten bis zum viel zu frühen Tod von ihm 2019 sind wir uns immer wieder begegnet und haben viele Fachgespräche geführt. Hans Peter Köpf war ein akribisch arbeitender Historiker und Theologe, dessen Thesen und Ergebnisse zwar man nicht allgemein übernehmen muss, die aber auf Grund seiner immensen Quellenkenntnisse, vor allem im Bereich des Urkundenwesens, bedacht und in die Diskussionen einbezogen werden müssen. Hans Peter Köpf hat sich bewusst zu dem entbehrungsreichen Leben eines Privatgelehrten im Stil des 19. Jahrhunderts entschieden, obwohl ihm durch seine Prüfungen, Begabungen und Ergebnisse überaus leicht der Weg in eine saturierte Lebensstellung gesichert gewesen wäre. Am Ausgang des Lebens kann man dieser entbehrungsreichen Entscheidung nur dem Fach zu leben Anerkennung und Wertschätzung zollen.
Hans Peter Köpf hatte sich bei seinem verehrten Lehrer Decker-Hauff die Geschichte der Patrizierfamilie Krafft in Ulm als Dissertation gewählt. Zahlreiche Publikationen im Bereich der Landesgeschichte, die er zum guten Teil aus wirtschaftlichen Gründen übernehmen musste, haben ebenso wie seine akribische Arbeitsweise den Abschluss dieser Arbeit über die Patrizierfamilie Krafft immer wieder verzögert. Die Untersuchung von Hans Peter Köpf zum Ulmer Bürgermeister Lutz Krafft in der Festschrift zur 600-Jahrfeier des Baubeginns des Ulmer Münsters 1977 ist als Teilergebnis seiner Forschungen als eine bedeutsame Arbeit zur Geschichte des spätmittelalterlichen Patriziats der Reichsstadt Ulm im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit zu berücksichtigen. Es ist mehr als anerkennenswert, dass sich die Witwe von Hans Peter Köpf, Frau Verena Kraft, – die Nachkommin der Patrizierfamilie Krafft ist –, entschlossen hat, das Manuskript der hier vorliegenden Untersuchung ihres Mannes für die Drucklegung vorzubereiten und drucken zu lassen. Hans Peter Köpf hat an dieser Arbeit vom Ende der 60er bis in seine letzten Lebenstage gearbeitet.
Die Arbeit hinterfragt die Geschichte der Ulmer Patrizierfamilien im Werk des Dominikanerpaters Felix Fabri und ihre Quellen, um dann auf die Familie Kraft des Schreibers und seine Brüder einzugehen. Diese hat im 13. Jahrhundert die Geschichte der Stadt Ulm entscheidend mitgeprägt. Neben dem Besitz und Vermögen der Brüder werden auch ihre Ämter und Nachkommen behandelt. Die Arbeit befasst sich dann mit dem Patrizier Otto am Steg, seiner Verwandtschaft und seinen Erben sowie zuletzt mit der Frage seines Verwandtschaftsverhältnisses zu Kraft dem Schreiber. Ein umfassender Beitrag widmet sich dem Wappen von Kraft dem Schreiber, seiner Brüder und Otto am Steg. Als Nachweis für den alten Adel der Familie Krafft wird die Untersuchung bis in die Neuzeit fortgeführt. Das Adlersiegel Krafts des Schreibers wird dabei unter Beachtung der Frage betrachtet, ob der Adler des Wappens als ein Amtszeichen zu sehen ist. Ein Exkurs befasst sich anschließend mit der Beobachtung zu mittelalterlichen Amtssiegeln. Der vorliegende Band schließt mit dem Fragment „Der Edle Kraft von Nau“, das als letztes Kapitel der Dissertation geplant war. Frau Verena Kraft sei für ihre Bemühungen um die Arbeit von Hans Peter Köpf abschließend nochmals herzlicher Dank gesagt.
Ellwangen/Tübingen, am Tag des hl. Michaels (29.Sept.) 2022 Prof. Dr. Immo Eberl
Siegel: Kraft der Schreiber, Urkunde von 1290 März 26, HstA-B.207 U 584
Inhalt
Das Ulmer Geschlecht Krafft von Dellmensingen im frühen Spätmittelalter
Der Edle Kraft von Nau
Anhang
Veröffentlichungen von Hans Peter Köpf, 1936-2019
Nachwort Kilian Spiethoff, Kreisarchivar
Dr. Rainer Prewo: Hans Peter Köpf in Nagold. Ein Epilog
Nachwort Verena Kraft
Abkürzungen
AStA
Allgemeines Staatsarchiv München
HStA
Hauptstaatsarchiv Stuttgart mit Staatsarchiv Ludwigsburg
GLA
Generallandesarchiv Karlsruhe
TLA
Tiroler Landesarchiv Innsbruck
DAA
Diözesanarchiv Augsburg
DAF
Diözesanarchiv Freiburg
DAR
Diözesanarchiv Rottenburg
FA
Fugger-Archiv Dillingen
KSta
Krafftisches Stiftungsarchiv
FlT
Flügeltafel
Das Ulmer Geschlecht Krafft von Dellmensingen im frühen Spätmittelalter
Die Familientradition
Welche Vorstellung das Geschlecht Krafft im 16. Jahrhundert von sich, seiner Geschichte und Herkunft hatte, das ist aus einer Darstellung zu ersehen, die in so vielen Abschriften aus dieser Zeit überliefert ist1, daß sie damals zweifellos jeder Angehörige des Geschlechtes kannte, vielleicht sogar besaß, und sein oder seiner Familie Selbstverständnis daran ausrichtete. Es handelt sich um die Verdeutschung des im Jahr 1488 von Bruder Felix Fabri in seinem „Tractatus de Civitate Vlmensi“ aufgezeichneten Berichtes über das Geschlecht Krafft. Wegen der Seltenheit des von Veesenmeyer edierten lateinischen Urtextes2 und der Verschiedenheit von der Übersetzung Hasslers3, auch bemerkenswerten Abweichungen von der Fassung Fabris, vor allem aber wegen ihrer grundlegenden Wichtigkeit ist es notwendig, diese Darstellung in ihrem Wortlaut hier vorzulegen4.
Der vrsprvng vnnd das Herkomen deß Edlen geschlechts der Kräfft.
Wie wol nit grundtlich noch aigentlich kann dargethon werden, zu was Zeiten vnnd von was Enden vnnd orten das allt Edelgeschlecht der Kräfft sein vrsprung vnnd Anfang genomen hab, So wurt doch vß sehr allten briefen Erwisen, das es allwegen der Statt Vlm beigewonet vnnd vor 300 Jarn vil Ansehlicher Fürnemer Leut diß geschlechts vnnd namens gewesen seien, ettliche aber vermainen vnnd wöllen, das sie vor allters die vom Steg gehaisen haben, Seien herkomen von Aim Schloß vf den Vildern Im würtembergerlannd beim dorf Scharnhausen gelegen, durch welche gegne Ain bach vßm Schonbach geloffen, Kerß genannt, derselb hab ernant Schloß vnnd dorf von Ainander geschiden, darüber ain Steg sey vom schloß Inns dorf ganngen, von welchem das gemain baurs volckh das ermelt Schloß Steg vund Folgendts die Innhaber die vom Steg genent. Alls man aber durch Kriegs Empörung dieselbe gegne vff den vildern verwüest, die vom Adel von Ire sitzen vertriben, denen vom Steg Auch Ir Schloß (von welchem noch heütis tags Ain burckhstall erfunden würt) Eingenommen vnnd verbrannt worden, seyen sie gen Vlm Inn die Statt geflohen, daselbst lanng hernach die vom Steg (welchen Namen auch Ir schillt vnnd Helm, darInn sie ain güldinin steg Inn Aim RotenFeld vber zwerchs Füeren, zustimmet) genennt worden, haben aber hernach durch ain erhaltenen Leib Kampf wider ain andern vom adel den namen Krafft bekomen, dann man sagt, es seie ain anderer Edelman gewesen der eben das wappen wie die vom Steg gefüert vnnd vermaint von wegen seins grossen vbermuots vnnd stoltz, es solte sich dess niemands dann er vnnd die seinen Anmassen, doher er Inen denen vom Steg ganntz abholld vnd feind worden, Ir wappen wo er es fuonden Aindtweder schendtlich besudlet oder gar zerrissen vnd verderbet, vber welchen die vom Steg nit onbillich sich erzürnet Ine Edelman vor dem Kaiser verklagt. alls sie aber hefftig vberainander verbytert gewesen vnd kains wegs haben mögen versönt werden, sei Inen vß kaiserlicher macht Ain Leib kampff zu hallten aufferlegt worden, welcher Imselben obsig, der sollt sein Allt herkomen Edelmans schillt vnd Helm behalten. do sie nur wohlgewapnet vnnd gerüst uff den Plan zu samen komen, hab sich der vom Steg so Ritterlich vnnd manlich erzaigt, das sich menigclich so zugesehen darab verwundert, vnnd Ime den Sieg mit freuden gegont, wann er auch vff sein gegenthail geschlagen drutzenlich geschryen „hie krafft, do krafft“, mit solchem sich hertzhafft, sein widersacher aber zag gemacht, In zu letst zu boden geschlagen und vberwunden vnnd dodurch sein Allt Edelmans wappen Für sich vnnd all seine nachkomen ganntz herrlich erhallten, diesen newen namen Krafft zur zeugnuß seins Sigs Folgends gen Vlm gebracht aldo er vnnd seine nachkomene Krafft genent worden. vß diesem geschlecht Ist der Erste burgermaister, als die Burgerschafft zu Vlm Angefangen, erküest worden, welcher sein Ampt vil Jar glücklich vnnd Erlich verwalten.
Es hatt Auch Ainer auß solchen den Ersten Fundament Stain An dem herrlichen gebew vnnser Lieben Frawen pfarkirchen zu Vlm gelegt, dann daß Prediger Closter daselbsten Anfangs gestifftet, dahin Ain fürtrefflicher vnnd allter man diß geschlechts Ain Aigne gewölbte begröbnuß Inn ainer besonndern Cappell, so er Johann genannt, zu nechst Am Chor gemacht vnnd geordnet, dar Inn er auch nach seim absterben vnnd vffs grab Ain gewalltiger vergüllter Stain mit seim schillt vnnd Helem vnnd Folgender grabschrifft gelegt worden:
Am tag der offenbarung Anno 1298 Starb der Herr Krafft Hertzog Albrechts dess erstens diß namens Inn osterreich Cantzler, vnnser des Prediger ordens stiffter.
Die Quelle Fabris
An anderer Stelle sagt Fabri über die Quelle seiner Kenntnisse, daß er das, was er berichte, aus alten Urkunden erhoben und von den Ältesten des Geschlechts erfahren habe.5 Das wird hier genauso gelten, wobei freilich nur die zitierte Grabplatteninschrift und die ebenfalls durch Inschriften bezeugte Grundsteinlegung zum Münster sich heute als auf primären Quellen beruhend feststellen lassen. Alles andere dürfte ihm demnach erzählt worden sein – er berichtet es auch mit deutlicher Skepsis. Doch ist das, was er wiederzugeben hat, so reich an anschaulichen Einzelheiten, daß nicht nur dieser Bericht viel länger ist, als jeder andere über eine Ulmer Familie, sondern auch dadurch ihm keine Möglichkeit gelassen wird, zu sonst beliebten etymologischen Spekulationen oder humanistischen Fabeleien von römischer oder troyanischer Abkunft – lediglich die Inschrift des Epitaphs bietet ihm Gelegenheit zur Anwendung seiner humanistischen Bildung in einer überaus geistreichen Exegese, auf die die Übersetzung jedoch verzichtet. Dafür ist hier die von Fabri wörtlich zitierte Inschrift erweitert um eine konkrete historische Angabe, die so bei Fabri nicht zu finden ist. Weggelassen auch Beweis für Adel-Selbstverständlichkeit.
Einmalig bei Fabri ist aber vor allem die Verwendung einer in sich geschlossenen Erzählung, die gut die Hälfte seines Berichtes ausmacht, von ihm freilich indirekt dargeboten wird. Ihrer Gattung nach ist diese Erzählung als Sage zu werten, genauer wohl als ätiologische Sage, da sie darauf abzielt, die Bedeutung und Entstehung des Geschlechtsnamens zu erklären. Dies geschieht durch ein Ereignis, das sich zweifellos so nicht abgespielt hat, zu dem sich aber offenbar grundsätzlich richtige Erinnerungen konkretisiert haben. Reduziert man nämlich die anschauliche Erzählung auf ihren abstrakten Inhalt, so handelt sie von einem Wechsel des Wohnsitzes, einer Änderung des Geschlechtsnamens und von einer Auseinandersetzung um das Wappen, wobei die beiden letzten hier miteinander in Verbindung gebracht sind. Als ursprünglichen Namen nennt die Sage „vom Steg“ – in Fabris lateinischem Originaltext heißt es „de Ita“ – und findet auch für ihn in den lokalen Verhältnissen des ursprünglichen Stammsitzes, als der Scharnhausen bei Esslingen eingehend beschrieben wird. Fraglich ist dagegen, ob auch die Deutung des Wappens als von dem alten Namen abgeleitet und damit redend ursprünglich einen Teil der Sage bildete, oder ob hier nicht eher eine Auslegung Fabris zu erkennen wäre.
Damit sind in dieser Sage nicht nur durchaus wahrscheinliche Vorgänge verarbeitet, sondern auch mit dem Geschlechtsnamen und der Ortsangabe derart präzise Aussagen gemacht, daß hier durchaus zuverlässige Überlieferungen zu erkennen sind. Diese werden zu berücksichtigen sein bei der Deutung der primären Quellen, mit denen die der Sage zugrundliegenden geschichtlichen Tatsachen erfaßt werden müssen, und behalten selbst da noch Gewicht, wo sie durch solche Quellen nicht bestätigt werden können. Denn daß ihnen jeder historische Gehalt mangle, ist völlig ausgeschlossen, weil die Sage als Überlieferungsform eines vorwissenschaftlichen Bewußtseins zwar den Context sorgfältig tradierter Gegebenheiten ändern, nicht aber diese selbst erfinden kann.
Man wird eine solche Sage wohl am treffendsten als Familiensage bezeichnen, weil hier in einer weit zurückreichenden Überlieferung vom eigenen „Ursprung und Herkommen“ das Selbstverständnis eines Geschlechtes seinen Ausdruck findet. Somit hat nicht erst Fabris Bericht das Selbstverständnis des Geschlechtes Krafft im Sinn dieser Sage geprägt, sondern diese ist die wesentlich ältere Grundlage seiner Darstellung. Daß übrigens auch andere Ulmer Geschlechter ihre Familiensage hatten, dafür finden sich bei Fabri Hinweise, doch offenbar erschien ihm keine andere so interessant, daß er sie gleichermaßen hätte ausführen mögen.
Die Entstehungszeit der Sage läßt sich mit Hilfe von Fabris weiteren Nachrichten eingrenzen. Unmittelbar an die Sage schließt er eine Mitteilung an, die sich mit der Zeitangabe „als die Burgerschafft zu Vlm Angefangen“ zunächst ebenso wenig datieren läßt wie die Sage selbst, darauf folgen die Vorgänge, bei denen er sich auf Monumente stützen kann. Die weiteren Nachrichten beziehen sich auf das späte 14. und das 15. Jahrhundert. Hundert Jahre vor der Niederschrift Fabris muß also die Familiensage schon so weit ausgebildet gewesen sein, daß in sie keine neuen Elemente mehr eingefügt werden konnten. Die Ereignisse, von denen sie erzählt, müßten sich dann wohl spätestens in der Zeit um 1300 abgespielt haben, können aber selbstverständlich alle oder auch nur zum Teil sehr viel weiter zurückliegen.
Weitere Traditionen
Daß auch Traditionen aus der Zeit, die wahrscheinlich von der Familiensage noch erfasst wird, nicht in ihr verarbeitet wurden, sondern neben ihr bestehen blieben, zeigt sich in der „Flügeltafel“, einem um 1515 angefertigten Totenverzeichnis der Familie Krafft6, an einer Ausführung zur Person des Kraffto Scriba des alten, der nach ihr 1299 – tatsächlich 1298 – am 6. Januar starb. Sie lautet:
„Disen kraftonem den alten vnd seine brüder mit hertzog Conrat von deck vertrib vß Vlme auf S. bernhartz tag Otto der alt ain mister vnd aman dieser stat. Darnach mit grossen eren warden sy berüfft vnd empfangen in diß statt.“
Allein schon, daß zwar der Tag, nicht jedoch das Jahr des Geschehens genannt wird, erweist die hohe Glaubwürdigkeit dieser Notiz, deren Inhalt genau so wenig erdichtet sein kann, wie die Aussagen der Familiensage.
Nicht auf den ersten Blick als Traditionen zu erkennen und als solche mit Sicherheit zu identifizieren sind Nachrichten, die in alten Darstellungen lediglich als historische Gegebenheiten verwendet sind, ohne daß ihre Herkunft noch erkennbar wäre. Dazu gehört die erläuternde Übersetzung von „Scriba“ mit „Hertzog Albrechts . . . Cantzler“ ebenso, wie die widersprechende Behauptung Fabris, der alte Krafft sei „Wirklicher Schreiber des Herrn Kaisers“ gewesen7. Auch die unbelegbare Zurechnung des Hirsauer Abts Kraft (1280-1293) zum Ulmer Geschlecht in der von Bucelinus verwendeten Stammtafel8 könnte auf überlieferter Kenntnis beruhen. Jedoch ist in solchen Fällen stets auch mit Irrtümern oder Erfindungen einer noch ganz unentwickelten Geschichtsforschung zu rechnen und jede solche Notiz mit Umsicht auf ihren möglichen geschichtlichen Wahrheitsgehalt zu prüfen.
Charakteristisch für die mündliche Überlieferung ist ja, daß das erzählte und gehörte Faktum sich den Vorstellungen und Verstehensmöglichkeiten des Übernehmenden anpaßt und dabei häufig in einen anderen, ihm nicht ursprünglich zugeordneten Zusammenhang gerückt, besonders gern aber mit ohnehin bekannten Personen verbunden wird. Eine solche Person ist Kraft der Schreiber, dessen prächtiges Epitaph der Familie stets vor Augen stand und den sie zu allen Zeiten als ihren Stammvater – „fundator“ – verehrte. Er ist auch der einzige in der zuverlässigen Überlieferung Genannte: Bei ihm muß also die Überprüfung der Tradition an Hand der primären Quellen einsetzen.
1 StAUlm 1m-G2 39.
2 Fratris Felicis Fabri Tractatus de civitate Ulmensi, hrsg. von Gustav Veesenmeyer. Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart Bd. 186, Tübingen 1889.
3 Bruder Felix Fabris Abhandlung von der Stadt Ulm, verdeutscht von K. D. Hassler. In: Mitt.UD 1315 (1909).
5 Fabri-Veesenmeyer, S. 82 bei Ehinger und S. 87 bei Strölin.
6 Im Besitz der Familie des Herrn Heinrich Krafft von Dellmensingen. Der Name „Flügeltafel“ bezieht sich auf die Form des Triptychons; geschlossen ist dieses bemalt mit Symbolgestalten von Tod und Leben, jede mit dem Krafftischen Wappen und einem Spruchband. Die Innenseite ist auf Pergament in vier Spalten geteilt, doch nur bis zur Mitte der dritten Spalte beschrieben, durch unsachgemäße Behandlung aber fast völlig unleserlich geworden. Eine nicht fehlerfreie Abschrift aus dem 19. Jahrh. hat mir Herr Heinrich Krafft von Dellmensingen überlassen – das Original unter der Quarzlampe zu lesen, war mir leider nicht vergönnt. Das Verzeichnis wurde wohl um 1515 im Predigerkloster erstellt, hauptsächlich wohl auf Grund der in der Johanneskapelle vorhandenen Grabplatten im Kloster gestifteten Jahrtagen. Die genealogischen Angaben sind unzuverlässig, vor allem in der älteren Zeit fast stets ganz willkürlich, auch die Sterbedaten nicht immer richtig gelesen. Trotzdem ist die „Flügeltafel“ eine Quelle von unschätzbarem Wert.
7 Fabri-Veesenmeyer S. 34: „insignis vir dictus antiquus Kraft, actu scriba domini Imperatoris“
8 Gabriel Bucelinus, Germania Topo-Chrono-Stemmatographica Sacra et Profana. Band 2. Ulm 1662.
Kraft der Schreiber und seine Brüder
Das Epitaph, das Fabri beschreibt – im Originaltext unter wörtlicher Zitierung der Umschrift9 – ist erhalten, wenn auch seit der Zerstörung Ulms am 17. Dezember 1944 schwer beschädigt und verwahrlost10.
Sein ursprünglicher Platz war über dem Grab Krafts in der Johanneskapelle, der alten krafftischen Grablege, die südöstlich an den Chor der Predigerkirche angebaut war und 1819 abgebrochen wurde11. Nach dem Umbau der Kirche zur Dreifaltigkeitskirche wurde der Stein 1621 an der Innenseite der Chorwand aufgerichtet und neu gefaßt12, Farbreste waren noch 1876, aber schon 1911 nicht mehr zu sehen, die Schrift jedoch damals noch vergoldet13. Auch die von Endriß angenommene Nacharbeitung der Umschrift kann, wenn überhaupt14, nur 1621 erfolgt sein, dann sicher zuverlässig nach der Lesung Fabris. In teils capitalen, teils unzialen Maiuskeln geschrieben lautet sie: ANNO DOM CC LX/ XXXVIII IN DIE E-PIP-HANIE OB/IIT DOMINVS KRAFTO/ANTIQUS – SCRIBA FUNDATOR/ NR. Die Abkürzung für „noster“ steht dabei, wegen schlechter Einteilung des auf dem Rand vorhandenen Platzes, in der rechten oberen Ecke des Innenfeldes, das ganz vom Hochrelief des krafftischen Wappens eingenommen wird. Die Unterbrechungen der Inschrift sind verursacht durch das Übergreifen von Helmdecke und Schild auf den Rand, der genau 10 cm breit und um etwas mehr als 45° nach außen abgeschrägt ist, so daß die oben rechts beginnende Inschrift im Herumgehen gegen den Uhrzeigersinn zu lesen ist. Damit erweist sich das Epitaph als Deckplatte eines Tumba-Grabes.
Kraft der Schreiber oder zumeist lateinisch Crafto dictus Scriba, kann urkundlich seit 1270 in Ulm nachgewiesen werden15 und ist bis zu seinem Tod achtundzwanzig Mal in zeitgleichen Quellen erwähnt. Aus diesen Erwähnungen läßt sich eine Vielzahl an Beziehungen erkennen, obwohl nur eine Urkunde von ihm selber ausgestellt ist und in siebzehn Fällen er lediglich als Zeuge genannt wird. Denn Amt und Ansehen sind nur selten der alleinige Grund der Hinzuziehung zu einem Rechtsgeschäft, entscheidend sind in der Regel doch die persönlichen Beziehungen zu den dabei agierenden Personen. Freilich finden sich dann dafür keine Bezeichnungen, nie sind sie ohne weiteres erkennbar, und nicht immer gelingt es, sie zu erschließen. Sie können darum zunächst nur angedeutet werden, ihre Präzisierung wird Aufgabe der weiteren Untersuchung sein.
Die Familie Krafts
Die einzige in den Quellen ausgesprochene Beziehung Krafts betrifft seine allernächste Verwandtschaft. Bei seinem zweiten Auftreten leistet er Zeugenschaft neben seinem Vater Ulricus Scriba, der zuvor nur einmal 1264 in dem Ulricus notarius, der eine lange Zeugenreihe mit Ulmer Bürgern abschließt, erkannt werden könnte16. Denn daß dieser nicht der 1277 und 1284 genannte Stadtschreiber Ulrich17 sein könnte, ergibt sich nicht allein daraus, daß zwischen 1255 und 1272 sonst nur der Stadtschreiber Berchtold von Unlingen bezeugt ist18, sondern auch aus dem Fehlen der beim Stadtschreiber sonst üblichen Beisätze „civitatis“ und „humilis“ bzw. „humillimus“. Dennoch steht seine Anführung an letzter Stelle in auffallendem Gegensatz zu der bevorzugten Stellung, die er 1271 und 1277 als dritter nach dem Amann Otto am Steg und dem greisen Wernher Mönch, 1272 gar als erster der nicht ritterlichen Zeugen, einnimmt. Zwischen 1277 Juni 28 und 1279 Juni 29 muß dieser gestorben sein, weil von da an Kraft und seine Brüder nur noch ohne ihn auftreten.
Mit seinen Brüdern zusammen erscheint Kraft häufig, bis 1289 fast regelmäßig, so daß von achtzehn Nennungen Krafts nur fünf ihn allein anführen, wozu noch drei oder vier Erwähnungen nur eines seiner Brüder kommen. Schon bei Krafts zweitem Auftreten ist außer dem Vater auch sein Bruder Ulrich, wie auch später in der Regel, ihm vorangestellt, also der älteste der Brüder. Als jüngere Brüder treten 1277, noch einmal mit dem Vater, Otto, Dietrich und Herman hinzu, 1279 als letzter Heinrich19. Doch zeigt dessen fast stets eingehaltener Platz zwischen Otto und Dietrich, daß er nicht der jüngste Bruder ist. Sein Alter wird 1302, wo er als vereidigter Zeuge des Klosters Söflingen in dessen Streit mit dem Grafen Eberhart von Wirtemberg um die Besetzung der Kaplanei Ehrenstein aussagt, mit vierzig Jahren angegeben20. Dies dürfte freilich sehr ungenau sein, wie aus den Altersangaben der übrigen Zeugen ersichtlich ist, die sich zum überwiegenden Teil auf runde Zehner beschränken, wobei gerade vierzig Jahre das am häufigsten genannte Alter ist21. Da ihm 1281 das Kommando über die von den Ulmern bis zu ihrer Übergabe an das Kloster Söflingen besetzt gehaltene Burg Ehrenstein übertragen war22, und er damals schwerlich erst neunzehnjährig gewesen sein wird, darf wohl angenommen werden, daß er einige Jahre älter war. Dazu stimmt dann auch die Zeugenschaft seiner beiden jüngeren Brüder schon 1277, die darauf schließen läßt, daß auch sie wohl noch vor 1260 geboren wurden, da allzu jugendliche Zeugen aus den Ulmer Geschlechtern, selbst zusammen mit Vater und Brüdern, sonst nie festgestellt werden können und später auch sechzehn Jahre das Mindestalter für die Aufnahme in die Geschlechterstube war.
Groß kann allerdings der Altersunterschied zwischen den drei jüngsten Brüdern dabei nicht gewesen sein, was sich auch daran zeigt, daß Herman, der jüngste, zweimal vor Dietrich, einmal sogar vor Heinrich genannt wird. Diesem Vorrücken entspricht wohl auch eine gegenüber den anderen gesteigerte Bedeutung, da es erst seit 1282 vorkommt, nachdem er also dem jugendlichen Alter entwachsen war. Etwas größer scheint dagegen der Altersabstand von dieser Brüdergruppe zu Otto zu sein, aber ebenso auch von diesem zu den beiden ältesten Brüdern, weil er immer dieselbe Stellung einnimmt, während Kraft auch zweimal seinem älteren Bruder Ulrich vorgezogen wird. Die überragende Bedeutung Krafts kommt hierin ebenso zum Ausdruck, wie vor allem in seiner ungleich häufigeren Erwähnung.
Als weiteren „Bruder des ersten stiffters“, also Krafts des Schreibers, nennt die „Flügeltafel“ einen 1333 gestorbenen und in der Johanneskapelle begrabenen Johannes. Da die genealogischen Angaben der „Flügeltafel“ für diese Zeit jedoch äußerst fragwürdig sind und Johans der Schriber nur einmal 1308 als Tochtermann des Biberacher Ammans Graether Kaepphinch urkundlich nachgewiesen werden kann23, muß seine Einordnung, die in die nächste Generation genauso gut möglich wäre, offen bleiben. Sollte aber die Angabe der „Flügeltafel“ auf echter Überlieferung beruhen, für die sich nur keine Bestätigung findet, so könnte er bei dem häufigen geschlossenen Auftreten der Brüder Schreiber allenfalls als Halbbruder aus einer nicht faßbaren späten Ehe des Vaters betrachtet werden.
Zwischen den auseinandergezogenen Geburtsjahren der Brüder muß wohl die Geburt auch einiger Schwestern angenommen werden. Von diesen läßt sich zunächst nur eine mit einiger Sicherheit erschließen. Als nämlich Renhart von Griesingen 1345 bei der Entlassung aus ulmischer Gefangenschaft seine Urfehde und Verbannung „in die Mark Brandenburg über das Wasser die Elbe“ beschwört, setzt er zu Bürgen („Tröstern“) vierzig „gebohr fründ“, also Blutsverwandte24. Die zugrunde liegenden Verwandtschaftsverhältnisse sind ebenso schwierig zu klären, wie die Genealogie der Herren von Griesingen selbst, doch scheint in der Reihenfolge der Bürgen eine gewisse, offenbar im Verwandtschaftsgrad begründete Reihenfolge eingehalten worden zu sein. So erscheint nach achtzehn Angehörigen der verschiedensten, meist landadeligen Familien der Griesinger Mannesstamm erst vom 19. bis zum 28. Bürgen, darauf folgt das Ulmer Geschlecht Rot aus der Linie des Ott Rot mit fünf Personen, wohingegen Fritz der Rot von Zelle und sein Bruder Heinrich schon an 8. und 9. Stelle aufgeführt sind. Fünf Nachkommen Krafts des Schreibers und auch der Enkel eines seiner Brüder nehmen den 34. bis 39. Platz ein: Hier ist also der Vater Krafts der nächste gemeinsame Vorfahr – wahrscheinlich auch mit Renhart von Griesingen. Dessen Vater ist nämlich Her Ulrich von Griesingen, der letztmals 1347 als „der alt“ und Bruder eines offenbar schon vor längerer Zeit verstorbenen Renhart genannt wird25. Da der Name Ulrich bei den Herren von Griesingen im 13. Jahrhundert noch nicht gebräuchlich ist, kann wohl angenommen werden, daß er durch eine Tochter Ulrichs des alten Schreibers eingeführt wurde.
Als deren Ehemann kann, da nur in dieser Linie der Name Renhart eine Rolle spielt, nur ein Reinhart von Griesingen in Frage kommen, der sich vorläufig von 1260 bis 1281 nachweisen läßt – er findet sich auch 1281 zweimal in höchst auffälliger Beziehung zu Kraft und seinen Brüdern26. Beide Male führt er als Ritter eine Zeugenreihe an, in der die Brüder Schreiber vollzählig und zudem noch in anderen wichtigen Funktionen vertreten sind, außer ihnen aber nur noch der Amman Otto am Steg und der Ritter Heinrich Stocker, dazu das eine Mal Otto der Rot, das andere Mal der Söffeler. Dieser kann wegen seiner bevorzugten Stellung zwischen den beiden Rittern nur mit dem 1278 Marquart und 1272 an dritter Stelle nach Ulricus Scriba senior und Otto Rufus genannten M. Soviler identifiziert werden27, während der Sefelaer, der 1286 auf Kraft, Ulrich und Dietrich die Schreiber unmittelbar folgend als einziger weiterer Ulmer Bürger Zeugenschaft leistet28, vermutlich sein Sohn und mit dem seit 1294 mehrfach erwähnten „dictus Seveler miles“29 identisch sein dürfte. Da dieser [1296] ein einziges Mal auch Ulrich der Souiler heißt30, darf mit aller Vorsicht die Vermutung gewagt werden, daß auch er ein Enkel Ulrichs des alten Schreibers, Marquart der Sefeler also ein Schwestermann Krafts gewesen sein könnte.
Mit seinem Sohn, der ebenfalls Kraft heißt, erscheint Kraft der Schreiber erstmals 129331. Man wird daher annehmen können, daß er bei seinem ersten Auftreten 1270 bereits verheiratet war, wie das ja auch natürlich ist, wenn er schon längere Zeit vor 1260 geboren wurde. Zusammen mit seiner Frau macht er 1290 eine Mahlzeitstiftung an das Ulmer Spital32, ihr Name ist da Elisabet. Daß sie seine einzige Frau war, ergibt sich aus einer Urkunde des Klosters Söflingen von 1338, wodurch die Einkünfte eines neu erkauften Hofes zur Hälfte zu „Hern Crafts Jar zit zv Obrosten vnd siner hvs vrowen zv sant Margretentag“ bestimmt werden33. Daß es sich um die – natürlich längst zuvor gestiftete – Jahrzeit Krafts des Schreibers handelt, beweist das Datum „Obrosten“, der 6. Januar. Im Guttäterbuch des Klosters34 finden sich die Einträge „Herr Crafft von Ulm“ in der ersten Woche, Januar 1-7, und in der 28. Woche, Juli 8-14, in die der Margretentag fällt, „Elisabeth Kräfftin“. Hätte Kraft eine zweite Ehe geschlossen, so wäre zweifellos auch für diese Frau im Kloster Söflingen eine Jahrzeit eingerichtet und diese in der Urkunde von 1338 erwähnt worden. Die Zuordnung der Mechthilt Hünrerin als seiner Frau bei Bucelinus ist schon im 18. Jahrhundert von Johann Anthoni Krafft35 als Mißverständnis der Nachricht Fabris, daß diese zum Bau des Predigerklosters einen Garten gegeben habe36, erkannt worden. Aber auch die Agnes, die von der „Flügeltafel“ für seine Hausfrau und bei ihm begraben ausgegeben wird und 1328 Mai 28 gestorben sein soll, ist unter diesem Tag im Necrolog des Klosters Urspring als „Agnes Kreftyn monialis“ eingetragen37 – die Urspringer Tabula Necrologica38 scheint das Sterbejahr zwischen 1329 und 1332 anzusetzen. Sie muß wohl eher für seine Tochter gehalten werden als für eine späte zweite Ehefrau, zumal auf einer Urkunde von 1307, worin den Predigern zu Ulm ein Haus übereignet wird39, der deutlich noch vom Anfang des 14. Jahrhunderts stammende Rückvermerk „littera pro domo kräftine antiqua“ kaum anders gedeutet werden kann, als daß die Witwe Krafts als einzige „alte Kräftin“ dieser Zeit damals dieses Haus als Leibgeding von den Predigern bewohnte und also wenigstens zehn Jahre nach Krafts Tod nicht ins Kloster Urspring eingetreten war. Diese „alte Kräftin“ muß doch wohl noch Elisabet gewesen sein, die Kraft den Schreiber überlebt hat.
Der Besitz Krafts
Vom Besitz Krafts des Schreibers wird nur wenig erkennbar. Dem Ulmer Spital übergibt er 1290 zu der Mahlzeitstiftung zwei Höfe, einen größeren in Oberstotzingen, der 16 Imi Ulmer Meß und 2 lb Ulmer Geldes jährlich gültet, und einen kleineren mit nur 4 Imi Vesen Gült in Niederstotzingen40. Während diese Höfe Krafts Eigen gewesen waren, besaß sein Bruder Dietrich ebenfalls in Stotzingen einen Hof als Lehen von den Grafen von Helfenstein, die ihn 1294 dem Kloster Kaisheim, das ihn gekauft hatte, eignen41. Die jährlichen Einkünfte werden dabei mit 15 lb Haller angegeben – nach den Kaisheimer Urbaren gab die „curia sive huba Scriptoris“ jährlich 16 Imi Vesen, 1 lb hl, 4 Herbsthühner, 1 Fasnachthenne und 9 den. zu weisat, dazu 6 den. Handlohn und 15 ß hl Weglöse42.
Daß Kraft und seine Brüder offenbar mehr Besitz in Stotzingen und wohl auch in dessen Umgebung hatten, läßt sich aus mehreren Zeugenschaften und auch Bürgschaften schließen, die sie bei Güterübergaben dort leisten. Als 1286 ebenfalls in Oberstotzingen ein Hof von Hertnid von Rammungen an das Kloster Medlingen verkauft worden war und von den Grafen von Helfenstein als Lehenherren diesem geeignet wurde, erscheinen als Zeugen gleich nach zwei Rittern die Ulmer Bürger Craft dictus scriba, Vlricus und Dietricus scribe und dictus Sefelaer43. Wieder Hertnid von Rammungen setzt 1288 Dietrich den Schreiber als dritten nach Ulrich von Stozzingen und Otto von Sunthain zum Bürgen, als er einen Hof in Rammingen an das Kloster Kaisheim verkauft, wobei sich unter den Zeugen als einzige Ulmer die Brüder Ulrich und Kraft die Schreiber befinden44. Schließlich ist noch Ulrich der Schreiber in einer undatierten, aber sicher auf 1294/1295 anzusetzenden Urkunde45, mit der Markgraf Heinrich von Burgau dem Kloster Kaisheim die diesem von Hertnid von Rammungen verkauften Lehen in Rammingen eignet, als letzter, jedoch einziger nicht zum Gefolge des Markgrafen zählender Zeuge genannt.
Damit sind freilich nicht alle Rechtsgeschäfte erfaßt, die über Güter in dieser Gegend abgeschlossen wurden, und es kann darum vermutet werden, daß die Brüder Schreiber dann, wenn sie hinzugezogen wurden, selber Ansprüche an den veräußerten Besitz erheben konnten. Bemerkenswert ist dabei die letztgenannte Urkunde von 1294/1295 deshalb, weil im vorangehenden Kaufbrief Härtnids von Rammungen45 weder unter den Bürgen noch unter den Zeugen ein Schreiber zu finden ist. So erhebt sich der Verdacht, daß ihre Ansprüche sich vielleicht auf das Eigentumsrecht an diesem Besitz erstreckt haben könnten. Wenn dem zu widersprechen scheint, daß Dietrich der Schreiber ja selber einen Hof zu Lehen hat, so muß dagegen bedacht werden, daß Lehen doch sehr unterschiedliche Ursprünge haben können und die frühere Widerlegung eines geeigneten Lehens mit einem Eigen hier ebenso denkbar wäre, wie der Ausgleich konkurrierender Eigentumsansprüche durch ein Lehensverhältnis.
Ein anderer Besitz Krafts des Schreibers erscheint [1293], wo er von Markgraf Heinrich von Burgau und dessen Enkel Heinrich mit dem Zehenden in Ketz belehnt und ihm zugleich gestattet wird, eine verpfändete Hube daselbst von Heinrich dem Tober mit
20 lb hl auszulösen46. Da hierbei jedenfalls kein Herrnfall vorliegt, muß Kraft das Lehen kurz zuvor erworben haben, ob durch Kauf oder durch Erbschaft, kann nicht ermittelt werden. Möglich wäre aber, daß er es von seinem Bruder Herman, der nach 1298 März 2547 nicht mehr nachgewiesen werden kann und wohl in dieser Zeit und anscheinend ohne Nachkommen gestorben ist, ererbt hat. Da Gütererwerbungen, wie sie auf jeden Fall die Auslösung der Hube darstellt, fast stets der Erweiterung schon vorhandenen Besitzes dienen, wird man annehmen dürfen, daß Kraft und wohl auch seine Brüder in der Nähe von Kötz mehr Besitz hatten. Hier finden sich allerdings in den Quellen weitere Hinweise, die diese Annahme erhärten könnten, die Kraft den Schreiber und seine Brüder nennen, nicht, sofern man nicht die zweimalige Erwähnung Dietrichs und einmal auch Hermans zusammen mit Güssen und Herren von Burgau – freilich in ganz anderem Zusammenhang48 – als solche werten will.
Lehen hatte Kraft auch von Graf Eberhart von Landau, der aber um 1318/20 offenbar selber nicht mehr wußte, um welche Güter es sich dabei handelt, und nur noch feststellen konnte, daß sein Sohn Kraft der Schreiber von vielen Lehen noch keines empfangen oder erfordert hatte49. Endlich ist 1308 noch Krafts Bruder Dietrich als Besitzer eines Hofes in Busenreute, einer abgegangenen Siedlung an der Iller südlich Ulms, erwähnt50. Damit sind die Quellenaussagen zum Besitz Krafts und seiner Brüder erschöpft, doch wird sich später aus dem Besitz ihrer Nachkommen mehr davon erschließen lassen.
Geldvermögen
Daß Kraft der Schreiber außer großem Besitz auch ein entsprechendes Geldvermögen hatte und wohl für ausgesprochen reich gehalten werden muß, zeigt sich daran, daß er Herzog Ludwig dem Strengen von Bayern eine befristete Anleihe zu gewähren in der Lage war – sicher eine beträchtliche Summe, die leider nicht überliefert ist, da die erhaltene Rechnung von Herzog Ludwigs oberem Vizedomamt 1291-1294 zwar noch die Entschädigung der von Kraft gemahnten Bürgen, aber nicht mehr den schon früher an ihn zurückbezahlten Betrag enthält51. Sein Reichtum läßt sich auch aus verschiedenen Stiftungen ersehen, wovon allerdings die Mahlzeitstiftung ins Spital von 1290 die einzige ist, über die eine Urkunde ausgestellt wurde oder erhalten ist32.
Doch ist auch die Gründung und Förderung des Ulmer Predigerklosters durch ihn sehr gut bezeugt, nicht allein durch Fabri, der seine Kenntnisse wahrscheinlich aus Aufzeichnungen der Prediger aus der Zeit ihrer Niederlassung in Ulm schöpfen konnte52. Auch die Bezeichnung „fundator noster“ in der Epitaph-Inschrift kann sich ja nur auf den Predigerconvent beziehen, der den Stein wohl noch während der Bauarbeiten an Kirche und Kloster anfertigen und das Tumbagrab bauen ließ, das nur dem Stifter zustand53 – dem Stifter des Klosters, nicht nur der Johannes-Kapelle, in der es stand. Die Erbauung dieser Kapelle als Stiftergrablege gleichzeitig mit der Klosterkirche an der prominentesten Stelle an der Südwand des Chores bestätigt die Gründung des Klosters ebenso, wie die stets auffallend regen Beziehungen seiner Nachkommen zum Ulmer Predigerconvent.
Nicht erweisen läßt sich die Behauptung Weyermanns, im Jahr 1281 habe ein Herr Kraft – der ja nur Kraft der Schreiber sein könnte – eine Ursula-Kapelle beim Tränktörlein erbaut54. Unglaubhaft ist dies vor allem deshalb, weil Kraft, wie gezeigt werden wird, wahrscheinlich im alten Pfalzbereich gar keine Kapelle bauen konnte. Dagegen kann die Stiftung des Ulmer Totengräberamtes nur durch ihn erfolgt sein, obwohl erst aus dem Jahr 1354 die älteste Nachricht darüber vorliegt55. Damals verliehen das Amt alle seine, aber nur seine Nachkommen, die es ausdrücklich als von ihren „Vordern“ ihnen überkommen bezeichnen, so daß es also vom nächsten gemeinsamen Ahnherrn Kraft dem Schreiber gestiftet worden sein muß.
Eine Zahlung „pro Chraftone de Ulma“ erfolgt im Rechnungsjahr 1290/1291 aus dem Tiroler Amt Gries auf Anweisung des Landesherrn56. Daß der Betrag von 12 Mark an den Bozener Berchtold Sartor – wohl ein Gewandhändler – ausbezahlt wurde, berechtigt allerdings noch nicht zu der Folgerung, daß Kraft selber als Warenkaufmann Handelsbeziehungen zu Tirol unterhalten habe; weit eher dürfte der Bozener durch seine Handelsbeziehungen die Möglichkeit gehabt haben, das Geld an Kraft zu übermitteln. Häufiger erscheint dann in den Tiroler Raitbüchern von 1298 an Chrafto de Ulma – nun also Krafts gleichnamiger Sohn – als Empfänger von Zahlungen, deren Ursache bei ihm auch genannt wird: Er war der Ulmer Wirt der Grafen von Tirol, als solcher auch ihr Geldgeber und Vertrauensmann, offenbar so etwas wie ihr ständiger Vertreter in Schwaben57. Den selben Grund hat zweifellos auch die Zahlung an den alten Kraft, und da lediglich aus Quellenmangel weitere Zahlungen an ihn nicht nachweisbar sind, wird man ihn als den Wirt des Grafen Meinhard II. (IV.) von Tirol auch schon bei dessen früheren Aufenthalten in Ulm ansehen dürfen.
Ämter
In einem Amt ist Kraft nur einmal bezeugt, 1279 schon, wo er und sein Bruder Ulrich zu den ersten urkundlich bekannten Ulmer Richtern gehören58. Da die Lebenslänglichkeit dieses Amtes vom ausgehenden 13. Jahrhundert an erweisbar ist und auch für den ebenfalls 1279 und noch 1293 und 1296 als Richter erwähnten alten Ulrich Gwärlich zu gelten scheint59, kann angenommen werden, daß auch Kraft und Ulrich dieses Amt bis an ihr Lebensende innehatten. Damit ist nicht unmöglich, daß zumindest Kraft auch weitere Ämter bekleidet oder amtliche Funktionen wahrgenommen hat, auch wenn dies nirgends ausdrücklich gesagt wird. Dabei ist jedoch das Amt des Ulmer Stadtschreibers mit Sicherheit auszuschließen, da der bevorzugte Rang, der Kraft und seinen Brüdern stets zukommt, in völligem Gegensatz steht zu der bescheidenen Stellung, mit der sich ein „humillimus scriba civitatis“ begnügt, wenn er einmal genannt wird; auch der 1277 und 1284 erwähnte Stadtschreiber Ulrich60 kann deshalb mit Krafts Bruder Ulrich keinesfalls identisch sein, auch wenn dieser in beiden Fällen nicht zugleich genannt ist.
Ob die Nachricht Fabris, daß der erste Ulmer Bürgermeister dem Geschlecht Kraft angehört habe, auf Kraft den Schreiber zu beziehen ist, muß in anderem Zusammenhang erörtert werden. Fabris Behauptung, Kraft sei ein kaiserlicher Schreiber gewesen, wird freilich durch die zeitgleichen Quellen eindeutig widerlegt. In ihnen läßt sich keine Spur einer Beziehung Krafts zur Kanzlei Rudolfs von Habsburg oder Adolfs von Nassau entdecken, und ebensowenig zu der Herzog Albrechts I. von Österreich. Gerade in diesem Punkt der Fabri-Übersetzung wird ja auch die Arbeit humanistisch gebildeter Historiker sehr deutlich, da eine unverfälschte Tradition unbedingt vernachlässigt hätte, daß Albrecht erst nach Krafts Tod König wurde. Dennoch muß eine echte Überlieferung den Namen Albrechts bewahrt haben, der dann wohl erst nachträglich mit Fabris Nachricht vom kaiserlichen Schreiberamt vermischt wurde, denn sonst wäre Krafts „Degradierung“ vom kaiserlichen zum herzoglichen Schreiber völlig unverständlich. Auch wenn diese Beziehung Krafts zu Herzog Albrecht quellenmäßig nicht faßbar ist und sicher nicht in einer Tätigkeit in seiner Kanzlei bestand, ist sie doch allein deshalb durchaus glaublich, weil ja seine gute Beziehung zu Albrechts Schwiegervater Graf Meinhart von Tirol61 belegt ist.
Weitere Beziehungen Krafts werden in den Quellen sichtbar, ohne sogleich auch faßbar zu werden. Aufschlußreich dafür sind in erster Linie die Urkunden, in denen die Brüder Schreiber sämtlich oder nahezu vollständig aufgeführt sind. Diesen können dann auch solche Fälle angefügt werden, in denen nur wenige oder einer der Brüder in den selben Zusammenhängen anzutreffen sind.
Eine enge Verbindung scheint zum Amman Otto am Steg zu bestehen, der die am häufigsten mit Kraft und seinen Brüdern genannte Person ist. Natürlich ist seine Anwesenheit vielfach durch seine amtliche Mitwirkung bedingt, die jedoch zuweilen auch mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, und zwar gerade dann, wenn außer ihm und den Brüdern Schreiber nur wenige andere, aber ausgerechnet sonst hervortretende Ulmer Bürger nicht genannt werden. Dazu gehören die beiden Urkunden von 1281, wo neben den Brüdern Schreiber und ihren vermuteten Schwestermännern auch Otto am Steg und Heinrich Stocker als Zeugen auftreten62. Diese beiden sind 1272 mit Ulrich und Kraft den Schreibern und Berchtolt Goldschmied auch Bürgen des Dietrich Raggelin63, dessen Witwe 1293 ihre Stiftung von Heinrich dem Schreiber mit nur zwei anderen bezeugen läßt64. Damit wird eine Beziehung sowohl zu Heinrich Stocker wie auch zu Dietrich Raggilin und ebenso zwischen diesen beiden vermutet werden können. Noch deutlicher ist die Beziehung zu Otto am Steg, wenn er, Wernher Mönch und der alte Ulrich Schreiber mit fünfen seiner Söhne sich 1277 als einziger Ulmer unter den Zeugen einer Urkunde der Grafen von Spitzenberg finden65 und wenn 1280 ein Rechtsgeschäft der Grafen von Berg neben nur wenigen Leuten aus deren Umgebung von ihm allein mit Kraft und seinen jüngeren Brüdern bezeugt wird66. Dazu rechnen können wird man auch die Hausschenkung der Agnes Wasgebin an Kloster Kaisheim 1285, bei der neben dem damaligen Amman Ulrich Coprel nur Otto am Steg, Ulrich Gwaerich und alle sechs Brüder Schreiber als Zeugen mitwirken67, und ebenso den Güterverkauf des Klosters Söflingen an den Bischof von Augsburg 1289, bei dem außer Otto am Steg und Kraft mit seinen drei jüngsten Brüdern nur Wernher Sumerwune und Ulrich Gewarlich – der junge, wie sein siebenter Platz erkennen läßt – Zeugenschaft leisten68. Als Hinweise auf die Verbindung mit Otto am Steg ergeben sich dann auch die beiden Urkunden über Burlafingen von 1287, wo mit ihm Herman und Dietrich der Schreiber mit ihm als einzige Ulmer unter den Zeugen auftreten69. In gleicher Weise wird man dann auch verstehen dürfen, daß Kraft – „Kirisso de Ulma“ – 1296 zusammen mit Otto am Steg, Ulrich Strölin und Liuprand von Halle wegen Beeinträchtigung des Ulmer Spitals beim päpstlichen Stuhl angeklagt ist70, wie auch die zweimalige Nennung Krafts allein mit Otto am Steg, auf die später noch einzugehen sein wird71.
Auffallend ist bei der Beziehung zu Otto am Steg, daß sie um 1290 fast völlig bedeutungslos wird, ungefähr gleichzeitig mit dem Ende des gemeinsamen Auftretens der Brüder Schreiber. Großenteils neue Leute treten von 1292 an neben dem Amman in den Vordergrund: Außer dem schon immer regelmäßig mit ihm genannten Ulrich Gwärlich nun auch dessen Söhne, besonders Ulrich, weiter Ulrich Strölin, Heinrich und Liuprant von Halle, Ott und Ulrich die Roten und Herman der Welser72. Die wenigen Nennungen Krafts zugleich mit ihm beschränken sich von nun an, abgesehen von der Anklage 129673, auf einen durchaus amtlichen Bereich. Damit wäre eine Möglichkeit gegeben, die von der „Flügeltafel“ überlieferte Vertreibung Krafts und seiner Brüder durch den Amman Otto in die Zeit um 1290 anzusetzen, was noch dadurch unterstützt wird, daß Kraft [1293] als Bürger zu Esslingen erwähnt wird74, und daß außer Heinrich, der weiterhin regelmäßig und mit ungemindertem Ansehen auftritt, vor 1294 keiner der Brüder in Ulm wieder nachgewiesen werden kann. Eine Erklärung der Zusammenhänge und genaue Datierung dieses Ereignisses wird allerdings erst später versucht werden können.
Freilich ist hier der Einwand möglich, daß eine Beziehung wie die zu Amman Otto am Steg und den wenigen einigermaßen regelmäßig zugleich genannten Bürgern lediglich durch das Zusammenwirken der angesehendsten Männer und Geschlechter in der Leitung der Stadt bewirkt sein könne. Doch läßt sich in späterer Zeit beobachten, daß die führenden Männer Ulms stets in recht nahem Verwandtschaftsverhältnis zu einander stehen, sodaß man für das 13. Jahrhundert, in dem ja nur die Quellen noch nicht so ergiebig sind, dieselbe verwandtschaftliche Verflechtung annehmen muß.
Unter diesem Gesichtspunkt erhält auch die Zeugenreihe der Urkunde Krafts von 1290 über seine Mahlzeitstiftung75 Bedeutung, obwohl sie zunächst den Eindruck macht, als ob nur wichtige Bürger, Ratsmitglieder oder ein Teil des Richterkollegiums hier aufträten. Spitzenzeuge ist Otto am Steg als Amman, auf ihn folgen Gervin Havener (Figulus) und sein vermutlicher Sohn Ulrich, zu denen eine besondere Beziehung sonst nicht erkennbar ist; die nächstgenannten Ulrich Gwaerlich der alte und Wernher Sumerwune sind dagegen schon mehrfach mit Kraft und seinen Brüdern in Erscheinung getreten; die drei letzten, Heinrich von Halle, Liuprant von Halle und Otto Rot erscheinen hier erstmals in Ulmer Urkunden. Zu ihnen allen dürfte Kraft in mehr oder weniger nahem verwandtschaftlichen Verhältnis gestanden sein, auch wenn sich dies im Einzelnen zunächst nicht fassen läßt. Bemerkenswert ist dabei das Ausbleiben sämtlicher Brüder Krafts, die vielleicht mit der Vergabe des Besitzes in Stotzingen nicht einverstanden waren.
Dann aber wird man auch annehmen dürfen, daß in den Zeugen, die 1296 März 11 der Beurkundung einer Jahrzeitstiftung des Herrn Liuprant von Halle für seine Eltern Conrat und Hiltrud an das Ulmer Spital durch dessen Meister beiwohnen76, ein gewisser Verwandtenkreis erscheint. Zwei Geistliche, „Bruoder Wol. der Kelnar von Bebenhuzen, Bruoder Hart. ain Halenstainar komentor der Tüschen herrn zi Ulme“, die den Anfang machen, sind wohl als Helfer des Spitalmeisters zu betrachten, während die Folgenden, „der Souelar ein Ritter, Herre Kraft der Scriber, vol. Strölin, Wernher Sumerwune, Herman der Welsar, der Junge Kraft, C. der kurzze Lebzelter und Sibot der Smit von stetten“, dem Stifter beistanden und zu dessen weiterer Verwandtschaft gehörten. Wahrscheinlich ist das auch deshalb, weil das gespannte Verhältnis Krafts und Ulrich Strölins zum Spital gerade in dieser Zeit bekannt ist77.
Beachtung verdient damit auch, daß 1282 der Edelfreie Conrat von Reisensburg die Abtretung seiner Rechte an die Vogtei des Klosters Elchingen und die Kirchen in Lautern und Westerstetten an König Rudolf und das Reich im Haus Ottos am Steg in dessen, des Ammans Ulrich Copperel, Ulrich Gewairlichs, Gerwig Haveners, Krafts mit vier seiner Brüder und Otto Roten Gegenwart beurkundet78. Zweifellos sind sie hier Vertreter der Stadt, deren Siegel der Aussteller neben seinem und denen des Markgrafen Heinrich von Burgau und der Grafen Albrecht von Hohenberg und Ulrich von Helfenstein an die Urkunde hängen läßt. Aber es fällt doch auf, daß es derselbe enge Personenkreis ist, der auch sonst zusammen mit Otto am Steg, der ja hier nicht als Amman mitwirkt, und den Brüdern Schreiber anzutreffen ist. Besonders bemerkenswert ist jedoch die Anwesenheit Gerwig Haveners in diesem Kreis, nicht nur deshalb, weil er sonst nur wenig hervortritt, sondern auch, weil er ja 1290 die Mahlzeitstiftung Krafts als erster nach dem Amman mit bezeugt79 und also auch zwischen ihm und Kraft enge verwandtschaftliche Beziehungen bestanden haben müssen. Ist aber hier ein Verwandtenkreis versammelt, zu dem dann auch Otto Rot, der schon 1281 einmal in auffallender Beziehung zu ihm erschienen war80, gehört haben dürfte, dann wird es schwerlich ein Zufall sein, daß gerade er die Vertretung der Stadt in dieser Sache wahrnahm, und daß die Zusammenkunft im Haus des ihm zugehörigen Otto am Steg, der ja nicht Amman ist, stattfand. Vielmehr muß dies die Vermutung nahelegen, daß der Grund dafür in irgendeiner Verbindung auch zwischen ihm und Conrat von Reisensburg gesucht werden müßte.
Überhaupt ist auffallend, wie wenige Männer in Ulm zwischen 1271 und 1289 – die Stiftung Krafts von 1290 muß ausgeklammert werden, weil dabei zum Teil schon die in der Folgezeit maßgeblichen Leute auftreten – das öffentliche Leben beherrschen und damit in den Urkunden genannt werden. Mit Otto am Steg und den Brüdern Schreiber, anfangs noch ihrem Vater, erscheint nur Ulrich Gwärlich häufig, doch keineswegs immer. Zu ihnen treten in der Regel einer oder zwei, insgesamt auch nur ganz wenige Bürger, von denen freilich in diesem Zeitraum einige durch den Tod ausscheiden, andere erst herangewachsen sind. Dazu gehört der greise Wernher Mönch, der beide Male, wo er noch mit Otto am Steg und den Schreibern genannt ist81, unmittelbar auf den Amman folgt und bald nach 1277 gestorben sein dürfte. Ältere Männer waren wohl auch der Ritter Heinrich Stocker und Marquart Seveler, die beide 1281 zum letzten Mal erwähnt werden82, und Otto Rot, der noch bis 1287 erscheint83. Auch Conrat von Halle ist nur zwei Mal, gut – davon 1279 prägnant als einziger mit Ulrich Gwärlich und fünf Brüdern Schreiber Zeuge einer von Amman Otto ausgestellten Urkunde84 und wahrscheinlich noch jung bald darnach gestorben, sonst müßte er vermutlich noch öfters mit ihnen zusammen anzutreffen sein. Als Nachwuchs muß dagegen Wernher Sumerwune betrachtet werden, der 1277 erstmals, jedoch in anderem Zusammenhang, erwähnt wird85 und von 1287 an in diesen Kreis aufgenommen zu sein scheint86. Ob der ebenfalls 1281 einmalig vorkommende Ulrich Schaprun dazu zu rechnen ist, bleibt unklar.
Andere Bürger gesellen sich zwar auch gelegentlich zu Otto am Steg, den Brüdern Schreiber und Ulrich Gwärlich, aber für sie scheint bezeichnend zu sein, daß sie, die ohnehin nur selten auftreten, gerade in den wenigen Urkunden zu finden sind, in denen diese nicht oder doch nicht vorrangig genannt sind. Berchtold Goldschmied, 1272 einer der Bürgen Dietrich Raggilins87, ist 1277 Zeuge88 mit dem jungen Wernher Sumerwune und Heinrich von Werd, der sich auch 1272 unter den Zeugen befindet89; noch einmal steht er 1282 als Zeuge zwischen Ulrich Gwärlich und Ulrich dem Schreiber, auf den noch der Gut Walther folgt90. Dieser bezeugt 1274 allein mit Ulrich Gwärlich für Otto am Steg dessen Leibdingrevers gegen das Deutsche Haus, das die übrigen Zeugen stellt91. Diepolt Trigolf erscheint 1284 als Zeuge mit Heinrich Waetzlin, Otto Rot und Gerwig Havener92, der trotz der festgestellten Beziehung zu Kraft doch eher in diese Gruppe zu gehören scheint.
Ihre Einordnung ergibt sich aus der Urkunde von 1271, mit der den agnatischen Nachkommen eines Dietrich Racgilin ihr Patronatrecht an der von diesem gestifteten Jacobskapelle von Amman, Rat und Bürgerschaft der Stadt Ulm verbrieft wird93, wobei diese Gruppe vermischt mit dem hier erstmals auftretenden Kreis um Otto am Steg und die Schreiber die Zeugenschaft bildet und offenbar die Hälfte des als Aussteller handelnden Rates darstellt:
„Otto minister, Wer. Monachus, Uolricus Scriba, Uolricus at Crafto filii sui, M. Vainacgo, Otto Rufus, C. Tagiman, Uolricus Gwarlich, H. Schaprun, Iohannes senior, Iohannes junior, Ger. Figulus, Uolricus Copprellus, D. Trigolf, Bonus Waltherus“.
Von ihnen sind die beiden Johannes nicht zu identifizieren und C. Tagiman nur 1272 noch einmal genannt94. Schon früher nachzuweisen sind Otto Rot und Marquart Vainagg seit 1253, der Gut Walther 1254, wohl auch der ältere Johannes 1255; der hier letztmals auftretende Heinrich Schaprun dürfte mit dem 1244 als Schaprunius, als minister Ulmensis dictus Schaprunius identisch und auch 1264 als H. minister belegt sein95. Da fast alle diese Geschlechter, ebenso die Coprel in früherer Zeit wesentlich mehr und auch mit größerer Personenzahl hervorgetreten sind, wird man in dieser Gruppe die Reste der alten Führungsschicht erkennen müssen. Obwohl zum größten Teil deren ältere, maßgebliche, und auch einige ihrer nachrückenden Männer mit Tod abgegangen sein dürften, ist es undenkbar, daß es nicht auch in dieser Zeit in ihr noch genügend Personen gegeben hätte, mit denen die führenden Positionen hätten besetzt werden können. So muß man zu dem Schluß kommen, daß diese Schicht in der Zeit um 1271 von dem Kreis um Otto am Steg und die Schreiber aus der Leitung der Stadt verdrängt wurde und nur einige aus ihr, die diesem Kreis wahrscheinlich naher Verwandten ebenfalls verwandtschaftlich verbunden waren, neben ihm eine beschränkte Führungsrolle spielen, andere kaum noch hervortreten konnten. Völlig undeutlich bleibt dabei vorerst das Verhältnis zu Ulrich Coprel, der nur 1282 und 1285 als Amman96 und dann vielleicht wieder 1298 mit seinem Bruder Conrat noch in Erscheinung tritt97.
Krafts Beziehungen zu Klöstern
Beziehungen anderer Art, nämlich zu Klöstern, können auf dieselbe Weise mit größter Bestimmtheit ermittelt werden. Daß dabei solche zu Krafts Stiftung, dem Ulmer Predigerkloster, nicht erkennbar sind, ist durch die Quellenlage bedingt. Man scheint nämlich zunächst die Traditionen, bei denen die Prediger sofort in den Genuß des übergebenen Gutes gesetzt wurden, nicht verbrieft, sondern nur über solche, die erst später wirksam werden konnten, Urkunden ausgefertigt zu haben. So ist zwar eine Urkunde vorhanden über den Verkauf eines Gartens in Westerlingen von den Deutschen Herren an die Converse Maehthild Hünraerin, dessen Weitergabe an die Prediger jedoch nur in einem Dorsualvermerk festgehalten98. Von zwei Lampen in der Johanneskapelle, die die Prediger unterhalten mußten, hatten diese eine Urkunde schon im 15. Jahrhundert nur über die eine – sie war ins ältere Copialbuch abgeschrieben, das leider wie auch viele Originale verloren ist99 – damit dürfte die Stiftung des anderen Lichts schon in sehr früher Zeit erfolgt sein. Auch eine Beurkundung der sicher reichlichen Zuwendungen Krafts, wohl nicht nur an Geld, sondern auch an Grundstücken, ist offensichtlich unterblieben.
Deutlich erkennbar sind die Beziehungen zum Kloster Salem. Es ist Empfänger der Urkunde der Grafen von Spitzenberg von 1277, deren Ulmer Zeugen in Ulrich Schreiber dem Vater mit fünf Söhnen und zwei Verwandten bestehen100, ebenso des Vermächtnisses der Witwe Eberhart Coprels, das 1279 der Amman Otto beurkundet und von fünf Brüdern Schreiber und zwei Verwandten bezeugen läßt101. Für die 1294 und 1295 in Unterelchingen erkauften Lehen stellt das Kloster als Lehenträger acht Ulmer Bürger, unter ihnen an zweiter Stelle nach dem Ritter Sevelar Kraft den Schreiber, dessen Bruder Heinrich 1294 auch einer der zwei Ulmer Zeugen ist102. Kraft wurde nach seinem Tod nicht ersetzt: Als 1300 die Lehen geeignet wurden, fehlt lediglich sein Name103. Doch ist in einem gleichen Fall 1301 unter nahezu den denselben Lehenträgern nur sein Sohn104. Allerdings erscheint kein Schreiber in zwei weiteren Salemer Urkunden von 1295, wovon aber gar keine Zeugen, nur den Amman Otto, Rat und Bürgerschaft von Ulm als Mitsiegler nennt, während sie in der anderen Sache tatsächlich nicht zugezogen sein dürften105.
Dagegen fehlen die Schreiber in keiner Urkunde des Klosters Kaisheim aus dem 13. Jahrhundert, die überhaupt Namen von Ulmer Bürgern enthält. Dreimal, 1281106 und 1285107, und nur in Urkunden dieses Klosters sind alle sechs Brüder gleichzeitig genannt, 1280108 einmal auch nur fünf, stets mit nur wenigen Verwandten. Andere Urkunden, die sie weniger vollzählig aufführen, betreffen den Besitz um Stotzingen109, wo Dietrich der Schreiber ja 1294 auch einen Hof an das Kloster verkauft hat110. Letztlich steht auch 1292 bei der Beurkundung eines Güterverkaufs vom Ulmer Spital an das Kloster Kaisheim durch den Amman Otto nach zwei Kaisheimer Brüdern an der Spitze der Ulmer Zeugen Heinrich der Schreiber111, dessen Brüder möglicherweise in dieser Zeit aus Ulm vertrieben waren.
Daß die Beziehungen zum Kloster Kaisheim besonders intensiv waren ergibt sich aus den zwei Urkunden von 1281. Mit der einen112 verkaufen Rudolf von Klingenstein und sein Bruder dem Kloster einen Eigenmann und verpfänden zur Sicherheit ihre Burg Klingenstein mit Zugehörden an Kraft und seinen Bruder Otto, die sie im Fall einer Ersatzforderung des Klosters in dessen Namen bis zu dessen völliger Entschädigung an sich ziehen sollen. Als Amtsträger des Klosters können hier die beiden Brüder keinesfalls verstanden werden, da dies zweifellos in der Urkunde ausgesprochen wäre, viel mehr aber setzt die ihnen übertragene Aufgabe, ein neutrales, zu beiden Seiten nahes und vertrauensvolles Verhältnis voraus. Dasselbe zeigt sich auch in der anderen Urkunde113, wo Kraft als Vermittler einen Streit zwischen den Brüdern Hartman und Otto Grafen von Brandenburg und dem Kloster Kaisheim um Güter in Stetten bei Bergheim durch seinen Schiedspruch beigelegt hat. Gerade die Rolle des Vermittlers erfordert aber einen unabhängigen Mann, der das Vertrauen beider Parteien genießt und zu beiden freundschaftliche Beziehungen pflegt. Dazu paßt nun wenig die Mitteilung Knebels zum Jahr 1281, Kraft habe als „boser müßgunner“ des Klosters die Brandenburger Grafen aufgehetzt, Ansprüche auf Klostergüter in Stoffen zu erheben. Doch ist leicht zu erkennen, daß Knebel, der seine Chronik vorwiegend aus den Urkunden des Klosterarchivs zusammen-schreibt, hier diese Urkunde völlig mißverstanden und auch den Ortsnamen falsch gelesen hat114.
Selbstverständlich sind in Ulm Beziehungen zum nahe gelegenen Kloster Söflingen, und daß in dessen zahlreichen Ulm und seine Umgebung betreffenden Urkunden auch die Brüder Schreiber genannt werden, ist so natürlich, wie daß dies nur in einem Drittel der Urkunden zwischen 1271 und 1300, in denen überhaupt Ulmer Bürger zu finden sind, geschieht. Doch lassen sich auch hier Beziehungen erkennen, die weit über das Übliche hinausgehen. Zwar sind nur einmal gleichzeitig mehrere, nämlich Kraft mit drei Brüdern, dazu drei Verwandten, 1289 beim Verkauf von Riedhausen zugegen115, und dies könnte auch im Zusammenhang mit dem Besitz im nahen Stotzingen gesehen werden. Wenn sie 1293 in einer Nachfolgeurkunde und im selben Jahr bei einem von vielen Ulmer Bürgern teils vermittelten, teils bezeugten Vergleich116 nicht anzutreffen sind, so muß das wohl als Hinweis auf ihre Abwesenheit in dieser Zeit verstanden werden, da sie sonst zu so wichtigen Rechtsgeschäften bestimmt herangezogen worden wären. Bei der für das Kloster sehr wesentlichen Erwerbung der Lehen Gerwigs des Güssen in Burlafingen sind für die Eignung durch die Herren von Stöffeln 1287 Juni 27 Herman und Dietrich die Schreiber, bei der Übergabe der Güter ans Kloster 1288 Mai 14 nur Dietrich Zeugen117, jeweils mit Otto am Steg, der bei der Eignung durch die Grafen von Kirchberg 1287 Juli 10 allein erscheint118; lediglich der Eignungsbrief des Klosters Reichenau von 1287 April 25 führt keine Ulmer als Zeugen an119.
An zwei weiteren bedeutsamen Erwerbungen des Klosters ist Kraft allein beteiligt. Die zwei Urkunden, die über den Verkauf der Burg Ehrenstein von Graf Eberhart von Wirtemberg und über den Verzicht der Grafen von Helfenstein auf ihre Rechte daran im September 1281 zu Gmünd in Gegenwart König Rudolfs ausgestellt werden, nennen als Zeugen neben vier Fürsten den Amman Otto und Kraft den Schreiber120. Aus dem 1302 aufgenommenen Zeugenverhör geht hervor, daß sie als Vertreter des Klosters die Kaufverhandlungen geführt haben121. Könnte dies vielleicht noch so verstanden werden, daß sie dazu von der an dem Geschäft sehr interessierten Stadt Ulm abgeordnet waren, so ist das eher unwahrscheinlich beim Kauf von Harthausen mit Kirchensatz und Zehenden vom Kloster Neresheim im folgenden Jahr, wo Kraft anscheinend in ähnlicher Eigenschaft mitwirkt122. Auch hier erscheint er in der Urkunde nur – an der Spitze weniger und sonst nicht hervortretender Ulmer Bürger – in der Zeugenreihe, die Graf Ludwig von Öttingen mit seinem Gefolge einleitet. Da dieser als Vogt des Klosters Neresheim sicher auf dessen Seite an den Verhandlungen teilnahm, kann wohl gefolgert werden, daß Kraft auf Seiten des Klosters Söflingen eine vergleichbare Funktion hatte.
Beweise für das gute Verhältnis Krafts und seiner Brüder zum Kloster Söflingen sind schließlich auch die Jahrtage, die dort gefeiert wurden, nicht nur für seine Frau Elisabeth123, auch für seinen Bruder Dietrich mit Hausfrau und Kindern124 sowie für mehrere seiner Nachkommen. Da das Söflinger Guttäterbuch jedoch nur als Fragment erhalten ist, können etliche Jahrtage nicht mehr nachgewiesen werden. Dazu gehört vielleicht der von Krafts Bruder Ulrich, der nach der „Flügeltafel“ 1314 Okt. 14 starb. Dieser Tag fällt zwar in die erhaltene 41. Woche, doch da die in Necrologen gewöhnlichen kleinen Ungenauigkeiten sich hier als Verschiebung um eine ganze Woche auswirken können, und erst recht, wenn der Termin des Jahrtags „circa Galli“ bestimmt war, ist nicht auszuschließen, daß sein Eintrag mit der 42. Woche verloren ging. Noch eine Beobachtung mag in diesem Zusammenhang von Bedeutung sein: Kraft ist der einzige der im Guttäterbuch Eingetragenen, der nachweislich noch im 13. Jahrhundert starb. Freilich darf davon ausgegangen werden, daß sein Tod zur Anlegung des Buches den Anlaß gab.
Beziehungen zum Kloster Reichenau sind in Ulm, wo dieses ja auf weiten Flächen Grund- oder Lehenherr war, unvermeidlich, können aber in dieser Zeit nur wenig nachgewiesen werden. Sollte jedoch der Otto de Ulma in der Zeugenreihe einer 1284 zu Sandegg vom Reichenauer Abt ausgestellten Urkunde125 nicht dem Thurgauischen Ministerialengeschlecht angehören, sondern mit Krafts Bruder Otto identisch sein, so wären hierin auch Beziehungen erkennbar, die das sonst in Ulm Übliche weit übersteigen. Auch zum Kloster Elchingen sind Beziehungen nur deshalb nicht nachzuweisen, weil dessen erhaltener Urkundenbestand erst im 14. Jhrh. einsetzt126. Daß sie bestanden und wohl sehr eng gewesen sein müssen, ergibt sich jedoch daraus, daß 1314 dort eine Jahrzeit für Kraft gestiftet wurde127





























