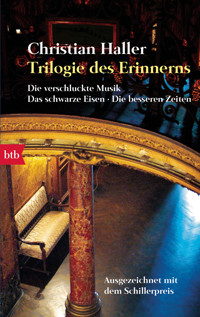5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon seit Kindertagen hat es sich der Erzähler von Christian Hallers neuem Roman zur Angewohnheit gemacht, allen Anforderungen und Erwartungen auszuweichen. Jetzt ist er Anfang zwanzig, auf der Suche nach einem Sinn für sein Leben, und er merkt, dass er sich aus seinen Rückzugsräumen hinaus in die gesellschaftliche Gegenwart begeben muss. Da er mit seinen eigenen poetischen Arbeiten nicht vorankommt, stürzt er sich in das Unterfangen, den unüberschaubaren Nachlass des Dichters Adrien Turel zu sichern sowie in einem kleinen Schweizer Dorf eine Stelle als Lehrer anzutreten. Während sich unerfüllte Hoffnungen und Träume immer mehr in ihm aufstauen, bricht unerwartet der Damm: Eher zufällig kommt er an das Gottlieb Duttweiler-Institut bei Zürich, macht Karriere, der Fluss seines Lebens trägt ihn in höchste gesellschaftliche Kreise. Doch mit dem Einblick in die Machenschaften von Politik und Wirtschaft muss er erkennen: Auch dies kann – trotz Aufstieg und Erfolg – nicht sein Weg sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Christian Haller
Das unaufhaltsame Fließen
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Umschlaggestaltung: buxdesign/München unter Verwendung einer Illustration von Ruth Botzenhardt
ISBN 978-3-641-21308-4V003
www.luchterhand-literaturverlag.de
Abend, Ende Juli. Der Presslufthammer ist verstummt. Nach Tagen und Stunden sich wiederholender Salven liegt eine Stille über dem Fluss, der serpentingrün und mit beruhigter Spiegelung vorbeizieht.
– Der Abbruch ist beendet, sagte der Bauleiter, nachdem er geklingelt und mich gebeten hatte, ihn zu begleiten.
Während eines Hochwassers war vor sechs Wochen ein Teil der Terrasse unseres Hauses weggerissen worden. Mauerteile, die einzustürzen drohten, mussten abgebrochen werden. Zugleich war es notwendig, Fels als Fundament zu finden, auf dem ein Balkon abgestützt werden konnte.
– Was beim Ausheben des Füllmaterials hinter der Mauer zum Vorschein gekommen ist, will ich Ihnen zeigen.
Vom Flussgarten des Nachbarhauses stiegen wir über einen Brettersteg in die Baugrube unter den Veranden. Die Arbeiter an ihren Seilsicherungen warteten, standen da auf Pickel und Schaufel gestützt, acht, zehn Meter über dem Strom. Der Bauleiter setzte den Helm auf, und bevor er mit Erklärungen begann, befragte er jeden der Arbeiter, hörte sich an, was sie zu sagen hatten. Es war diese Art der Zusammenarbeit, die mich beeindruckte und mir das Vertrauen in das Urteil des Bauleiters gab. »Wir arbeiten am Fels«, sagte er, als ich das eingespielte Vorgehen beim Abbruch lobte. »Wir arbeiten am Fels«, das hieß, in gefährlichen Lagen, unter unsicheren örtlichen Bedingungen, und ich empfand Hochachtung vor diesen Leuten: Sie kannten sich mit dem Gestein, den Mauern und Fundamenten aus, verstanden sich auf deren Befestigung und wussten, welche Gefahren bei der Arbeit drohten.
Der Bauleiter sagte:
– Die rheinoberseitige Flügelmauer muss vollständig neu aufgebaut werden. Doch da gesunder Fels zum Vorschein gekommen ist, können wir auf ihn die neue Mauer auflagern. Bei der rheinunterseitigen Flügelmauer jedoch ist der Zustand komplizierter. Schauen Sie dort, in der Ecke, was wir nach dem Freilegen entdeckt haben.
Wir stiegen in eine Vertiefung hinab. Der Bauleiter zeigte mir den losen, eingebrochenen Mauerteil, von Rissen durchzogen, und meinte, der Untergrund sei in diesem Teil der eingestürzten Terrasse nicht stabil, der Fels werde vom Strom unterspült und sei brüchig. Durch Betoneinspritzungen müssten sie das lose Material erst verdichten. Danach würde eine armierte Betonwand vor die alte Mauer und das Fundament des Hauses gesetzt. Auf die neue Befestigung ließe sich dann ein Balkon auflagern, der durch Drahtzüge im Fels des Tonnenkellers verankert würde.
Ich nickte, dachte an die Kosten. Sie würden hoch ausfallen.
– Können Sie uns eine Offerte für die von Ihnen vorgeschlagene Lösung machen, inklusive der Konstruktion eines Balkons?
Die Zeit drängte. Wegen einer Abwasserleitung, die zum Vorschein gekommen war, mussten die Arbeiten vor dem Winter abgeschlossen sein. Provisorien sind teuer, und das Projekt bewilligt zu erhalten, brauchte Zeit, die Kosten zu sichern, brächte noch einige Mühe mit sich.
Am Tag der Katastrophe Mitte Juni war mir die weggerissene und in die Tiefe gestürzte Terrasse wie ein Abbild meiner Lebenssituation erschienen. Ich begann mit Nachforschungen, suchte nach den Ursachen, weshalb auch mein »Lebensgebäude« in Teilen weggerissen worden war.
Und nun traf mich der Anblick des festen und zerrissenen Gesteins ein zweites Mal heftig, zwang mich zur Frage, ob der Zustand meines Fundamentes, auf dem ich aufbauen wollte, nicht ähnlich gewesen sei. Während ich dem Bauleiter zuhörte, wie er von dem »gesunden Fels« sprach, der zum Vorschein gekommen sei, mir aber auch den »unterspülten, brüchigen« Untergrund bei der anderen Mauer zeigte, fühlte ich mich an den inneren Gegensatz erinnert, den ich als junger Mann in Zürich empfunden hatte. Einerseits fand sich damals ebenfalls ein »fester, gesunder« Fels in mir, von dem ich mich abstoßen konnte, weg von meinen Rückzugsgebieten, hinein in die Welt und die Gegenwart: Ich beschäftigte mich mit dem Nachlass eines Schriftstellers, begann ein Studium, machte Karriere an einem international tätigen Institut. Ein anderer Teil meiner Grundfeste aber war, wie die alte, rheinabwärts gelegene Mauer, zerrissen und brüchig. Und doch konnte sich mein Schreiben, das mir zur Hauptsache geworden war, nur auf sie abstützen.
Teil 1Mikrofilme
1
»Wo stehe ich heute auf meinem Weg, vier Jahre nach dem Entschluss, Schriftsteller zu werden?«
Ich schrieb die Frage auf ein Blatt Papier, suchte die Bambusstäbchen hervor, die ich im Sommer zugeschnitten hatte, und hockte mich auf den Teppich in meiner Mansarde. Ich konzentrierte mich auf die Frage, die ich nicht zu beantworten wusste, teilte das Bündel Stäbchen in zwei Haufen und begann, sie nach der Vorschrift auszuzählen.
Ich war im Frühsommer auf das »I Ging, Buch der Wandlungen« gestoßen. Mein literarischer Lehrmeister Max Voegeli hatte es während eines Gesprächs im Kaffeehaus erwähnt, und da ich mir stets die Autoren und Buchtitel merkte, die er erwähnte, kaufte ich die von Richard Wilhelm übersetzte Ausgabe in der folgenden Woche. Den Band schlug ich in eine alte Zeitung ein und nahm ihn mit in die Ferien. Mathias Gnädinger hatte Pippa und mich gefragt, ob wir nicht Lust hätten, mit ihm und seiner Freundin Gerda an den Lago Maggiore zu fahren, sie hätten in einem Dorf auf der italienischen Seite ein Haus gemietet.
Carmine Superiore lag auf einer Felsrippe über dem See, und von der Bushaltestelle führte ein gewundener Pfad zur Kirche hoch, von deren Vorplatz eine Pforte ins Dorf führte, das sich hinter der Kirche beidseits einer Gasse den Berg hinanzog und an den zerfallenden Terrassen eines Rebgartens endete. Die Häuser, aus Bruchsteinen gebaut, waren verlassen, hatten leere Fenster und eingesunkene Dächer. Einzig die geschlossene Zeile über der Schlucht war instand gehalten, teilweise renoviert, und in ihr wohnten noch wenige alte Leute wie »Methusalem«. So nannten wir den Nachbarn des von uns gemieteten Ferienhauses, ein Bauer, der am Fenster lehnte, den Filzhut auf dem Kopf, und hinab in die Tiefe des Bacheinschnitts sah, zu den einstigen Gemüsegärten, die jetzt von Bambus und Büschen überwuchert waren.
In der Morgendämmerung, wenn Pippa und die Gnädingers noch schliefen, stieg ich durch die Gasse zur Kirche hinunter, betrat den Vorhof, von dem aus sich der Blick auf den See und die gegenüberliegenden Berge weitete. Die Stille der frühen Stunde lag wie ein Schleier von Dunst über dem Wasser, das ruhig und schiefergrau zwischen den Ufern lag. Ich setzte mich auf die Steinbank an der Kirchenmauer, schlug das »Buch der Wandlungen« auf, las im Dämmerlicht den Text zu den vierundsechzig Zeichen durch, beschäftigte mich mit den geschichtlichen und philosophischen Grundlagen im zweiten Teil des Bandes, ging dann zu den »Kommentaren der Entscheidung« im dritten Teil über. Jeden Morgen verbrachte ich drei, vier Stunden auf der Steinbank, spürte die Sonne aufsteigen, das allmähliche Warmwerden der Mauersteine, kehrte dann zum Haus zurück, in dem es nach Kaffee roch und das Frühstück zubereitet wurde.
Die Beschäftigung mit den Texten des I Ging, dieses neue, mir unbekannte Wissen, spann mich in eine Hülle von Bildern und Gedanken ein, die sich mit der kargen Atmosphäre des Dorfes und den Stunden auf dem Felssporn über dem See verband. In den Texten reihten sich fremdartige, manchmal unverständliche Metaphern aneinander, waren aus einer urtümlichen Kosmologie von Kräften und ihren Beziehungen untereinander abgeleitet und fügten sich doch zu einem abstrakt-logischen System aus Zahlen und Strichen zusammen. Diese Verbindung von Bild und Zeichen, von sinnlicher Anschauung und mathematischer Abstraktion, faszinierte mich durch ihr Ineinandergreifen von Gegensätzlichem. Der Felssporn mit dem ummauerten Vorplatz der Kirche ließ mich an jenen letzten Sommer meiner Gymnasialzeit denken. Ich war damals ohne meine Freundin Veronique nach Ponte Brolla gefahren, hatte Stanislawskis »Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst« im Gepäck. Ich wollte mich auf die Prüfung an die Schauspielschule vorbereiten. Doch während der Tage, die ich in einem Albergo verbrachte, spürte ich, wie meine Theaterträume brüchig wurden, mein Talent, wie ich bei Stanislawski las, durch Laienaufführungen bereits verdorben war, und ahnte in Ton und Klang der spärlichen Briefe Veroniques das Ende meiner ersten Liebe. Meine Pläne und Hoffnungen für die Zeit nach dem Lehrerseminar begannen sich aufzulösen, stürzten mich in eine ängstliche Ratlosigkeit.
An einem Nachmittag stieg ich, statt hinab in die Schlucht der Maggia zu gehen, hinauf zu einer Kapelle, die leuchtend aus der Bergflanke ragte. Auf dem Pfad, der durch einen Hain alter Kastanienbäume führte, fielen mir unerwartet Wörter zu, die zu meinem ersten Gedicht wurden.
Und nun, knapp vier Jahre nach dem Erlebnis, mit dem mein Schreiben begonnen hatte, verbrachte ich die Morgenstunden an einem ähnlichen Ort, studierte im Vorhof der Kirche das I Ging und fragte mich, wie weit ich mit meinem Wunsch, Schriftsteller zu werden, in der Zwischenzeit gekommen sei.
Könnte mir nicht das »Buch der Wandlungen« eine Antwort auf die Frage geben?
Nach den Ferien entschloss ich mich, den Anweisungen des I Ging folgend ein entsprechendes Orakelzeichen zu ermitteln. Dazu waren Stängel von Schafgarben nötig, die nach einem aufwendigen Verfahren ausgezählt werden mussten. Da ich in Carmine keine Schafgarben gefunden hatte, war ich an einem Nachmittag unter »Methusalems« Fenster ins Bachtobel hinabgestiegen, hatte junge Bambusruten geholt, die ich zu fünfzig »Stängel« schnitt. Diese teilte ich jetzt, auf dem Teppich in meiner Mansarde sitzend, in zwei Haufen und zählte die Stäbchen aus. Durch das sechsfach wiederholte Auszählen, das einige Zeit in Anspruch nahm, ergaben sich die Linien – weich, fest oder sich wandelnd – aus denen ein Zeichen aufgebaut wird.
Ich rechnete und schrieb, und als ich endlich sechs Striche ausgezählt und übereinander angeordnet hatte, schlug ich neugierig, auch aufgeregt, das »Schema zum Auffinden der gezogenen I Ging-Zeichen« nach. Es müsste, so war ich versucht zu glauben, mein Schicksalszeichen sein.
Ich erhielt die Nummer 29:
KAN / DASABGRÜNDIGE, DASWASSER.
Es ist eines der acht Doppelzeichen. Keiner der Striche war in Wandlung, und beim Kommentar las ich, dass KAN dem Norden angehöre, ein Zeichen der Mühe sei und als Symbol die Schlucht habe. Während ich mich über den Text beugte, zu verstehen suchte, was »Das Urteil«, »Das Bild«, »Die einzelnen Linien« bedeuteten, wuchs ein dumpfes, beschwerendes Gefühl in mir, brach ein und sackte ab, als öffnete sich die durch das Zeichen symbolisierte Schlucht in mir. Ich war enttäuscht, gestand mir ein, etwas Großartigeres erwartet zu haben, ein Zeichen der Bestätigung, der Ermutigung vielleicht. Doch Mühe, Abgründigkeit, Gefahr? Das klang nach Unerlöstem, Problematischem, und ich setzte mich an die Schreibmaschine, tippte den Text ab, um die Wörter von »Das Urteil«, »Das Bild«, »Die einzelnen Linien« besser akzeptieren zu können. Bei dem Satz im Kommentar hielt ich ein: »Wie das Wasser keine Mühe scheut, sondern sich immer der tiefsten Stelle zuwendet, weshalb ihm alles zufließt, so ist der Winter im Jahreslauf und die Mitternacht im Taglauf die Zeit der Sammlung.« War ich damals, in Ponte Brolla, auf den Felsen der Schlucht, nicht zu einer ähnlichen Einsicht gekommen, als mir die Felszeichnungen wie eine durch das Wasser herausgeschliffene Schrift erschienen waren? Je mehr und je länger ich über das Zeichen nachdachte, desto zutreffender fand ich es. Der Pfad, den ich gehen wollte, war gefährlich, die Schlucht ein Abgrund, in den mich ein Fehltritt stürzen konnte. Doch in der Tiefe strömte das Wasser, war ein unaufhaltsames Fließen, das mir zeigte, wie Schwierigkeiten überwunden würden: Es folgt den sich öffnenden Gefällen, füllt durch Sammeln die Hemmnisse auf, und der Kommentar zu dem Zeichen hieß:
»So kommt das Wasser ans Ziel.«
2
Ich entschloss mich, alle Texte wegzulegen, an denen ich in den letzten Wochen gearbeitet hatte: Einen Zyklus von fünf Gedichten, »Genesis«, der mein Ausgetriebenwerden aus Dunkelheit und Leere in die Labyrinthe der Stadt thematisierte, und ein Dialogstück »Brahm«, in dem die Macht aus der immer wieder neu geschöpften Hoffnung ihres Gegenspielers erwächst. Mit beiden Arbeiten war ich nicht zufrieden, hatte sie mehrmals umgeschrieben, ohne wirklich voranzukommen. Beide Stoffe hatten mit der Vergangenheit zu tun, die Gedichte mit der Zeit ohne Veronique, nach dem Ende meiner ersten Liebe; das Dialogstück mit dem Ruin meines Vaters durch die Machenschaften eines Geschäftspartners. Ich aber hatte gegenwärtige Probleme. Die Beschäftigung mit dem Zeichen KAN liess mich bewusst werden, wie sehr mein Leben und Arbeiten gestaut und nicht in Fluss war. Den Band Märchen, an dem ich die letzten Jahre gearbeitet hatte, würde kein Verlag herausbringen wollen. Aus Trotz hatte ich mich in eine Arbeitswut gesteigert, in der ich nichts mehr um mich wahrnahm, vor allem nicht, dass ich im Begriff war, meine jetzige Freundin Pippa zu verlieren. Sie war eine Nacht nicht nach Hause gekommen. Seither wusste ich nicht, wie es mit uns weitergehen sollte. Ich fand keine Kraft mehr zu arbeiten, die Texte waren tot, und ich lag auf dem Bett, versuchte zu lesen, doch die Wörter blieben stumm, drangen nicht in mich ein. Pippa hatte Probe im Theater, und ich wusste, dass sie dort auch den Kollegen wieder traf, bei dem sie die Nacht verbracht hatte. Die Eifersucht lähmte mich, ich war aber auch traurig und selbstmitleidig, haderte und quälte mich, versuchte, mir klar zu werden, wie ich mich Pippa gegenüber verhalten sollte. Da schoss aus dem linken Augenwinkel ein Traumbild hoch, stand gewaltig über mir: Eine riesenhafte, dunkle Gestalt, wie ein Geist oder Dämon aus den Märchen. Dieser hatte langes, zottliges Haar, einen Bart um den offen stehenden Mund, in dem spitze, entstellte Zähne standen wie bei den hölzernen Masken aus dem Lötschental. Erschreckend waren die leeren Augen, schwarze Höhlen, die dennoch giftig glänzten, mich mit einem Blick ansahen, den ich nicht ertrug. Während ich ihm auswich, sah ich über dem Dämonenhaupt eine junge Frau aufsteigen. Ihr Haar, das Gesicht, die Körperhaltung ließen keinen Zweifel: Es war Pippa, und sie lächelte mitleidig und traurig zu mir herab. Sie stieg höher und höher, ließ zuoberst die Griffe in den Falten eines Theatervorhangs los, wich ein wenig zur Seite, als habe sie etwas ohne Absicht berührt oder wollte sich dafür entschuldigen, breitete die Arme aus, schwebte einen Augenblick lang im Zustand dieser Überhöhung. Sie würde stürzen, wenn ich mich nicht endlich bewegte, ausbräche aus dem lähmenden Brüten. Ich schreckte hoch. Mein Herz hämmerte, »wie ich es noch nie in meinem Leben verspürt habe«.
Ich fuhr mit der Straßenbahn in die Stadt, lief durch die Straßen, ziellos und schon leicht enttäuscht, dass sich wieder nichts Befreiendes einstellen würde, »kein Gefälle«, dem ich folgen könnte, wie das Wasser seinem Weg. Aus Gewohnheit und auch Langeweile betrat ich ein Antiquariat, stand nach dem Klingeln der Türglocke in einem von Neonlicht beleuchteten Raum. Ein Gefühl des Bedauerns beschlich mich: Statt wie erhofft Menschen zu begegnen, war ich durch meine Flucht in die Stadt nur wieder bei Büchern angelangt. Jetzt müsste ich wohl oder übel ein paar Regale durchsehen, und so fragte ich den älteren Mann, der im Hintergrund an einem Pult saß und bei meinem Eintreten hochgeblickt hatte, ob ich mich umsehen dürfe. Ohne seine Antwort abzuwarten, entzog ich mich seiner Beobachtung, trat zwischen die Regale, ließ den Blick über die Reihen meist schon vergilbter Umschläge gleiten. Ich schaute flüchtig die Abteilungen Philosophie und Psychologie durch, verweilte etwas länger bei den Romanen und Erzählungen. Seit ich Antiquariate besuchte, galt meine besondere Aufmerksamkeit dem stets schmalen Segment mit den dünnsten Bänden. Gerade dort hatte ich Funde gemacht, die mich prägten: Die Gedichte Robert Walsers und Alexander Xaver Gwerders. Auch jetzt verweilte ich etwas länger vor dem Regal, das zwischen den Abteilungen »Literatur« und »Theologie« eingeklemmt war, sah die Rücken durch, nahm einzelne Bändchen zur Hand, um Autor und Titel zu lesen. Ich achtete besonders auf die etwas älteren Ausgaben, waren sie doch oftmals schön gestaltet, hatten eine Radierung oder eine Lithographie auf dem Vorsatzblatt, und solch einen Band zog ich jetzt aus dem Regal. Ich schlug ihn an einer beliebigen Stelle auf, las den Titel des auf Büttenpapier gedruckten Gedichtes, und war versucht, den Band augenblicklich zurückzustellen. »Der Kuss«, so lautete der Titel. Das gewohnte Durchsuchen der Lyrikregale hatte mich gelehrt, dass ein Großteil der vor sich hin alternden Bändchen von ebenso gealterten Gefühlsüberschwängen zeugten, und es war nicht so sehr Interesse als die Genugtuung, den Dichter mit solch einem Kitschtitel scheitern zu sehen, die mich die erste Strophe lesen ließ:
Ich liebe dich und glaub’ dich nicht zu kennen.
Ich halte dich und weiß das kaum zu nennen,
Was deine Wangen schlaff und fröhlich macht,
Es ist des Geistes innigste Empfängnis
Von Mensch zu Mensch in Lust und in Bedrängnis
Nur wie ein Ruf von Wandrern durch die Nacht.
In den beiden Anfangszeilen war ein Klang, der mich berührte und einen Widerhall in den beiden Schlusszeilen fand. Trotz der verunglückten dritten Zeile war ich gespannt auf den Namen des Dichters, klappte den Band zu, las in Goldprägung und Kapitalen: »Adrien Turel, Es nahet gen den Tag« und stutzte. Den Namen hatte ich gehört, und als ich am Abend meinen Jugendfreund Fredi, dem ich zufällig in Zürich wiederbegegnet war, in der Bodega traf, erzählte ich ihm, dass ich mich beim Anblick der Prägeschrift auf dem Buchdeckel plötzlich erinnert habe. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte ich bei Frau Bürdeke in der ehemaligen Buchhandlung gearbeitet. An einem Abend standen wir vor der Ladentür, und sie begann von der Witwe eines Schriftstellers und Philosophen zu erzählen. Frau Bürdeke, die selbst Gedichte schrieb, schaute über die Kirchgasse hinweg in den abendlichen Himmel, das Gesicht von einem inneren Bild für einen Moment reglos, bevor sie sich mir zuwandte und weitersprach:
– Sie müssen dort hingehen, Sie müssen das gesehen haben. Tausende von Manuskriptseiten, Stapel von Entwürfen, Notizbüchern, Skizzen, Abhandlungen – in Kasten und Regalen angehäuft. Adrien Turel war ein Verrückter, ein Besessener, der all die Jahre weiter- und weitergeschrieben hat, obwohl er kaum noch ein Buch publizieren konnte. Sie müssen seine Witwe besuchen und sich diesen Wust an Papier ansehen!
Mit Fredi hatte ich archäologische Entdeckungen, Grabungen und Forschungen gemacht, und ein wenig fühlten wir uns an die urgeschichtlichen Exkursionen in der Jugendzeit erinnert, als wir uns über den Stadtplan beugten, nach der Venedigstraße suchten, in der Turel gewohnt hatte und seine Witwe noch immer lebte. Gäbe es einen Fund von nationaler Bedeutung zu machen, wie damals die neolithische Grube am Goffersberg bei Lenzburg? Oder stießen wir auf das Geschreibsel eines verwirrten Geistes in einem engen, hohen Verlies voll Papierstapeln, Mappen, Schachteln, erhellt von einer nackten Birne, die an ihrem Draht von der Decke baumelt?
Mit der Straßenbahn fuhren wir zur »Enge«, einem Quartier am linken Rand des Seebeckens. Das Wetter war kalt und regnerisch. Unweit der Haltestelle bogen wir in ein kurzes Straßenstück, standen schließlich vor einem Haus der Belle Epoque, dessen Balkone mit Säulen und Rundbogen italienische Stilelemente zitierten.
Frau Turel empfing uns an der Wohnungstür, führte uns durch einen breiten Flur in ein Zimmer, das früher einmal der Salon oder das Speisezimmer gewesen sein mochte, jetzt als Arbeitsraum diente. Von zwei Seiten fiel das Nachmittagslicht herein, spiegelte auf dem Parkett und sammelte sich in einem Erker hell um einen Topf mit Farnfächern. Rechterhand, vor einem Schrank aus Nussbaumholz, stand am Fenster ein Pult. Es sei der Arbeitsort Turels gewesen, erklärte seine Witwe, an dem seit seinem Tod niemand mehr geschrieben habe. Schräg davor und gegen die Mitte des Zimmers hin bedeckten Stapel maschinenbeschriebener Manuskriptseiten einen Tisch, auf dem auch Schere und Leim, Lineal sowie Farb- und Bleistifte lagen: Dies sei ihr Arbeitstisch, an dem sie das Werk bearbeite.
Frau Turel trug einen Wollrock, dazu eine Bluse und leichte Strickjacke. Ihre Begrüßung an der Tür war knapp, ohne Herzlichkeit gewesen, und die Art, wie sie ins Zimmer voranging – etwas nachlässig und ohne uns noch weiter zu beachten – ließ uns eine distanzierte Überlegenheit spüren, die einen höflichen, gar herzlichen Empfang unnötig machte. Sie hieß uns am Tisch Platz nehmen, brachte aus der Küche ein Tablett mit Teekanne und Tassen, schob Manuskriptbündel zur Seite, und während sie einschenkte, fiel ihr Haar vom Mittelscheitel über die ausgemergelten Wangen zum Kinn.
Niemand wolle heute noch etwas von Turel wissen, sagte sie, schob mit beiden Mittelfingern die Strähnen zur Seite, schüttelte kurz den Kopf, dass ihr Haar in den Nacken fiel. Mit diesem großen Werk sitze sie allein da, arbeite Tag und Nacht an den Manuskripten, die sie lesbar machen müsse.
Turel sei auch heute noch seiner Zeit voraus. Selbst ein Künstler wie Max Bill, der zur Avantgarde gehöre und mit dem sie seit der gemeinsamen Zeit an der Kunstgewerbeschule befreundet sei, habe keinen Zugang gefunden und auch nie etwas für Turel getan, obwohl sie sich gut verstanden hätten.
Sie sah uns durch leicht zusammengekniffene Lider an, ein Blick, der verschleiert wirkte, als sehe sie durch uns hindurch in eine nur ihr zugängliche Ferne.
Sie bereite eine weitere Ausgabe von »Splittern« vor, aphoristischen Sätzen, die sie aus dem riesigen Material hinterlassener Manuskripte heraussuche und zu einem Band zusammenstelle.
Sie stand auf, ging zum Pult am Fenster, öffnete die beiden Schranktüren, und ich sah in Regale mit Mappen, Schachteln und verschnürten Manuskriptstößen. Im Schrankboden stapelten sich hektographierte Bücher, die Frau Turel in den letzten Jahren herausgegeben hatte, A4-große, heftartige Bände.
– Turel selbst hat seine Autobiographie »Die Bilanz eines erfolglosen Lebens« in dieser Form herausgebracht, als sich kein Verlag für das Manuskript finden ließ. Erst muss ich das Buch schreiben, hat er gesagt, dann das kleine Vermögen meiner Frau plündern, um es zu drucken, und dann muss ich meinen Freunden die Pistole auf die Brust setzen, dass sie es lesen.
Sie lachte ein keuchendes Lachen, das ihr Gesicht zu einem Ausdruck von Schmerz verzerrte, und ich war verblüfft, wie sehr Frau Turels Stimme sich beim Zitieren ihres Mannes verändert hatte. Sie sprach die Wörter gedehnt und in einer tiefen Tonlage aus, dazu in ungewohnter Emphase, die ich noch mehrfach und gesteigert an dem Nachmittag zu hören bekommen sollte. Kaum saß sie wieder am Tisch, griff sie zu der einen und anderen Manuskriptseite, las einzelne Stellen vor, auch Gedichte, und es war die Stimme ihres Mannes, die Art, wie er seine Texte gelesen haben mochte, die sie nachahmte. Während des Lesens straffte sich ihr Körper, Frau Turel saß aufrecht am Tisch, die Manuskriptseite in den aufgestützten Händen und war vielleicht auch in dieser Haltung ein Abbild ihres Mannes. Am Ende jedes Vortrags sank sie im Stuhl zurück, verwandelte sich in eine bewundernde Zuhörerin. Sie strich ihr Haar aus der Stirn und schüttelte es in den Nacken, ließ ein geflüstertes »Großartig« oder »Wunderbar« hören, dem sie ein nach Bestätigung verlangendes »Nicht – nicht« hinterhersandte.
Frau Turel gab uns beim Abschied von ihren hektographierten Büchern mit, mir dazu noch einen Stoß Manuskripte. Ich solle die Seiten überarbeiten. Denn viele Texte, wie sie sagte, seien Entwürfe und müssten umgeschrieben, einfacher und lesbarer gemacht werden.
Fredi hatte nach dem Besuch das Interesse an Turel verloren. Ich jedoch saß in meiner Mansarde am Fenster, vor mir auf dem aus einer Kiste gezimmerten Tisch die vergilbten, brüchigen Manuskriptseiten. Mit verbrauchtem Farbband war eine Fülle an Gedanken auf engen, unregelmäßigen Zeilen getippt. Ich las von Freuds Psychoanalyse, die mit Ergebnissen der Atomphysik verknüpft wurde, folgte evolutionstheoretischen Betrachtungen und geschichtlichen Exkursen, lernte auf den Seiten ein anarchisches Denken kennen, das mich zutiefst beeindruckte. Ich begegnete auf den vergilbten Blättern einer geistigen Universalität, die alles und jegliches aus der Welt an sich zog und dem eigenen Schauen anverwandelte. Aus den Zeilen gehämmerter Buchstaben wuchs ein Kosmos, in dem die Wörter die Luft zum Atmen waren und in dem die Freiheit herrschte, die Stoffe zu kneten und umzuschaffen, sie nach eigenen Visionen zu gestalten. Ihre Grundlagen bildeten historische und naturwissenschaftliche Fakten, sie waren belegt durch Ergebnisse der Forschung und bewahrheitet durch die Dichtung. Die Reise in diesem weiten, über Zeiten und Kontinente sich hinziehenden Wörterraum wurde durch Assoziationen vorangetrieben, führte zu phantastischen Ausblicken, aber auch zu Einsichten, die für mich neuartig waren und mich zu eigenen Spekulationen über technische und gesellschaftliche Entwicklungen anregten.
Allerdings verunsicherte mich ein Mangel an Sorgfalt: »Ich arbeite an den Schriften«, schrieb ich in mein Tagebuch, »die eine Fülle neuer und wesentlicher Gedanken bergen. Leider sind sie sprachlich und formal durchwegs ungenügend, ohne Richtung.« Ich grübelte darüber nach, ob es Erkenntnisse geben konnte, die nicht wirklich klar und präzise formuliert waren. Max Voegeli hatte während meiner Seminarzeit öfter Schopenhauer zitiert, es ginge darum, komplizierte Dinge einfach zu sagen und nicht einfache Dinge kompliziert. Auf den von Frau Turel mitgegebenen Seiten fanden sich jedoch nicht nur komplizierte Sätze, sondern auch Geschmacklosigkeiten, schiefe Bilder, Rückschlüsse vom Tier auf den Menschen, die ich für unstatthaft hielt. Die Unbekümmertheit, von Plato bis Marx, von der hellenistischen Mythologie bis zu Nietzsches Zarathustra alles zu nehmen und in eine eigene gedankliche Knetmasse zu rühren, faszinierte mich zwar, machte mich gleichzeitig aber auch stutzig: Womit hatte ich es auf diesen alten, brüchigen Seiten zu tun? Wer war Turel, ein Scharlatan oder ein Genie? Oder bloß ein Verrückter, wie Frau Bürdeke an jenem Abend auf der Kirchgasse gesagt hatte?
»28. Februar 1952 (zu Dante-Variationen)
… Die tiefsinnigen Metaphysiker müssen es dem lebendigen Leben schon verzeihen, wenn man sich um ihre Verbote nicht immer kümmert. Auch Planck, Einstein und die Nuklear-Physiker der Epoche von 1895 bis 1945 (erste Realisation des »Jenseits« durch Explosion einer Atombombe) werden sich damit abfinden müssen, dass das Massenbewusstsein des Menschen alle Hürden kantianischer Erkenntnisbeschränkung überspringt und jählings den perspektivischen Standpunkt der vollentwickelten Nuklear-Physik besetzt, um von hier aus die Substanz oder Materie der Welt unter geradezu verklärten Gesichtspunkten zu betrachten.
Bei diesem Wechsel der Barrikadenseite fragt es sich dann, ob der Mensch die alten Formen der Sinnlichkeit und der Realitätsbeziehung endgültig preisgeben muss, um des neuen Standpunktes teilhaftig zu werden. Schon seit langem scheinen die großen Mathematiker und Physiker ihre machtvollen Einsichten durch eine fast selbstmörderische »Zerstreutheit« mit Bezug auf die irdischen Geschäfte erkaufen zu müssen. Auch von den großen religiösen Denkern und Visionären wissen wir, dass sie in einem gewissen Sinne Fähigkeit und Interesse zu den irdischen Geschäften verlieren. Dazu kommt, dass die Masse der Menschen offensichtlich zu einer Art von Rentnertum drängt, wobei sich der Mensch (Mann und Weib, Rentner und Witwe) vom eigentlichen »struggle for life« des Wirtschaftskampfes emanzipiert, sich ihm entfremdet, um eine Art von buddhistisch verklärtem Mönchsleben zu führen, welches ihm die Illusion der Entrücktheit vermittelt.
Solche Illusionen bilden eine reale Gefahr für unsere Bevölkerungsmassen, denn sobald der heutige Kleinbürger aufhört, vor der Atombombe zu zittern, beginnt er von einer unendlichen Wirtschaftsenergien spendenden Nukleartechnik zu träumen, welche die Oberfläche der Erde sozusagen von innen bengalisch durchleuchtet und in eine behagliche Couch verwandelt.
Die Realität unseres kommenden Nuklear-Zeitalters wird ganz anders aussehen. Es wird weder den ach! nur allzu bequemen Weltentod Sardanapals durch Atombomben bringen, noch auch das »Paradies« eines Rentnertums, das durch unendliche Energien noch weit über Frigidaire und Staubsauger und Fernseher im Sinne einer märchenhaften Erfüllung aller kindischen Wünsche hinausgehen wird …«
Ich begann die Seiten zu redigieren, weil Frau Turel es gewünscht hatte, las mich parallel weiter in das Werk ein, besorgte mir die zu Turels Lebzeiten gedruckten Bücher. An einem Nachmittag, als das winterliche Licht auf die Seite vor mir fiel, sah ich nicht die Gedanken, die sprachlichen Nachlässigkeiten, die fragwürdigen Vergleiche und Bilder. Ich sah die Seite selbst, als ein Dokument, als die Hinterlassenschaft eines Schreibvorgangs, von dem ich nichts wusste. Wie kam ich dazu, darin herumzukorrigieren und nach zwanzig, dreißig Jahren in das Werk eines mir weitgehend unbekannten Schriftstellers einzugreifen? Was wusste ich von der Art Prozess, in dem Turel sich bei der Niederschrift befunden hatte, Seiten, die bestimmt nicht zur Publikation vorgesehen waren, sondern einen Gedankengang festhalten, einen Einfall skizzieren wollten?
Ich rief Max Voegeli an und bat um ein Treffen, ich würde dringend seinen Rat benötigen. Im Kaffeehaus erzählte ich ihm von meinem Besuch bei Frau Turel und dass sie mir ein Bündel Manuskripte mitgegeben habe. Nach meiner Einschätzung handle es sich um Notizen, und mir seien bei der Redaktion Zweifel gekommen, ob ich mit meinen Korrekturen nicht eine Art von Verfälschung betreibe. Auch wenn es sich um offensichtliche Fehler handle, so griffe ich genauso wie Turels Witwe in ein Werk ein, in das einzugreifen ich mich nicht berechtigt fühlte.
– Sie haben nicht nur keine Berechtigung, sagte Max Voegeli, während der Rauch der Zigarette einen Faden ins Licht der Tischlampe spann, es ist ganz und gar unstatthaft. In was Sie Einblick nehmen durften, sind Werkstattblätter: Entwürfe, Versuche – Niederschriften aus einem Moment, der vielleicht bestimmt war durch eine Anregung, einen Einfall, durch ein gedankliches Bedrängtsein. Die Seite ist das nicht zu entschlüsselnde Zeugnis jenes Schaffensmoments. Was wollen Sie daran ändern? Ihn der Konvention korrekter Schreibweise angleichen? Ihn in eine »anständige Form« bringen?
Max Voegeli nahm mit seiner zittrigen Hand die Zigarette von der Packung, auf der sie glimmte, sah mich durchdringend an, ein prüfender Blick. Dann sagte er:
– Turel war ein »Echter«, der aus einer inneren Zerrissenheit heraus gearbeitet hat. Ich bin ihm mehrmals begegnet, und was immer er geschrieben haben mag, er gehört für mich zu den wenigen, die kompromisslos ihren Weg gegangen sind.
Ja, dachte ich auf der Zugfahrt nach Hause, das ist, was auch ich tun will: Meinen Weg gehen und einzig dem eigenen Erkennen vertrauen und dafür einstehen, auch wenn es zu Widerspruch führt, wie Max Voegeli erzählte:
– »Dein Werk soll deine Heimat sein«, das hat Turel bei einer Tagung des Schweizerischen Schriftstellervereins den nationalistischen Kollegen entgegengehalten, die während der Kriegsjahre Stimmung gegen die aus Deutschland emigrierten Schriftsteller gemacht haben. Sie fürchteten deren Konkurrenz, schwafelten von Heimat und schweizerischem Volksgut und beschimpften Turel als unzuverlässigen Staatsbürger.