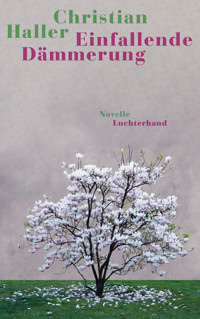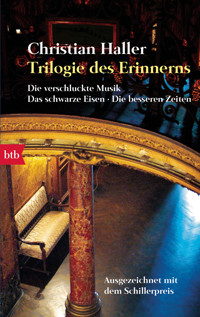9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchmal sind wir uns selbst am meisten fremd.
Clemens Lang ist ein anspruchsvoller Fotograf. Der genaue Blick für die Strudel und Untiefen der Welt ist seine Stärke. Und doch ist er sich selbst am meisten fremd. Das jedenfalls beginnt er zu begreifen, als er sich auf die Reise zu einer bedeutenden Tagung in einer weit entfernten Metropole begibt.
Als der Fotograf Clemens Lang eine unerwartete Einladung zu einer Tagung irgendwo im Orient erhält, fühlt er sich enorm geehrt. Doch was ihm zunächst als verlockender Ausbruch aus dem Alltag erschien, entpuppt sich als Albtraum. Denn schon am Flughafen begegnet er einem seltsamen Fremden, der von da an sein hartnäckiger Begleiter wird. Selbst am Tagungsort taucht er in einem fort auf und führt dem Fotografen eine Welt vor, die undurchschaubaren Gesetzmäßigkeiten gehorcht. Und während Clemens Lang auf dem Kongress bald der Kopf schwirrt angesichts der hitzigen Diskussionen über Wahrnehmung und Wahrnehmungsgeschichte sowie über die Folgen der Digitalisierung für das Spannungsverhältnis von fotografischer Abbildung, Wirklichkeit und Kunst, wird er zugleich unbarmherzig konfrontiert mit sich selbst, seinem Kunstverständnis und seinem Verhältnis zu Gesellschaft und Leben. Bildgenau und mit höchster sprachlicher Sensibilität erzählt Christian Haller die Geschichte eines Mannes für den eine Reise in die Welt zu einer zutiefst verstörenden Begegnung mit sich selbst wird. Es ist ein Roman über die Kunst und das Leben, über die Bilder, die wir uns von der Welt machen, und über die Manipulation unserer Wahrnehmung von Wirklichkeit, über das Sehen und das Wegschauen und über die blinden Flecken in unserem Auge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
CHRISTIAN HALLER
Der seltsame Fremde
ROMAN
Luchterhand
© 2013 Luchterhand Literaturverlag, Münchenin der Verlagsgruppe Random House GmbH.Satz: Uhl + Massopust, AalenAlle Rechte vorbehalten. ISBN 978-3-641-08798-2
für Monique
Es gibt nichts auf der Welt, das nicht einen entscheidenden Augenblick hätte.
Henri Cartier-Bresson
Der Teufel hat eine romantische Leidenschaft für die Vergangenheit; und wenn man die Vergangenheit weit genug zurückführt, wird sie zu dem Chaos, aus dem sich unsere energische, lebhafte Welt herausschälte.
John Cowper Powys
IDAS ERLEUCHTETE ZIMMER
Es war der dritte Tag mit Nordwind. Der Fluss, die Uferbäume vor den Fenstern steckten wie schon gestern und vorgestern in einer Hülle aus Nebel: Schwaden, in denen schattenhaft Zweige und Äste auftauchten und verschwanden. Doch nun versprach ein Brief, blendend im Licht der Tischleuchte, ein Loch in die herbstliche Trübnis zu stoßen: We are honoured to invite you – stand unter den Lettern eines Institutes, das auf schneeigem Weiß den Dear Sir bat, für die Präsentation seiner fotografischen Arbeiten in eine ferne, nach meiner Kenntnis warme Gegend zu kommen. Da ich fand, es wäre schon lange an der Zeit gewesen, eine Einladung ins Ausland zu erhalten, beschloss ich, auf jeden Fall zuzusagen.
Der Briefkopf des »Institute for Contemporary and Colonial Studies ICCS« deutete auf eine gewichtige und international tätige Organisation hin, und ich war eben im Begriff, das Blatt mit Genugtuung aus dem Lichtkreis der Lampe zu schieben, als mir noch ein Nachsatz auffiel, der mir bisher entgangen war. Dieser besagte, dass zusätzlich zu meiner Präsentation der Aufenthalt während des Kongresses genutzt werden solle, ein Portfolio zusammenzustellen. Als Thema vorgegeben sei die Stadt und ihre Bewohner, ein Ansinnen, das meine anfängliche Freude etwas dämpfte.
Mein Arbeitstisch aus Spanplatten, die auf Stützen gelegt sind, nimmt die Länge des Zimmers ein. Er bietet neben den beiden Computern, dem LCD-Bildschirm, dem Drucker und Scanner genügend Platz, um Reihen von Fotos auszulegen. Zusätzlich sind an der Wand entlang Drähte gespannt, an denen sich Abzüge mit Magneten befestigen lassen. Durch Legen und Hängen der Bilder, durch Austauschen und Umstellen versuche ich in einem oft langwierigen Prozess, eine Abfolge zu finden.
Ein Portfolio! In fünf Tagen! Mit dem unbescheidenen Thema: »Der Ort und die Menschen« – während ich noch nicht einmal wusste, wo genau die Reise hingehen sollte, keine Ahnung von der Stadt, geschweige denn von ihren Bewohnern hatte.
An den »Mappen«, eine Bezeichnung, die ich von einem alten, verehrten Fotografen übernommen habe, arbeite ich Monate, an einzelnen sogar Jahre. Kannten die Veranstalter überhaupt meine thematisch und formal komponierten Bildfolgen? Würden sie dann tatsächlich vorschlagen, ich solle während eines so kurzen Aufenthalts ein paar Schnappschüsse zu einem Portfolio zusammenstellen? – Egal! Es hatte lange gedauert, bis ich eine so ehrenvolle Einladung erhielt: Jetzt würde ich sie auch annehmen.
An diesem Morgen des 12. November stand ich also von meinem erleuchteten Arbeitstisch überm Fluss auf, trat mit meinen widersprüchlichen Empfindungen hinaus auf die Veranda. Durch das Fenster sah ich auf den Strom. Die neblig duftige Hülle war dauernd in Gefahr, von der Bise zerfetzt und übers Wasser weggetrieben zu werden. In den aufgerissenen Löchern, bevor neue Lagen sie bedeckten, wurden dunkle Einsprengsel sichtbar, Verunreinigungen, aus denen Büsche wuchsen, ein Stück Mauer, die Wiese und der Uferweg auftauchten und wieder unter Schleiern verschwanden.
Die Mappe mit den Flussbildern wäre vielleicht für die im Brief erwähnte Präsentation geeignet. Sie hätte mit meinem Wohnort, der unmittelbaren Umgebung meines Schaffens zu tun: Die Aufnahmen zeugten zudem von einer Arbeit, die mich schon lange beschäftigte, mit einem Lebensgefühl und einer gesellschaftlichen Situation zu tun hatte, die ich charakteristisch für die Gegenwart hielt.
Ich holte die Mappe aus dem Schrank, legte sie vor mich auf den Arbeitstisch, schlug eine beliebige Stelle auf:
Abzug 3: Die Stauung
Zu diesem Foto hatte ich in mein Arbeitsjournal notiert: »Der Widerspruch von Bewegung und Verharren, von Dauer und Vergehen ist in einem Moment durch ein klares Frühsommerlicht sichtbar geworden, als die schon tief stehende Sonne auf das Wasser fiel«, und ich hatte nach all den Wochen und Monaten des Beobachtens den mich überraschenden Moment erwischt, der in einem besonderen Zusammentreffen von Licht, Farbe, Materialität bestanden hatte:
Das Fließen zurückgehalten, verlangsamt, als wirke eine Kraft des Stillstands. Durch sie wird das Wasser einem polierten Speckstein ähnlich, in den unauffällige Muster geschnitten sind. Ketten kleiner Wirbel. Bänder, die um eine Nuance dunkler im Grünton sind, eine leicht gewölbte Oberfläche haben, deren Ränder von gegenläufigen Strömungen aufgeraut werden. Dazu Rippungen oberflächlicher Wellen, vom Wind gegen den Fluss getrieben. Ein fließender Stein. Auf seine eingearbeiteten Muster aus Wirbeln, Bändern, Windschauern legt sich das Spiegeln der Ufer: die Böschung, die Stützmauer, der Bahnhof, das dahinter ansteigende Gelände – Felsen und Büsche –, abgeschlossen von Häusern, deren Giebelzacken eine scharfe Schattenlinie in die Mitte des Stromes ziehen: Ein stehendes, sich dennoch dauernd veränderndes Bild. In diesen Wandel aus Beharren und Fließen, aus Mustern und Spiegelungen zieht ein Kormoran beim Aufsetzen aus dem Flug eine schäumende Linie, kurz, von rasch verströmender Vergänglichkeit.
Zufrieden war ich mit einer Arbeit nie, bei jedem neuen Betrachten fielen mir Einzelheiten auf, die nicht ganz stimmig waren. Ich fürchtete allerdings auch den Perfektionismus. Das ständige Überarbeiten verdarb am Ende das Bild und sein Motiv. Ich blies auf den Glanz des Fotos, um feine Staubpartikel zu entfernen, was mir vorkam, als wollte ich ihm Leben einhauchen, und legte den Abzug mit skeptischer Miene in die dunkelblaue Mappe zurück.
Drei Leuchten brannten im Zimmer: Die Halogenlampe über dem Arbeitstisch, die Leselampe neben dem Fauteuil, ein Kristalllüster im hinteren, dunklen Teil des Zimmers aus dem Haushalt meiner Großeltern. Drei Lichtkreise, die den Tätigkeiten entsprachen, die meinen Alltag bestimmten: Die Bilder bearbeiten und sichten, Studien betreiben und die Mappen ordnen. Das Einfügen einer neuen Arbeit gehörte zum Lüster, dessen Licht ein weiteres Erbstück beschien, einen massiven Nussbaumschrank mit geschwungenem Aufsatz, der von seitlichen Pfeilern getragen wurde. Das eingedunkelte Holz der Tür war rissig, versehen mit einem verschnörkelten Beschlag aus Messing. Im Innern standen auf den Tablaren die Mappen, aufgereiht in fünf Reihen mit verschieden dicken blauen Rücken. Sie hatten Titel, waren thematisch geordnet – um die vierhundert Stück –, und die Mappe mit den Flussbildern, die ich an ihren Platz zurückschob, trug den Titel »Strom und Fall«.
Ich klickte am Laptop auf das Symbol des Kalenders, kippte hinein in den leuchtenden Raster aus den Tagen eines Monats, ein Netz von Linien, in das einzelne Stunden eingefangen waren, künftige Verpflichtungen, rot die Arbeit betreffend, blau die Vergnügen, zappte einen Monat weiter, und das Netz der Tage und Stunden zeigte einen mäßig beschäftigten Menschen, klar zu wenig für ein ausreichendes Einkommen, und geradezu bedenklich für jemanden, der Ende vierzig auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Tätigkeit stehen sollte: Die Zeit der Reise war ohne unverschiebbaren Eintrag, eine Reihe dürftig gefüllter Quadrate. Es wäre ja auch Pech gewesen, hätte ich absagen müssen, Mr. Lang sei unfortunately anderweitig verpflichtet, obschon die Reise, der lange Flug auch Strapazen bedeuteten, ganz abgesehen von der Präsentation, bei der mir völlig unklar war, was genau man erwartete. Doch Sarah würde mich begleiten, und ihre Reaktion, als ich sie im Büro anrief, war genau so, wie ich es vorausgesehen hatte.
– Großartig, ich freue mich für dich, Clemens. Ich komme mit! Auf jeden Fall. Wir hängen ein paar Tage an, eine Woche oder so.
Und weg war sie, hatte den Hörer hingelegt, um ihre Agenda zu holen. Endlich!, hörte ich sie im Hintergrund sagen, endlich hast du eine Einladung, war aber auch Zeit, die Rollen des Stuhls gaben ein unterstreichendes Geräusch, als sie sich wieder hinsetzte, und im Hörer tönte das energische Blättern in ihrer Agenda.
– Das ist ja bereits in zweieinhalb Wochen, sagte Sarah, und die Verlangsamung ihrer Worte, das Abgleiten der Stimme in eine tiefere Lage verhießen nichts Gutes, veranlassten mich zum raschen Einwurf, ja, ja, es sei unanständig knapp!, nur um noch hinauszuschieben, was schon Gewissheit war:
– Ich habe Kurs. Ich kann die Vorlesungen nicht ausfallen lassen.
Sarah war Astrophysikerin, hatte einen Lehrauftrag an der Universität, zwar nicht allzu viele Stunden, doch sie musste bedacht darauf sein, dass diese nicht auch noch gestrichen wurden. Vom ehemaligen Institut waren grade mal drei Stellen übrig geblieben. Die Gruppe von Studenten, die sie zu betreuen hatte, war kleiner geworden, und die Sparrunde vor einem Vierteljahr hatte sie und ihre beiden Kollegen in enge Büros unters Dach des Physikgebäudes verbannt.
– Ich kann unmöglich weg, sagte sie, bevor sie auflegte, und ihre Entscheidung klang unwiderruflich.
Die Aussicht, ohne Sarah zu fahren, verdunkelte meine anfängliche Freude noch um ein Beträchtliches. Ich hasste es, allein unterwegs zu sein, obschon ich früher viel gereist war. Doch seit ein paar Jahren machte sich zunehmend ein leidiges »Erbstück« meiner Familie bemerkbar. Mamas »nervöse Leiden« während oder nach der Ankunft einer Reise waren geradezu sprichwörtlich, und ich kannte inzwischen mehr, als mir lieb war, worin diese nervösen Leiden bestanden: Seh- und Wahrnehmungsstörungen, denen oftmals Übelkeit folgte. In Sarahs Begleitung fühlte ich mich besser, sie wirkte beruhigend und gab mir eine Sicherheit, die ich nun in den zu präsentierenden Arbeiten finden müsste. Ich ging deshalb nochmals zum Schrank mit den Mappen, zog diejenige mit dem Titel »Strom und Fall« heraus, meine Flussbilder, wollte nochmals einen Blick hineinwerfen.
Ja, es würde die richtige Entscheidung sein! Die Fotos waren gut, und es ließe sich ausführlich, anhand einzelner Aufnahmen, über die Motive und ihre Umsetzung sprechen:
Abzug 6, Titel: Strömungslinien
Die Stauung. Dieses Verlangsamen des Flusses, das gleichzeitig ein Auf- und Hochschichten des Wassers ist. Ufer verschwinden, der Strom wird zum See, und sein Fließen verbirgt sich unter der beruhigten Oberfläche: Sie ist zur Haut geworden, auf die jedoch wieder und wieder Schauer aus der Tiefe, aus dem felsigen Untergrund, der einstmals zu den Klippen des Falls gehört hat, heraufdringen. Vor einem Jahrhundert sind hier die Wassermassen niedergetost, ein schaumiges Zerfetzen, das jetzt nur noch als Strömungslinien zu sehen ist, in die Fläche projizierte zahme, kaum sichtbare Aufwallungen, die unregelmäßige Kreislinien in einem ununterbrochenen Hochstoßen aussenden – und diese Oberfläche, diese »Haut« abzuziehen, sie aufs Fotopapier zu bringen, war das Ziel der Aufnahme: Sie sollte die untergründige Bewegung, die unauslöschliche Spur des ursprünglichen Gefälles im Bezähmten sichtbar machen, »die rasche Vergänglichkeit, die sich jetzt unter der Stauung verbirgt – unter diesem fließenden Stillstand unseres heutigen Daseins«.
IIDER NICHT-ORT
Den Rucksack am Rücken, die Fototasche über die Schulter gehängt, zog ich den Rollkoffer hinter mir her, eingepackt in eine gefütterte Jacke. Sie würde von jetzt an nur noch Ballast sein: Die Glastür schob sich auf, ich betrat die helle, beheizte Abflughalle und ließ die Windböen, die einen Schneeregen durch den Schein der Straßenleuchten trieben, hinter mir zurück.
Eine Rolltreppe schleppte mich und mein Gepäck zu einer Plattform hoch, die eingefasst von Leuchtschriften, Schaltern und Geschäften war. In Abständen dämpfte ein Glockenton den Lärm, eine besänftigende Stimme bat die Passagiere zu ihren Gates, und ich folgte den Hinweistafeln mit Piktogrammen. Trotz all der Bewegungen von Menschen, die nach ihren Zielen strebten, herrschte eine gleichbleibende Atmosphäre, als hätte die Zeit, die hier jedermann bestimmte, kein wirkliches Vorankommen in dem lindgrünen Licht aus Leuchtstoffröhren. Mich erfasste ein Gefühl, als verlöre ich allmählich meinen Körper an die Gepäckstücke: den Arm an den Rollkoffer, Rücken und Brust an den Rucksack, die Schulter mit einschneidendem Schmerz an die Fototasche. Meine Beine wurden stapfend schwer auf dem mit Plastikplatten ausgelegten Boden, belastet von einem Magen, der in ungewohnter Plumpheit unter dem Atmen lastete, als gehöre auch er zum Gepäck.
Meine Blicke führten mich zur Check-in-Halle, stellten mich vor eine Anzeigetafel, deren rotierende Plättchen stets neue Flugnummern und Destinationen anzeigten. Eine Zahl wies mich zu einem Tresen, hinter dem mich ein Lächeln, angeknipst wie ein Lämpchen, unter straff nach hinten gekämmten Haaren empfing. Das Make-up bewahrte noch Spuren der morgendlichen Blicke in den Spiegel. Die Schatten unter den Augen, die lackierten Fingernägel, die über die Tastatur glitten, ließen mich ein Zweizimmer-Appartement in einer der Satellitensiedlungen vermuten, eine beheizte Nüchternheit, in der das Sofa, davor der Beistelltisch, das Fernsehgerät, die ungespülte Kaffeetasse als schattenhafte Umrisse verblieben waren. Aus diesen verlassenen Räumen heraus wurde mir jetzt »ein guter Flug« gewünscht, und ich nickte.
Wenigstens war ich einen Teil des Gepäcks los. Rucksack und Tasche wollte ich mit an Bord nehmen: Im Rucksack war der Laptop, in der Tasche die Fotoapparate, beides meine Arbeitsgeräte.
Ich stellte mich vor der Zollkontrolle an, ein Durchlass in der gläsernen Abschrankung, ergab mich in die nun folgenden Prozeduren, wie die übrigen Passagiere auch. Man hielt die Pässe und Bordkarten bereit, wartete, um endlich durch die Pforte der passengers only zu gehen, löste sich allmählich aus dem Alltag heraus wie aus einem verwitternden Gestein. Einige Reisende ließen winkende und weinende Bekannte zurück, die noch letzte Blicke zu erhaschen suchten und sich dann abwandten, um in die Verfestigung gewohnter Tätigkeiten zurückzukehren. Den Kopf gesenkt, trabten sie davon, im Rücken bereits die Erinnerungen an die eben stattgefundene Trennung.
Ich blickte diesen mir unbekannten Leuten hinterher, wie sie nach dem reliefartigen Hervorgehobensein, das sie beim Abschied kurz erreicht hatten, wieder im kalkgrauen Tag verschwanden, ließ mich von ihren Abschieden in die eigenen Erinnerungen gleiten. Ich hatte heute früh zu Hause am Küchentisch gesessen, Kaffee getrunken und auf die Wirrnis in meinem Körper gelauscht. Mutters Erbe! Als spielten die Organe nicht in der gewohnten Weise zusammen! Es entstanden synkopische Lücken, durch die ein Unbehagen heraufdrang, das sich in ein Muster ausweitender Wellen von Ängstlichkeit verwandelte, an deren vordringenden Rändern kleine Wirbel entstanden. Sie zerrten an der Wahrnehmung, entstellten die gewohnte Umgebung, Tisch, Herd und Spüle – und ich suchte Halt, blickte zum Fenster, in dem der Morgen dämmerte, sah unerwartet eine Bildkomposition, die mich veranlasste, die Kamera nochmals aus der Tasche zu holen: Auf dem Sims vor dem nebelgrauen Viereck des Fensters, in das hinein der Stern der Kirchturmspitze ragte, stand der Globus, den mir Sarah vor Wochen geschenkt hatte. Er war von innen erleuchtet, und mit dem Stern und dem Grau über den Dächern kam mir das Arrangement wie eine surreale Vision meines bevorstehenden Flugs vor. Zumal der Globus eine für Sarah typische Besonderheit hatte. Statt des üblichen Blaus leuchtete er glühend rot.
Sie hatte den Globus in einem Trödelladen gefunden, ein Stück, auf dem es Länder gab, die nicht mehr existierten, und Grenzen, die längst verschoben worden waren. Die Kontinente glichen Inseln in den Ozeanen, und diese Kugel mit schräg gestellter Achse, gehalten von einem Bügel, auf dem die Grade eingeprägt waren, wurde durch eine elektrische Birne von innen her beleuchtet – wenigstens eine Weile lang. Doch schon nach zwei, drei Wochen blieb die Kugel dunkel, war das Licht im Innern kaputt – und mich amüsierte, wie Sarah an einem Sonntagmorgen im Pyjama, mit vom Schlaf wirren Haaren, am Küchentisch vor dem Globus saß, den Ausdruck forschender Neugier in den Augen. Ihr helles Gesicht war ganz Konzentration, hatte in der unbedingten Zuwendung an die bereits demontierte Kugel etwas Kindliches: Wenn eine elektrische Birne in diese Plastikkugel hineingebracht worden war, musste sie auch ausgetauscht werden können. Und es dauerte über das Frühstück hinaus, bis Sarah das Problem gelöst und ein neues geschaffen hatte. Sie wusste endlich, wie die Glühbirne zu wechseln war, stellte jedoch fest, dass sie keine neue besaß, außer einer roten, von der ich nicht zu sagen gewusst hätte, wie sie in unseren Haushalt gekommen war. Sarah schraubte sie mit der Bemerkung ein, das Rot sei nun eben das flüssige Magma, das man durch die Erdrinde schimmern sehe.
Ich suchte den geeigneten Sichtwinkel von Globus zu Kirchturmspitze und Himmel, schoss ein paar Bilder von der rot unter dem Stern schwebenden Kugel, in der Hoffnung, damit bereits das einleitende Foto zum Portfolio gefunden zu haben.
IIIDER CAUSEUR
Ein wenig erschöpft ließ ich mich nach dem security-check in eine der Plastikschalen fallen, die aufgereiht in der Halle standen. Andere Reisende warteten bereits, lasen, arbeiteten an Laptops oder starrten auf ihre Smartphones. Ich schob den Rucksack zwischen die Beine, legte die Hand auf die Tasche neben mir. Eine halbe Stunde bliebe noch bis zum Einsteigen, 37 B, ein Gangplatz.
Zwischen den Wartereihen, in der Mittelachse des hohen, verglasten Raums, hatte eine Kaffeebar geöffnet, ein hell beschienener Kubus mit Tresen, dem eine Zeile Schaukästen folgte, in denen Schmuck und Uhren, Schreibutensilien, Etuis und Accessoires in gleißendem Licht ausgestellt waren. Die Schaukästen wiederholten im Kleinen die Würfelform der Bar wie auch der Halle als Ganzem, in deren Glasfronten der nasskalte Morgen stand.
– La beauté des restes. Die Schönheit – nun, wie soll man das übersetzen – des Übriggebliebenen?, fragte ein Fremder im dunklen Wollmantel, der zwei Sitzschalen weiter saß, einen Stetson auf das übergeschlagene Knie gesetzt. Er wies mit der Zigarre auf die glänzenden Artikel in den Schaukästen, eine Geste souveräner Selbstverständlichkeit, und plauderte in angenehmem Ton, als würde er mich kennen.
– Zeugnisse einer Kultur, die noch als Luxusprodukte in unsere Zeit hinübergerettet worden sind, ohne hier wirklich gebraucht zu werden. Die Füllfeder des 19. Jahrhunderts nimmt sich gegen einen dieser Laptops hier wie ein Teeklipper gegen einen Hochseefrachter aus.
Der Fremde lächelte ein augenzwinkerndes Lächeln, nahm von der Zigarre einen Zug, der die Asche aufglühen ließ.
Ich hätte den Unbekannten gerne darauf hingewiesen, dass das Rauchen hier verboten sei, um dem Herrn durch meinen Tonfall klarzumachen, er solle mich in Ruhe lassen, mir sei nicht nach Konversation zu Mute. Doch der Fremde redete, und er tat dies in einem zunehmend vertraulichen Ton, wies mit dem Aschekegel nach den Vitrinen:
– Ein Museum, sagte er, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Schmuckstücke liegen dort aus, die eine gewisse Astrophysikerin zweifellos bemerkenswert fände.
Er nahm einen weiteren Zug von der Zigarre, von deren Glut seltsamerweise kein Rauch aufstieg.
Bei der Nennung von Sarahs Beruf stutzte ich, kam nicht umhin, mir zu überlegen, ob ich dem Mann schon einmal begegnet, er mir womöglich vorgestellt worden war.
– Wer weiß denn heute noch, sagte der Fremde, dass »Kosmos« auch Schmuckstück heißt.
Seinen wuchtigen, kahlen Schädel umfasste ein Kranz brauner Haare, die an den Schläfen ergraut waren. Die hellen, listigen Augen und das für sein Alter – er mochte Mitte vierzig sein – stark von Furchen gezeichnete Gesicht erinnerten mich an einen Professor für Sozialgeschichte, der aus Wien 1938 emigriert war, zwei Jahre in einem Bleibergwerk gearbeitet hatte und nach einem ökonomischen Experiment auf einer Südseeinsel, in Wales an der Universität über die Vorteile kleiner Nationen las. Ich hatte ihn mehrere Male für eine Agentur porträtiert: Ein eigenwilliger Mann, den ich sehr schätzen lernte, weil er neben Humor auch Charme besaß, seine Philosophie mittels Anekdoten betrieb und bei Lobreden, die es zu jener Zeit nicht selten auf ihn gab, stets sein altertümliches Hörgerät abstellte.
– Ich werde Sie immer wieder an alle möglichen Leute erinnern, sagte der Fremde in einem schleppend ironischen Ton, denn sehen Sie, das leicht Wandelbare gehört zu meinem Wesen. Manchmal mag Sie dieses schauspielerisch Unbestimmte irritieren. Doch bedenken Sie, wie viele Gesten, Haltungen, auch Redefiguren selbst ein gewöhnlich Sterblicher in seinem Leben aufnimmt. Mit der Zeit hat man eine ganze Gesellschaft in sich wohnen. Oh! nicht die schlechteste, wie ich in Bezug auf Sie betonen darf. Was jedoch mich betrifft, so glaubt man oftmals in mir einen anderen, mir fremden Menschen wiederzuerkennen, obschon mir eine gewisse Ähnlichkeit mit meinem einstigen Aussehen verblieben ist. Doch bin ich dieses Verwechseltwerden gewohnt, wie das Rauchen übrigens auch: Es war zu meiner Zeit noch eine Selbstverständlichkeit.
Ich sah nach der Uhr, hoffte, mein Flug würde endlich aufgerufen, um mich mit gutem Grund entfernen zu können, obwohl der Fremde eine seltsam belebende Ausstrahlung besaß. Mein körperliches Unbehagen war wie weggeblasen. Doch wurde das Gate hinter der Flugnummer noch immer nicht angezeigt.
– Sie brauchen sich nicht zu beeilen, sagte jetzt der Herr im dunklen Mantel, Ihr Flug hat Verspätung, leider – wie ich Ihnen ungern gestehe – sehr viel Verspätung.
Als hätte es bloß das Stichwort des Unbekannten gebraucht, tönte aus dem Lautsprecher die Mitteilung, der Flug SL 874 sei wegen technischer Probleme verschoben. Please, contact the information desk – und auf der Anzeige klappte die Tafel herunter: delayed.
– Sie haben Zeit. Doch verzeihen Sie, dass ich mich nicht vorgestellt habe: Friedländer. Wenigstens habe ich bis 1916 so geheißen. Danach, na ja, Sie wissen von dem Professor, an den ich Sie eben erinnert habe, was danach kam. Friedländer klang im Ersten Weltkrieg zu ironisch und bald danach zu jüdisch.
Ich lächelte nun meinerseits, ein wenig gequält, als versuchte man mit mir einen etwas angestrengten Scherz. Der Mann müsste ein biblisches Alter haben, wenn zuträfe, was er erzählte. Aber würde überhaupt etwas von dem zutreffen, was dieser seltsame Fremde erzählte, besonders da er jetzt erwähnte, er sei von Beruf »Causeur«?
– Auch dies ein Begriff, der verschwunden ist, weil es das Bezeichnete, also mich selbst, nicht mehr gibt, schon gar nicht in der ursprünglichen Bedeutung. Dazu gehörte eine gesellschaftliche Ambiance, von Salons und Empfangsabenden geprägt, wie sie im Frankreich des 18. Jahrhunderts und bis in die Zeit Prousts existiert hat.
In gewisser Weise, wenn auch schon vulgarisiert, habe auch das Kaffeehaus noch die Aufgabe erfüllt, die besten Köpfe zum zwanglosen Gespräch zusammenzuführen.
– Ich habe es noch gekannt, sehr ausgiebig sogar. Ein tägliches Wörterfechten, geistreich, schlagfertig, sehr intrigant.
Als Causeur habe damals nur gegolten, wer über eine umfassende Bildung verfügt und die Fähigkeit besessen habe, durch präzises Formulieren erstaunliche und unentdeckte Seiten des Alltäglichen sichtbar zu machen. Da stünde ich, was die erstaunlichen und unentdeckten Seiten des Alltäglichen betreffe, in einer gewissen Nachfolge, wenn auch eines Causierens mit Bildern, während er sich noch ganz auf den Redefluss habe verlassen müssen. Dieser sei lediglich durch das Faktum legitimiert gewesen, dass wir nicht sehr viel mehr als die Wörter hätten, um uns zurechtzufinden, was gleichbedeutend sei wie unsere Welt beständig redend zu erfinden. Leider taugten die Wörter – wie übrigens die Bilder auch – lediglich zu Halbwahrheiten, zu bestechenden Irrtümern, die zu weiteren Irrtümern führten, die, elegant formuliert und in ihrer Aussage überraschend, ein Gefühl großer Einsicht gäben, doch nichts weniger als Irrtümer blieben.
Redefluss – lange hatte ich dieses, wie ich fand, altmodische Wort nicht mehr gehört, und es erinnerte mich an eine Aufnahme in der Mappe »Strom und Fall«: Es gab Bilder, die hatte ich im Kopf, bevor ich sie außerhalb finden konnte, und es dauerte oft Wochen, manchmal Monate, bis ich auf sie stieß, meist unerwartet – oder wie ich es nenne: »ungesucht« –, und der Uferstreifen gehörte zu dieser Art Aufnahmen:
Ein Stück Ufergrund. Überströmt von seichtem Wasser, das in Flussrichtung – dem linken Bildrand zu – von Reflexen des einfallenden Lichts verborgen wird, jedoch rechts und in der Mitte die Sicht auf Schlamm und Kiesel, den Algenbewuchs freilässt. Die Strömung wird durch ein Netz leuchtender Linien sichtbar, von der bewegten Wasserfläche zum Grund gebrochen.
Es war schwierig gewesen, diesen Moment des Lichteinfalls zu finden, der den Untergrund des Wassers zu einer kurz verschwimmenden Erscheinung werden ließ: Mit der Aufnahme wollte ich ersichtlich machen, wie unsere Wahrnehmung die Wirklichkeit, die sie eben entdeckt, durch Reflexion wieder verhüllt. Ich wählte eine Anordnung, bei der die Zeit von der ersten zur zweiten und dritten Aufnahme je sieben Minuten betrug. Die Reflexe nahmen durch das Sinken der Sonne und den dadurch flacheren Lichteinfall zu – und nachdem ich durch das Wort »Redefluss« an die Arbeit erinnert worden war, mir die Bilder einen Moment lang vergegenwärtigt hatte, stellte ich erstaunt fest, dass der Fremde spurlos verschwunden war.
IVDIE SCHMUCKSTÜCKE
Einerseits fühlte ich mich erleichtert, die Sitzschalen neben mir leer zu sehen und Landers – so hatte der Fremde sich schließlich vorgestellt – nirgends in der Nähe zu entdecken. Andererseits war das Wohlbefinden, die körperliche Leichtigkeit, die von dem Causeur ausgegangen war, wie weggeblasen. Ich spürte wieder die ängstlichen Aufwallungen, die klumpig in den Magen sackten. Auch die Umgebung – die Reihen Wartender, die Bar, die Halle mit ihren Glasfronten – verlor augenfällig an Intensität, als wäre sie durch die Anwesenheit des Fremden in einen angeregten Zustand versetzt gewesen, in eine intensivere Gegenwärtigkeit, die jetzt verblasste und die Sitzreihen und gate desks ins diffuse Licht der Halle zurücksinken ließ.
Obwohl ich den Rucksack und die Fototasche mitschleppen müsste, mein Sitzplatz vielleicht später besetzt sein würde, entschloss ich mich, bei der Auskunft wegen der Verspätung des Flugs nachzufragen. Wie zufällig und vielleicht doch auch aus Neugier blieb ich bei einem der Schaukästen stehen, um nachzusehen, was dort ausgestellt sein mochte, das »eine gewisse Astrophysikerin bemerkenswert fände«.
In der Vitrine waren Halsketten, Armbänder, die dazugehörigen Ohrringe ausgelegt, präsentiert in einem Licht, das sie einzigartig und wie Fundstücke erscheinen ließ. Ich konnte jedoch nichts entdecken, das mit Sarah oder ihrer Wissenschaft zu tun hatte. Außerdem war mir unklar, woher der Causeur überhaupt etwas von Sarahs Tätigkeit wissen sollte. Ich blickte hoch, sah den Flur entlang, in dessen Mitte die Schaukästen aufgestellt waren. In ihnen ein Planetensystem des Luxus sehen zu wollen, erschien mir als eine zu abwegige, zu gesuchte Assoziation, doch als hätte es dieses Einfalls bedurft, bemerkte ich einen Anhänger in der Vitrine, der tatsächlich mit Kugeln und Ringen an eine Darstellung des aristotelischen Kosmos erinnerte: Im Zentrum war ein Saphir als Erdkugel, umfasst von Ringen als Zeichen für die Planetenschalen und einem äußersten, brillantbesetzten Reif, der den Fixsternhimmel darstellte – ein in seiner Geschlossenheit anziehendes Schmuckstück. Es versinnbildlichte die in himmlische Sphären eingehüllte Welt, wie sie dem Altertum noch selbstverständlich gewesen war und die ein Geborgensein im All erahnen ließ.
Ästhetik ist da keine Lehre des Schönen und Gefälligen, sondern eine Methode der Erkenntnis, die nach den gültigen Harmonien in den Erscheinungen sucht – : Ein Gedanke, der mir unvermittelt beim Anblick des Anhängers einfiel, mir jedoch wie ein aufgenötigtes Zitat erschien. Ich habe eine Abneigung gegen diese Art belehrender, behauptender Sätze. Sie haben mir schon als jungem Mann, der nach der Kunstakademie noch ein paar Vorlesungen in Philosophie hörte, stets wie eine Art Wörterlärm geklungen, gegen den ich mich instinktiv wehrte. Damals glaubte ich, dass die Fotografie offener, auch umfassender sei, als es Sätze sein könnten – und das Bild auch ein zuverlässigerer Zeuge des Wirklichen sei. Beides trifft nicht zu, wie ich im Fotolabor schon bald entdeckte.
Ich brauchte eine Weile, auch in der nächsten Vitrine den Anhänger zu finden, der sich als Sinnbild des Kosmos lesen ließ. Über dem Saphir, den Ringen und dem Brillantreif war nun bei diesem Schmuckstück ein römischer Brunnen als Kettenöse gearbeitet, dessen überfließende Schalen – durch feine Goldfäden dargestellt –, für das neuplatonische »Überfließen des Einen« standen. Von Planetenschale zu Planetenschale nahm die Zahl der Goldfäden ab, was für die Verminderung der Kraft und Klarheit des Einen stand. Den Abstieg in die Vielheit deutete der Schliff des Saphirs an, dessen Kugelform aus lauter kleinsten Flächen bestand, die das Licht brachen.
Im dritten Schaukasten war der Teil zwischen dem Brillantreif des Fixsternhimmels und der Kettenöse entsprechend der Entwicklung zum christlichen Empiraeum auf die Art gestaltet, dass die Kette selbst zum Funkenreigen der Engel wurde. Über ein weiteres Schmuckstück, das nun einen strahlenden Rubin im Zentrum trug, während der Saphir unserer Erde hinaus auf eine Planetenbahn gerutscht war, gelangte ich beim letzten Schaukasten zu einem Anhänger, der als Turmuhrwerk gestaltet war, ein aus Rädern, Federn, Spangen bestehendes mechanisches Elaborat, getrieben von der ewigen Unruhe, die mich mit Fototasche und Rucksack vor die große Glasscheibe brachte, die den Flur abschloss.
Ein trostloser Ausblick in den unbegrenzten, euklidisch leeren Raum zum Schluss, kam mir wiederum ein eingeflüsterter Gedanke ins Gehirn, und über Flugzeuge und Pisten hinweg blickte ich in den verhangenen Himmel, in den ich endlich zu fliegen hoffte.
Ich versuchte, Sarah im Institut anzurufen, doch mein Handy zeigte – NUR NOTRUF MÖGLICH –, und ich sah irritiert auf das Display. Andere Reisende hatten gestikulierend ihre Smartphones am Ohr, eine Verbindung musste folglich möglich sein, es sei denn, mein Gerät wäre defekt oder zu alt. Es galt mit seinen acht Jahren bereits als eine Antiquität. Die Befürchtung jedoch, während der Reise keinen Kontakt zu Sarah aufnehmen zu können, beunruhigte mich. Wir tauschten oftmals SMS aus, und nun, da ich noch nicht abgeflogen war, hatte ich sie überraschen und von den Schmuckstücken erzählen wollen, die ein Künstler, wie ich annahm, als geschichtliche Folge sich wandelnder Weltbilder entworfen hatte. Verwunderlich war nur, dass es keinen Hinweis auf die Ausstellung gab und auch der Name des Künstlers, ungenannt blieb. Es sollte offenbar dem Zufall überlassen bleiben, ob jemand die Installation entdeckte. Allzu häufig geschähe dies wohl kaum. Man musste schon genau hinsehen. Ohne den Hinweis des Fremden wäre ich nicht einmal auf den Gedanken verfallen, mir die Auslagen anzusehen. Dann setzten die Schmuckstücke auch ein Wissen voraus, das ich durch Sarah besaß, das aber kaum zum Allgemeinwissen gehörte. In ihrer Grundvorlesung leitete sie die Darlegung der modernen kosmologischen Theorien mit einem historischen Abriss ein, der ihr auch Gelegenheit bot, ihrer heimlichen Leidenschaft für Dante nachzugeben. Sarah sah in der »Göttlichen Komödie« die vollkommenste kosmologische Vision, die je in der Menschheitsgeschichte gestaltet worden war: In ihrem Büro unterm Dach des Physikgebäudes hing eine Reproduktion von Botticellis »Karte von Dantes Hölle«, diesem gestuften Trichter, der durch den Sturz Luzifers aus dem Himmel in die Erdkugel hineingeschlagen worden war. Doch typisch für Sarah, hatte sie Botticellis Bild verkehrt herum aufgehängt und durch den Gang ergänzt, der vom tiefsten Punkt der Hölle durch das Zentrum der Erde wieder hinauf zur Südhemisphäre führte, wo sich – herausgedrückt durch den Höllentrichter – der Läuterungsberg erhob, auch er gestuft, mit dem irdischen Paradies als seinem Gipfel. Darüber wölbten sich die Himmelssphären und über diesen das himmlische Paradies, ein Lichtreigen von Engeln. Sarah hatte diesen oberen Teil aus alten Darstellungen der Planetenbahnen, zum Teil aus den Illustrationen zu Dantes Komödie zusammengesetzt: Eine Collage, von der sie behauptete, durch diese daran erinnert zu werden, dass wir seit der Urknalltheorie wiederum von einer kosmischen Blase ausgehen würden: ein den Menschen von der Vorstellung des unbegrenzten euklidischen Raums befreiendes Bild und tröstliche Analogie zu Dante.
VLANDERS BUCH
Ob es schon Informationen gäbe, wie lange es noch bis zum Abflug dauern werde?
Ich hatte mich zum information desk begeben, hinter dem ein junger Mann in kurzärmligem Hemd sein gebräuntes Gesicht mir mit dem Interesse zuwandte, das man einem unbekannten Porträt entgegenbringt.
Mit welcher Ankunftszeit denn zu rechnen sei?
Als ich vor der Glasscheibe in den leeren Himmel geblickt hatte, war mir klar geworden, dass ich um Stunden verspätet, vermutlich mitten in der Nacht, in einer Millionenstadt ankäme. Niemand würde mich abholen, vergeblich suchte ich am Ausgang unter wenigen Wartenden ein Schild mit meinem Namen. Ich wäre ohne eine Adresse, an der ich untergebracht wäre, ohne eine Telefonnummer, an die ich mich wenden könnte. In der Mail, die meine Reisedaten auflistete, war für die kommende Nacht lediglich ein private hosting vermerkt, zu dem ich gefahren würde, ohne Ortsangabe, gefolgt von den Flugdaten der Weiterreise am nächsten Tag. Ich stünde in einer Halle, die verlassen im Schein unveränderlichen elektrischen Lichts läge – lost in transition –, und dieser Übergang, soweit war mir klar, hatte bereits hier, an diesem Nicht-Ort, begonnen. Auf meine Frage, ob der Flug überhaupt durchgeführt würde, worin auch die leise Hoffnung steckte, aus Gründen »höherer Gewalt« gar nicht erst reisen zu müssen, sah der Angestellte angestrengt auf den Bildschirm, ohne mich noch weiter zu beachten.
– Wir werden Sie informieren, sobald wir Näheres wissen.
Ich ging zur Bar, bestellte einen Kaffee, dazu ein Croissant. Da mein Handy nicht funktionierte, würde ich von einer Telefonzelle aus Sarah anrufen. Sie konnte versuchen, Verbindung mit dem Institut aufzunehmen. Dort müsste man über meine Unterkunft Bescheid wissen und könnte veranlassen, dass jemand mich auch spät nachts noch erwartete. Der Barmann schob die Tasse unter den Kolben, stellte Untertasse und Löffel bereit, angelte das Croissant aus dem Korb – dies alles mit einer Routine, die längst in die Muskeln eingeprägt war. Auch ich hätte bei den gewohnten Abläufen bleiben sollen. Was sollte ich »über die Ergebnisse der eigenen Arbeit« sprechen, mir unbekannten Leuten erklären, dass die Beschäftigung mit den Flussbildern mich zum Thema der Erosion, des Zerfalls und der Endlichkeit geführt habe.
Heftig stippte ich mein Croissant in den Kaffee, erinnerte mich, dass dies in meiner Jugend einzig an den Sonntagen, als feiertägliche Ausnahme, gestattet gewesen war. Das Ritual, ein Stück geflochtenes Weißbrot, zu dem es weder Butter noch Konfitüre geben durfte, in die Tasse Kaffee zu tunken, war ein Tribut an den Landarzt, meinen Großvater. Bei seinen Krankenvisiten in den Bauernhäusern hatte er jeweils Brot, in eine Schale Kaffee gebrockt, angeboten erhalten, was er liebte. Mir jedoch brachte der Geschmack des kaffeedurchtränkten Croissants die Atmosphäre der Sonntage in meiner Kindheit zurück. Das Licht fiel hell vom Garten ins Speisezimmer, blendete auf dem Weiß der frisch ausgebreiteten Tischdecke, und der Tag versprach von freundlicher Belanglosigkeit zu werden. Diese konnte leicht in eine durch Radiomusik untermalte Langeweile umschlagen, in der ich mir wünschte, es wäre nicht mehr heute, aber auch nicht schon morgen, ein unerträglicher Zwischenzustand.
Als ich die Tasse zur Seite schob, bemerkte ich ein Buch, das in Armlänge neben mir auf dem Bartresen lag. Der Titel des eher schmalen Bandes lautete: »Das Buch der Halbwahrheiten«. Ich sah niemanden, dem es hätte gehören können, und der Barmann schüttelte bloß den Kopf, die Mundwinkel nach unten gekrümmt. Ich zog das Bändchen zu mir heran, öffnete es auf den ersten Seiten und fand als Motto ein nicht näher ausgewiesenes Zitat:
»Wir befinden uns zwischen Wahrheit und Wahrscheinlichkeit: Die Wahrheit ist unsere Herkunft, die Wahrscheinlichkeit, wohin wir gehen. Auf diesem Weg entsteht ein Gefühl der Unredlichkeit, des Willkürlichen und Beliebigen. Wir möchten uns wieder auf das Absolute beziehen, das es nicht mehr gibt, doch für Jahrhunderte gültig gewesen ist.«
Ich blätterte durch die Seiten, auf denen einzelne Sätze und Notate standen. Beim Überfliegen fand ich Texte, die wie herrschaftliche Häuser von altem Glanz zeugten, allerdings eklektisch im Stil waren, mit klassizistischen Ornamenten an Türen und Fenstern, wie etwa die in Zeilenbrüche gesetzte Notiz: »Vertrieben bin ich nicht nur aus Florenz/Und aus dem Garten mit den beiden Bäumen/Vertrieben bin ich aus der Welt/Auf der ich lebe, doch nicht mehr in ihr …« Daneben gab es Texte, die an Wohnblöcke erinnerten, etwas Gewaltsames in ihrer Betonfestigkeit hatten oder einem rücksichtslosen Modernismus verpflichtet waren, funktional und hässlich, von einer Verachtung für die Menschen und ihre kleine Beschaulichkeit: »Das Individuum ist mit der Entdeckung des Urknalls, des Big Bang, als Gestalt und gestaltendes Wesen – das noch immer tief in unserer Vorstellung lebt – zersprengt worden. Wir sind zerrissene, entwertete Ichs. Wie in der Renaissance die Himmlischen an den Horizont des Universums, so sind wir an die Ränder von Bildschirmen versetzt, von denen aus wir hinab in »unsere« Welt sehen, hoffend, uns als elektronisch hochaufgelöste Bilder in einer Vorabend-Soap wiederzufinden.«
Ich las die Notiz voller Skepsis. Sie bestand aus verbaler Kraftmeierei, und die war mir aus meiner Studentenzeit bestens vertraut. Bei abendlichen Diskursen zielten kunsttheoretische oder kulturpolitische Tiraden einzig darauf ab, jemanden in der Runde zu verunsichern, ihm sein mangelhaftes Wissen vorzuführen, während man selbst mit Kenntnissen brillierte: Wir nannten dieses Spiel »einen Kollegen verblöden«. Doch was mich an diesem kruden Büchlein dann tatsächlich verblüffte, war die Widmung. Auf der Titelseite, in einer schwungvollen, mit Füllfeder geschrieben Schrift, stand: Für Clemens Lang vom Autor. Dazu war das Datum gesetzt, an dem der Kongress am »Institute for Contemporary and Colonial Studies ICCS« beginnen sollte.
VIFLUG IN DIE NACHT
Aus dem Lautsprecher tönte ein melodiöses, doch befehlendes immediate boarding. Ich tippte an der Telefonsäule nochmals die Nummer von Sarahs Büro ein, verwählte mich, versuchte es erneut, hörte auf das Summen, das nicht unterbrochen wurde, während bereits ein dringlicherer Aufruf folgte: Mr. Lang, please, Mr. Lang! Ich hängte den Hörer ein, packte meine Fototasche, lief los, den Rucksack am Rücken, rannte den Flur hinunter, an den Schaukästen vorbei zum Gate. We are just waiting for you, Mr. Lang, und die Luft in der Gangway war kalt und feucht, die Tür des Jets ein sphärisch gebogener, an den Ecken gerundeter Eingang in eine Höhle aus Technik. Ich bückte mich, schob mich durch die bereits besetzten Reihen, die Fototasche vor den Knien, quetschte mich in meinen Sitz. Ich war erleichtert, als Nachbarn einen älteren, schlanken Herrn zu haben, der mich an mein einstiges Vorbild erinnerte, einen damals noch weitgehend in seiner Bedeutung verkannten Fotografen. Dieser hatte gegenüber dem Zimmer, das ich nach dem Studium bewohnte, sein Atelier im Souterrain eines Wohnblocks, und ich sah die hochgewachsene, schlanke Gestalt in hellem Anzug, den Hut auf dem Kopf, fast täglich den Weg entlang zu seiner Tür gehen. Der Gang und die Haltung waren von vornehmer Eleganz, doch in ihnen verbarg sich eine Schüchternheit, die man erst bei näherer Bekanntschaft entdeckte. Sie galt weniger den Menschen als den Dingen gegenüber, die er anschaute: diese feinstofflichste Art, sich den Erscheinungen zu nähern. Eingepfercht in meinen Sitz, neben dem Herrn, der einen Laptop vor sich auf den Knien hielt, dachte ich an die Besuche im Kelleratelier, in das kaum Tageslicht fiel, in dem ein Kronleuchter sein Licht über das Bett, einen Wandspiegel mit Goldrahmen und die Staffelei ausstreute – eine Art Dunkelkammer, die der Alte bewohnte, von theatralischer, auch vergangener Einrichtung: Der Schrank in meinem Arbeitszimmer, die Mappen wie auch der Leuchter sind Zeichen der Wertschätzung für diesen großen Fotografen, der durch seine Themen – die verschwindende bäuerliche Welt, der Alltag in den Labors von Industriebetrieben, die Ballnächte der besseren Gesellschaft – mich erstmals auf meine eigene Familiengeschichte aufmerksam gemacht hatte.
Die Fototasche war unter dem Sitz verstaut, den Rucksack jedoch, für den kein Platz mehr in der Ablage gewesen war, hatte ich einer Stewardess gegeben. Als sich die Maschine bereits im Steigflug befand, fiel mir meine Lektüre ein, die ich vergessen hatte, aus dem Rucksack zu nehmen. Das Personal würde nach dem Erlöschen des Signals mit dem Servieren der Getränke beginnen und hätte dann bestimmt keine Zeit, Gepäckstücke hervorzusuchen.
– Es bleibt Ihnen ja noch das kleine Buch in der Rocktasche.
Mein Sitznachbar, den Laptop auf den Knien, sah bei der Bemerkung auf die Lehne des Vordersitzes, als wäre er ganz auf den Steigflug konzentriert.
– Ich gebe allerdings zu, es ist keine sehr erbauliche Lektüre.
– Ich hätte mir denken können, dass Sie es sind, schon als ich mich an den alten Fotografen erinnert fühlte.
– Sie haben es sich selbst zuzuschreiben, wenn Sie mich verwechseln. Sie hängen noch an Unterscheidungen und begreifen den Wandel nicht, der durch alle Erscheinungen fließt, manchmal in einer ihnen bekannt scheinenden Figur kurz zur Ruhe kommt. Eine Frage der Zeit.
Ein halb boshaftes, halb von Wehmut gezeichnetes Lächeln spaltete sein Gesicht in eine melancholische und eine eingekniffene Hälfte, in der das Auge schmal, der Blick scharf wie ein Skalpell war.
Als wäre »Zeit« ein weiteres Stichwort gewesen, erlosch das Signal, angeschnallt zu bleiben, mit einem Klang, und Bewegung kam in die Reihen der Passagiere.
Ich zog die Schnalle auf und war einen Moment lang von dem Gefühl angerührt, erst jetzt wirklich unterwegs zu sein, ohne Rückhalt, allein auf mich gestellt.
– Ach, es findet sich immer jemand, der uns ein Stück begleitet, sagte mein Nachbar, als wolle er mich trösten, und erstmals fiel mir auf, dass der Fremde mit einem leicht wienerischen Akzent sprach.
– Ich weiß nicht, habe ich schon erwähnt, dass ich zu Ihrer angelegentlichen Begleitung bestellt worden bin?
Er klappte den Laptop auf, und der erneute Klang signalisierte nun einen Start, der ein schwarzes Rechteck zu einem leuchtenden Raum öffnete. Er habe sich ein Leben lang mit Kulturgeschichte beschäftigt, sagte der Causeur, dieser seltsamen Menschheitserzählung, die wir nie ganz verstünden und an deren Ende die unfassbare Gegenwart stehe, die ihr Ergebnis und zugleich der Ausgangspunkt künftiger Geschehnisse sei.
– Sie kommentierend zu durcheilen, war mein Vergnügen, gleichzeitig aber auch mein Leiden. Ich las sie als eine zunehmende Verdunkelung. Zumindest seit Ende der Renaissance, wo nach der mittelalterlichen ›göttlichen Komödie‹ die neuzeitliche ›menschliche Tragödie‹ folgte, über die nachzudenken ich ein Leben verwendet habe.
Ich überlegte mir, ob ich das Büchlein mehr aus Höflichkeit denn aus Interesse hervorziehen sollte. Die Vorstellung jedoch, unter den Blicken des Autors – dafür hielt ich den Causeur – in den Notaten zu lesen, war mir so unangenehm, dass ich dagegen eine körperliche Abneigung verspürte, als käme mir der Fremde zu nahe, träte in meine Regungen und Gedanken ein.
– Lassen Sie es nur bleiben, sagte dieser, während er sich durch die Dateien klickte, ich nehme es Ihnen nicht übel. Das »Buch der Halbwahrheiten« soll weniger ein Vergnügen als eine Art »letzte Hilfe« sein, ein Reiseführer der etwas anderen Art.
Er stieß ein amüsiertes Grunzen aus, zog aus einem Lederetui eine lange, schmale Zigarre, kniff das linke Auge ein, als ich ihn auf das Rauchverbot aufmerksam machen wollte. Mit der Zigarrenspitze deutete er auf den Steward, der eben den Gang entlangkam, mir eine Zeitung mit den Worten reichte: – Daran haben Sie doch eben als Ersatzlektüre gedacht?, sich dann zu meinem Sitznachbarn neigte und in unterwürfiger Vertrautheit fragte, ob er einen ersten Whisky bringen dürfe.
– Sie sehen, kein Grund zur Aufregung. Ich konnte mir das Rauchen nie abgewöhnen. Die Zigarren gehören für mich zur Sprache, sind ihr Geschmack und ihre Würze. Ich hätte auch von den Wörtern lassen müssen, um vom Rauchen loszukommen. Doch dann säße ich nicht hier. Nach dem finalen Ereignis jeden Lebens, das eigentlich auch einen Causeur zum Schweigen bringen müsste, verhelfen mir einzig die Wörter noch zu einem zeitweiligen Dasein – –.
Er hielt den letzten Satz in einer bedauernden Schwebe, während er mich mit einem spöttischen Blick ansah, als wäre auch diese Bemerkung nur eine Halbwahrheit, ausgesprochen zur Verwirrung des Jüngeren, der nicht über die Gegenwart hinaussehen konnte und von dem, was ihn auf der Reise erwartete, keine Ahnung hatte. Dann wandte er sich ab, beugte sich entschieden über seinen Laptop und schaute sich irgendeine Eröffnungszeremonie in einem Stadion an, als wolle er in die Szene hineinschlüpfen, in der ein kugelrunder Moderator in buntem Kostüm wie ein Ball über die Bühne hüpfte.
VIITEN MINUTES MORE
Die Ankunftshalle war nicht der verlassene Ort, den anzutreffen ich befürchtet hatte. Ein Gedränge von Reisenden nahm mich auf, schob mich vorwärts. Träger manövrierten Schubkarren mit Gepäckstücken, Beamte in Uniform, Schlagstöcke an der Seite, suchten mit stumpfer Gleichgültigkeit die Masse zu lenken, und über all den angestrengten Gesichtern, öligen Scheiteln, Hüten, Kappen und Kopftüchern schwebte ein Lärm aus Stimmen und Rufen, durchstoßen von den Ansagen aus Lautsprechern, von Ermahnungen, keine fremden Gegenstände entgegenzunehmen, und dem in regelmäßigen Abständen von einer sanften Männerstimme verkündeten: This is a non-smoking area. Einen Moment blieb ich überwältigt inmitten der Turbulenzen stehen, verwirrt von der Menge an Menschen, die mich umdrängte. Ich sah nach der Uhr, die hoch in der Halle angebracht war, mit elektronisch zuckendem Sekundenzeiger die Minute kürzte und mir die gültige Ortszeit anzeigte: Zehn Minuten vor zwei Uhr am Morgen.
Meinen »Begleiter«, der lediglich mit einer Tasche reiste, hatte ich bereits bei der Gepäckausgabe verloren. Ich sah ihn zwar kurz noch, wie er bereits am Ende der Halle an der Schlange Wartender vorbeiging, die Einreiseschalter ohne Kontrolle passierte, begleitet vom Steward, der seine Tasche trug. Bevor er durch den Ausgang verschwand, glaubte ich noch seine Hand zu sehen, die mit der von mir zurückgelassenen Zeitung einen Gruß zuwinkte.
Ich hatte mich während des Flugs mit dem Gedanken beruhigt, der Causeur würde bei der Ankunft bestimmt behilflich sein, meine Unterkunft zu finden, sollte mich tatsächlich niemand mehr erwarten. Nun stand ich allein da, spürte, wie die belebend heitere Ausstrahlung dieses seltsamen Fremden erlosch. Schwere und Müdigkeit breiteten sich in mir aus, und es brauchte einen inneren Rempler, dass ich mich wieder in Bewegung setzte. Die Schiebetür am Ausgang der Flughafenhalle entließ mich endgültig aus dem durch Linienflüge verbundenen Netz hochtechnisierter Sphären – und das Dunkel schlug mir mit einer ungewohnten Wärme entgegen. Es war erfüllt von einem rußig rostigen Geruch, und trüb strahlten die wenigen Lichter.
Ich zögerte, verlangsamte die Schritte. Hinter einer Schranke drängte sich eine Menge von Leuten. Hände umklammerten die rostigen Eisenstangen, und als ich näher trat, beladen mit meinen Gepäckstücken, fühlte ich auf mir die Blicke, die ohne Anteilnahme prüften, wer aus der erleuchteten Halle kam. Ich spähte nach den hochgehaltenen Schildern, ging in meiner winterlichen Kleidung vor diesen Gesichtern auf und ab, hoffte, meinen Namen auf einer der Tafeln zu lesen: Clemens Lang, photographer – Buchstaben, die dafür standen, dass ich zu der für mich reservierten Unterkunft gebracht würde. Als ich das Schild mit meinem Namen abseits der Menge endlich entdeckte, war ich von Erleichterung überwältigt, drängte mich unverzüglich zu dem hageren, schon älteren Mann durch.