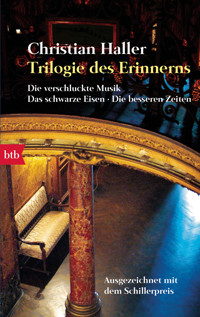4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben mit neuen Augen sehen
Tempo, Geschwindigkeit und rastloses Tun, die Wesensmerkmale des modernen Lebens, lassen uns zusehends blind werden für die Schönheit des Seins. Dafür, was eigentlich zählt im Leben. Christian Haller macht sich in diesem Buch auf den Weg, das Leben zu entdecken, das unter der täglichen Unrast begraben liegt: Ein Leben, das seine eigene, uns unbekannt gewordene Schönheit und Wahrheit besitzt...
Was geschieht, wenn jemand keinen Terminkalender führen und nicht erst sein Smartphone hinzuziehen muss, bevor er sich mit einem Freund verabreden kann? Eine Katastrophe? Ein Chaos aus verpassten Terminen? Dabei geht die Welt vielleicht gar nicht unter, wenn jemand nicht über Wochen hinaus verplant ist und wie Christian Haller aus dem Strom der alltäglichen Verrichtungen heraustritt. Die Zeit beginnt sich nämlich für ihn zu dehnen, sie erlaubt ihm, sich umzusehen und sich wie der große Vladimir Nabokov, der, mit einem Netz ausgerüstet, auf die Jagd nach Schmetterlingen ging, mit dem vermeintlich Nutzlosen zu beschäftigen. Er lernt Umwege lieben, freut sich über unspektakuläre Erlebnisse wie eine Fahrradfahrt durch einen Park oder ist vollkommen verblüfft, dass er eine Landschaft, von der er überzeugt ist, sie gut zu kennen, mit neuen Augen sieht. Überhaupt wird er den lange verweilenden Blick schätzen lernen. Dieser Blick bringt ihm die Schönheit von Gegenständen und unverbrauchte Momente näher – er lehrt ihn ein Leben, das keinem Zweck unterstellt ist; ein Leben, das gerade deswegen seine geheime Pracht entfalten kann, weil es zu nichts gut sein muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2010 Luchterhand Literaturverlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Satz: DTP im Verlag
ISBN 978-3-641-05210-2V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
Inhaltsverzeichnis
VOLL AM ROTIERENoder die beschleunigte Welt
Kürzlich saß ich mit einer Gruppe von Leuten zusammen, die versuchte, einen gemeinsamen Termin zu finden. Vier blätterten in der Agenda, einer tippte auf dem Smartphone, jemand rief: — Der 22.! Alle schüttelten die Köpfe, alle wendeten die Seite (wie das bei einem Smartphone geht, weiß ich nicht), ein anderes Datum, ein erneutes Kopfschütteln, es wurde spät am Abend und noch später in der Agenda, dem Frühjahr folgte der Frühsommer, danach waren sowieso alle in den Ferien, und man beschloss, sich per E-Mail weiter zu unterhalten.
»Das Leben ist der Narr der Zeit, und Zeit muss enden«, so steht es bei Shakespeare. Doch bis es so weit ist, dass sie endet und mit ihr unser Leben, haben wir keine Zeit – und danach gibt es sie eh nicht mehr.
Meine Sammlung von Agenden beginnt 1975, und obschon ich damals an einem Institut gearbeitet habe, das internationale Kongresse organisierte, gibt es in dem damaligen Terminkalender erstaunlich wenige Einträge. Da ein Treffen, dort eine Sitzung, doch kein Vergleich zu heute, wo ich nirgends angestellt bin und schon gar nichts organisiere.
Ein Freund, den ich nach langer Zeit wiedersehen wollte, sagte erfreut, genau das wünsche er sich auch. Im übernächsten Monat hätte er gut Zeit, da könne er noch zwei Stunden an einem Dienstag eintragen.
Mein Großvater, der Direktor eines Stahlwerks war, hatte keine Agenda. Und doch begann zu seiner Zeit das, was Musils »Mann ohne Eigenschaften« den Akzelerismus nannte, die zunehmende Beschleunigung des Alltags, des Lebens überhaupt. Tempo galt als chic, als modern. Es war Ausdruck des städtischen Lebensgefühls, und Walter Mehring konnte in den zwanziger Jahren dichten: »Die Großstadt schreit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit!« Obschon es damals – im Vergleich zu heute — noch unendlich viel Zeit gab, das rasende Tempo erst bei fünfzig Stundenkilometern lag und der Rausch der Geschwindigkeit noch in den Anfängen der Sucht steckte. Doch wer auf sich hielt, unternahm eine Studienreise dorthin, wo die Beschleunigung um eine Größenordnung höher getaktet war als in Europa, fuhr mit dem Dampfschiff in jenes »Land der unbegrenzten Möglichkeiten«, in dem Chaplin die verborgene Komik der »Modern Times«, aber auch ihre Unmenschlichkeit, bereits erkannt hatte. Unternehmer, Architekten, Ingenieure jedoch standen bewundernd vor den Industrieanlagen, die groß, gleichförmig und komplett mechanisiert waren, Massenartikel vom Fließband spuckten: Automobile, Büromaschinen, Rasierklingen.
Dort gab es auch die entsprechenden Theorien zur Zeit-, Raum- und Geldersparnis. Dass Zeit Geld sei, diese Gleichsetzung war allerdings ein alter Hut, sie war schon von Franklin Mitte des 18. Jahrhunderts gemacht worden und klang wie ein Gassenhauer in den Köpfen braver Kaufleute. Nun aber »rockte« eine Mechanisierung, die dank der Technik und der Elektrizität einen härteren »Beat« schlug. Die Songtexte klangen denn auch mehr nach Befehlen als nach einem Liebeslied: Organisation, Präzision, Rationalisierung, Standardisierung, Normierung, Produktivitätssteigerung. Der Mechanisierung folgte die Automatisierung, der Automatisierung die Computerisierung, und nur der Mensch blieb irgendwie das alte Modell, urtümlich hergestellt, mit einem biologischen Chassis, einer psychischen Steuerung und einer nicht mehr ganz stimmigen Anpassung an die von ihm selbst geschaffene Welt.
Hier habe ich nun eine entsprechende Theorie, wie Leben und Beschleunigung zusammenpassen:
Nachdem die Erde für Jahrtausende als eine Scheibe betrachtet worden ist, hat man sie nach einer kurzen Kugelphase wiederum zu einer Scheibe gemacht, jetzt allerdings zu einer global-ökonomischen, unter Beibehaltung der Rotation. In gut demokratischer Tradition dürfen alle, ob Länder oder Individuen, am gleichen Punkt beginnen: in der Mitte nämlich, am Achspunkt. Einzig die entwickeltste und beschleunigtste Volkswirtschaft gibt das Tempo vor. Klar ist, dass, wer keine Eigenrotation mitbringt, sofort »die Mitte« verliert und zentrifugal wegrutscht. Entwicklungsländer etwa oder behinderte Menschen. Eigene Drehung ist also Voraussetzung. Schulen sind deshalb notwendige Anstalten, um Kinder in eine möglichst hohe Rotation zu versetzen. Nur rotierend lässt sich die Mitte halten. So sagt es auch die Alltagssprache: »Ich bin voll am Rotieren«, und das meint, ich bin mitten im Leben, im Zentrum der Geschehnisse, und »es läuft wie geschmiert«. Doch früher oder später setzen die Trägheitsgesetze ein, reibt man sich, verliert an Tempo, wird nach außen abgedrängt, wo das Gefühl einer Beschleunigung sich paradoxerweise noch verstärkt –und es gibt kein Halten mehr.
Das Leben ist der Narr der Zeit — ja, und es hat sein eigenes langsames Vorankommen, das des Wachsens. Muße war das vornehmste Gut des Menschen, ihm als Einziges mit auf den Weg gegeben. Von diesem Gut haben wir nichts mehr, wir haben dafür Waren – und eben keine Zeit. Wie mein Freund. Oder hat er nur keine Zeit, weil ihm unsere Begegnung in der Fülle der Angebote doch nicht wichtig genug ist? Dann hätte ich an jenem Nachmittag im übernächsten Monat zwar Zeit, doch dafür einen Freund verloren.
GADGETSDER SEELEoder mir wird ein Licht aufgesteckt
Im Fenster war Nacht, die Lampe brannte, beschien den Arbeitstisch, ein Regal mit Büchern, und wir sahen auf einen Bildschirm von großem Format. Der Graphiker erklärte mir die Farbabstimmungen, die er an dem Plakat vorgenommen hatte: eine Photoblende, in deren Öffnung eine alte Stadtansicht abgebildet war. Dieser Ausschnitt leuchtete aus der Vergangenheit in die Gegenwart hinein, hatte auf dem Bildschirm eine Brillanz, die das Haus, das Ladengeschäft, die Reklametafeln mit Stumpen und Waschmitteln wohl nie gehabt hatten. Der Graphiker sprach von Duplex und Druckverfahren, kam immer wieder auf die Linien zu sprechen, welche die Segmente der in Schwarz dargestellten Blende unterteilten. Er habe an diesen feinsten Strichen »lange getüftelt«, wie er immer wieder betonte, und da ich nicht genügend Begeisterung für die Komplexität dieser einfachen Linien äußerte, zog er ein Heft heran. Er wies mich auf ein Hochglanzinserat mit einer geschwungenen rötlichen Linie in tiefem Schwarz hin, sagte mit genießerischer Bewunderung, die Linie sei »beinahe ideal«, doch würde dies auch »ein totaler Luxus an Druck« sein. Während er über die benutzten Techniken spekulierte, wurde mir klar, dass nicht nur das, was in dem Heft abgebildet war, nämlich Uhren, Schmuck, Modekostüme, Hotelsuiten und Gadgets, der reine Luxus waren, sondern auch das Verfahren, in dem dieser Luxus mir präsentiert wurde. Meine Augen würden folglich gleich doppelt »verwöhnt«. Einerseits durch das, was abgebildet ist, und andererseits durch die Art, wie es abgebildet ist. Eine versteckte »Überkostbarkeit«! Und während der Graphiker sich so begeistert über das Hochglanzinserat beugte, schaltete sich hinter seinem Rücken der Bildschirmschoner ein: Photos meines Wohnortes wechselten sich ab, zeigten Ansichten von Gärten, dem Ufer und dem Fluss, von den Gassen des Städtchens — und auch sie waren durch das hinterleuchtende Licht von einer Brillanz, dass mir der Gedanke nicht abwegig schien, mein Lesezimmer im Altstadthaus ließe sich leicht tageweise für teures Geld vermieten, ohne Frühstück versteht sich, dafür mit freier Benutzung aller Bücher, die selbstverfassten mit eingeschlossen.
Doch als ich später nach Hause ging, waren die Gassen dunkel, opak die Mauern, von Sickerwasser geschwärzt der Schwarzwaldgneis, der überall hervordrängt. Nicht einmal die Straßenleuchte — Sparlampe, wie es sich gehört — gab ein wenig Glanz. Ernüchtert stieg ich zu meinem Lesezimmer hoch, gewiss, die Bücher alle selber lesen zu müssen, doch mit der Frage beschäftigt, ob ich vielleicht wegen meiner luxusverwöhnten Augen unfähig geworden sei, die Schönheiten von Gassen, Gärten und Ufern noch wahrzunehmen. Sie sind eben nicht brillant hinterleuchtet wie auf einem Bildschirm, keine Gadgets der Seele, sondern bestenfalls von diesem alten Himmelsmöbel angeleuchtet, der Sonne, die irgendeiner da oben hingehängt hat.
Ich rief am nächsten Tag meine rumänische Freundin an, die zur Zeit einen Stipendienaufenthalt in der Schweiz verbringt, um nachzufragen, wie sie sich eingelebt habe: — Wundervoll, sagte sie, ich bin ganz verliebt in die Landschaft, und dieses Wetter! So prachtvoll. Ich bin überzeugt, es ist nur so phantastisch schön, weil ich hierhergekommen bin, es kann gar nicht anders sein! Überflüssig zu sagen, dass meine Freundin eine Dichterin ist. Und ihre überschwängliche Freude darüber, dass selbst das unbeständige Wetter so wunderbar ist, weil sie da ist, hat meine Augen von allen Linien, Druckverfahren, Hinterleuchtungen und »Überkostbarkeiten« auf einen Schlag befreit. Ich sah durchs Fenster ins Februarlicht, wurde mir dieses klaren, hellen Lichts bewusst, das in sich schon das Steigen des Jahres trägt und doch noch so winterlich ist, leicht und flüssig die Luft erfüllt. Kein Laub und Grün hält es auf, kein Schatten dunkelt es ab, ungehindert dringt es durch die Zweige, bringt die Brauntöne in so großen Nuancen hervor. Ja, ich musste und wollte hinaus, wanderte am Fluss dem Schilf und alten Bäumen entlang, kam zu einem Stauwehr, blickte lange auf die ruhige Fläche, gleißend von der tiefstehenden Sonne. Dann wandte ich den Blick flussabwärts, sah in Wasserläufe, von Uferbäumen eingefasst, und unter dem Band lichtflüssigen Himmels lagen Inseln, Kiesbänke, von Weiden, Büschen, Gras und Schwemmholz bedeckt. Jedoch das Licht, dieses tiefstehende Februarlicht, bewirkte, dass die Äste und Zweige, die Rundungen der Kiesel, die Stämme und filigranen Wimpel des Schilfs von einer gestochenen Schärfe waren. Und ich stand und staunte: diese Feinheit der Linien, diese Transparenz der Farbtöne, diese nicht fassbare Schönheit einer ganz gewöhnlichen Uferlandschaft! Ist sie nur da, weil ich da bin, wie meine rumänische Freundin meinte? Ich werde den Uferstreif in der Erinnerung behalten, wenigsten bis zu den nächsten Nebeltagen, an denen ich mich fluchend wieder über die »Schöneren Seiten« beuge, mich in die Werbebilder hineinträume, in ein hinterleuchtetes Leben, das eine Breitling am Arm trägt und vierfarbigen Duplexdruck auf den Augen hat.
Doch auch dann wird es vor meinem Fenster einen kleinen, unscheinbaren Gesang geben: tidi tidi tidi tidi – einmal vier und einmal fünf. Diese wunderbar insistenten Rufe der Meisen. Laute, die wie feinste Linien an Schilf und Uferbäumen sind, wenn das Licht tief steht.
DIE STECKNADELN DES HERRN NABOKOVoder ein Versuch, dem Unscheinbaren gerecht zu werden
Vladimir Nabokov, einer der großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, war ein leidenschaftlicher Sammler von Schmetterlingen, die er sich mit dem Netz aus der Luft fing. An diesen Wesen, so leicht und flüchtig wie ein Farb- und Lichtspiel, erstaunt, ja mutet unglaubhaft an, dass es aus einem so katastrophalen Wanst entstanden sein soll, der die Raupe nun einmal ist: ein Darm mit viel Füßen.
Nabokov mag an den Schmetterlingen die Vielfalt der Muster und ihrer Farben fasziniert haben. Sie sind »zwecklos«, um ihrer selbst willen da, eine Schönheit, die sich mit Nützlichkeit nicht wirklich erklären lässt. Und wenn der eine oder andere Leser seiner Werke finden sollte, es sei für einen Schriftsteller gleichwohl ein seltsames Vergnügen, diese Wunderwesen aus der Luft zu fangen, sie womöglich in einem Kasten aufzuspießen, so mag er bedenken, dass Herr Nabokov auch mit dem Netz der Wörter nichts anderes getan hat, als unser flüchtiges Dasein aus dem Licht in die Sprache zu bringen, es über den Tag hinaus in Farbe und Form festzuhalten.