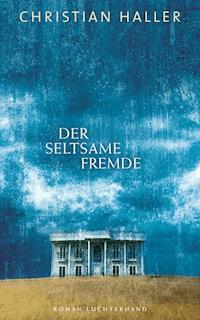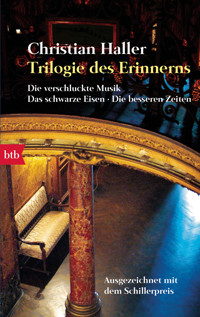
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hallers preisgekrönte Romantrilogie erstmals in einem Band
Christian Haller erzählt in seiner „Trilogie des Erinnerns“ von einer Schweizer Industriellen-Dynastie und dem zögernden Heranwachsen eines Autors aus dieser Familie, der Jahre später die Geschichte dieser Familie schreibt: aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vom eleganten Leben in Bukarest bis hin zu dem kargen Leben in der Schweizer Provinz, die langsam aber unaufhaltsam von einem neuen Wohlstand hinweggespült wurde.
Eine Romanfolge, die „zu den bemerkenswertesten Werken des vergangenen Jahrzehnts“ (Literarische Welt) gehört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 885
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Schweiz in den zwanziger, in den dreißiger und in den fünfziger Jahren: In seinen Romanen »Die verschluckte Musik«, »Das schwarze Eisen« und »Die besseren Jahre« erzählt Christian Haller auf faszinierende Weise von den Brüchen im Leben einer Familie im 20. Jahrhundert: Die Geschichte einer jungen Frau, die mit ihren Eltern das mondäne Bukarest verlassen und sich in der Schweiz ansiedeln muss. Die Geschichte des Großvaters, der sich aus armen Verhältnissen hocharbeitete und zu einem führenden Industriellen wird. Und schließlich die Geschichte eines begabten Verkäufers, des ewigen Sohnes in der Familie, der in der neuen Zeit nach 1945 nicht wieder richtig Fuß fassen und seinen Platz in der Gesellschaft verteidigen kann. Drei Romane, geschrieben aus jeweils einer anderen Perspektive, über die in der »Literarischen Welt« geurteilt wurde: »Christian Hallers Trilogie ist – auch wegen seiner überaus sinnlichen Darstellungsweise – ein zentraler Beitrag zu unserer Erinnerungskultur.«
CHRISTIAN HALLER wurde 1943 in Brugg, Schweiz, geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb-Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u.a. mit dem Aargauer Literaturpreis (2006), dem Schillerpreis (2007) und dem Kunstpreis des Kantons Aargau (2015) ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der abschließende Teil seiner autobiografischen Trilogie erschienen: »Flussabwärts gegen den Strom«. Er lebt als Schriftsteller in Laufenburg.
CHRISTIAN HALLER BEI BTB Im Park. Roman (74230) Der seltsame Fremde. Roman (74853) Das unaufhaltsame Fließen. Roman (71829) Die verschluckte Musik. Roman (77033)
Christian Haller
Die verschluckte Musik
Das schwarze Eisen
Die besseren Zeiten
Trilogie des Erinnerns
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Genehmigte Taschenbuchausgabe Februar 2008, btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © Die verschluckte Musik, 2001,
Das schwarze Eisen, 2004, und Die besseren Zeiten, 2006.
Alle drei Bände: Luchterhand Literaturverlag, München, ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Umschlaggestaltung: Design Team München unter Verwendung eines Motivs von © Ilja C. Hendel / visum creative
Satz: Filmsatz Schröter, München
Druck und Einband: GGP Media GmbH, Pößneck
cb · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-33173-3V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Die verschluckte Musik
Die Gegenwart ist unser Leben.falsch daher jedes Strebenund Warten auf die goldene Zeit,die keinem Menschen je erscheint.
Wappenspruch der S. zu Köln, an den sich keiner der Familie auch nur einen Moment lang gehalten hat.
Für meine Mutter
I
ICH SEHE SIE NICHT ...
– Es schwankt, sagte Madame S., stand wie festgewurzelt am oberen Ende des Stegs, die Hand auf das Bruststück des Leinenkostüms gelegt, den Schatten des breitkrempigen Hutes über den Augen. Ihr Blick war hart und starr, als hätte sich Großmama in ebendem Moment trotzig gegen jegliche Bewegung entschieden, ein Protest gegen die unsicheren, schwankenden Lebensumstände, die zu Schiffsreisen führten, einem »Geschaukel«, wie sie vorausgesagt hatte, und jetzt durch das Scheuern des Schiffbords am Holz der Landungsstelle bestätigt sah.
– Ja, es schwankt, sagte der Herr im schattendunklen Anzug, den Hut steif auf das schmale Gesicht gesetzt, das mit der Spitze seines Kinns auf den Flügeln des Vatermörders balancierte. Ja, es schwankt, sagt der Herr, der mein Großpapa werden würde, doch das wird sich geben. Und er sagte es leise, wie es seine Art war, ohne die weichen, sinnlichen Lippen, die ein blonder Schnauzbart vermännlichte, allzu sehr zu bewegen, doch in einem Ton, der erst fein und zögerlich einen Faden Resignation mitspann. Er neigte sich vor, fasste den Griff des Koffers, der aus einem dicken Rindsleder genäht war und zwei Messingschlösser besaß, ein breiter, aber nicht allzu großer Koffer, und Großpapa hob ihn vermutlich in dieser ergebenen und entschlossenen Art auf, die ich später – sehr viel später – noch oft sehen sollte.
Als hätte man Gelbfolie vor die Scheinwerfer geklemmt, um nostalgische Gefühle zu wecken und mich in eine Epoche zu versetzen, die Jahrzehnte zurückliegt: Vielleicht habe ich deshalb bei meinem Besuch im Hafengebäude von Dhaka das Empfinden gehabt, mich in einer verfilmten Vergangenheit zu bewegen. Der Widerschein der Sonnenflecken, die hellgeschnittenen Flussbilder der Ausgänge, die hallenden Geräusche erfüllten den Raum mit einer Atmosphäre, die mir das Einschiffen der Familie S. so unerwartet vergegenwärtigte, als wäre ich unversehens zu deren Begleiter geworden, wobei ich gestehen muss, zu diesem Zeitpunkt noch nie in Rumänien gewesen zu sein. Doch dieses Licht in Sadarghatt, dem Flusshafen an der Buriganga, erinnerte mich so sehr an die Erzählungen meiner Mutter, dass ich die Gebäulichkeit ganz selbstverständlich in meine eigenen Vorstellungen übernahm und sie mir – wie bei Filmen üblich – von dem sehr viel südlicheren Lande auslieh, von Bangladesh, um genau zu sein, und die gesamte Anlage nach Giurgiu an die Donau verlegte. Ich tat es mit der plötzlichen Gewissheit eines Wiedererkennens: So muss der Moment damals gewesen sein, als meine Mutter Rumänien, in dem sie aufgewachsen war, für immer verließ.
Das Hafengebäude lag langgestreckt am Ufer, durch die Straße von den Lagerschuppen und den Geschäften der Händler getrennt, ein geradliniger, schnörkelloser Bau, der in der Sonne leuchtete, wie die endlosen Kornfelder, durch die meine Großeltern mit Tochter und Sohn von Bukarest nach Giurgiu gefahren waren. Drei Stufen führten aus dem Gedränge der Straße zu den Zugängen der Halle, vor denen Drehkreuze angebracht waren und Zutrittskarten verkauft wurden. Gierig schluckten die Hände das Geld von den speckigen Tischplatten, schoben einen Kupon hin, der zum Aufenthalt im Hafengebäude berechtigte, und ein weiterer Passant rückte in der Reihe wartender Händler und Reisender vor.
Großpapa legte den Geldschein für sich und seine Familie mit der ihm eigenen Langsamkeit und Sorgfalt vor den Kontrolleur hin, durch nichts würde er sich hetzen lassen, was nur zu unbedachter Fahrigkeit führen konnte und seiner innersten Lebensform, der Vornehmheit, widersprach.
Nachdem er sein Portefeuille in die Bauchbinde zurückgeschoben hatte, trat er einen Schritt beiseite, ließ zuerst Ruth, dann Curt und Großmama passieren, nahm den Koffer auf, schob ihn unter dem Gestänge durch, und nachdem er sich aufgerichtet, den Zwicker mit dieser kurzen, doch energischen Geste festgedrückt hatte, legte er die Hand auf den eisernen Balken des Drehkreuzes, schob ihn ein Viertel der Umdrehung – besiegelt vom vertieften Wappen seines Rings – weiter: Man schrieb das Jahr 1926, die Familie S. verließ Rumänien endgültig, keiner von ihnen sollte es je wiedersehen, und Großpapa hatte beschlossen, diesmal die Reise gemächlich, in der entsprechenden gesellschaftlichen Ambience und auch mit Vergnügen zu tun, zu Schiff nämlich, von Giurgiu auf der Donau bis Wien. Bedachtsam wollte man sich der Schweiz nähern und in einer Art, die, bei aller künftigen Ungewissheit, keinen Zweifel an der gesellschaftlichen Zugehörigkeit offenließ.
Und in der verfilmten Vergangenheit, durch die ich selbst mich bewege, betritt die Familie S. das Hafengebäude, einen zum Dach hin offenen, fensterlosen Raum, in dem sich auf Seite des Stroms ein Gitter aus Mauerwerk entlang der Decke zieht, rautenförmige Öffnungen, durch die das Sonnenlicht einfällt, gleißende, flüssige Flecken auf den Steinboden und die Wand wirft und die staubige Luft mit blauen Bändern schraffiert. Nach dem Lärm der Straße ist es in der Halle beinahe still. Einzelne Klangbrocken hallen von den Wänden, was dem Raum eine ungerechtfertigte Würde gibt. In der Mittelachse sind Bänke in regelmäßigen Abständen angebracht, die von nur wenigen Reisenden besetzt sind, während auf ausgebreiteten Decken Gruppen von Menschen kauern, die Frauen mit Kopftüchern, die Männer in Pluderhosen, umgeben von Körben. Diese Leute reisen, so wenigstens ist anzunehmen, weil die Umstände, die Not und Armut, sie weitertreiben, und der Herr, der in dunklem Anzug, den Strohhut auf dem Kopf, eben an einer der Gruppen ausgemergelter Gesichter vorbeigeht, ohne sie zu beachten, könnte durchaus etwas über das Zwiespältige des Reisens beitragen, wäre er nicht fest entschlossen, es diesmal einseitig und fraglos als Vergnügen zu sehen, obschon auch er nicht freiwillig fährt. Er schreitet, den Koffer in der Hand, seitlich hinter Großmama und den Kindern her durch die Halle, an deren Ende der Ausgang zum Steg leuchtet, der hinunter zur Anlegestelle führt, ein helles Viereck Tag.
Der Strom zog gemächlich in die Ebene hinein, und das dunstige Nachmittagslicht legte einen Schimmer aufs Wasser, der die Oberfläche beruhigte, beinahe verfestigte und eine metallische Drohung in die erdige Umgebung legte, als träte etwas Unerbittliches zutage, ein Stück fettigen Stahls, das an den Winter siebzehn erinnerte. Doch diese Sicht entsprach eher der Wahrnehmung des Herrn S., der seinen goldenen Zwicker zwischen Daumen und Zeigfinger sich panoramisch umzusehen beliebte, während Großmama das nahe Aufquellen der Wassermassen beargwöhnte, die gegenläufigen Strömungen, denen entlang Ketten von Wirbeln sich öffneten; diese unsteten Muster, die sich verändernd, in einem unaufhaltsamen Rhythmus, kurzatmige Wellen ausschickten. Und auch sie empfand eine Unerbittlichkeit, als sie unter der Krempe ihres mit Blumen und einem Schleier geschmückten Conotiers auf den Strom sah. Das Wasser bewegte sich von rechts nach links, von rechts nach links, und sie spürte diese ziehende Strömung in ihrem Kopf, merkte, wie ein Rad unter dem hochgesteckten Haar in Schwung geriet, die sie aufrecht haltende Transmissionsstange in Drehung versetzte und den Magen unter dem Korsett sich heben ließ: Sie bekäme ihre berüchtigten Schwindel, die Schwindel, die eine Gewissheit bestätigten, der sie sich bereits vor der Abreise sicher gewesen war:
– Wir hätten die Eisenbahn nehmen sollen, wie die anderen Male auch.
Doch der Herr, der mein Großpapa werden würde, hatte den Koffer bereits in der Hand und schickte sich eben an, mit den beiden Kindern den Steg zum Schiff hinunterzugehen.
Ich sehe meine Mutter als ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid, eine Schlaufe im strohblonden Haar, sie läuft neben ihren Eltern her, die Beine nackt und gebräunt, die Füße in Sandalen. Sie wird in wenigen Schritten durch den Ausgang hinaus ins diesige Licht des Nachmittags treten, wird für immer und auf eine mir rätselhafte Weise verschwinden, mich in Vermutungen zurücklassen, den Steg – wie ich annehmen muss – hinuntergehen und das sehen, was sie mir so oft erzählt hat: Der Strom, der breit in die Landschaft hineinglitt, die Donau, von der sie gehört hatte, war nicht blau, sie war sandgelb. Und vielleicht ist es wegen dieser naiven Erwartung, die so sehr enttäuscht worden war, dass ich sie als ein Mädchen von fünf oder sechs Jahren sehe, obschon sie damals bei der Abreise aus Rumänien bereits siebzehn und eine junge Dame gewesen ist.
Doch die Fluten waren sandgelb, und Großmama sah unter ihrem Conotier hervor nach dem Schiff, das unter Dampf stand und trotz seiner Größe schwankte, während meine Mutter über das von vielen Händen blanke Geländer aufs Wasser schaute, ihr Bruder Curt die Schritte beschleunigte, getrieben vom Wunsch, in den Maschinenraum hinabzusteigen, dorthin, wo es nach Ruß und öligen Stahlstangen stank, der Feuerschein aufblakte und die Flamme aus dem Ofenloch schoss, wenn der Heizer die Tür aufriss, um die Kohlenbrocken einzuschaufeln. Die Sirene heulte, ein Erzittern und Erschauern lief durch den Schiffsrumpf, Wellen schlugen an die Ufermauer, und Großmama fasste oben am Steg, vor dem schattenhaften Viereck des Ausgangs, den einsamen Entschluss, sogleich, nachdem ihr eleganter Schuh das Deck betreten haben würde, sich in die Kabine zu begeben, um sich hinzulegen und sich für die Dauer der Reise nicht wieder zu erheben. Großpapa, der auf dem Fallreep einen Blick zwischen Mauer und Bordwand auf das Wasser warf und das Gefühl eines schicksalhaften, einzigartigen Momentes hatte, dachte bereits an die Zahlmeisterei und die Fahrkarten. Mit einer Spur Unwillen sagte er zu der schlanken, weißgekleideten Gestalt seiner Tochter, die zögernd ihre Hand aufs Geländer legte:
– Wir sind in Rumänien. Blau ist sie in Wien. Dort ist die Donau blau, nicht in Rumänien.
Blau ist der zweite der pigmentlosen Farbeffekte. Während Weiß von sämtlichen Zellen einer Feder erzeugt werden kann, ist Blau streng begrenzt: Nur die Federäste vermögen diese besondere Strahlenauslese im weißen auffallenden Licht. Dieses Blau ist eines der Wunder des Alltags, vom gleichen Ursprung wie das des Himmels.
Die Farben, die ich benutzt habe, um den Ort der endgültigen Abreise meiner Großeltern zu kolorieren, erinnern mich an meinen alten Universitätslehrer. Sein Büro im ehemaligen Hauptgebäude der Universität, das ich oftmals betreten hatte, lag im zweiten Stockwerk, die Fenster mit Blick auf die Altstadt, und er setzte sich jeweils an den Schreibtisch, vor die Regale mit den Nachschlage- und Standardwerken, der schier endlosen Reihe der Traités zoologiques.
Die Kopfform des Professors hatte mich stets ein wenig überrascht. Der Schädel war langgezogen, knochig und erinnerte mich an eine frühe Menschenspezies. Seine Augen blickten konzentriert in stetig witternder Beobachtung. Er hatte auf den verschiedenen Gebieten der Morphologie gearbeitet, der Gestaltlehre, wie er sie nannte, seine Liebe jedoch gehörte der Feder, diesem »Hautgebilde« der Vögel, das so viel Wunderbares, Widersprüchliches und Unerklärliches ausdrückt: Die Feder war für ihn das sichtbare Zeugnis, dass sich die Lebenserscheinungen nie ganz erklären lassen, aller Forschung zum Trotz.
Und es war während eines unserer Gespräche gewesen, als er den Satz sagte, der mich zu dem Beruf führen sollte, die längst umgefallenen Lebewesen wieder aufzustellen, ihnen Fleisch auf ihre versteinerten Skelette zu dichten und sie in Lebensräume aus Schachtelhalmwäldern zu setzen, die längst als Kohle gebrochen und verfeuert sind: in Fabrikanlagen mit Stahlöfen und Schloten, die ihrerseits unter den Bombenteppichen des Jahrhunderts zur Schuttnagelfluh sedimentierten.
Er sagte:
– Dem Paläontologen ist vertraut, ausgehend von fossilierten Resten – einzelnen Knochenstücken beispielsweise –, das gesamte Skelett und damit die Gestalt zu rekonstruieren. Die Analogie, wie auch die Formverwandtschaft, die eine Entsprechung in der Entstehung hat – was als Homologie bezeichnet wird –, verhelfen ihm zur Anschauung, und es ist eine wunderbare Fähigkeit des menschlichen Geistes, vergleichend, ergänzend und Einzelheiten verknüpfend zu einem Bild von einem Ganzen zu kommen, das selbst so nicht mehr existiert, vielleicht auch nie existiert hat.
Und vor dem Fenster seines Arbeitszimmers flog eine Möwe vorbei, hell aus dem Hintergrund geschnitten durch ihr Weiß, dem ersten der pigmentlosen Farbeffekte: Feinste Luftbläschen, in der Hornsubstanz der Federzellen eingeschlossen, haben die Wirkung, dass alle Strahlenarten des Lichts gleichmäßig vermischt ins Auge gelangen. Besonders rein begegnet uns das Weiß vor allem bei Vögeln, die die Wasserfläche beleben …
Sind deshalb auch die Dampfschiffe weiß und heben sich klar von der Wasserfläche und den vorbeiziehenden Ufern ab, weil sie sich geschützt vom Strom die Auffälligkeit leisten können? – Aus dem dunstigen Licht tauchte rechts von den Bündeln aufgeschichteter Rundhölzer, weiß und breitausladend, der Dampfer auf der Buriganga auf, den ich für die Abreise meiner Familie aus Rumänien zu benutzen gedenke: Er war 1921 gebaut worden, ein in England konstruiertes Schiff für ferne indische Kolonien. Doch gänzlich verschieden von einem Donaudampfer in Giurgiu konnte das Schiff wohl nicht sein, schließlich war es ebenfalls für die Flussschifffahrt bestimmt gewesen und somit, wie ich fand, für meinen Zweck verwendbar. Nachdem der Dampfer am Landungssteg verankert lag, ließ ich mir das Innere zeigen, den Maschinenraum, die Kombüse, in der mit Zweigen eingefeuert wurde, das Zwischendeck, auf dem sich Familien auf Decken und Matten drängten, um schließlich hinauf in die 1. Klasse zu gelangen, in deren Räumen noch immer ein verblichener Glanz spürbar war …
Und Großpapa zog die Kabinentür, die direkt auf den Salon ging, hinter sich ins Schloss, sah kurz über die Tafel hin, die den langgestreckten Raum beherrschte, an deren Ende der Kapitänstisch vor den Fenstern zum vorderen Deck stand. Dann schritt er in entgegengesetzter Richtung, um sich beim Dressoir unter der Schiffsuhr, die halb vier zeigte, einen Kaffee beim Kellner zu bestellen, blieb überrascht stehen, rückte an seinem Zwicker und trat entschlossen auf einen Herrn zu, der leicht gelangweilt mit zwei Damen beim Kaffee saß.
– Was für eine Überraschung, sagte Großpapa, ohne seiner Freude mehr als einen andeutenden Ausdruck zu gestatten, wir scheinen uns auf Reisen immer wieder zu sehen.
– Oder die Zeit zwingt uns zu reisen, sodass man sich notwendigerweise auf Reisen trifft. Sehr angenehm, Herr S.
Die beiden Herren – denn das waren sie, ganz ohne Zweifel – begrüßten sich mit einem angedeuteten Lächeln und einer ganz leichten, eigentlich nur innerlich, in Gedanken vollzogenen Verbeugung.
– Sie haben recht, Herr Silberling, unruhiger ist es geworden. Man bleibt davon nicht verschont.
Großpapa wurde den beiden Damen vorgestellt, einer Reisebekanntschaft, Mutter und Tochter aus Cernowitz, und er setzte sich zu ihnen, winkte die Bedienung herbei und bestellte einen türkischen Kaffee und einen Ţuicǎ.
Er hatte »Onkel Mendel«, wie Mutter Herrn Silberling nannte, 1917 während der Bahnfahrt nach Wien kennengelernt, als ein weiteres Verbleiben in Rumänien wegen des Krieges unmöglich schien, man war zusammen für Wochen im Lager von Linz gewesen, ein kleiner, agiler Mann, der ein rundes und auffallend abgeflachtes Gesicht besaß, das durch das straff nach hinten brillantierte Haar noch auffälliger wurde. Er hatte die unruhigsten Augen, die man sich nur denken kann, dunkel, mit einem fiebrigen Glanz, denen nichts entging: Als ich Onkel Mendel 1947 im Elsass das erste Mal getroffen habe, da glaubte ich, er brauche den Goldrand seiner Brille, damit ihm die Augen nicht entlaufen würden. Ich ahnte ja nicht, dass sie es gerne täten, weil sie gesehen hatten, und wieder in Träumen sehen mussten, unauslöschlich, was an Furchtbarem keine Worte nennen können.
– Sie müssen mir recht geben, Herr S., und der Dampfer querte die Donau nach Bulgarien, lange noch vor jenem Tag, an dem für Onkel Mendel beginnen würde, unauslöschlich, was kein Ende mehr finden konnte, Sie müssen mir recht geben, die guten alten Zeiten, die auch nicht nur gut waren, sind vorbei, die Unruhe wird größer, und die Geschäfte werden schwieriger werden.
– Es wird sich auch wieder bessern, sagte Großpapa in der Überzeugung, die ihn noch immer einen Zwicker tragen ließ. Unsere Firma, die Bumbac-Weberei – ich gebe das gerne zu –, hat sich seit Kriegsende allerdings nicht so vergrößert, wie wir uns das wünschten.
– Was sag ich Ihnen, und Sie reisen zurück. Obschon, in Wien ist es nicht besser, nun ja, vielleicht in der Schweiz. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwo leichter werden wird.
Die Stühle, auf denen sie saßen, hatten hohe Lehnen, waren cremefarbig gestrichen, die Rahmen und Armstützen von einer Goldlinie verziert. Die Polster waren mit einer rosagemusterten Seide bezogen, und sowohl bei den Mahlzeiten wie beim Kaffee schien die Atmosphäre des Salons Großpapa in seinen Ansichten zu bestätigen: Auf dem Schiff, das gegen den Strom stampfte, war noch alles so wie »immer damals«.
– Warum also gehen Sie? Bukarest hat doch dank des Öls so etwas wie seine beste Zeit, vielleicht ein Jahrzehnt noch, vielleicht zwei, wer kann das sagen? Und es lebt sich dort sehr angenehm, geben Sie zu.
– Weißman in Wien, wo er selber noch eine Fabrik betreibt, hat Söhne, die ins berufstätige Leben treten und mit der gesetzlich vorgeschriebenen Rumänisierung der Direktion, was lässt sich dagegen einwenden?
Onkel Mendel und mein Großpapa liebten es, sich an die gleiche Tischkante zu setzen, die Stühle einander zugewandt, sodass sich die Beine noch bequem übereinanderschlagen ließen und der Tisch als Lehne benutzt werden konnte. Großpapa rauchte eine ovale Zigarette, trank, falls sie sich nachmittags trafen, Kaffee und einen Ţuicǎ, während Onkel Mendel Selterswasser vorzog.
– Ich habe dafür Verständnis, sagte Großpapa, seine Söhne werden später die Firma übernehmen, die Betriebe in Ploeşti, in der Türkei und natürlich das Stammhaus in Wien. Sie brauchen Erfahrung, und so übernimmt der eine jetzt meine Direktion der Bumbac.
– Warum schickt er seinen Sohn nicht nach London? Oder Lyon? Hätte ihn Weißman vor dem Krieg nach Bukarest geschickt?
Und ich sehe, wie Onkel Mendel dieses Lächeln lächelt, das angenehm war und ihn gleichzeitig versteckte, als wäre sein Gesicht ein zurückgelassenes Erinnerungsstück aus dem Familienbesitz, kostbar ja, aber vereinzelt und durch die Umstände in fremde Hände gekommen.
– Man könnte wissen, was geschieht, sagte er, doch wer hat ein Interesse? Man hat diese Verträge gemacht, in Versailles, und man hat sie gemacht, damit sich die Konflikte fortsetzen, glauben Sie nicht? Schauen Sie, Herr S., man will ein nationales Deutschland als Bollwerk gegen den Internationalismus. Nun begreifen Sie, weshalb die Ökonomie ist, wie sie ist, eigentlich schwach – und Weißman schickt seinen Sohn nach Rumänien, wo es wenigstens noch einen König gibt.
Und während der Dampfer flussaufwärts stampfte, in Budapest und Bratislava anlegte, führten Großpapa und Onkel Mendel Gespräche, lag Großmama von Schwindel befallen in der Kabine, trieb sich Curt im Maschinenraum und auf der Brücke herum, nur meine Mutter sehe ich nicht. Was hatte sie unternommen, wie sich amüsiert, Ruth, eine siebzehnjährige Dame, schlank, das Gesicht blass? Sie würde nicht in einem der Korbstühle auf dem Sonnendeck gesessen haben, sie, die stets die Sonne mied. Hatte sie sich Onkel Mendels Reisegesellschaft angeschlossen, der Dame mit Tochter, denen Großpapa vorgestellt worden war? Leistete sie Mama in der Kabine Gesellschaft? – Ich weiß es nicht, und doch muss sie am Ende der Reise, in Wien, aufs Wasser geschaut haben, auf die Donau, und diese war grau:
– Es brauchte sehr viel guten Willen, einen Schimmer Blau zu sehen.
II
FOTOGRAFIEN
Das Hotelzimmer hinter dem Bahnhof war trist. Es roch nach Flüchtigkeit, und das grünlich sirrende Neonlicht machte den Raum kalt, illusionslos. Der letzte Zug war eine Viertelstunde vor meiner Ankunft weggefahren. Ich hatte die Ausgrabung am Monte San Giorgio erst spät und nach der Übergabe an meinen Assistenten verlassen können. Im Dämmer der Bettlampe las ich über die Triasfunde des Chicagoers The Field Museum in Nevada, zappte mich durchs Spätprogramm. Um halb drei löschte ich das Licht. Obschon ich die Jalousien vorgezogen hatte, drang der Schein der Straßenleuchte herein, jodfarbig wie Tinktur auf einer Schürfwunde. Ich lag da, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, nahm den Lärm vor dem Fenster hin, er war wie ein unförmig sich windender Körper, gepierct von Polizeisirenen. Ich sah zur Wand am Bettende. Über sie lief ein Lichtstreifen. Der Umriss einer Ständerlampe drückte sich ins Halbdunkel ein. Ich dachte an den Telefonanruf bei meiner Mutter am Nachmittag, und diese Helle und die schattige Figur an der Wand lösten eine Schicht über den Erinnerungen ab, brachten einen schwarzglänzenden Abdruck meiner Kindheit zum Vorschein, die nachmittäglichen Spiele, die ich als Junge während der Ruhezeit an der Zimmerdecke und an den Wänden gespielt hatte. Und während sich die Erinnerung aus dem Kinderzimmer ausstülpte, Kreise um das Haus und durch die Zeit zog, ich mir Mutters Stimme im Telefonhörer vergegenwärtigte, wurde mir die bange Dringlichkeit bewusst: Ich hatte seit jenem Tag in Sadarghatt, als mir die junge Dame, die meine Mutter einstmals gewesen war, durch den Ausgang zu dem schwankenden Flussdampfer entschwand, immer wieder nachfragen wollen. Jetzt bliebe nicht mehr viel Zeit, sie in ihrer Vergangenheit zu finden, Ruth S. aus den Überschichtungen der Jahre zu lösen, vielleicht ihr eigenes Zeugnis zu hören, den Grund zu erfahren, weshalb sie in ihrer eigenen Lebenszeit ausstarb wie eine Spezies des Erdaltertums…und dennoch meine Mutter war, eine selbstverständliche und lebenslang vertraute Gestalt.
Ich hatte sie angerufen, während einer Pause am Nachmittag, sie lebte allein in ihrem Haus, außerhalb des Städtchens L., an einem ehemaligen Rebhang, und es dauerte eine Weile, ehe sie abhob.
Ihre Stimme klang flach, sie flüsterte gehetzt und atemlos, redete, ohne mich zu begrüßen oder sich zu erkundigen, von wo ich anriefe, redete in einem sich endlos fortsetzenden Monolog, und die Wörter balancierten auf einem brüchigen Ton der Kopfstimme:
– …sie sind alle da weißt du alle und sie machen Musik unaufhörlich und immer wieder spielen sie das gleiche di da da dum und dann nochmals und nochmals di da da dum es sind die Jenseitigen man darf das nicht sagen aber ich sage ihnen so die Jenseitigen und sie spielen Musik unaufhörlich di da da dum aber du verrätst mich nicht du behältst es für dich sonst sagen die Leute ich bin verrückt ich bin nicht verrückt doch sie sind da die Jenseitigen ein Chor ganz aus Licht aus strahlendem Licht blau und grün und sie machen Musik …
Sie redete ohne Rhythmus und Pause, und ihre Stimme war dünnes Glas. In der unglaublichen Langsamkeit, mit der die Zeitlupe das Aufprallen eines Tropfens auf der Wasserfläche sichtbar macht, eine flüssige Krone aufstreben und wieder zerfallen lässt (ich hatte die Bilder zum ersten Mal im Kino, in der Sonntagsmatinee mit Vater gesehen), lief ein Riss durch dieses Glas, ein Sprung, der eine scharfe Kante einzog, an der sich das Licht brechen würde und diese glatte, ungetrübte Fläche zerstörte.
Ich regelte die Arbeit auf der Ausgrabung für den folgenden Tag, stopfte Zahnbürste und Unterwäsche in die Tasche, dann ließ ich mich in der Dämmerung hinunter ins Tal und zum Zug bringen. Als ich nach der schlaflosen Nacht im Hotel am Morgen den Taxifahrer bezahlte, wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Ich stand vor dem Haus, das ich selbst zwar nie für längere Zeit bewohnt hatte, das aber doch mein Elternhaus war, Ergebnis und bauliches Gerüst ihrer Lebensform.
Die Azaleen blühten, der Durchgang zum Garten, so oft ausgehauen, war wieder zugewachsen. Moospolster bedeckten das zur Einfahrt hin tiefgezogene Dach, hinter der Giebellinie ragten die drei Masten des japanischen Ahorns auf: Seine Kronen standen wie grün flirrende Segel vor dem Himmel. Zur Eingangstür führten beidseits Stufen hinab, das Haus war in den Abhang hineingebaut, die Fassade mit dem Küchenfenster und den nach oben versetzten Fenstern des Bads hatte die Farbe verwaschenen Graus, feine Risse durchzogen den Verputz. – Es bewegt sich, dagegen lässt sich nichts tun, hatte Vater jeweils gesagt, ein Hanghaus eben, das rutscht unvermeidlich – nichts war gemacht worden, kein Anstrich, kein Ausbessern der Sprünge. Es sah nicht schäbig oder baufällig aus, das nicht, es war nur eben dünn und wie unter einer fein lasierten Patina durchsichtig geworden, die hölzerne Eingangstür hatte wieder einen rohen, ungeschützten Zustand erreicht, und die Azaleen, der Ahorn, die wild gewachsenen Büsche hinter der Garage hielten ihre Zweige über den Schorf der Flechten.
Befremdlich an jenem Morgen war, während ich – die Reisetasche in der Hand – auf dem überwucherten Vorplatz verhielt und die gewohnte Ansicht in mir aufnahm, das Haus mehr und mehr in der Zeit zurückbleiben zu sehen, von einer wachsenden Vergangenheit überwältigt, als wäre die Kontinuität meiner Wahrnehmung eben gerissen: Ich sah das Haus wie auf einer Fotografie abgelichtet, schwarzweiß, ein Albumblatt, und mich erfasste eine Ratlosigkeit wie vor allen Erinnerungsfotos.
Mutter würde nicht hören, wenn ich das Türschloss aufsperrte, meinen Besuch hatte ich auch nicht angekündigt, so öffnete ich die Tür vorsichtig und langsam, um sie nicht zu erschrecken. Durch den Flur spähte ich in den um drei Stufen nach unten versetzten Wohnraum, der im Gegenlicht der großen, nach Süden gerichteten Fenster lag. Hinter kahlen Büschen breiteten sich unter Nässe und Nebel die Felder aus, von den Gehöften zog Rauch über den Weg hin zu den Obstbäumen, und obschon das jahreszeitlich nicht stimmen konnte, es war damals Frühsommer, ist mir ein graues, einförmiges Licht in der Erinnerung geblieben, das den Wald verwischte, die Erde voll Wasser sog, das Gras welk und die Bäume kahl machte und die Gehöfte duckmäuserisch unter ihre Kamine drückte.
Vor diesem winterlichen Ensemble saß Mutter im hochlehnigen Lederfauteuil, saß unbeweglich in dem klobigen meuble, in dem vor zwanzig Jahren mein Vater gestorben war und das sie seither »besaß«, kleiner und leichter werdend.
Im Haus herrschte eine tiefe Stille, eine Reglosigkeit auch. Es roch nach den abgetretenen Teppichen, nach versteckter Feuchtigkeit, und eine Wärme wie von einer schlottrigen Strickjacke umgab mich. Mutter, dem Fenster abgewandt, blickte gegen den Kamin, die Arme auf die Lehnen gelegt. Vorgeneigt hielt sie den Kopf ins Genick gedrückt, sah geradeaus, sah etwas, das nicht nur das leere Cheminée mit den geschnitzten Steinfiguren und dem dreiarmigen Kerzenstock auf dem Marmorsims sein konnte. Und sie saß, dachte ich, schon eine geraume Weile so da, ummantelt von der Einsamkeit der vertrauten, aber zu großen Räume. Fädig und sehr gerade fiel ihr Haar herab, ein feines Gespinst, das ein Leben lang zu Wellen und Schlaufen gelegt gewesen war und in Farbe und Form an einen noch frischen, blasshäutigen Nusskern erinnert hatte. Ihr Gesicht, weiß, wie von Sprüngen einer Craquelé-Glasur durchzogen, wölbte sich nach innen, war ein Eindruck, in den sich Reste einsammelten, wie in eine Schale, gleichgültig, womit man sie füllt. Das Blau ihrer Augen wirkte wie von allzu häufigem Gebrauch verwaschen, Spuren von Pinselstrichen, über die sich die dünnen Bögen der Brauen wölbten. Ihre Scheitelpunkte drangen in einen Himmel voller Kondensstreifen – und diese hohe, durchfurchte Stirn stand im krassen Gegensatz zum Kinn, das spitz und brüchig geworden war, als hätte sich allmählich der Wille aus ihrem Leben gestohlen.
Langsam, ohne Erschrecken, ohne ein Zeichen der Überraschung, wandte sie mir das Gesicht zu, als ich unter die Wohnzimmertür trat, sagte, als hätte ich schon lange dort gestanden und sie nähme das Wort nur wieder auf:
– Es ist grün und blau, sehr hell, sehr strahlend, grün und blau, und sie spielen Musik, di da da dum, unaufhörlich, ein Chor von Jenseitigen …
Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment müsste es dunkel in den großen, nach Süden gerichteten Fenstern geworden sein.
– Was wissen wir denn?, meldete sich mein Professor im weißen Labormantel, die weinrote Krawatte zwischen den Revers. Angesichts des gestaltlichen Reichtums und des sinnvollen Baus der fertigen Feder zögern die Versuche des Denkens, eine Geschichte ihrer Entstehung zu ersinnen, wo kein Lichtschimmer der Vorstellungskraft wenigstens ungefähr den Weg weisen kann.
Ich würde meine Mutter nicht allein lassen können. Ich rief den Arzt an, der sie seit vielen Jahren behandelte und kannte, bat ihn herzukommen, ich sei sehr beunruhigt, Mutter höre unablässig Musik in ihrem Bauch spielen, eine sie quälende, von Visionen begleitete Musik, die auch nachts nicht verstumme; meldete mich bei der Ausgrabung für den nächsten Tag ab, ich müsste zuwarten, wie sich der Zustand meiner Mutter entwickle und was der Arzt empfehle; sah in der Küche nach, was an Lebensmitteln noch im Haus war, öffnete den Kühlschrank, und im Licht der eingebauten Lampe zeigte sich mir Mutters schmal gewordenes, bedürfnisarmes Leben. Ein Glas Konfitüre, ein Bällchen Anken, eingeschweißter Aufschnitt, ein halber Salatkopf, das Kännchen mit Milch und ein Knuchelchen mit den Resten einer Mahlzeit. Dies Wenige lag auf den Gitterrosten wie die Waren in einem leeren Kaufgeschäft in Bukarest – damals, als während der Revolution die ersten Bilder im Fernsehen zu sehen waren.
Ich fuhr zum Supermarkt einkaufen, brachte auch einen »Russenzopf« mit, ein Gebäck, das sie besonders liebte. Ich kochte Tee und suchte im Schrank mit den Aperitifs und Schnäpsen nach der Flasche Rum: Ceai cu rom, den wir an den Winternachmittagen vor dem Eindunkeln getrunken hatten, aus dem gleichen Herend-Teeservice von Großmama, wie ich es auch jetzt hervorholte, und dieser »Tee mit Rum« musste eines der verborgenen Rituale gewesen sein, das sie, für sich und ohne dass wir anderen seine Bedeutung kannten, von Bukarest her weiterführte. »Machen wir einen Tschaigorum«, das war für den Jungen, der ich damals gewesen bin, ein schweigendes Zusammensitzen im Wohnzimmer, vor den dünnwandigen, mit Blumen bemalten Tassen, zurückgelehnt in die Polster des Kanapees, während die Fenster sich tintenblau füllten. Eine Wärme durchdrang mich, und unsere damalige Wohnung am Dorfausgang von S., inmitten der Molasse, wurde noch einsamer, die Felder, von Schneeresten durchsetzt, dehnten sich zur Ebene, weiteten sich zu einer scheinbar endlosen Tiefe des Landes.
Und jetzt war ich es, der den Tee einschenkte, den Löffel Rum zusammen mit dem Zucker einrührte, während Mutter weiter und weiter erzählte, dass die Jenseitigen Musik machten: Di da da dum, immer gleich, unaufhörlich wie ein Radio. Dann, als sie zittrig, tief gebeugt über der Tasse den Duft einsog und einen Schluck nahm, lächelte sie, und ihre Stimme hatte wieder den Klang, den ich kannte, ruhig für einen Moment.
– Alle Häuser besaßen einen Lattenzaun vom Hof zur Straße hin, und der Schnee lag am Morgen, nachdem es geschneit hatte, bis zu meinem Fenster hoch. Ich sah aus dem Eckzimmer auf eine gleißende Fläche, auf der vom Zaun zur Strada Morilor nur noch eine Reihe von Häubchen zu erkennen war, Brioches aus Schnee.
Großpapa besaß 1912 eine Fotokamera, er liebte Bilder, und das Gerät war noch immer, obschon seit einem Vierteljahrhundert verbreitet, das Merkmal eines gesellschaftlichen, die Zeit charakterisierenden Typs. Das dunkle Gehäuse auf den hölzernen Stelzen des Stativs entsprach der steifen, schwarzberockten Gestalt, die daneben stand und über ein Kabel den Auslöser betätigte: Man besaß den kühlen objektivierenden Blick, der festhalten und bewahren würde, emotionslos. Denn bei aller Brüchigkeit der Epoche, der Apparat bestätigte anschaulich das Vertrauen, wie sehr man mit den technischen Einrichtungen gleichwohl die Zeit, das Licht und das Arrangement der Dinge in der Hand hatte. Großpapa war Ingenieur.
Er besaß eine Vorliebe für die »nature morte«, das Stillleben. Selbst wo Menschen auf seinen sorgfältig abgezirkelten Fotografien zu sehen sind, wirken sie in ihrer Reglosigkeit wie abgebrochene, zurechtgelegte Früchte in der Schale ihrer Umgebung. Seine Bilder sind so präzise komponiert, dass sich bei längerer Betrachtung darin verborgene geometrische Linien zeigen, die an Koordinaten eines morphogenetischen Feldes erinnern, aus denen sich Rückschlüsse auf deren Entstehung ziehen lassen.
Es könnte also gewesen sein, dass im Oktober 1912 – ein paar Tage nach Ankunft seiner Frau und der Kinder in Bukarest – Großpapa das Lattentor zur Strada Morilor geöffnet und das »Trottoir«, wie man damals den Gehsteig in Bukarest bezeichnete, betreten hat. Er blickte kurz nach dem dunstig blassen Himmel, wandte sich nach rechts, der tiefstehenden Sonne zu, die über den Baumkronen entlang der Dîmboviţa ein spätsommerliches Licht in die Straße und auf die Fassaden der Häuser warf. Im schwarzen Gehrock, das Stativ mit der festgeschraubten Kamera im Arm, betrat er nach einigen Schritten die Fahrbahn, blickte zurück in die breitangelegte Strada Morilor, die bis auf eine Droschke, dort, wo die Straße leicht anstieg, verlassen lag. Er schätzte die Distanz, klappte die Stützen aus, versuchte die Eisenspitzen zwischen den Feldsteinen, die als ein holpriger Belag in die Erde gedrückt waren, zu verankern. Er blickte durchs Objektiv, verschob den Standort, schraubte an den Stützen: Die Aufnahme zeigt deutlich seine Absicht, das Haus derart abzulichten, dass auf dem Bild so viel wie nur möglich von der Stirn- und Seitenfront zu sehen sein würde, jedoch nichts von den Nachbarhäusern erschiene. Er löste »die kleine Villa« bewusst aus der Reihe herrschaftlicher Bauten, die bereits das Serielle, das Vervielfältigte selbst vornehmer Häuser verriet. Er hätte sich gewünscht, dass das Haus allein dastünde, dass er und seine Familie ein Jahrhundert früher lebten und die hohen Fenster beidseits der Nische mit der Statue einer lichtbringenden Botin auf einen Park blickten. Doch bei der optischen Korrektur der Wirklichkeit unterlief Großpapa ein Fehler. Einer, den außer ihm niemand bemerkte, auch meine Mutter nicht, der aber auf dem Bild festgehalten war. Ich entdeckte ihn an dem Tag, als ich nach Hause kam, weil die Musik im Bauch meiner Mutter spielte.
– Immer wieder verschwanden Kinder, und Mama hatte Angst um uns. Wir durften unbegleitet nie ausgehen, auch nicht auf die Straße vor unserem Haus.
Wir wohnten im Süden Bukarests, hinter der Fabrik begannen die Felder und lag das Schlachthaus. Die Straße entlang der Dîmboviţa führte zwischen Obstbäumen ins Unbekannte, wohin wir nicht gehen durften: Dort wohnten die Zigeuner und begann für mich, damals als Kind, das Ende der Welt. Dagegen fuhren wir oft ins Zentrum der Stadt, wo ein Bäcker seinen Laden hatte, der die besten Fleischpasteten Bukarests machte, und es gehörte zum guten Ton, bei diesem Bäcker Pasteten zu kaufen. Sie waren sehr begehrt, schon weil es sie nicht jeden Tag gab, und die besseren Kreise holten sich in ihren Cabriolets diese feinen, leicht süßlichen Stücke. Und immer wieder verschwanden Kinder. Und wir alle hatten von den Pasteten gegessen …
Am Abend, nachdem ich meine Mutter zu Bett gebracht hatte – das Neuroleptikum würde ich erst am nächsten Tag abholen können –, trug ich die kleine Biedermeiertruhe, die einst im Salon in Bukarest gestanden hatte, als Großpapa das Haus fotografierte, ins Wohnzimmer. Sie enthielt jetzt die Alben und Umschläge mit Fotos, die Bilder eines ganzen Lebens, ungeordnet und lückenhaft, wie die Erinnerungen meiner Mutter heute. In ein Etui aus Krokoleder hatte Großpapa kohlefarbene, löschblattartige Seiten von Halbkarton mit einer Kordel zu einem Album gebunden und auf die Seiten seine Fotos geklebt. In weißer Tusche bezeichnete er die Aufnahmen, und seine Schrift ist mir als Kind, das noch nicht lesen konnte, selbst wie ein Bild oder ein dazugehöriges Ornament erschienen: Bucureşti1912, Unser Haus, Strada Morilor7: Der Schriftzug bedeutete für mich ein Stück gusseisernes Geländer an der Dîmboviţa, von dem aus man das Haus sah.
Ich bin lange am Tisch vor diesem ersten Bild des Albums gesessen, das in meiner Kindheit so wichtig und mir so vertraut gewesen ist. Es gehörte zu Mutters »geheimer Galerie« – einer Handvoll Fotografien, die ich mir immer wieder ansehen durfte –, zu deren einzelnen Bildern Mutter manchmal eine Geschichte erzählte, wie die von den Kindern, die verschwunden waren, und von dem Bäcker, der wunderbare Fleischpasteten backte.
Die Bilder dieser kleinen inneren Seelenausstellung wurden in der obersten Schublade der Kommode gehütet, und sie bezeugten, »wie man damals gelebt hat« – ein Zeugnis, das eine unausgesprochene Kritik der Gegenwart beinhaltete.
Die Aufnahme von 1912 ist mir so vertraut, als kennte ich die hohen Fenster, ihre verzierte Laibung und die figuren- und wappengeschmückten Stürze, das Giebelband mit den gemalten Ornamenttafeln, das kleine Lichthaus und den wie einen Keil in den Himmel ragenden Dachaufbau mit seinen zwei Wetterspitzen aus eigener Anschauung. Als besäße ich eine Erinnerung, die über das Bild hinaus und zurück ginge, und so betrachtete ich an jenem Abend erneut das Foto, untersuchte es mit der Lupe, den Kopf so tief gebeugt, dass ich den säuerlich-staubigen Geruch der Blätter riechen konnte …
Und in den Baumwollgardinen des Salons verfing sich das blasse Licht der Sonne, drang in den hohen Raum, wo Großmama und ihre Schwester Anna, die sie auf der Reise nach Bukarest begleitet hatte, noch beim »Tschaigorum« saßen und von den Kuchen naschten, die sie bei Wienert am Ende der Straße hatten holen lassen. Auf dem ovalen Tisch mit der gehäkelten Decke stand das Herend-Service, Curt lehnte sich in einem der Stühle zurück, deren dunkles Holz einen Bogen um das Geflecht spannte, in deren achteckige Löcher ich drei Jahrzehnte später meine Finger stecken würde.
– Wo ist Ruth?
– Ich denke, Ernst hat sie mit sich vors Haus genommen.
– Doch nicht auf die Straße? Curt, sieh bitte nach. Sie trat ans Fenster, schlug die Gardine zurück, blickte in den Garten hinaus, auf das Oval von Rosenstöcken und auf die Zweige des kahlen Flieders.
– Er möchte sowieso, dass wir für die Aufnahme vors Haus treten.
– Ahba, sie wandte sich ab, du weißt, wie lange er an seinem Apparat herumschraubelt.
Großmama machte es »nervös«, wie rückhaltlos ihr Mann sich mit Stativ und Kamera beschäftigen konnte, die Einstellung der Höhe mehrmals veränderte, endlich die Eisenspitzen festdrückte, um im nächsten Moment die spreizige Stütze doch wieder hochzuheben, sie ein paar Ellen zu verschieben und erneut mit Zurechtrücken, Schrauben, durchs Objektiv spähen zu beginnen. Die Bügelfalte knickte ein über das andere Mal ein, wenn er gebeugt an den Flügelmuttern drehte.
Curt und Anna hatten noch nicht das Gartentor erreicht, da war der Auslöser gedrückt, die Aufnahme gemacht, und Großpapa bemerkte sein Missgeschick. Wie um es gutzumachen, stellte er Curt neben den jungen Alleebaum, und der Sechsjährige stand da, so offensichtlich herbefohlen und ausharrend, bis Großpapa seine Kamera neu eingerichtet hatte, dass mir an dem Abend, während ich mit der Lupe die Aufnahmen untersuchte, klar geworden ist, dass gerade dieses zweite Bild, das die Strada Morilor in der Zentralperspektive zeigt, das Eingeständnis eines Fehlers bei seinem ersten Bild war. Großpapa hatte beabsichtigt, das Haus so vorteilhaft wie möglich abzulichten. Doch durch das dauernde Herumrücken, Abzirkeln und Korrigieren der Wirklichkeit war die kleine Ruth, die er neben dem Lattentor aufgestellt hatte, perspektivisch hinter das Stämmchen und die Haltestange des Alleebaums geraten: Sie war von dem Bild, das sie ein Leben lang bewunderte, verschluckt worden, bis auf eine Haarschleife, die hervorschaute.
Mutter hatte an die Zeit vor Bukarest nur eine einzige Erinnerung, ihre erste Erinnerung überhaupt, das Geschehnis hat sich möglicherweise im süddeutschen Murg zugetragen, wo mein Urgroßvater, bevor er in der Schweiz zwei Textilfirmen kaufte, eine Weberei leitete und nahe der Fabrik ein stattliches Haus hatte bauen lassen. Es muss eine geräumige Küche gewesen sein, die Wände waren gekachelt, der steinerne Fußboden zeigte ein dunkleres, von einem roten Band umfasstes Karree. Durchs Fenster fiel das nüchterne Licht eines Frühjahrnachmittags, lag kalt auf den Wänden und den wenigen Einrichtungsgegenständen.
Großmama hatte die kleine Ruth, in einem gestärkten Leinenröckchen, auf den Küchentisch beim Fenster gesetzt, um ihr einen Schmetterling zu zeigen, der an der geklöppelten Jalousie krabbelte und in regelmäßigen Abständen die Flügel spreizte: Zwischen schwarzen Arkaden offenbarte er einen dunklen Purpur, samtig, und er hatte gegen die Spitze hin einen blauen Punkt, als wäre dort eine bloße Stelle, durch die der Himmel schimmerte. Doch es war nicht der Himmel, es war kein Blau, und noch während Mutter den Schmetterling betrachtete, sah sie, dass er inmitten lohender Flammen saß, die das Fenster mit einem reißenden Glutstrom ausfüllten, scheinend und strahlend, als wäre die Sonne herabgestürzt und vor dem Küchenfenster in einen Feuerball zerplatzt. Die Fabrik brannte. Die Fabrik! – und der Flammenschein verwandelte den Schmetterling, ließ ihn wie ein dürres Blatt aussehen, hängen geblieben im geklöppelten Netz der Jalousie.
III
POSTKARTEN
– Wer weiß, sagte der Professor, ob wir etwas über die Frühzeit der Vögel wüssten, hätte nicht Alois Senefelder 1796 in München den Steindruck erfunden.
Die Luft im Büro war trocken, bestaubt von einem leimigen Geruch, der aus Ritzen und Fugen drang. Man vermeinte im Dämmer einen grünen Linoleumbelag wahrzunehmen, Tresen mit metallverstärkten Kanten, doch die Nüchternheit wurde gemildert durch einen Lichtkegel, der geometrisch im Raum stand, ein Stück geborgener Stille: Die Lampe warf ihren Schein zwischen die Stapel von Büchern und Skizzen, auf das Mikroskop und eine Abbildung des Archaeopteryx lithographica, dessen Original im Museum für Naturkunde in Berlin aufbewahrt wird: die besterhaltene Versteinerung des Urvogels, 1877 bei Eichstätt gefunden.
– Welch ein Zusammentreffen von Zufällen!, sagte der Professor. Ein Vogel, der allem Anschein nach Gebüsch und Wald bewohnt hat, findet am Meeresstrand den Tod. Sein Körper wird im Schlamm derart eingebettet, dass die ausgebreiteten Fittiche mit einzelnen sichtbaren Fingern und Zehen uns erhalten bleiben. Feinste Spuren bezeugen die Federstruktur recht zuverlässig.
Was mich am Archaeopteryx lithographica immer zutiefst berührt hat, ist das Schriftzeichen, das die Form des versteinerten Skeletts für mich bedeutet, ein Piktogramm, unmissverständlich und vor aller Zeit geprägt. Der Kopf – ins Profil gedreht – ist zurückgeworfen, als wäre er auf das Undurchdringliche, Undeutbare geprallt und dadurch sofort und endgültig verwandelt worden, zu einer seltsam gelösten Nutzlosigkeit. Die Schwingen und Beine sind ausgebreitet zu einer ungewollten Ergebenheit, dem Annehmen des Unausweichlichen, und ich lese das versteinerte Skelett, es heißt »Vergänglichkeit«, ist ein Dunkel und auch eine Leere.
– Der versteinerte Archaeopteryx besaß echte Schwungfedern, der Professor fixierte mich, und sein Blick war von belustigter Boshaftigkeit. Wir aber wollen wissen, wie gerade dieses Außerordentlichste am Vogel, die Feder, geworden ist. Dieses Geheimnis jedoch verrät keiner der Funde.
»Sfîntu Gheorghe/Lipscani: Dies ist der Centralpunkt, nach welchem man von uns aus per Tram fährt, um nach den verkehrsreichen Plätzen zu fahren.« – So schrieb Großpapa am 30. 6. 1912 auf die Rückseite einer Postkarte. Da die Linien nicht ausreichten, überschrieb er im rechten Winkel seine schwungvolle Schrift, sodass ein Gewebe altdeutscher Schriftzeichen entstand, leicht und locker wie das Baumwolltuch, das die Societatea românǎ pentru Industria de Bumbac unter Großpapas Leitung herstellte.
Die Postkarte ist koloriert, als einzige eines Bündels, das er in jener Zeit geschrieben hat und das ich bei den Alben in der handlichen Biedermeiertruhe gefunden habe. Großpapa hatte sie in einem Schreibwarengeschäft an der Strada Lipscani gekauft, von dem ich annehme, dass es ein schlauchartig tiefer Raum gewesen sein muss, abgedunkelt durch die rotgestreiften Storen vor der Auslage, und Großpapa beugte sich über die Postkarten, stieß die eine oder andere auf dem Tresen mit seinen behandschuhten Fingern an, rückte den Zwicker auf der Höckernase zurecht und murmelte: Bun o iau. Die glanzbezogene Ansicht des Platzes und der zu den Kuppeln am Horizont verlaufenden Geschäftsstraße sollte seiner Frau ein Bild von dem Ort vermitteln, der seine Gefühle so sehr bewegte: Spross einer alten, großbürgerlichen Familie, hatte er endlich, nach Jahren der Unentschiedenheit, seinen »Centralpunkt« doch noch gefunden, und es war am Platz Sfîntu Gheorghe, eingangs der Strada Lipscani, wo der vornehme Herr, der mein Großpapa war, zur Überzeugung gelangte, dass ein schon lang währender Verlust endlich und für immer seinen Ausgleich finden würde.
Er war nach Rumänien vorausgereist – Großmama und die beiden Kinder sollten in drei, vier Monaten nachkommen –, und nach dem zweitägigen Aufenthalt in Wien, bei seinem Schwager Alfred, der an der Mariahilfer-Straße Federn für Hüte färbte, stand Großpapa vor dem Schlafwagenabteil am Fenster, blickte auf die größer werdenden Häuser, deren Fassaden im Licht wie Marmor schimmerten, als der Zug in Bukarest einfuhr. Der Rauch der Lokomotive wurde von der Bahnhofsbedachung herabgedrückt, zog wie Nebelfetzen vor der Scheibe vorbei und drang als teeriger Geruch in den Waggon. Auf dem Bahnsteig tauchten einzelne Reisende und Paare aus den Rauchschwaden auf, auch Gruppen in orientalischer Kleidung, eine dichter werdende Menge harrender Menschen, die vorbeiglitt, bis nach einem langanhaltenden Pfiff die Bremsen griffen, sich festfraßen, und der Zug mit einem Ruck zum Stehen kam. Als wäre etwas von der Energie auf die Umgebung übertragen worden, entstand eine Bewegung unter den Wartenden, Stimmen und Rufe wurden hörbar, der Gang füllte sich mit Reisenden, die ihre Gepäckstücke aus den Schlafabteilen zogen, Träger stiegen zu, boten ihre Dienste an, Männer in abgenutzten Röcken, Mützen auf den Köpfen, und es war Großpapas Bedächtigkeit, die einen fetten Mann zugreifen ließ: Mit fleischigen Händen packte er den geflochtenen Koffer und die beiden Schnürpakete, die Großpapa ordentlich bereitgestellt hatte, schleppte sie durch den Gang, während der Herr in Cut und gestreifter Hose, mein Großpapa, den Zylinder aufsetzte und mit einiger Beunruhigung den Stock aus der Ablage holte.
Gara de Nord Bucureşti.
Er stand an der Waggontür, bereit die Stufen hinabzusteigen, blickte in die Gesichter unter ihm, fremde Gesichter – ein Gemisch unter der glasigen Hitze des Mittags –, und einen Moment lang umfing ihn eine Stille, an der er sich wie eine Fatamorgana gespiegelt fühlte: Eine überschlanke, hochgezogene Gestalt, im Ausschnitt der Weste die Krawatte mit Brillantnadel, den Stock unter den Arm geklemmt, einen Anflug von Grau an den Schläfen, die Augen hinter dem Zwicker vorstehend und stechend, von einem hellen, wässrigen Blau. Und Großpapa begriff, dass die Blicke der drängenden, meist einfachen Menschen ihn künftig auf den Stufen oben festhalten würden, Blicke, die scheinbar gleichgültig waren – aus dunklen, staubigen Augen eines unbekannten Herkommens – und die ihn doch auf unerklärliche Weise bedeutend machten und ausgezeichnet erscheinen ließen.
Dieser Moment einer Erhöhung überraschte Großpapa, als er sich anschickte, die Stufen des Waggons hinunterzusteigen, und über der harrenden Menge schwebte, wie er mich überraschte, als ich bei meiner Ankunft in Dhaka die Halle des Flughafens verließ, durch die verglaste Tür aus der klimatisierten Blutbahn der Industrienationen in eine heiße, staubige Luft trat.
Ich denke, die damalige Zugsfahrt nach Bukarest entspricht heute einer Reise nach Bangladesh. Die Postkarte der Gara de Nord, die ich im Bündel gefunden habe, eine Außenansicht des Bahnhofgebäudes, zeigt allerdings einen gewichtigen Unterschied zu meiner Erinnerung an die Ankunft in Dhaka, Bangladesh: nichts von Überfüllung, von unabsehbarer Masse an Menschen, Fahrzeugen, Handlungen. Hell und offen liegt der Platz in der Hitze des Junivormittags. Reisende streben dem Seiteneingang des winkelförmigen Gebäudes zu, sie tragen Koffer auf den Schultern und in den Händen, gemächlich schreiten sie aus, während die Schatten kürzer werden. Vor dem Haupttrakt und den mit offenen Loggien gekrönten Türmen stehen die Mietkutschen, reihen sich entlang der Überdachung unter den Bogenfenstern, und dort hatte auch Herr Leo Schachter, Generaldirektor der Bumbac, seinen Landauer warten lassen, um Großpapa am Zug abzuholen.
In den Tagen nach seiner Ankunft fühlte sich Großpapa beflügelt und hochgestimmt, als wäre durch die Ankunft in Bukarest etwas in Ordnung geraten, das nicht allein ihn betraf, sondern die Zeit, die Epoche – und was anfänglich ein mit Eindrücken durchmischtes, undeutliches Gefühl gewesen war, begann zu einer Gewissheit zu werden, nachdem er bei der Kirche Sfîntu Gheorghe über den eisernen Tritt der Equipage hinab aufs Pflaster getreten war, den Stock leicht aufgesetzt hatte und unter den Bäumen, in deren Schatten Bauern neben Packen und Körben lagerten, gemessen zum Boulevard vorging, den flachen Strohhut auf dem Kopf: Endlich würde sich das Leben zu einer ihm gemäßen und lange entbehrten Form bequemen, einem sittlich geordneten und von Wohlstand und Vornehmheit geprägten Dasein. Zigeunerinnen verkauften Blumen, riefen ihn an (Domnu! Domnu!), den Arm voll Margeriten, deren Blüten über den krautigen Stielen leuchteten: Es war heiß, ein weiter, wolkenloser Himmel spannte sich über die Stadt, die Luft stand reglos, es roch nach ausgegossenem Wasser und Staub der von weither in die Strada Lipscani und ihrer Märkte gekarrten Waren. Großpapa blieb stehen, den Stock leicht abgewinkelt. Die mit Eisenreifen beschlagenen Räder der Karren ratterten hinter den Hufschlägen über das Pflaster, das in konzentrischen Kreisen um den »Centralpunkt« gesetzt war, ein Rondell, in dessen Mitte, auf wappengeschmücktem Sockel, die Lupa Capitolina gestanden hat, die Wölfin, die Romulus und Remus säugt, zwei lustvoll sich windende Kinder. Drei ältere Damen, in schwarzen geschnürten Kostümen, halten ihre Schirme gegen die Sonne aufgespannt, eine junge Frau in luftiger Bluse und sommerlich weitem Rock wartet auf die Pferdetrambahn, sie sieht einem Händel vor der Kirche Sfîntu Gheorghe zu, während der Mann, der eben seinen Hut von der schweißnassen Stirn gezogen hat, nach Kleingeld für eine Bettlerin in der Rocktasche sucht.
Hinter diesem hell aus der kolorierten Postkarte herausdrängenden Rondell zieht sich die Strada Lipscani gerade in die Häuserflucht hinein, gegen die pralle Sonne sind die rotgestreiften Storen des Schreibwarengeschäftes ausgeklappt, gegenüber räumen die Händler in weißen Schürzen ihre Waren auf das Trottoir, und Herr S., der sich eben anschickt, den Platz zu queren, um nach einer Postkarte für seine Frau Ausschau zu halten, wird einen Blick zu den vierschrötigen Gesellen werfen, die niedergebeugt zusammenstehen, als wäre dort eben ein Tier geschlachtet worden und hätte Neugierige angezogen. Doch auch vor La Papagal drängen sich die Leute, weichen zur Straße hin aus, wo die Kutschen an abgestellten Gespannen vorbeizirkeln. Ein Schild preist in roten Lettern die Anfertigung von Röcken. Danach verengt sich die Strada Lipscani zwischen den Fassaden und nackten Brandmauern, läuft in einen Fluchtpunkt unter den Kuppeln eines Prunkgebäudes, und sie ist warm und gelb wie Mais, erfüllt von einer Gemächlichkeit und sommerlichen Nonchalance, vielleicht ein kleines Paris, doch eines – so wenigstens auf Großpapas Postkarte –, in dem die Wölfin in die Straße schaut.
Und ich stehe auf den Tag genau fünfundachtzig Jahre später an der Stelle, an der Großpapa gestanden hat, und spüre in meinen Mundwinkeln sein Lächeln unter dem gezwirbelten Schnurrbart, dieses leicht versteckte Verziehen der Lippen, und ein Glanz muss damals in seine Augen gekommen sein, ein helles Leuchten, wie ich es gesehen habe, als Onkel Mendel ihn besuchte, kurz bevor er starb.
Das Sitzpolster war heiß von der Sonne, ein rotgefärbtes Leder, durch Knöpfe gespannt, deren Vertiefungen ein rautenförmiges Muster suggerierten, doch in seiner dünnen Auflage wenig gegen die Schläge der Räder auf der Steinpflasterung vermochte. Großpapa lehnte sich in die Ecke des Landauers zurück, die Beine übereinandergeschlagen, den Stock gegen die Leiste der gegenüberliegenden Sitzbank gestellt, blickte, halb zugewandt, am scharfen Profil Herrn Schachters vorbei auf die Fassaden, deren Säulen, Karyatiden, girlandengeschmückte Gesimse in der Sonne blendend leuchteten, als wären sie aus einem durchscheinenden Material gefertigt. Die Geschäfte waren geschlossen, eiserne Rouleaus schützten die Eingänge, wenige Passanten, ihre Sonnenhüte ins Gesicht gezogen, schritten während der Mittagszeit auf den hitzeflimmernden Trottoirs aus. Sie nutzten die schmalen, harten Schatten, die wie Reste eines Schnittbogens entlang von Kanten und unter Absätzen lagen. Doch man saß erhöht, bequem in die Ecke gelehnt. Als der Landauer in die weiße Flucht des Boulevards einbog, brachte ein leichter Luftzug Kühlung, einen Anhauch aus den Gärten und aus hinter Linden verborgenen Fensterreihen, einen Anhauch feucht erdigen Geruchs.
– Sie werden sehen, Herr S., in Bukarest lässt es sich ausgezeichnet leben …
Und Leo Schachter erinnerte in seiner untersetzten, wohlgenährten Statur, seinem gepflegten Äußeren, dem blanken, freundlichen Gesicht, der Krawatte mit Goldnadel und einer Uhrkette, an der zwei Medaillons über den englischen Westenstoff scheuerten, Herr Schachter erinnerte in seiner selbstgewissen, der eigenen Stellung bewussten Art, an Gustav Wilhelm S., der seit alters her aus dem Rahmen seines Porträts in das Wohnzimmer meines Elternhauses blickte.
Das Pflaster der kurzen Allee, durch die ich nach Ankunft in Bukarest im Taxi gefahren bin, um zu dem Haus zu gelangen, in dem ich wohnen sollte, war in der Mitte aufgerissen. Die grob behauenen Steine lagen gehäuft und von Kot und Abfall bedeckt entlang des zugeschütteten Grabens. Der Gehsteig, notdürftig ausgebessert, mündete auf einen Platz, ein durch die Verzweigung der Allee weites, ungleichschenkliges Dreieck, von Zäunen und Mauern begrenzt. Die zerfallenden Häuser hielten sich in dünnen Schatten kranker Bäume, deren Äste und Zweige weichere Risse zwischen die wirklichen legten und deren Blätter blasse Flecken auf den abgeblätterten Putz warfen. Klassizistisch-orientalische Portale, Säulen, Stuckornamente drängten sich zwischen Büsche und Verschläge; matt, von Staub und Rost verkrustet, wucherten Autowracks unter Wicken, trotteten Hunde in den Gartenkorridoren zwischen Haustür und Gartenportal oder lagen, die Zitzen rot und prall, auf den zerbrochenen Platten, hechelnd in der Hitze des Nachmittags. Leer und verstummt lag der Platz in der Sonne, ein vergilbendes Licht, das eine Nuance heller und härter war als das Mais- und Tabakgelb der Fassaden: Diese unvergleichliche Farbe, die ich ein Leben lang kannte, ohne sie bis zu meiner Ankunft in Bukarest an diesem Nachmittag wirklich gesehen zu haben. Sie war der sichtbare Niederschlag eines Duftes, den das Wort »Rumänien« für mich ausströmte, warm und süß, und rief Muster einer vergangenen Ornamentik wach, die sich kratzig anfühlten wie das bestickte Baumwolltuch, das Mutter im Schrank, in Seidenpapier eingeschlagen, aufbewahrte.
An diesem Platz, unter den vor fünfundachtzig Jahren noch jungen Bäumen, ließ Leo Schachter den Landauer vor einem Gartenportal halten. Er wies den Kutscher an, die Gepäckstücke hineinzubringen, stieß das Tor, das tagsüber unverschlossen blieb, auf und bat Großpapa um den Vortritt: Die kürzlich erst mit Wasser besprengten Platten des Gehweges führten an einem Rosenbeet unter der Grundstücksmauer entlang zum seitlichen Eingang des großzügigen, von Elementen des Wiener Jugendstils geprägten Hauses.
Sie betraten die Eingangshalle
– Ich lasse Ihr Gepäck in Ihre Räume schaffen, Sie werden von der Reise ermüdet sein, sagte Leo Schachter, während sie die drei Stufen zum Vorraum hochstiegen, wo sie Hut und Stock auf der Garderobe ablegen würden. Doch bis alles hergerichtet ist, wollen wir – wenn es Ihnen recht ist – Kaffee trinken. Bitte!
Er wies zur Tür des Empfangssalons, und Großpapa ließ sich in ein schattiges, hohes Zimmer bitten, unter einen reich mit Stuck verzierten Plafond, in dem ein Heris, über den andere kleinere Teppiche gelegt waren, die Schritte und Stimmen dämpfte. Die Wände waren von Stichen, die eher spärlichen Möbel von Sammelstücken, auch Nippes, bedeckt, und den Salon beherrschte eine gelassene, doch auch träge Atmosphäre, die – verstärkt durch den Rauchtisch und die niederen Sessel – orientalisch wirkte.
– Von den Geschäften wollen wir nicht reden, dafür haben wir noch genügend Zeit.
Großpapa verbeugte sich leicht, nahm auf der Ottomane, nachdem sich Herr Schachter gesetzt hatte, Platz, wobei er die Bügelfalten seiner gestreiften Hose hochzog, und legte den Arm angewinkelt auf die Lehne.
Er hoffe, Großpapa werde sich wohl fühlen, selbstverständlich sei vieles anders als in den europäischen Städten, und an einiges müsse man sich gewöhnen, doch sei das Leben hier im Ganzen genommen – wie schon gesagt – angenehm:
– Gute alte Zeiten! Gute alte Zeiten! Ein wenig wie die Belle Epoque damals. Obschon die Regierung immer mehr Restriktionen uns Ausländern gegenüber erlässt, was den Investitionen nicht eben bekommt. Aber sie brauchen uns, sehen Sie, sie brauchen uns. Und so ist die Parole der Liberalen, ihr prin noi înşine, »durch uns selbst«, auch nur ein Wunsch.
In dem helleren Speisezimmer, das durch einen offenen Zugang verbunden war, bauschte die Zugluft sich in den weißen Vorhängen der Terrassentür.
Herr Schachter bot Zigaretten in einer silbernen Dose an, er selbst entnahm einem Etui eine Zigarre, deren Kopf er mit einem kleinen Messer einschnitt.
– Es wird geredet und geredet, und es entstehen Gerüchte, fürchterliche, manchmal kitschige. Tragisch sind sie immer. Stets gibt es Verwicklungen, Vermutungen, Befürchtungen. Lassen Sie sich nicht irremachen. Das gehört zu Bukarest: Es ist seine Würze und sein Gift – und ein wenig wird man süchtig davon.
Und Leo Schachter, zurückgelehnt, den Embonpoint über den gespreizten Schenkeln, sah auf den Rauchfaden seiner Zigarre, und sein Gesicht hatte den Ausdruck eines Menschen, dem Gott die Gabe verliehen hat, die Dinge klar und einfach zu sehen, wie sie nun einmal sind, nützlich und verwendbar.
– Ein feines Gewebe, leicht, duftig, nicht ganz zu fassen: Nichts scheint so, wie es ist. Alle denken sich, es müsste ein Dahinter geben, versteckte Kräfte, die man nicht genau kennen kann, die aber überall und jederzeit hervorbrechen und die Welt verändern können.
Doch gar nichts werde geschehen, vor allem nicht hier in Rumänien. Ja, die Spannungen zum Wiener Hof wegen des magyarischen Siebenbürgen, die territorialen Ansprüche der Bulgaren an das Osmanische Reich, doch das alles sei nicht ernst zu nehmen, so wenig wie das Säbelrasseln des Kaisers.
– Was braucht er in Marokko auch die Engländer zu ärgern. Die Deutschen sind nun mal keine Kolonialmacht – werden es auch nie sein. Es reicht auch, wenn sie ihre Hand über Jerusalem und uns Juden halten.
Und Leo Schachter hob seine buschigen Brauen, dass sich die Stirn unter dem tiefen Haaransatz runzelte und er den Ausdruck eines Mannes bekam, dessen helle, wässrige Augen eine Freude am unveränderlichen Erhalt angenehmer Umstände verrieten.
– Schließlich, nicht wahr, sind die europäischen Mächte zivilisierte Nationen. Und Sie werden mir als Ingenieur recht geben, dass die Wissenschaften uns in den letzten Jahrzehnten eine Technik beschert haben, mit der die meisten Probleme zu lösen sind.
Großpapa beugte sich vor, nickte, als wäre es ein persönliches Kompliment.
– Ich bin ganz Ihrer Meinung, sagte er fest.
Das Mädchen brachte türkischen Kaffee, dazu Ţuicǎ, und Herr Schachter ließ Madame in den Salon bitten.
Gelb ist als echte Farbe in der Feder enthalten. Wir sondern ein mehr gelbbraunes bis rötliches »Phäomelanin« von einem schwärzeren »Eumelanin«. Diese Melanine werden durch besondere Farbzellen an die Federanlage abgegeben und dort in verschieden dichter Ablagerung in die Hornsubstanz der Federanlage eingeschlossen. Die vielen Abstufungen der Färbung werden durch die Dichte der Verteilung in den Federstrahlen bewirkt. – Alles Gelb der Vogelfeder entsteht auf diese Art, und nur die Vögel haben das Reptilienerbe besonders gelber und roter Pigmente bewahrt.
Madame Schachter betrat den Salon, mit der Linken die angedeutete Schleppe des langen, anliegenden Kleides zum Schein gerafft, und die beiden Herren erhoben sich.
– Mascha, darf ich dir Herrn S. vorstellen, unseren neuen Direktor …
Großpapa klappte unhörbar die Hacken zusammen, beugte sich über die ihm dargebotene blasse und kühle Hand, blickte in das nicht sehr ebenmäßige, zu charaktervolle Gesicht, irritiert durch die dunklen, freundlichen Augen. Madame Schachter war eine selbstbewusste, elegante Frau, jünger als ihr Mann, schlank, doch nicht sehr groß gewachsen. Sie besaß eine natürlich ruhige Art, sich zu geben, und Großpapa staunte, weil ihre vornehme Ausstrahlung so sehr dem Rang entsprach, den er sich im gesellschaftlichen Umgang erhofft hatte, dass er sich auf das Angenehmste bestätigt sah.
Er entspannte sich, hielt den Arm nicht mehr ganz so steif angewinkelt und schlug die Beine übereinander.
Madame erkundigte sich nach Herrn S. Familie, wann seine Frau und die beiden Kinder nachzukommen gedächten und in welchem Teil der Stadt sie zu wohnen beabsichtigten. Darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht, es bleibe genügend Zeit, in Ruhe einen Ort zum Wohnen zu finden. Seine Familie werde erst nach der Hitze, gegen Ende September herreisen, seine Tochter Ruth wäre dann drei Jahre alt und somit in einem Alter, in dem sie die Reise unbeschadet bestünde. Großpapa versäumte nicht, bei der Gelegenheit zu danken, dass er vorübergehend im Schachterschen Hause wohnen dürfe.
– Man lebt in Bukarest eben in allem ein wenig zu groß, sagte Madame, und so bereite es keine Schwierigkeiten, ihm einen Salon und ein Zimmer abzutreten.
– Dazu also kein Wort. Erzählen Sie uns lieber von Ihrer Reise. Sie waren in Wien?