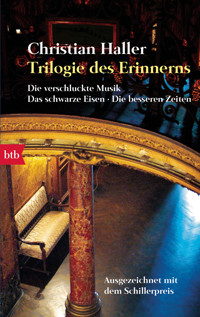7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Damm ist gebrochen, der Fluss des Lebens trägt Christian Haller näher an seine Bestimmung heran. Aus dem jungen Mann, der den Weg suchte, "den es nicht gab und den er dennoch gehen wollte", ist ein Schriftsteller geworden. Durch Widerstände, Schicksals- und Rückschläge eröffnen sich ihm zunächst neue Lebens- und Arbeitsbereiche. Er aber muss kämpfen gegen finanzielle Nöte, gegen Ablehnung und für die Anerkennung seiner Arbeit. Doch schreibend gelangt er an sein Ziel: In der Erkundung seiner Herkunft, jener Einschläge des 20. Jahrhunderts, die die Wege seiner Familie bestimmten, tritt allmählich das erzählende Ich hervor. Und mit ihm die Frage, wie der Untergrund des Lebens tatsächlich beschaffen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2020 Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Covergestaltung: buxdesign, München Covermotiv: Getty Images/Nadine Berghausen/EyeEm
ISBN 978-3-641-23744-8V003www.luchterhand-literaturverlag.de
Christian Haller
Flussabwärts gegen den Strom
Roman
Luchterhand
Anfang März, acht Uhr morgens. Pippas Schwester und ich, Besitzer der Liegenschaft, warten mit unserem Anwalt in der Eingangshalle des Gerichtsgebäudes. Die Verhandlung soll in Kürze beginnen.
Vor drei Jahren, am 13. Juni, stürzte die sieben Meter hohe Mauer, die unsere Terrasse zum Rhein hin begrenzt hatte in den Strom. Ein Grollen und Bersten erschütterte das Fundament des Hauses, riss eine klaffende Wunde aus Erde und Fels unter die beiden Veranden. Nach Befestigung des Untergrunds und der Errichtung eines Balkons blieb die Frage zu klären, ob die Schadenssumme nicht durch die Versicherung wenigstens teilweise bezahlt werden müsste.
Unser Anwalt, der den Fall aus freundschaftlicher Hilfsbereitschaft übernommen hatte, bedeutete Pippas Schwester und mir zu schweigen, wir hätten Zuhörer. Wenige Schritte entfernt standen die Vertreter der Gegenpartei. Ihnen gehörte jener Stadtrat an, der während der Bauzeit die Vertrauensperson bei der Gemeindebehörde gewesen war: ein massiger Mann Mitte vierzig, in Lederjacke, Hemd und Jeans, das wellig dunkle Haar zurückgekämmt. Er lächelte mir zu, nickte. Als Regionalchef vertrat er jetzt die Versicherung, die abgelehnt hatte, für eine Kostenübernahme zuständig zu sein.
Wir wurden in den Gerichtssaal geführt, nahmen vor dem Tresen Platz, an dem, flankiert von zwei Fachrichtern, der Gerichtspräsident saß. Es gehe um die Befragung der Parteien – und nachdem das Prozedere erläutert, die zugezogenen Experten vorgestellt worden waren, wurde der Fall summarisch zusammengefasst: von den Sanierungsarbeiten an der Terrassenmauer, ihrem Einsturz während eines Hochwassers und der Wiederherstellung einer heute sicheren Wohnlage. Ich wurde vom Gerichtspräsidenten angesprochen, und obwohl vereinbart gewesen war, dass lediglich unser Anwalt Auskunft geben solle, bedeutete er mir mit einem Blick zu reden.
Ich hatte mir in den vergangenen Monaten die Hochwasserzahlen besorgt, die mehrjährige Entwicklung der Durchflussmengen studiert, machte mich über die geologische Formation im Uferbereich kundig, hatte die alten Unterlagen über die Felssprengungen während des Kraftwerkbaus herausgesucht. Nun begann ich die Erkenntnisse zu erläutern, die ich aus meinen Studien gezogen hatte.
Die Gegenseite, nachdem ihr das Wort zur Stellungnahme gegeben wurde, widersprach. Was ich vorgebracht habe, seien nicht zu belegende Vermutungen. Es habe nach ihren Kenntnissen zu dem Zeitpunkt kein Hochwasser gegeben, von Felsabbrüchen im Untergrund der Mauer sei nichts bekannt, und unsere Sanierungsmaßnahmen vor dem Einsturz hätten offenbar nicht die gewünschte Stabilisierung erbracht. Es sei, ihren Einschätzungen zufolge eine alte Mauer gewesen, der Schaden altersbedingt und deshalb auch nicht versichert.
Während der Anwalt der Gegenpartei seine Argumente vorbrachte, blickte ich auf die Papiere, die sich vor jedem im Saal stapelten. Ich hatte meinen Teil dazu beigetragen. Aus dem donnernden Zusammenbruch der Mauer, damals, an jenem frühen Junimorgen, waren im Verlauf des Prozesses Texte geworden. Sie hatten sich vom tatsächlichen Geschehen abgelöst, waren in der Zwischenzeit zu einer eigenen Wirklichkeit aus Wörtern geworden. Die Mauer bestand aus Beschreibung, das Wasser strömte in Kubikmetern pro Sekunde, die Terrasse war eine Jahreszahl und die Wiederherstellung des Balkons eine Geldsumme.
Während der Anwalt der Gegenpartei weitschweifig seine Argumente erläuterte, ergriff mich eine Heiterkeit. Wie die Akten, dachte ich, seien auch meine Romane, Erzählungen und Gedichte eigene, vom Erlebten abgelöste Wirklichkeiten. Sie hätten genauso eine Tatsächlichkeit aus Wörtern und Sätzen geschaffen, die für sich und unabhängig von ihrem Ursprung existierte, und ich hätte als junger Mann früh geahnt, dass es für mich leichter wäre, mich in Textwirklichkeiten zu bewegen als in einer mir oft fremd erscheinenden, unverständlichen Welt. Wenn ich beharrlich beim Schreiben geblieben war, dann aus der Überzeugung, mich einzig durch Schreiben – wie hier vor Gericht – in der alltäglichen Wirklichkeit behaupten zu können.
TEIL I Einschlagskrater
1
Ich hatte die Zeit zwischen zwanzigstem und vierzigstem Lebensjahr mit dem Versuch zugebracht, die Welt, in der ich mich bewegte, lesen zu lernen. Jetzt wollte ich sie mir erschreiben.
Ich hatte genügend Material gesammelt. In der Zeit am Gottlieb Duttweiler-Institut war ich mit den unterschiedlichsten Kreisen bekannt geworden und wollte nun einen Gesellschaftsroman über Intrigen und Machtspiele schreiben. Ich hatte Notizen und bereits den Titel: »Der Kongress«. Die Vorbereitung und Durchführung einer Zusammenkunft internationaler Exponenten von Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur gäbe die Dramaturgie des Romans, das allmähliche Aufdecken unlauterer Machenschaften den Plot. Die Hauptfigur, ein Kongressorganisator, wie ich es gewesen war, sollte sich mit Einflussnahme, Erpressung und der Vorspiegelung falscher Tatsachen auseinandersetzen. Dieser Thyl Osterholz, so nannte ich meinen Protagonisten, ein Narr und Heiliger, wäre Ermittler und Strippenzieher. Mir schwebte eine Figur wie Jack Burden im Roman »All the King’s Men« von Robert Penn Warren vor, der stets im Hintergrund, als Pressesprecher eines Gouverneurs, verfolgt, wie aus dem besorgten Bürger, der idealistisch sein Amt antritt, ein korrupter und machtbesessener Politiker wird.
Ein Jahr lang müssten meine Ersparnisse reichen, um ungestört arbeiten zu können. Pippa zöge von Aarau zu mir nach Zürich an den Heuelsteig, da sie seit dem Ende der »Innerstadtbühne« kein Engagement mehr hatte. Sie wollte künftig selbständig als Regisseurin arbeiten und nur vereinzelt noch Rollen als Schauspielerin übernehmen. Wir müssten sparsam leben, und obwohl meine Wohnung im ehemaligen Weinbauernhaus oberhalb des Römerhofs für zwei Personen zu klein war, richteten wir uns ein so gut es eben ging. Die Küche, ein gefangener Raum zwischen Flur und zwei Zimmern, bot nur gerade so viel Platz, dass man ohne einen Schritt zu machen alles erreichen konnte: den zweiflammigen Gaskocher, den Kaltwasserhahn über dem Spülbecken, das Regal mit den Vorräten und einen Schrank mit Geschirr. Die eine Kammer diente als Schlafzimmer, die andere – mit Großvaters Schiefertisch, den Bücherregalen und dem »Sägebock«, einen Ohrensessel, dessen angebliche Bequemlichkeit einem auch bei langweiligster Lektüre wach hielt – war Speise-, Wohn- und Pippas Arbeitszimmer. In der dritten Kammer standen mein »Schreibtisch«, eine Spanplatte auf zwei Holzböcken, dazu ein Bücherregal und ein Kleiderschrank, auf die ein schwacher Schein der Wärmelampen aus dem Terrarium mit den Leguanen fiel. Auch wenn es kein Warmwasser gab, kein Bad, und die Toilette außen neben der Treppe, war, liebten wir die Wohnung. Sie besaß eine Atmosphäre höhlenartiger Geborgenheit und war so günstig, dass wir auch bei längeren Einkommenslücken die Miete bezahlen konnten.
Ich sank ganz und gar in mein Romangeschehen ein. Die Szenen, die ich auf meiner alten Hermes Baby schrieb, nahmen eine Intensität an, die stärker als das Leben vor den kleinen, unterteilten Fenstern war, die wenig Licht einließen. Am Schreibtisch, im Kreis der Tischlampe, lebte ich in Zeilen mit Klebeband und Tipp-Ex. Zwischen Blatt und meinen Augen entstand das Büro im Industriequartier, wurde zu Wörtern wie »spinatgrüner Filzteppich«, auf dem mein damals altes Stahlpult stand. An ihm saß ich als Osterholz, zurückgelehnt im Drehstuhl, ohne Idee für einen nächsten Kongress, als ein Telefonanruf kam und eine Stunde später ein Mann, dem ich den Namen Jiri Loos in meinem Manuskript gab, am Besprechungstisch geheime Berichte von Untersuchungen ausbreitete, die eine Verunreinigung von Lösungsmitteln mit giftigen Substanzen bestätigten: ein Skandal vom Ausmaß der Giftfässer von Seveso. Jiri Loos’ Geschichte eines Angestellten, der im Konzern Alarm schlägt und nicht gehört wird, nahm ich als Ausgangspunkt der Romanhandlung um Umweltgifte, Vertuschung und Erpressung. Ich führte meinen Text eng an den Erfahrungen entlang, die ich am Gottlieb Duttweiler-Institut während der Vorbereitung des Kongresses »Chemie / Mensch / Umwelt« gemacht hatte. Während des Schreibens destillierten die Sätze das damalige Geschehen zu einer berauschenden Essenz. Ich verspürte kein Bedürfnis mehr, meine Klause zu verlassen, in die Stadt zu gehen, Leute zu treffen. Pippa war mit Vorbesprechungen, Recherchen, später mit Proben beschäftigt. Sie hatte für die neue Spielzeit einen Regieauftrag erhalten und würde »Der böse Geist des Lumpazivagabundus« von Nestroy am »Kellertheater Bremgarten« inszenieren. So hatte ich die Kammern am Heuelsteig die meiste Zeit für mich allein. Ungestört konnte ich meine Tage einteilen, die Zeit des Schreibens, die Zeit der Lektüre, und es gab Wochen, in denen ich kaum einmal einen Schritt vor die Haustür machte, es sei denn, um eine Dose Ravioli im Coop-Geschäft zu holen.
Doch das Alltagsleben kam zu mir, drang durch einen Jungen, der quer über der Straße wohnte, in meine Abgeschiedenheit ein. Er hieß Nils und war der Sohn eines Kollegen aus der Seminarzeit. Alex Melzer und ich hatten uns zufällig auf der Straße getroffen und herausgefunden, dass Alex keine hundert Meter von meiner Heuelhöhle entfernt an der Bergstrasse wohnte. Ich war damals frisch am Gottlieb Duttweiler-Institut angestellt gewesen, Alex hatte eine Assistenzstelle an der Eidgenössischen Technischen Hochschule und beschäftigte sich mit ökonomischen Strategien im Umkreis der Club-of-Rome-Forschung zu den Grenzen des Wachstums. Wir trafen uns nach dieser ersten, zufälligen Begegnung regelmäßig, philosophierten über die Auswirkungen, welche die Aufhebung der letzten Reste des Goldstandards auslösten und wie nach der Ölkrise 1973 ein zunehmender Vorrang der Ökonomie die Gesellschaft in allen Lebensfragen zu verändern begann. Als Alex in Manila eine Stelle bei der Internationalen Entwicklungsbank annahm, wirtschaftliche und soziale Förderprojekte in den Ländern Asiens umsetzte, klopfte sein Sohn Nils, der mit seiner Mutter in der Schweiz geblieben war, an die Wohnungstür und wollte wissen, weshalb es bei uns keine Abenteuer mehr gebe. Es sei langweilig. Was geschehe, bleibe vorhersehbar. Irgendwie müsse das Leben doch spannend sein. Nils fand sein Schelmenstück, beim Metzger am Römerhof kurz vor Mittag ein Fünfzigrappenstück auf den Tresen zu legen und mit großen Hungeraugen zu fragen, ob es dafür Salami gebe, kein wirklich großes Abenteuer. Er zog zwar regelmäßig mit einem Packen seiner Lieblingswurst ab, klimperte mit dem eingesparten Mittagsgeld in der Hosentasche – »doch es geht zu einfach, beim letzten Mal hat der Metzger mir die Salami sogar geschenkt!«
Das Abenteuerliche, das Spannung in den Alltag brachte, beschäftigte uns beide, Nils, weil er sich nach heldenhaften Taten sehnte, mich, weil ich einen Gesellschaftsroman zu schreiben begonnen hatte. Ich verschwieg, dass ich durch meine Erfahrungen zur Ansicht gelangt war, in einer saturierten Gesellschaft, ohne Mythen und existentielle Stoffe, lägen die Abenteuer einzig noch in den gesetzlichen Randzonen, die Nils mit seiner Schlaumeierei, das Sackgeld einzusparen, nur streifte. Während ich herausfinden wollte, wie durch den Bruch des Geregelten und Gewohnten erst Dramatik entsteht, segelte Nils auf Abenteuersuche mit Emilio Salgaris Buch »Sandokan – Die Tiger von Mompracem« in den südasiatischen Gewässern, unweit der Philippinen, wo sein Vater sich aufhielt. Nils kämpfte in seiner Lektüre unter der Bettdecke gegen britische Kolonialherren, sein Vater Alex in den Institutionen gegen westliche Fehlkonzepte, und ich war überzeugt, es müsse eine neue Art von Kriminalliteratur geben. Diese setzte sich nicht mit physischen, sondern geistigen Verbrechen auseinander, die zwar in keinem Strafgesetzbuch vorkamen, doch in unserer Gesellschaft verbreitet waren. Dieses Thema wollte ich in meinem Roman herausarbeiten.
Das rauschhafte Schreiben war längst zu nüchterner Textarbeit geworden. Ich fühlte mich unsicher, wo ich verknappen, wo ich mehr ausführen sollte. Wie konnte ich ein Geschehen für den Leser verständlich machen, der mit dem Milieu, den Akteuren im Duttweiler-Institut nicht vertraut war. Ich strich, fügte hinzu und beschloss nach dem geplanten Jahr Arbeit am Roman, auch das folgende mit meinen Schreibprojekten zu verbringen. Meine Ersparnisse waren weniger geschrumpft, als ich erwartet hatte, und Pippa verdiente mit ihren Regiearbeiten zwar wenig, doch das Geld reichte, um unsere Kosten anteilig zu tragen. Zudem erhielt ich dank der Zeit am Gottlieb Duttweiler-Institut ein paar Folgeaufträge, wurde als Referent nach Salzburg zu einem Symposium zu Ehren des Philosophen Leopold Kohr eingeladen, bekam etwas Sitzungsgeld als Stiftungsrat der »Schweizerische Energie-Stiftung«, die ich in den Siebzigerjahren mitbegründet hatte. Nach einem weiteren Jahr konzentrierter Arbeit wollte ich meinen Roman beendet haben. Gelänge es, ihn kurz danach zu publizieren, so hoffte ich, könnte ich mich noch etwas länger in finanzieller Unabhängigkeit und Freiheit halten.
Pippa las das fünfhundert Seiten starke Manuskript während der Ferien. Ein Bekannter hatte uns ein Zimmer in seinem Haus auf Mljet, einer Insel vor Dubrovnik, überlassen. In dieser von Föhren und weißem Gestein geprägten Landschaft, in der azurblau das Wasser durch die Zweige und Nadelbüsche leuchtete und im Verlaufe des Nachmittags mehr und mehr gehämmertem Silber glich, lag Pippa in ihrem Liegestuhl und las. Ich war überzeugt, sie müsste von meinem Roman begeistert sein, ihn vielleicht sogar bewundern. Eine Spannung blieb dennoch, auch wenn ich schon Pippas lobende Kommentare hörte. Eine Spur Unsicherheit ließ mich beim Herumschlendern am Strand öfter zu Pippa und dem Manuskript hinüberblicken: Sie las, gut, gut, sie las!
Hatte der Apostel Paulus, wie die Sage ging, auf Mljet Schiffbruch erlitten, so tat ich es ihm mit meinem Romanmanuskript gleich. Pippa fand den Text nicht wirklich gelungen. Die Geschichte sei zwar »interessant«, doch die Hauptfigur finde sie unsympathisch. Sein besserwisserisches Kommentieren, sein Machogehabe gehe ihr auf die Nerven. Ich argumentierte und verteidigte. Mein Held müsse ein harter Bursche sein, schließlich bewege er sich auf gefährlichem Terrain: Industriebosse seien in ihrem Handeln unzimperlich, würden sie angegriffen. Was also müsste ich ändern?
Das südliche Eiland verdunkelte sich. Ich hockte vor dem Haus, brütete vor mich hin. Wie ließe sich dieser Osterholz, der ich doch auch selber war, sympathischer darstellen?
Zu Hause begann ich sofort mit Überarbeiten, schrieb den ganzen Winter durch an einer neuen Fassung. Doch auch diese fand keine Gnade vor Pippas im Theater geschultem Blick. Thyl Osterholz habe kein Privatleben, man wisse nicht, wo und wie er wohne, ob er Familie habe oder allein sei und welche anderen Interessen er außer Intrigen, Machtspielen und faulen Tricks habe.
Pippa hatte mit ihrem Einwand recht. Dieser Osterholz war ausschließlich mit seinem »Fall« beschäftigt, reiste herum, führte Gespräche, saß im Büro, doch ohne je die Kleider zu wechseln, ein Spiegelei zu braten, sich mit einer Frau zu treffen. Ich müsste eine zusätzliche Ebene in den Text einarbeiten. Ein Privatleben, das Auswirkungen auch auf das gesamte Romangefüge haben würde und ein weiteres Jahr konzentrierten Arbeitens am Roman nötig machte. Finanziell ließ sich dies deshalb verantworten, weil sowohl bei Pippa wie bei mir Bewegung in unsere selbständigen Tätigkeiten gekommen war. Ich hatte den Auftrag erhalten, eine Expertise zu einem geplanten Lektorat Schweiz des S. Fischer Verlags, Frankfurt, zu verfassen. Mit meiner Abklärung überzeugte ich Frau Schöller und den Verlagsleiter Erb, dass es sich um eine Fehlinvestition handeln würde, wenn in der Schweiz ein Lektorat eingerichtet würde. Es ist zu wenig Substanz vorhanden, um ein größeres Programm zu realisieren , stand in meinem Papier, eine Einschätzung, die mich um eine einträgliche Stelle brachte. Doch ich wollte schreiben und keine feste Anstellung. Mein Band Märchen »Prinz Ramins Garten« erschien, ich verfasste für die Zeitschrift »OMNI« gut bezahlte Glossen, erhielt vom »Aargauer Kuratorium« ein Werkjahr für die Weiterarbeit am Romanmanuskript »Der Kongress«. Wenn Pippa auch weiterhin regelmäßig Aufträge als Regisseurin bekäme, ich Glossen und Artikel neben der Arbeit am Roman schriebe, ließe sich vielleicht eine freiberufliche Existenz aufbauen, und wir könnten uns ohne feste Anstellungen finanziell durchbringen.
2
Die Tage Mitte Februar waren kalt. Das Wasser gefror in der Toilette, unsere Gusseisenöfen hielten die Räume kaum noch warm. Wir hatten meine Mutter besucht, kamen abends nach Hause, und ich legte Kohlebriketts in den Öfen nach. Pippa richtete sich im Wohn-Ess-Arbeitszimmer mit einem Glas Tee und einer Banane im »Sägebock« ein. Sie wolle noch lesen. Ich war müde und etwas ungehalten: Bestimmt würde ich nicht mehr einschlafen können, wenn sie spät ins Schlafzimmer käme und mich weckte. Ich drehte in der Küche die Flammen des Gaskochers ab, die ich zum Wärmen hatte brennen lassen, sah im Ausschnitt der Tür Pippa lesend im Rund der Deckenlampe vor den nachtschwarzen, spiegelnden Scheiben sitzen, wandte mich ab und ging den kurzen Flur zur Schlafkammer. Es sollte der letzte Blick in unser bisheriges, gemeinsames Leben gewesen sein.
Zwischen zwei und drei Uhr früh erlitt Pippa eine Hirnblutung, lag zur Hälfte aus dem Bett gerutscht am Boden, stöhnte, schlug um sich, und grell durchzuckte mich ein Gedankenblitz: Es ist passiert! Überwach begann mein Körper zu handeln, selbsttätig, durch ein Hirn gesteuert, das emotionslos einen Katalog von Maßnahmen abhakte wie Notanruf, Symptome beschreiben, Weg erklären. Ich war ein Jemand, der sich über das schmerzverzerrte Gesicht beugte, Wörter flüsterte, kühle Waschlappen auf die Stirn legte, die schlagenden Bewegungen des einen Arms zu beruhigen suchte. Ich bestand aus Blicken, die aus dem Innern des erleuchteten Krankenwagens hinaus ins Dunkel gingen, in verlassene, leere Straßen, über die hinweg das Blaulicht kreiselte, funktionierte als ein Haufen koordinierter Zellen, der hinter der Bahre durch Korridore des Krankenhauses lief, bis dieser Körper, der mein Körper war, auf einer Bank gegenüber dem Untersuchungszimmer, in den Zustand apathischer Betäubung schaltete.
Auch da hatte es einen letzten Blick gegeben, als ich aus dem Untersuchungszimmer weggewiesen worden war und sich die Schiebetür zu schließen begann. Im Schein einer Lampe beugte sich der Arzt über Pippa, schrie sie an, ohrfeigte sie, dann hatte sich die Tür geschlossen, war nichts mehr als der leere Flur im flirrenden Neonlicht.
Nach einer Stunde wurde ein Bett an mir vorbeigeschoben, Pippa lag jetzt ruhig in weißen Laken, und ich schaute dem Gefährt nach, als wäre es bereits eine Erinnerung, die ich vergegenwärtigen müsste, Geschehnis einer Vergangenheit, die nicht mehr zu ändern war, jedoch meine Kehle zuschnürte, Tränen hervorpresste, den Magen anhob: Pippa, die am Boden lag und die ich anrief, ohne dass meine Stimme zu ihr in die Tiefe drang.
Nach drei weiteren Stunden, gegen sieben Uhr, verließ ich die Klinik, ohne mit jemandem gesprochen zu haben, ohne zu wissen, wo Pippa sich jetzt befand. Ich lief die Straßen entlang, durch die wir nachts gefahren waren. Zu Hause stand ich in der Schlafzimmertür, sah auf das Bett und die verrutschte Decke, in der noch Pippas Umriss eingedrückt war.
Ich erledigte Telefonanrufe, sagte Termine ab, begab mich dann in mein Arbeitszimmer. Durch die Fenster fiel graues Morgenlicht. Der Schreibtisch, die Bücher und Manuskripte, mein Lesestuhl, das Terrarium mit den Leguanen sahen mich fremd an, befanden sich außerhalb eines mich umgebenden Hofs von Gefühllosigkeit. Ich hörte den Verkehrslärm von der Straße, lauschte auf die Geräusche aus den Räumen des Tuchhandels im Haus – Geräusche einer geschäftigen Welt, der ich mich nicht mehr angehörig fühlte.
Gegen Mittag ging ich vom Heuelsteig zu Fuß zum »Pfauen«, um von dort mit der Straßenbahn zur Universitätsklinik zu fahren. Vor der Auslage der Buchhandlung »Kellerhals« am Schauspielhaus blieb ich stehen. Ich sah auf die Bücher in farbigen Umschlägen mit weißen oder schwarzen Schriftzügen. Ich sah auf die Bücher wie auf Zeichen eines künftigen Lebens, betrat den Laden, kaufte ein Taschenbuch, das ich in der Auslage gesehen hatte, von dem ich weder den Autor noch den Titel kannte. Beim Verlassen der Buchhandlung schob ich die Tüte mit dem Buch in die Manteltasche, und diese Geste, scheinbar selbstverständlich, löste in mir eine Empfindung aus, als gehöre sie zu einer Figur, die ich einst selbst sein würde, in einem neuen, erst zu entdeckenden Dasein: Es hatte heute Nacht begonnen, und mein Lebensraum würden die Seiten zwischen zwei Buchdeckeln sein.
Dieser Gedanke, der sich mir beim Hineinschieben des Buches in die Manteltasche aufgedrängt hatte, sank in mich ein, verhärtete sich zu einer Überzeugung, gegen die ich mich wehrte. Ausgerechnet dieser katastrophale Einbruch in Pippas und mein Leben sollte mich zum Schreiben führen, mich zum Schriftsteller machen? Im Tausch zum möglichen Tod Pippas? Jenem Menschen, der mir wie kein anderer im Leben nahe war?
Pippa lag in einem Zimmer der neurophysiologischen Abteilung im vierten Stock. Sie hatte eine außerordentlich starke und schwer zu stillende Blutung in der rechten Hirnhälfte erlitten, war im Koma, und der Arzt sagte, dass die nächsten Tage entscheidend sein würden: Erwache die Patientin nicht im Lauf einer Woche, dann … Er zuckte die Achseln, schüttelte leicht den Kopf.
Ich saß bis am Abend an Pippas Bett, ging am nächsten Tag schon frühmorgens wieder hin, hielt Wache und zählte die Tage. Jeden Morgen öffnete ich erwartungsvoll die Tür ihres Krankenzimmers, spürte den Stich Enttäuschung, wenn ich sie unverändert daliegen sah. Die Zeit wurde kürzer, in der Pippa erwachen sollte. Reglos lag ihr Kopf auf dem Kissen, die Haare aufgelöst, der Mund halb offen. Der Atem ging stoßweise ein und aus. Über ihr lief der Kathodenstrahl, zog seine Linie in gleichförmigem Rhythmus. Die Tropfen aus dem Plastikbeutel zählten die Minuten, und im Fenster hing ein Nebelgrau, das heller wurde und wieder eindunkelte, und im Aufzucken des Neonlichts spiegelnde Schwärze wurde. Ich verließ das Zimmer, trottete nach Hause, und es weinte in mir schmerzlich beklemmend in der Brust.
Als dränge durch Pippas Hand, die ich während meiner Besuche durch das aufgezogene Gitter hielt, ihre Bewusstlosigkeit auch in mich, saß ich für Stunden einfach da, lauschte auf ihre Atemzüge, blickte durch das Fenster in die Baumspitzen und zur Kuppel der Universität hinüber. In diese mir ferne Welt müssten wir wiederum zurückfinden, zurück in das eben erst begonnene selbständige Arbeiten, zu Pippas Regieprojekten, zu meinem Schreiben. Und ich beugte mich tief über ihren Kopf, redete auf sie ein, eindringlich, doch nicht laut, flüsterte, sie solle von dem Ort zurückkommen, an dem sie jetzt weile. Wir wollten doch unsere Wege gemeinsam weitergehen, das sei doch stets das innerste Versprechen aneinander gewesen. Ich wolle mit ihr weitergehen … und es dauerte einen Moment, bis Pippa antwortete: Ich verspürte einen leichten, doch deutlichen Händedruck.
3
Eine Woche war vergangen. Noch immer lag Pippa bewusstlos da, die Lider geschlossen, voll feiner Fältchen. Ihre Schwester und ich harrten am Bett aus. Ich flehte sie an, endlich aus der Schlucht heraufzukommen, in die sie gestürzt sei, aufzuwachen, die Augen aufzuschlagen. Es wurde Nachmittag, ging auf drei Uhr. Als wartete Pippa den letzten Moment ab, um in die Tagwelt zurückzukehren, begannen plötzlich ihre Lider zu flimmern. Ich beugte mich vor, wollte sehen, ob tatsächlich eine Regung die feine Haut durchlief. Da zerrten zwei, drei Zuckungen an den Wimpern, Pippa schlug die Augen auf, blickte erstaunt ins Zimmer. Doch sogleich verzerrten sich die Gesichtszüge zum Ausdruck heftigen Schmerzes. Sie warf den Kopf zur Seite, die Augen zugepresst. Nach einer Weile öffnete Pippa sie erneut, sah uns an. Sie versuchte zu sprechen, konnte es nicht, hob die rechte Hand, deutete auf sich und machte eine abwehrend verneinende Geste zu uns hin, die bedeuten sollte: »Bin kaputt!« Sie zeigte auf mich und ihre Schwester, wir sollten uns zusammentun, mit ihr könnten wir nicht mehr rechnen. Und wieder das Zeichen: »Bin kaputt!«, und Pippa wandte den Kopf ab.
Was sie gesehen hatte, nachdem sie aus dem Koma erwacht war, musste erschreckend gewesen sein, zumal sie es nicht äußern konnte. Sie verlangte am nächsten Tag Papier und Stift, wollte aufschreiben was sie quälte. Pippa schrieb, schrieb ohne abzusetzen in Wiederholung und Wiederholung von »Silsilsilsilsil-benbenbenben …« Eine lange, sich senkende Zeile.
Sechs Wochen verblieb Pippa auf der neurologischen Abteilung der Universitätsklinik. Am Morgen auf dem Hinweg, am Abend nach den Stunden im Krankenzimmer verweilte ich im Park, der die Spitalgebäude umgab. Ich schlenderte im Dämmerlicht die Wege entlang, blieb stehen, setzte mich trotz der Kälte oftmals auf eine Bank, blickte zu den erleuchteten Fenstern hoch, lauschte dem Verkehrslärm der Stadt. Ich befand mich mit kahlen Bäumen und immergrünen Büschen in einem Dazwischen, war noch nicht im Lebensgedränge draußen, hielt mich jedoch auch nicht mehr im »Vorhof des Todes« drinnen auf, wie ich die Klinik nannte. Wie würde möglich werden, mich von diesem Nullmeridian fortzubewegen und erneut herzustellen, was ich doch zu einem Teil bereits erreicht hatte, nämlich das Gleichgewicht zwischen Rückzug und dem Versuch, mich in der Welt durchzusetzen? Wie gelänge es, zur konzentrierten Arbeit am Roman und zum Abarbeiten von bezahlten Aufträgen zurückzufinden? Und ließe sich fortsetzen, was Pippa und ich uns erhofft hatten, nämlich uns auch weiterhin, ohne feste Anstellungen, in freiberuflicher Tätigkeit durchzubringen?
Am Abend aß ich am Schiefertisch ein paar Brote. Danach stellte ich mich ans Fenster meines Arbeitszimmers, sah zwischen den Vorhängen hinaus in die Nacht, wartete, lauschte in die Stille der Wohnung. Nein, nichts hielt mich hier, im Gegenteil, die Erinnerung an die Nacht von Pippas Hirnblutung trieb mich hinaus.
Ich fuhr nach Bremgarten, verbrachte die Abendstunden im »Theater am Spittel«, einem Kellertheater, dessen Leiter ich kannte. Ich besuchte Premièren, sah manche Stücke zwei, drei Mal an, blieb nach den Vorstellungen im Foyer zurück, in einer stets gleichen Gesellschaft von theaterbegeisterten Gymnasiasten, aber auch gut situierten Leuten mittleren Alters, zu denen sich die Schauspieler und Musiker gesellten. Es wurde geflirtet, getrunken, getanzt und der neueste Kleinstadtklatsch verhandelt, und ich mischte mich unter die Besucher, bis die Betäubung wich, ich wiederum am Steuer meines Autos saß, mit den Tränen kämpfte, aus Trauer, aus Selbstmitleid, auch aus Neid auf die jungen Menschen, die wie Pippa und ich damals in unserer Dachkammer, von ihrem Aufbruch ins Berufsleben, von ihren Plänen und Zielen erzählten, von glänzenden Zukünften, auf die sie hofften.
Nachts lag ich wach. Bilder kamen in mir hoch, die ich in einem Fotobuch gesehen hatte: Aufnahmen einer Kraterlandschaft, entstanden durch den Einschlag eines Asteroiden, aufgerissene Erde, zerstörte Vegetation, ein riesiger Trichter, dessen Ränder erodierten – und ich sah im nächtlichen Dunkel diese verwüstete Landschaft vor mir, die doch in mir war, schaute vom Kraterrand in den eingeschlagenen Trichter, aus dem Rauch und Dämpfe quollen. Über dieses Bild spannte sich ein Koordinatennetz von einst regelmäßigen Maschen, als sollte es vermessen werden. Dieses Netz war jetzt gestaucht, verzerrt, an anderer Stelle überdehnt oder gar zerrissen. Das bisherige Geflecht ausgeglichener Beziehungen war zerstört, und ich fürchtete, in dem Einschlagsgebiet gehorchten die Dinge nicht mehr den üblichen Gesetzen. Sequenzen aus Tarkovskis Film »Stalker«, den ich vor einigen Jahren gesehen hatte, überlagerten die Bilder aus dem Fotobuch, und ich erinnerte mich des Mottos: »… was es war? Der Fall eines Meteoriten? Der Besuch von Bewohnern des menschlichen Kosmos?« Auch ich müsste wie der »Stalker« in die ZONE