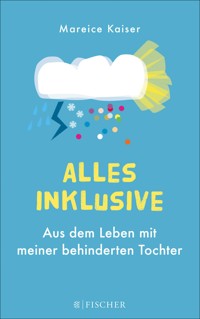14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Versorgerin, Businesswoman, Mom I'd like to fuck – Mütter sollen heute alles sein. Dass darunter ihr Wohlbefinden leidet, ist kein Wunder. Mareice Kaiser, Journalistin und selbst Mutter, stellt immer wieder fest: Das Mutterideal ist unerreichbar und voller Widersprüche. Nichts kann man richtig machen und niemandem etwas recht. Mutterschaft berührt dabei, natürlich, jeden Lebensbereich: Denn egal, ob es um Arbeit, Geld, Sex, Körper, Psyche oder Liebe geht – Stereotype, Klischees und gesellschaftlichen Druck gibt es überall, auf Instagram, im Bett und im Büro. Mareice Kaiser zeigt, wo Mütter heute stehen: noch immer öfter am Herd als in den Chefetagen. Und, wo sie stehen sollten: Dort, wo sie selbst sich sehen – frei und selbstbestimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mareice Kaiser
Das Unwohlsein der modernen Mutter
Über dieses Buch
Versorgerin, Businesswoman, Mom I’d like to fuck – Mütter sollen heute alles sein. Dass darunter ihr Wohlbefinden leidet, ist kein Wunder. Mareice Kaiser, Journalistin und selbst Mutter, stellt immer wieder fest: Das Mutterideal ist unerreichbar und voller Widersprüche. Nichts kann man richtig machen und niemandem etwas recht. Mutterschaft berührt dabei, natürlich, jeden Lebensbereich: Denn egal, ob es um Arbeit, Geld, Sex, Körper, Psyche oder Liebe geht – Stereotype, Klischees und gesellschaftlichen Druck gibt es überall, auf Instagram, im Bett und im Büro. Mareice Kaiser zeigt, wo Mütter heute stehen: noch immer öfter am Herd als in den Chefetagen. Und, wo sie stehen sollten: Dort, wo sie selbst sich sehen – frei und selbstbestimmt.
Vita
Mareice Kaiser, Jg. 81, Journalistin, Autorin und Kolumnistin, lebt in Berlin und im Internet. Seit März 2020 ist sie Chefredakteurin des Online-Magazins EDITION F. Mit ihrem Blog «Kaiserinnenreich» wurde sie 2014 mit dem Newcomer-Preis der Goldenen Blogger und 2015 mit dem Bestes-Tagebuch-Preis der Goldenen Blogger ausgezeichnet. Für ihr gesellschaftliches Engagement erhielt sie 2017 den Blogfamilia Award. 2018 wurde sie mit ihrem Artikel «Das Unwohlsein der modernen Mutter» für den Deutschen Reporterpreis nominiert.
Ich
In der Rushhour des Lebens, genau da bin ich gerade. Ich bin auf meinem Fahrrad, ich bin auf Instagram. Ich schmiere ein Schulbrot, ich schreibe einen Tweet. Ich mache Fotos, ich höre Musik, ich singe, ich tanze, ich poste eine Instagram-Story. Ich gehe nicht ans Telefon, ich schreibe Telegram-Nachrichten, ich lese Nachrichten, ich höre Podcasts. Ich date, ich küsse, ich arbeite, ich gehe einkaufen. Manchmal bin ich krank. Dann gehe ich spazieren, wenn es wieder geht.
Ich mache Überweisungen, ich mache mir Gedanken. Ich habe Sex, ich habe Hunger, ich will alles verstehen. Ich rede, ich höre zu, ich unterbreche, und ich lasse mich unterbrechen. Ich räume die Spülmaschine ein und die Waschmaschine aus. Ich sollte meine Eltern mal wieder anrufen. Ich mache mir Sorgen, ich mache mir ein Brot. Ich hole mein Kind von der Schule ab, ich bestelle Dinge, ich putze das Klo. Ich müsste mal wieder saugen und zum Zahnarzt. Ich bringe mein Kind ins Bett und schlafe ein. Ich liebe, ich lache, ich laufe. Die Gleichzeitigkeit von allem, oder: mein Leben.
Ich bin nicht allein. So, wie es mir geht, geht es auch meinen Freundinnen, die Mütter sind. Meine Freundinnen, vor allem die, die auch Mütter sind, sehe ich selten. Meistens schreiben wir uns iMessages oder bei WhatsApp oder auf Instagram. Am meisten Zeit verbringe ich mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Mit denen ich mittags essen gehe. Und mit meinem Kind. Sie sind, so wie die Verkäuferinnen meiner Bäckerei, die Konstanten in meinem Leben. Und die Sorgen.
Die Sorge, meinem Kind nicht gerecht zu werden. Die Geldsorgen. Die Sorge um mein Kind. Manchmal frage ich mich, wie verantwortungsvoll es war, ein Kind in diese Welt zu setzen. Diese Welt, die es so, wie sie gerade ist, bald nicht mehr geben wird, wenn wir weitermachen wie bisher. Eine Welt in der Klimakrise. Dann die Sorge, nicht genug zu machen aus meinem Leben. Könnte ich mehr tun, mehr erreichen, mehr bewegen? Die Sorge um meinen Körper.
Meine Wohnung sieht nicht so schön aus wie die Wohnungen auf Instagram, mein Bauch ist schwabbeliger als die Bäuche, die in Magazinen zu sehen sind. Ich schlafe oft ein, während ich meine Tochter ins Bett bringe. Ich bin so müde. Dabei will ich mehr schreiben und mehr tanzen und singen, wieder singen. In der Realität bin ich froh, wenn ich es schaffe, meine Fingernägel zu schneiden und manchmal, wenn es richtig gut läuft, sie zu lackieren.
Und ja, ich kenne all die Feel-good- und Selfcare-Sprüche, und ich weiß, dass ich nicht alles schaffen muss. Dass es okay ist, an den eigenen Ansprüchen zu scheitern. Dass es okay ist, die Fingernägel nicht zu lackieren. Dass alle die gleichen Probleme, ähnliche Sorgen haben. Dass Fehler und Unzulänglichkeiten mich smarter machen. Bei anderen kann ich das genau so sehen. Mit mir selbst bin ich weniger nachsichtig. Meine Sorgen bleiben.
Nur manchmal, für kurze Momente, oft mit meiner Tochter, sind sie weg. Momente, in denen sie Dinge sagt wie: «Mama, Kindsein ist wunderschön», und fragt: «Mamasein bestimmt auch, oder?»
Ja. Ich liebe es, Mutter zu sein. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, Mutter zu werden. Dabei war Kinder zu bekommen kein zwingender Teil meines Lebensplans. Ich dachte nicht: Davon hängt mein Lebensglück ab. Aber ich hatte Lust darauf. Lust darauf, mit diesem Mann ein Kind zu machen. Und dann noch eins. Und für beide Sorge zu tragen.
Als ich Mutter wurde, wurde ich es mit aller Wucht. Meine erste Tochter kam mit einem seltenen Chromosomenfehler und dadurch mehrfach behindert zur Welt. Mit ihrer Geburt wurde ich zur Übermutter gemacht. Denn Eltern behinderter Kinder – und vor allem ihre Mütter – werden, ob sie wollen oder nicht, auf einen Sockel gestellt. Ein Sockel aus Mitleid und Ehrfurcht. Ihr Vater und ich waren nicht nur ihre Eltern, sondern auch ihre Pflegerin und ihr Pfleger. Zuletzt waren wir ihre Sterbebegleiterin und ihr Sterbebegleiter.
Über die vier gemeinsamen Jahre mit meiner ersten Tochter habe ich in einem anderen Buch geschrieben. Mein Leben und auch das Buch, welches Sie jetzt in den Händen halten, ist geprägt durch die Zeit mit ihr. Ich weiß, wie es ist, das eigene Kind zu verlieren. Ich weiß auch, wie es ist, nicht mehr zu können. Und damit meine ich nicht, zu denken, nicht mehr zu können, sondern wirklich nicht mehr zu können. Körperlich und psychisch.
Ich weiß, wie es ist, mit einem Kind im Krankenhaus zu leben. Wie es ist, wenn das Kind im OP liegt und man bangt, ob es wieder aufwachen wird aus der Narkose. Wie es ist, als Mutter Mitleid für die Mutterschaft zu bekommen. Wie es ist, ein Kind zu lieben, bei dem andere fragen: Musste das denn sein?
Ich weiß den Wert des Lebens zu schätzen. Vor allem weil ich weiß, wie es ist, wenn das Leben wieder geht. Geblieben ist meine zweite Tochter, die gerade siebenjährig durchs Leben hüpft. Sie hat mich nicht zur Mutter gemacht, aber sie sorgt dafür, dass ich es im täglichen Handeln bleiben darf.
Mutter zu sein ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Es ist – und das schreibe ich auf die Gefahr hin, kitschig zu klingen – jeden Tag ein Geschenk für mich. Merken Sie sich diesen Satz gern für spätere Abschnitte dieses Buchs. Meine Liebe und meine Demut stecken in jedem Satz – auch in denen, in denen Sie sie vielleicht nicht vermuten.
Also: Ich liebe es, Mutter zu sein. Was ich nicht liebe: die Strukturen unserer Gesellschaft, die weder gemacht sind für Menschen mit Kindern noch für Kinder selbst. Und eine Gesellschaft, die Menschen in binäre Geschlechterrollen (Mann – Frau) einteilt und Frauen noch immer anders behandelt und bewertet als Männer.
Als Mutter spüre ich das alles, jeden Tag. Es wundert mich nicht, dass eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung belegt: In den sieben Jahren nach der Geburt eines Kindes verschlechtert sich das mentale Wohlbefinden von einem Drittel aller Mütter deutlich. Es handelt sich, so die Studie, um eine «substanzielle Verschlechterung». Das Unwohlsein der befragten Mütter äußert sich in drei Dimensionen: mentaler Stress, stressbedingter und sozialer Rückzug, depressive Verstimmungen und Angstgefühle.
Woran das liegt? Bei Müttern kommen mehrere Diskriminierungsformen zusammen: die Benachteiligung aufgrund des Geschlechts und die generelle Benachteiligung von Menschen, die mit Kindern leben und für sie sorgen. Bei vielen Müttern kommen noch weitere Diskriminierungen dazu. Schwarze Mütter, Mütter mit Behinderungen, geflüchtete Mütter, rassifizierte Mütter, alleinerziehende Mütter, trans Mütter, lesbische Mütter, nicht binäre Mütter, junge Mütter, alte Mütter, Adoptivmütter, Ko-Mütter.
Meine Perspektive ist die einer weißen, queeren cis Frau ohne Behinderung[*]. Einer Frau, die in einer heterosexuellen Beziehung selbstbestimmt Mutter geworden ist. Die zwei Kinder bekommen hat, von denen eins nicht mehr lebt. Meine Perspektive ist die eines Arbeiter*innenkindes, das nicht studiert hat.
Unsere zweite Tochter lebt die Hälfte der Zeit bei mir und die andere bei ihrem Vater, wir begleiten sie gemeinsam. Dieses Buch entsteht aus meiner persönlichen Perspektive mit journalistischem Blick und dem Bemühen, weitere Diskriminierungsformen mitzudenken und sichtbar zu machen. In der Hoffnung, dass es noch viele Bücher aus den verschiedensten Mütterperspektiven geben wird.
Denn Eltern – und vor allem Mütter – fehlen im gesellschaftspolitischen Diskurs. In der Literatur, in der Kunst, in der Musik, in den Medien. Noch immer werden mehr Bücher von Männern als von Frauen verlegt, noch immer schreiben die meisten Meinungsstücke in großen Medien Männer, noch immer werden mehr Männer in Galerien ausgestellt als Frauen, noch immer bestehen die Headliner-Bands bei Festivals vor allem aus Männern, noch immer machen vorwiegend Männer Politik. Männer denken, Männer schreiben, Männer machen Musik, Männer sind Fotografen, Männer sind Künstler, Frauen übernehmen (unbezahlte) Fürsorgearbeiten.
Dabei machen feministische Autorinnen seit Jahrzehnten darauf aufmerksam. Bereits 1929 (!) thematisiert Virginia Woolf in ihrem berühmten Essay Ein Zimmer für sich allein, was Frauen brauchen, um Protagonistinnen eines kulturellen Kanons zu sein. Das Zimmer steht für einen Rückzugsraum, für geistige Freiheit; dafür, einfach mal in Ruhe gelassen zu werden, um Denken zu können – um so mit den künstlerischen Ergebnissen dieses Denkens Teil der Kulturproduktion zu werden.
Woolfs Thema ist heute aktueller denn je. In einer Zeit, in der Mütter froh sind, wenn sie zwischen Lohn- und Care-Arbeit überhaupt noch Zeit finden, die grundlegenden Beziehungen zu Freund*innen und zu sich selbst zu pflegen, ist der Gedanke an kulturelle Teilhabe und Mitgestaltung weit entfernt – geschweige denn sind die Ressourcen vorhanden, sich öffentlichkeitswirksam über die gesellschaftlichen Bedingungen aufzuregen.
Apropos aufregen: «Gibt es denn auch ein Kapitel über Väter?», war die mir am meisten gestellte Frage, wenn ich von diesem Buch erzählt habe. Nein, es gibt kein Kapitel über Väter. Denn alles, was ich zur (Un-)Vereinbarkeit von Familie und Beruf schreibe, gilt für alle Eltern – unabhängig von ihrem Geschlecht. Bei Müttern kommen dann aber noch ein paar Themen dazu, wie Sie in den folgenden Kapiteln lesen werden.
Oft heißt es, die Väter hätten keine Rollenvorbilder und würden deshalb die veraltete Rolle des Ernährers erfüllen. Ich finde, es gibt genug Rollenvorbilder, an denen sich Väter orientieren können. «Die Frauen sind die Vorbilder», schreibt der Autor Till Raether. «Als ich meinen Elternzeit- und Teilzeit-Kram gemacht habe, waren es Frauen, die mir erklärt haben, was ich zu erwarten habe (Machtverlust, Prestigeverlust, Teamverlust usw.) und was es für Strategien gibt, damit umzugehen (loslassen, Umwege gehen, andere Prioritäten setzen, stur bleiben usw.). Das hat mir geholfen.»[1]
Um die Wahlfreiheit der Lebensgestaltung geht es in diesem Buch. Die Autorin Anna Menke stellt sie als Frage und in Anführungszeichen in ihrem Buchtitel «Wahlfreiheit» erwerbstätiger Mütter und Väter?. Darin schreibt sie: «Die erkämpften Emanzipations- und Gleichstellungsgewinne gebildeter, weißer Frauen der gehobenen Mittelschicht der letzten zwei Jahrzehnte scheinen sich vor allem auf die Partizipation von Frauen und Müttern an der bezahlten Erwerbsarbeit zu beschränken.»[2] Gleichberechtigung darf aber nicht nur bedeuten, dass Mütter einer Lohnarbeit nachgehen «dürfen», sondern dass sie in allen gesellschaftlichen Bereichen gleichberechtigt sichtbar sind und eine Stimme haben.
Sheila Heti, Autorin des Buchs Mutterschaft, schreibt in diesem Zusammenhang: «Mutter ist eine politische Kategorie und sie ist auch eine symbolische Kategorie. Eine Kategorie, in der viel Energie und Komplexität stecken, die genutzt werden können, um kraftvoller und kreativer in der Welt zu agieren, als wir es bisher gesehen haben.»[3]
Muttersein als politische Kategorie zu sehen, das erscheint mir logisch. Denn an Müttern sehen wir die Auswirkungen von Familien-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, und zwar von allen gleichzeitig. Wenn wir Mutterschaft als politische Kategorie verstehen, wird klar, wie wichtig Stimmen von Müttern sind. In der Politik, in der Literatur, in der Musik, in den Medien. Mutterschaft ist politisch.
In diesem Buch werfe ich einen Blick auf die moderne Mutterschaft. Wie modern ist die eigentlich? In welchen politischen Strukturen ist sie möglich? Wie frei und selbstbestimmt ist Mutterschaft heute? Wie wollen wir als Mütter arbeiten, Beziehungen führen, Sex haben, Sorgearbeiten aufteilen, Kinder begleiten, uns verwirklichen, Kunst machen, glücklich sein, leben? Um diese Fragen wird es gehen. Und um den Pullover, den Sie auf dem Cover sehen. Möchten Sie ihn tragen?
Damit dieses Buch entstehen konnte, hatte ich ein Zimmer für mich allein. Es wurde mir nicht geschenkt, ich musste es einfordern, immer und immer wieder. Und es gab Menschen, die mir einen Stuhl hingestellt haben. Die die Wände gestrichen und mir Snacks gebracht haben.
Dieses Zimmer ist ein Privileg. Und ich bin sicher: Die Welt wäre eine bessere, wenn alle Mütter solche Zimmer hätten. Und wenn sie sich diese Zimmer nicht immer wieder mühsam erkämpfen müssten.
Der Pullover
Es ist dieser Pullover aus dem Schaufenster. Ich bleibe stehen, sehe ihn an. Rosa, eigentlich gar nicht meine Farbe. Aber dieser hier, der könnte mir stehen. Edel sieht er aus, aber auch lässig, cool. Und weich, sehr weich.
Er passt zu einer Hose, vielleicht halb reingesteckt, aber auch zu meinem Lieblingsrock. Eigentlich passt er zu allem. In jedem Fall gut zu dunkelblauen und schwarzen Sachen. Caro hatte letztens einen ähnlichen an und sah verdammt gut in ihm aus. Er ist ziemlich teuer, aber der Preis schreckt mich nicht ab. Jetzt muss ich erst mal weiter.
Ich kann den Pullover nicht vergessen, suche und finde ihn online. Waschen wird wahrscheinlich schwierig, aber egal. Längst habe ich mich entschieden und klicke auf «in den Warenkorb». Ich male mir mich aus in diesem weichen Kuschelpullover. In einem Café, bei einem herbstlichen Spaziergang, in einem Museum vielleicht. Auf jeden Fall mit einem Lächeln. Erwachsen fühlt sich die Vorstellung von mir selbst in diesem Pullover an.
Dann kommt das Paket und ist größer als gedacht. Die Farbe ist genauso wie im Schaufenster. Ich befreie ihn aus dem Seidenpapier. Scheiße, ich glaube, der kratzt.
Ich ziehe den Pullover an, und scheiße, er kratzt wirklich. Und auch mit der Farbe bin ich jetzt unsicher. Sie ist wirklich ungewohnt. So schön wie bei den anderen sieht er an mir gar nicht aus. Vielleicht habe ich ihn falsch herum angezogen?
Ich verpasse die Rücksendefrist und ziehe ihn an, mit einem Longsleeve darunter, so geht es irgendwie. Nur am Hals kratzt er manchmal.
«Der steht dir aber gut, der Pullover», sagen die Leute. «Danke», sage ich und sage nicht, wie sehr ich in ihm schwitze.
Die Mutter
Man kann nicht über Mutterschaft schreiben, ohne über die eigene Mutter zu schreiben. Meine Mutter war immer da. Meine Mutter schmierte mir die Schulbrote und wartete mit dem Mittagessen auf mich. Meine Mutter ging im Sommer mit mir schwimmen und fuhr im Winter mit mir Schlitten. Meine Mutter lachte mit mir, hörte mir zu, tröstete mich, erzählte mir Geschichten. Meine Mutter brachte mich ins Bett, sie betete mit mir und ließ meine Kinderzimmertür einen Spaltbreit offen. Genau so, dass es nicht zu dunkel und nicht zu hell war. Meine Mutter war immer da.
Mein Vater war meist arbeiten. Wenn er zu Hause war, sollte ich ihn in Ruhe lassen, weil er müde war von der Arbeit. Sein Befinden hatte bei uns zu Hause immer oberste Priorität. War mein Vater gut gelaunt, durften wir es alle sein. War er schlecht gelaunt, was meist mit wenig Geld und viel Arbeit zu tun hatte, waren wir still. Wir wussten: Papa reißt sich für uns den Arsch auf. Für das abzubezahlende Haus, für unser Zuhause, für seine Kinder, also für meine Brüder und mich. Er hatte schon genug Stress, also sollten wir nicht noch mehr machen.
Meine Mutter war vor allem meine Mutter. Eine fürsorgliche Mutter – was sie sonst ausmacht, davon weiß ich nicht viel. Sie singt gern, sie lacht gern, und sie mag Blumen. Aber vor allem mochte sie es gern, Mutter zu sein. Eine gute Mutter zu sein war ihr Lebensziel. Der Tag, an dem ich auszog, so weit wie möglich weg, war ein trauriger Tag für meine Mutter. Für mich war es ein sehr glücklicher – endlich konnte ich raus aus diesem Dorf, raus in die Welt, raus zu den Möglichkeiten.
Im Sommer saß ich neben meinem Vater auf der Bank im Garten meiner Eltern. Meine Brüder waren da mit ihren insgesamt drei Kindern, mein Vater atmete erschöpft, er hatte gerade Volleyball mit seinen Enkelinnen gespielt. Wir sahen meinem Bruder dabei zu, wie er weiter mit den Kindern Bälle warf. «Ach, Mareice», sagte mein Vater. «Ich merke erst jetzt, was es bedeutet, sich wirklich um Kinder zu kümmern.» Und fügte hinzu: «Wenn ich eine Sache ändern könnte, dann wäre es das. Deine Mutter entlasten und mehr Zeit mit euch verbringen. Aber dafür ist es jetzt zu spät.»
«Was macht eine gute Mutter aus?», frage ich meine Mutter später. Meine Mutter sagt: «Da sein, wenn die Kinder dich brauchen. Alles dafür tun, dass die Kinder glücklich und zufrieden sind.» – «Meinst du, du bist eine gute Mutter?», frage ich sie. «Ach, ich weiß nicht», antwortet meine Mutter. «Ich würde sagen: Ich war bemüht», lacht sie. «Und was macht einen guten Vater aus?», frage ich meine Mutter. Sie überlegt kurz, dann antwortet sie: «Ach, eigentlich genau das Gleiche.»
Meine Mutter erzählt, sie wollte eigentlich fünf Kinder haben. «Es war einfach so ein Gefühl», sagt sie. «Und war Kinder zu haben dann so gut, wie du gedacht hast?» Sie antwortet mit einem langen und von Herzen kommenden: «Ja.» So ein Ja, das Menschen seufzen, wenn sie im Fernsehen einen Heiratsantrag bekommen.
Ob auch etwas nicht schön daran war, Mutter zu sein? Meine Mutter überlegt lange. «Nein, eigentlich nicht.» Für sie war es schön, das Schönste überhaupt. Und die Babyzeit, toll. Die riechen so gut, die Babys. Und es macht viel Freude, sich um sie zu kümmern. So spricht meine Mutter über ihre Mutterschaft. Nie würde sie jammern, nie klagen. Jedenfalls nicht vor mir.
Ich jammere oft, findet meine Mutter. «Du hast ja auch nicht gearbeitet», sage ich dann, um mich zu rechtfertigen, und sie antwortet: «Den Haushalt musste ich ja schon machen!» Damit hat sie natürlich recht. Und der Haushalt war immer tipptopp – anders als meiner jetzt, by the way. Meine Mutter beschreibt ihren Job als Hausfrau als große Freiheit. Und meint damit, dass sie nicht noch in ein Büro gehen musste oder zu einem anderen Job.
Nach der Geburt meiner Tochter war meine Mutter für einige Tage bei uns zu Besuch. Manchmal hatte ich das Gefühl, die Hebamme kam vor allem zur Betreuung meiner Mutter, so viele Fragen hatte sie.
«Ach, es ist in Ordnung, das Kind zu stillen, wenn es will?», war eine davon. Eine andere, ob das Familienbett – also das Konzept, dass Eltern und Säugling in einem Bett schlafen – wirklich okay sei. Es war, als würde sich meine Mutter jetzt, 33 Jahre nachdem sie das letzte Mal Mutter geworden war, ihre Legitimation holen für die Art, wie sie mit mir und meinen Brüdern umgegangen war. «Mir haben immer alle gesagt, ich muss aufpassen, meine Kinder nicht zu verwöhnen.»
Heute wäre sie vermutlich eine der bedürfnisorientierten Mütter auf Instagram, doch früher war sie geprägt von einer anderen Muttererzählung. Meine Mutter ist 1950 geboren und damit eine von vielen Müttern und Müttergenerationen, die beeinflusst waren vom nationalsozialistischen Mutterbild. «Das ist ja krass», sagt sie zu mir, als ich ihr erzähle, in welchem Zusammenhang ihre Glaubenssätze in Sachen Kindererziehung mit den Erziehungsideologien der Nazis stehen.
Stellvertretend für diese Zeit und ihre Erziehungsmethoden steht das Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Haarer. Das Buch der Ärztin war während der Nazizeit ein Bestseller und wurde in abgemilderter Form bis in die 1980er Jahre verkauft. Haarer propagiert darin eine strenge und unerbittliche Erziehung von Kindern, und zwar von Anfang an: Mutter und Kind sollen direkt nach der Entbindung getrennt werden, das Kind soll der Mutter im Wochenbett «nur zum Stillen gereicht» werden. Nachts gelte: «Schreien lassen! Jeder Säugling soll von Anfang an nachts allein sein. (…) Nach wenigen Nächten (…) hat das Kind begriffen, daß ihm sein Schreien nichts nützt, und ist still.» Das beschreibt sie als eine der «Kraftproben» zwischen Mutter und Kind im ersten Lebensjahr, «sie in der richtigen Weise zu bestehen, ist das Geheimnis aller Erziehung. (…) Auch das schreiende und widerstrebende Kind muß tun, was die Mutter für nötig hält, und wird, falls es sich weiterhin ungezogen aufführt, gewissermaßen ‹kaltgestellt›, in einem Raum verbracht, wo es allein sein kann und so lange nicht beachtet, bis es sein Verhalten ändert.»[1]
Was man heute mit Grauen liest, hat die Generation meiner Eltern in ihren Erziehungsmethoden nachhaltig beeinflusst. «Mir wurde gesagt, Kinder sollen nur alle vier Stunden gestillt werden und sonst nicht», sagte meine Mutter zu unserer Hebamme im Wochenbett. Die Stimme von Säuglingen würde sich ausbilden beim Schreien. «Aber mein Bauch hat mir immer was anderes gesagt.»
Der Bauch meiner Mutter fand auch lange «Fremdbetreuung» nicht gut. Wenn ich ihr dann entgegenhalte, dass Eltern ja auch erwerbsarbeiten wollen und müssen, kommt sie ins Denken. Inzwischen findet es meine Mutter in Ordnung, dass Kinder früh in Kitas gehen. «Heute ist es ja so, dass die Frauen mitarbeiten, ja, wahrscheinlich hätte ich mir das dann doch noch mal überlegt und euch in die Betreuung gegeben», sagt sie.
Viele Rollenbilder, die auch heute noch immer auf Mütter projiziert werden, stammen aus der Nazizeit. Im Mutterkult des Nationalsozialismus herrschte der Anspruch an sogenannte arische Mütter, eine Vielzahl von Nachkommen zu produzieren, die sie im Sinne nationalsozialistischer Ideologie entweder zu Soldaten oder zu Müttern erziehen sollten – natürlich indem sie sich dafür komplett aufopferten. Belohnt wurde die Mutter dafür mit dem Mutterkreuz. Voraussetzung: Sie selbst musste «erbgesund», «anständig» und «sittlich einwandfrei» sein und mindestens vier Kinder lebend geboren haben, die «deutschblütig» und «erbtüchtig» (also nicht behindert) waren. Überreicht wurde das Mutterkreuz, natürlich, am Muttertag.
Der Muttertag ist mitnichten als Nazipropaganda erfunden worden, lässt sich von ihr aber auch nicht so recht lösen. 1907 forderte die US-amerikanische Feministin Anna Jarvis einen Festtag für Mütter und griff damit die Idee ihrer Mutter Julia Ward Howe auf, die sich 37 Jahre vorher innerhalb der US-amerikanischen Frauenbewegung für einen «Muttertag des Friedens» einsetzte.
Der Muttertag wurde 1914 in den USA als Feiertag etabliert, aber Jarvis störte sich an der Kommerzialisierung des Tages in den 1920er Jahren so sehr, dass sie sich für seine Abschaffung einsetzte. Auch in Deutschland stand die Einführung des Muttertags erst unter einem kommerziellen Stern: Er wurde initiiert vom «Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber». 1933 machten die Nationalsozialisten den Muttertag zum offiziellen Feiertag und feierten ihn 1934 mit der Einführung des sogenannten Reichsmütterdienstes, der in Mütterschulungen Babykurse nach den Lehren Haarers anbot.
Heute ist der Muttertag vor allem dafür da, die Mutter zu ehren und ihr Arbeit abzunehmen. Blumen werden verschenkt und Basteleien aus der Kita oder der Schule. Während Väter den Vatertag traditionellerweise nutzen dürfen, um alkoholisiert um die Häuser zu ziehen, sollen Mütter sich am Muttertag mal so richtig von ihrer Familie und ihrer Familienarbeit erholen. Aber bitte auch nur an diesem einen Tag im Jahr.
Jedes Jahr am Muttertag teile ich auf Social Media eine Illustration der Künstlerin Mari Andrew. Darauf sind Blumensträuße zu sehen, dazu dieser Text: «Ich denke an euch: Mütter, die ihre Kinder verloren haben; Mütter, die ihre Mütter verloren haben; Mütter, die eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter haben; Mütter, mit schwieriger Beziehung zu ihren Kindern; Menschen, die entschieden haben, keine Mütter zu sein; Menschen, die eine Sehnsucht danach haben, Mutter zu sein.»
Den Muttertag fand meine Mutter immer doof. «Jeder Tag soll doch Muttertag sein», fand sie. Über Blumen als Geschenk hat sie sich trotzdem immer gefreut.
Meine Mutter ist eine westdeutsche Mutter. Die Geschichte, die ich erzähle, würden Kinder ostdeutscher Mütter sehr wahrscheinlich ganz anders erzählen. Während die Erwerbstätigkeit von Müttern in Westdeutschland die vergangenen Jahrzehnte kontinuierlich gestiegen ist, war sie in Ostdeutschland schon immer hoch. Erwerbsarbeit von Frauen gehörte in der DDR dazu. In Westdeutschland war eher das Hausfrauenmodell die Regel.
2017 waren in Westdeutschland 57 Prozent der Mütter, deren jüngstes Kind zwischen zwei und drei Jahre alt war, erwerbstätig. In den ostdeutschen Bundesländern lag die Quote mit 72 Prozent deutlich höher. Außerdem ist hier der Anteil der Mütter, die in Vollzeit oder fast in Vollzeit arbeiten, höher.
Die Gründe für die unterschiedliche Erwerbsbeteiligung von Müttern in Ost und West sind noch immer auf unterschiedliche kulturelle, gesellschaftliche und politische Prägungen während der deutschen Teilung zurückzuführen. Schon kurz nach der Gründung der DDR wurde 1950 ein «Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau» erlassen, das mit der Tradition des Nationalsozialismus, die Frau primär über ihre Mutterrolle zu definieren, klar brach. Im Paragraph 14 hieß es, dass «… die Eheschließung für die Frau keine Einschränkung oder Schmälerung ihrer Rechte zur Folge hat» und noch expliziter in Paragraph 15: «Durch die Eheschließung darf die Frau nicht gehindert werden, einen Beruf auszuüben oder einer beruflichen Ausbildung und ihrer gesellschaftlichen und politischen Fortbildung nachzugehen; auch wenn hierdurch eine zeitweilige örtliche Trennung der Eheleute bedingt wird.»
Auch die Rechte von Frauen, die uneheliche Kinder geboren hatten, wurden mit diesem Gesetz von 1950 gestärkt: «Die nicht eheliche Geburt ist kein Makel. Der Mutter eines nicht ehelichen Kindes stehen die vollen elterlichen Rechte zu, die nicht durch die Einsetzung eines Vormundes für das Kind geschmälert werden dürfen.»
In Westdeutschland, wo meine Mutter aufwuchs, galten währenddessen Gesetze, die teilweise noch jahrzehntelang Ehefrauen und Alleinerziehende benachteiligten. Vor 1970 unterstanden dort nichtehelich geborene Kinder dem Vormund des Jugendamtes, und erst seit 2011 unterscheidet das Recht nicht mehr zwischen ehelichen und nicht ehelichen Kindern.
In Westdeutschland waren Frauen erst ab 1958 berechtigt, ein eigenes Konto zu eröffnen und damit über ihr eigenes Geld zu entscheiden. Und auch in puncto Vereinbarkeit war die DDR weiter. Das «Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau» sorgte ab 1950 in der DDR dafür, dass Mütter vor und nach der Geburt eines Kindes Mutterschutz bekamen und einen vollen Lohnausgleich. Das Gesetz beinhaltete ebenfalls den Ausbau der staatlichen Kinderbetreuung. Bis heute ist die Kinderbetreuungsstruktur in Ostdeutschland wesentlich besser als die in Westdeutschland. 1970 wurde in der DDR das bezahlte Babyjahr für Mütter beschlossen.
Die Akzeptanz externer Kinderbetreuung war in der DDR sehr hoch, denn die soziale Norm der Vollzeiterwerbstätigkeit galt auch für Mütter, sodass die meisten nach Ablauf des Babyjahres wieder arbeiten gingen. Nur so war die hohe Erwerbsbeteiligung von 91 Prozent (1989) erreichbar – die höchste Quote weltweit. Dies heißt allerdings nicht, dass die Verantwortlichen der DDR alle Feminist*innen gewesen wären: Durch die Abwanderung von Arbeitskräften und später die technische Rückständigkeit konnte die DDR schlicht nicht auf die Arbeitskraft der Frauen verzichten. Gleichzeitig war es für viele Familien eine finanzielle Notwendigkeit, dass beide Erwachsenen arbeiten gingen: Das Geld einer Alleinverdienerin reichte in der DDR oft nicht zum Leben.
All die Bestrebungen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen zu fördern, bedeutete auch nicht, dass die Frauen in der DDR neben Beruf und Kindererziehung nicht noch den Haushalt zu erledigen hatten. Nach dem Vollzeitjob, den die meisten hatten, kam die sogenannte zweite Schicht. Das «Institut für Bedarfsforschung» veranschlagte 1965 für Haushalt und Kindererziehung rund 50 Wochenstunden.[2]
Diese Doppelbelastung wurde nicht hinterfragt, mehr noch diente sie der Unterstreichung des sozialistischen Ideals: Meisterhaft und mühelos verband die moderne Frau der DDR beides, Haushalt und Erwerbsarbeit. Dabei verdiente sie wesentlich weniger als ihr männliches Pendant und hatte kaum Chancen auf Führungspositionen.
In Westdeutschland durfte noch bis 1977 eine Frau nur dann berufstätig sein, wenn das «mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar» war. Kinder, Haushalt und Erziehung – in Westdeutschland war das ganz klar Frauensache. Meine Mutter war der Durchschnitt. Für sie war das selbstverständlich.
Was genau bedeutet er eigentlich heute, der Begriff Mutter? Was verbinden wir mit ihm? Der Duden beschreibt eine Mutter als Frau, die ein oder mehrere Kinder geboren hat. Als Synonyme werden angeboten: Erziehungsberechtigte, (salopp) Alte, (familiär) Mama, Muttchen (ja, wirklich). Den Ursprung sieht der Duden in einem «Lallwort der Kindersprache». Eine Mutter wird beschrieben als Frau, die in der Rolle einer Mutter ein oder mehrere Kinder versorgt und erzieht. Also auch Mütter, die ihre Kinder nicht geboren haben, soziale Mütter, Ko-Mütter, Adoptivmütter. Personen, die keine Frau sind, aber Mutter, erwähnt der Duden nicht. Es gibt außerdem Personen, die vom Gesetz dazu gezwungen werden, als Mutter in die Geburtsurkunde des Kindes eingetragen zu werden – obwohl der Begriff nicht zu ihnen passt.
Sowohl der Duden als auch das deutsche Recht verknüpfen die Begriffe Mutter und Vater mit dem Geschlecht. Diese Verknüpfung ist ein Dilemma für Regenbogenfamilien, also für Familien mit lesbischen, schwulen, trans oder intergeschlechtlichen Menschen. Problematisch ist außerdem, dass ein Kind rechtlich nur zwei Elternteile haben darf.
«Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung», so steht es im sechsten Artikel des Grundgesetzes. Drei Zeilen darunter: «Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.» Während recht klar ist, was eine Ehe ist, bleiben die Begriffe Familie und Mutter ungeklärt. Was, wenn es zwei Mütter gibt oder zwei Väter? Und was, wenn es keine Kinder (mehr) gibt? Gibt es dann auch keine «Familie»?
«Familie» bedeutet im ursprünglichen Sinn eher Hausgemeinschaft als Vater-Mutter-Kind. Die Idee der Kernfamilie, für die wir heute synonym den Begriff der Familie verwenden, setzte sich erst mit der industriellen Revolution in der westlichen Welt durch. Diese beschränkende Bedeutung hat heutzutage wenig mit der gelebten Wirklichkeit zu tun und schlägt sich in Benachteiligungen derjenigen nieder, die nicht das patriarchal-konservative Familienbild leben.
Erst seit 2017 dürfen homosexuelle Paare heiraten und damit theoretisch auch Kinder adoptieren. Doch obwohl es rein rechtlich erlaubt ist: Schwul-lesbische Vereine beklagen immer wieder, dass Vorurteile bei Behörden eine Adoption erschweren. Queere Familien, bei denen die Eltern zum Beispiel ein schwules Paar und eine lesbische Mutter sind, existieren vor dem Gesetz praktisch nicht. Auf Geburtsurkunden gibt es nur zwei Felder, Mutter:___, Vater:___. Was tragen Eltern ein, bei denen ein trans Mann das Kind ausgetragen hat? Er wird vom Gesetzgeber dazu gezwungen, als Mutter tituliert und so misgendert und geoutet zu werden.[*] Wie werden Eltern erfasst, die einen offenen oder einen diversen Geschlechtseintrag haben und für die weder «Mutter» noch «Vater» oder auch beides passt?
Leihmutterschaft ist in Deutschland per se verboten, schwule Paare müssen mit ihrem Leihmutterwunsch direkt ins Ausland. Die Bundesärztekammer fand bis 2018, dass Samenspenden verheirateten, heterosexuellen Paaren vorbehalten sein sollten. Dann strich sie diese Empfehlung und vermeidet seither jede Aussage. Queere Paare sowie alleinstehende Frauen sind also auf wohlwollende Samenbanken und gynäkologische Praxen angewiesen.
Die Kinder von gleichgeschlechtlichen Eltern haben zudem nur einen «rechtlichen Elternteil», die leibliche Mutter. Bei lesbischen Paaren kann immer nur die gebärende Mutter die Mutter des Kindes sein – die zweite Mutter muss das eigene Kind adoptieren und ein aufwendiges Adoptionsverfahren durchlaufen.
Es folgt eine lang andauernde und teure «Stiefkindadoption», um den zweiten Elternteil auch rechtlich zu einem solchen zu machen. Unter anderem muss dafür dem Jugendamt, das über die Eignung entscheidet, ein «Lebensbericht» vorgelegt werden: Kindheit, Teenagerjahre, Berufsausbildung, Hobbys, Beziehung zu den eigenen Eltern, Art der Beziehung. Dazu kommen Wohnungsbesuche, Anhörungen, Führungszeugnisse, Meldebestätigungen und Gerichtstermine.
In einer heterosexuellen Ehe ist der Mann dagegen automatisch der Vater, egal, ob das Kind durch künstliche Befruchtung entstand oder durch einen Seitensprung. In einer unehelichen, heterosexuellen Beziehung reicht die Bestätigung der Vaterschaft durch den Vater aus.
Aktuell kämpfen einige queere Initiativen dafür, dass zwischen dem Kind und dem zweiten Elternteil, der mit der Mutter verheiratet ist oder die Elternschaft anerkannt hat, ein rechtliches Eltern-Kind-Verhältnis besteht. Menschen führen also gerichtliche Prozesse, um sich verantwortungsvoll um ein Kind kümmern zu dürfen.
Im Familienrecht gibt es viele Ungereimtheiten und Benachteiligungen, die zeigen, dass das Recht der Realität um einige Schritte hinterherhinkt. Warum soll ein Kind nur zwei Elternteile haben dürfen? Liebe erfahren, sich verantwortlich fühlen, sich kümmern – dafür muss ein Mensch ein Kind weder gezeugt noch geboren haben. Umgekehrt gilt das, wie wir wissen – und ich später noch erzählen werde –, auch nicht zwingend.
Und auch in heterosexuellen Beziehungen mit Kindern gibt es oft nicht nur zwei Elternteile. Zum Beispiel in Patchwork-Konstellationen. Im besten Patchwork-Fall bekommt ein Kind oder mehrere Kinder mehr kümmernde Elternteile dazu.
Ich weiß nicht, ob meine Mutter noch ein zusätzliches Elternteil gut gefunden hätte. Nicht immer alles allein machen zu müssen, das wäre bestimmt nicht schlecht gewesen. «Aber so konnte ich immer alles machen, wie ich es wollte», sagt sie.
Meine Mutter wird niemals jammern, jedenfalls nicht vor mir. Das gehört zu ihrem Rollenbild als Mutter dazu. Mein Muttersein ist in vielem der Gegenentwurf zu dem meiner Mutter – und vielleicht ist das nur möglich, weil meine Mutter so ist, wie meine Mutter ist.
Ohne das bewusst entschieden zu haben, wusste ich früh, später mal vieles anders machen zu wollen als sie. Mehr sein als Mutter, verschiedene Rollen ausfüllen, nicht nur eine. Damit ich das machen konnte, brauchte ich eine Sache: Freiheit.
«Mir war immer wichtig, dass ihr euch nicht verantwortlich fühlt für mich. Kein schlechtes Gewissen solltet ihr haben, wegen nichts», sagt meine Mutter.
Ich hatte fast immer das Gefühl, so sein zu können, wie ich es wollte, und somit auch die Mutter zu werden, die ich sein will. Oder auch keine Mutter zu werden. Ich habe vieles anders gemacht als meine Mutter. Außer das mit der Liebe und mit dem Lichtspalt in der Tür. Denn beides war immer genau richtig für mich.
Die Arbeit
Ich nehme das Brot und schneide es. Ich hole die Butter aus dem Kühlschrank und schmiere sie auf das Brot. «Möchtest du Käse?», frage ich. Ich lege den Käse auf das Brot. Ich wasche die Brotdose aus. Ich nehme den Schäler aus der Schublade und schäle die Gurke. Sie wird sie eh nicht essen, aber ich will, dass wenigstens die Möglichkeit besteht. Vielleicht will ich auch nur, dass irgendwer sieht, dass sie Gurke dabeihat. Ich schneide die Gurke in Scheiben und lege sie in das obere Fach der Brotdose. Das Brot lege ich in das untere Fach. Ich schmiere ein Knäckebrot mit Butter. «Mit Salz?», frage ich. Ich streue Salz auf das Knäckebrot. Ich lege das Knäckebrot auf einen Teller und stelle den Teller auf den Tisch. Ich gieße Wasser in ein Glas und stelle das Glas auf den Tisch.
Ich räume Wäsche in die Maschine. Ich fülle Waschpulver in die Maschine. Ich drücke den Knopf. Ich stelle die elektrische Zahnbürste zurück in den Schrank. Ich wische Zahnpasta vom Waschbecken. Ich nehme ein Tuch und wische das Waschbecken sauber. Ich puste Staub.
Ich packe das Matheheft in den Rucksack. Ich schaue auf den Stundenplan. «Ich komme gleich», sage ich. Ich wische Kacke vom Po. Ich drücke auf die Spülung. Ich wische Kacke vom Klo. Ich spüle noch mal. Ich schließe die Schnalle des Schuhs. Ich schließe die Schnalle des zweiten Schuhs. Ich nehme die Jacke vom Haken. Ich helfe dem Arm, in den Jackenärmel zu schlüpfen.
Ich schreibe eine Mail an den Lehrer. Ich schreibe eine Mail an den Vater. Ich schreibe eine Mail an die Freundin, die das Kind morgen von der Schule mitnimmt. Ich rufe im Hort an und sage: «Morgen geht das Kind mit der Freundin mit. Ja, den Zettel packe ich in den Rucksack.»
Ich rufe bei der Kinderärztin an. Ich vereinbare einen Termin. Ich trage den Termin in meinen digitalen Kalender ein. Die Waschmaschine piept. Ich räume die Waschmaschine aus. Ich hänge die Wäsche auf. Ich bügle das Kleid. Ich räume die Spülmaschine ein. Ich wische den Küchentisch ab. Ich nehme die Jacke vom Haken. Ich stecke meinen Arm in den Ärmel. Dann den anderen. Ich öffne die Tür.
Ich mache eine Überweisung. Ich mache mir einen Kaffee. Ich verschiebe einen Friseurtermin. Ich versuche, an die Zahnpasta zu denken. Ich schreibe Mails, ich schreibe viele Mails. Ich habe vergessen, Müllbeutel zu kaufen, also werfe ich den Müll in eine alte Plastiktüte, die ich provisorisch im Abfalleimer befestigt habe. Ich muss beim Einkaufen unbedingt an Mülltüten denken.