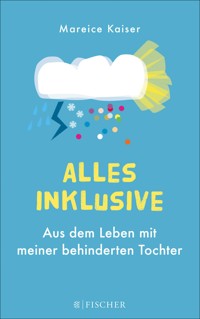14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Geld ist nicht alles? Aber Geld ist ziemlich viel: Macht, Status, Lebensgrundlage. Und Grund für ziemlich viele Gefühle: Scham, Neid, Eifersucht. Aber auch Sicherheit, Glück, Freiheit. Was macht Geld mit uns, und was machen wir mit Geld? Mareice Kaiser erzählt ihre eigene Geldgeschichte und trifft Menschen, mit denen sie über Geld spricht. Vom Pfandflaschensammler bis zum Multi-Millionär stellt sie ihnen Fragen: Wie viel Geld ist genug? Wie viel Geld macht glücklich? Wer sollte mehr Geld haben? Wer weniger? Und wie könnte Geld gerechter verteilt sein? Es geht um Armut und Reichtum, um Kälte und Wärme, um Kreditkarten und Mahnungen, um Erfolg und Not, um Chancen und Schicksal, um Macht und Machtlosigkeit – und um das Dazwischen. Außerdem um einen Blick auf ein Land, in dem die einen frieren müssen, während die anderen von Fußbodenheizungen gewärmt werden. So entsteht eine Analyse, die entlang persönlicher Geschichten eine Struktur zeigt, die zutiefst ungerecht ist und unser aller Zusammenleben bestimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mareice Kaiser
Wie viel
Was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht
Über dieses Buch
Geld ist nicht alles? Aber Geld ist ziemlich viel: Macht, Status, Lebensgrundlage. Und Grund für ziemlich viele Gefühle: Scham, Neid, Eifersucht. Aber auch Sicherheit, Glück, Freiheit. Was macht Geld mit uns, und was machen wir mit Geld?
Mareice Kaiser erzählt ihre eigene Geldgeschichte und trifft Menschen, mit denen sie über Geld spricht. Vom Pfandflaschensammler bis zum Multimillionär stellt sie ihnen Fragen: Wie viel Geld ist genug? Wie viel Geld macht glücklich? Wer sollte mehr Geld haben? Wer weniger? Und wie könnte Geld gerechter verteilt sein? Es geht um Armut und Reichtum, um Kälte und Wärme, um Kreditkarten und Mahnungen, um Erfolg und Not, um Chancen und Schicksal, um Macht und Machtlosigkeit – und um das Dazwischen. Außerdem um einen Blick auf ein Land, in dem die einen frieren müssen, während die anderen von Fußbodenheizungen gewärmt werden.
So entsteht eine Analyse, die entlang persönlicher Geschichten eine Struktur zeigt, die zutiefst ungerecht ist und unser aller Zusammenleben bestimmt.
Vita
Mareice Kaiser, Jahrgang 1981, arbeitet als Journalistin, Autorin und Moderatorin. Sie scrollt, schreibt und spricht zu Gerechtigkeitsthemen. Mit ihrem Essay «Das Unwohlsein der modernen Mutter» war sie für den Deutschen Reporter:innenpreis nominiert, ihr gleichnamiges Buch erschien 2021 bei Rowohlt Polaris und stieg direkt in die «Spiegel»-Bestsellerliste ein. Sie lebt in Berlin, in Zürich und im Internet.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
nach einer Idee von Karin Lubenau
ISBN 978-3-644-01462-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Wie viel?
Teil I
Mein Geld
Das Geld
Arm & Reich
Kapital ist mehr als Geld
Teil II
Erwin
Sara
Lukas
António
Elisa
Sven
Marlene
Papa
Teil III
Die letzten Tage des Kapitalismus
Geldgefühle
Danksagung
Literatur
Anmerkungen und Endnoten
Wie viel? Ich hasse Geld. Und trotzdem schreibe ich dieses Buch. Oder eben genau deshalb. Warum fühle ich so viel, wenn ich an Geld denke? Ich hasse Geld – und ich will es haben. Klingt wie eine toxische Beziehung, oder? Ist es auch. Und ich habe keine Chance, sie zu ghosten. Denn Geld ist allgegenwärtig.
Geld ist Status, Geld ist Macht. Geld ist eine Chance, Geld ist ein Symbol. Geld ist eine Metapher. Geld ist Freiheit. Geld ist Sicherheit. Geld ist Druck. Geld ist Papier. Geld ist Gold. Geld macht Neid. Geld macht Möglichkeiten. Geld macht sorglos. Geld macht schlaflose Nächte. Geld macht Freiheit. Geld macht Ruhe. Geld macht Unruhe. Geld macht ungleich. Geld macht unfrei. Geld macht Arbeit. Macht Geld Glück?
Geld hat viele Namen: Zaster, Penunzen, Asche, Moneten, Marie, Moos, Pulver, Steine, Piepen, Kröten, Mäuse, Para, Patte, Cash, Lappen, Kies, Kohle. Für kaum einen anderen Begriff gibt es so viele Wörter.
Geld liegt auf der Straße, Geld liegt auf dem Konto. Geld ist dreckig. Geld macht Urlaub, Geld macht Autos, Geld macht aus Häusern Objekte. Geld macht aus Menschen Arbeitskräfte. Menschen machen Geld. Geld macht Menschen. Macht zu viel Geld Menschen schlecht?
Geld macht Gegensätze. Geld macht Hierarchien. Geld macht Gemeinsamkeiten. Geld macht Reichtum. Geld macht Armut. Geld macht Scham.
Ich schäme mich, kein Geld zu haben. Ich schäme mich, Geld zu haben. Ich schäme mich, dass es Geld gibt. Ich schäme mich, weil Geld ungerecht verteilt ist.
Obwohl Geld allgegenwärtig ist, sprechen wir selten darüber. Jedenfalls nicht so richtig: Kontoauszüge, Erbe und Mahnungen auf dem Tisch. Wir erzählen uns oft nicht einmal, wie viel Geld wir in unseren Jobs verdienen. Warum eigentlich nicht? Weil Geld für so viel mehr steht als für Münzen und Scheine. Geld regiert die Welt, heißt es. Und im Kapitalismus, unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsform, ist das wohl wirklich so.
Kapitalismus? Kein Problem, wenn Sie nicht genau wissen, was das bedeutet. Ich werde versuchen, schwierige Wörter zu erklären. Denn ich mag Texte nicht, in denen die, die sie schreiben, voraussetzen, dass man alles schon mal gehört oder, noch schlimmer, gelesen haben müsste. Das vorauszusetzen, hat auch mit Geld zu tun. Im Kapitel «Kapital ist mehr als Geld» erkläre ich das genauer.
Im Kapitalismus wird privates Eigentum vom Staat geschützt, er greift nicht erheblich in das Wirtschaftsgeschehen ein. Über allem steht der Profit, also das Geld. Der Wert von Menschen ist verknüpft mit ihrem Geld. Und der Staat setzt auf die Eigenverantwortung der einzelnen Menschen, nach dem Motto: «Du bist deines Glückes Schmied.»
Die Frage, die sich stellt, ist: Hält der Kapitalismus dieses Versprechen? Und hält er es für alle? Einfach nur genug anstrengen, dann läuft das schon alles mit dem Geld?
In Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die soziale Marktwirtschaft eingeführt. Sie ist Kapitalismus mit einem Hauch Sozialpolitik. Sozialpolitik, das bedeutet, es gibt politische Maßnahmen und Strukturen, die Menschen absichern sollen. Die soziale Marktwirtschaft beinhaltet die Grundlagen des Kapitalismus (Angebot und Nachfrage, Privateigentum, Eigenverantwortung) und soziale Sicherungssysteme, die große Ungerechtigkeiten vermeiden sollen. Aber funktioniert das eigentlich?
Die sogenannte Schere zwischen Arm und Reich wird in Deutschland immer größer (dazu im dritten Teil des Buches mehr). Durch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine haben wir eine Inflation – das bedeutet, alles wird teurer, Geld ist weniger wert, für dieselbe Summe können wir uns weniger kaufen. Die Auswirkungen der aktuellen Krisen spüren vor allem Menschen mit wenig Geld, während die sehr Reichen immer reicher werden. Menschen, die von Armut betroffen sind, sind auch von weiteren Krisen heftiger und schneller betroffen, zum Beispiel von den Auswirkungen der Klimakrise.
Kapitalismus ist ein System, in dem Menschen leben – und arbeiten, ein zentraler Punkt im Kapitalismus. An den Leben dieser Menschen, also an uns, an Ihnen und an mir, sehen wir, wie dieses System funktioniert. Und ob überhaupt. Oder für wen überhaupt. Darum wird es in diesem Buch gehen.
Ich habe Menschen getroffen und mit ihnen über Geld gesprochen. Über alles, wofür Geld steht – und über uns Menschen, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen in dieses System geworfen werden.
Ich habe mit Menschen gesprochen, die mit Wärmflasche ins Bett gehen, weil ihre Heizung nicht funktioniert. Mit Menschen, die in einem Haus mit Fußbodenheizung wohnen. Mit Menschen, die ein Vermögen erben, und mit Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Mit Menschen, die bestellen, und mit Menschen, die liefern. Mit Menschen, die von morgens bis abends arbeiten und wenig Geld haben, und mit Menschen, die von morgens bis abends arbeiten und viel Geld haben.
Ich stelle Fragen, und in den meisten steckt diese eine: Wie viel? Also: Wie viel ist genug? Wie viel ist zu wenig? Wie viel wäre gut? Wie viel bin ich wert?
Dass mir Menschen ihre Geldgeschichte erzählt haben, ist nicht selbstverständlich. Geld ist ein Tabuthema. Armut ist ein Tabuthema, Reichtum ebenfalls, wenn auch auf eine andere Art. Sogar über das Dazwischen sprechen ist schwierig. Warum ist das so? Wie können wir das ändern? Wie kann Geld ein Thema werden ohne Tabu? Das möchte ich in diesem Buch herausfinden. Und woher meine eigenen Geldgefühle kommen. Ob andere sie teilen? Oder ganz andere haben?
Geld ist die erfolgreichste Erfindung der Menschheit. Wenn wir Geld erfunden haben, können wir auch neu erfinden, wie wir damit umgehen, oder?
Es geht um Chancen, Möglichkeiten, Teilhabe. Darum, was Geld mit Menschen macht und was Menschen mit Geld machen. Und darum, was wir mit Geld machen könnten, damit es gerechter wird, für alle.
Sie sind herzlich eingeladen, mitzufühlen und mitzudenken. Und auch, Ihre eigene Geldgeschichte zu erzählen. Denn auch das kann ein Weg zu mehr Gerechtigkeit sein. Deshalb beginne ich mit meiner.
Teil I
Wie viel kostet mein Leben?
Sag’s mir, ich kann nicht zählen.
Haiyti
Mein Geld Der erste Pullover, an den ich mich erinnern kann, ist dunkelgrün. Die Farbe ist aber egal. Viel wichtiger war, was hintendrauf stand: Benetton. Ich war zwölf Jahre alt und wollte Markenklamotten tragen wie alle anderen auch. Aber im Gegensatz zu allen anderen konnten meine Eltern sie mir nicht kaufen: «Das können wir uns nicht leisten.» Irgendwann habe ich nicht mehr gefragt. Der Wunsch aber blieb.
Meine Freundin Lea trug fast ausschließlich Anziehsachen, in oder auf denen Namen standen, die als cool galten. Schuhe von Dr. Martens, Shirts von Benetton. Leas Vater war Arzt. Leas Mutter hatte wohl Mitleid mit mir, und so gingen wir irgendwann in diesen einen Laden in unserer Kleinstadt, in den ich mich sonst nie getraut hätte, und Leas Mutter kaufte ihr einen Pullover und mir den gleichen, in Dunkelgrün. Hintendrauf, über dem Po, stand Benetton. Ich war megastolz.
Am nächsten Tag trug ich meinen Lieblingspullover in der Schule und am übernächsten Tag auch. Dann musste ich in einer Schulstunde etwas an die Tafel schreiben, und während ich das tat, sagte mein Lieblingslehrer aus dem Off: «Oh, Mareice trägt jetzt also auch Markenklamotten.» Es war mir so peinlich. Ich trug den Pullover nie wieder. Das Gefühl, nicht das zu haben, was die anderen haben, blieb. Aber genau das Gleiche wie die anderen, das wollte ich ab diesem Moment auch nicht mehr haben.
Was ich ebenfalls nicht haben wollte, waren die ständigen Diskussionen über Geld in meiner Familie. Stand eine Klassenfahrt an, war immer die Frage: Können wir uns das leisten? War das Auto kaputt, ging die Welt unter.
Ich komme aus einer Arbeitendenfamilie, einer Familie, in der die Eltern Arbeiter*innen sind. Meine Eltern haben beide einen Volksschulabschluss, ähnlich dem heutigen Hauptschulabschluss. Mein Vater ist gelernter Koch und arbeitete die meiste Zeit meines Lebens als Lkw-Fahrer. Meine Mutter hatte lange keine Berufsausbildung, leistete viele Jahre unbezahlte Care-Arbeit und holte eine Ausbildung als Altenpflegerin später nach. Geld war das Streitthema meiner Familie, ist es bis heute. Arbeit war das Diskussionsthema. Und Sicherheit, Absicherung – in den Augen meines Vaters war das eine Festanstellung.
Ein Mensch ist dann etwas wert, wenn er hart arbeiten kann, lernte ich. Die augenzwinkernde Drohung meiner Eltern, wenn meine Brüder oder ich keinen Bock auf Schule hatten: «Dann geht ihr im Steinbruch arbeiten.» Harte körperliche Arbeit als Abschreckung. Bildung als Ausweg. Aber nur bis zu einem bestimmten Bildungsgrad. Denn studieren sollte ich nicht: «Das können wir uns nicht leisten.»
Damit bin ich keine Ausnahme. Kinder aus Arbeitendenfamilien sollen es zwar immer besser haben als ihre Eltern. Aber gleichzeitig sind Arbeitendeneltern sehr bedacht darauf, dass ihre Kinder «was Ordentliches» machen. Ordentlich im Sinn von Ausbildung, Arbeitsvertrag, Bausparvertrag, Hausbau. Sicherheit eben.
Ich laufe bis heute vor Sicherheit davon. Arbeitsverträge unterschreibe ich immer mit Bauchweh. Die Sicherheit meiner Eltern ist nicht meine. Meine Sicherheit ist Wissen. Meine Sicherheit ist Bildung. Meine Sicherheit ist Freiheit. Im besten Fall: Entscheidungsfreiheit. Ich will entscheiden, wie ich meine Zeit verbringe. Dafür brauche ich Geld. Das anzunehmen, den Gedanken und das Geld dafür, fällt mir bis heute schwer.
Denn in den Gesprächen in meiner Herkunftsfamilie war immer klar: Menschen mit Geld sind die schlechteren, die korrupten Menschen. Vor allem die mit sehr viel Geld. Die, die sich ihren Wohlstand nicht selbst erarbeitet haben. Die, die ihren Wohlstand haben, weil andere dafür arbeiten. Denn sehr viel Geld entsteht selten durch «ehrliche Arbeit», sondern durch Glück. Es ist also nicht «verdient». Und es resultiert aus der Arbeit von Menschen wie meinem Vater.
Ich war die Erste aus meiner Familie, die aufs Gymnasium gehen wollte (und sollte – ich hatte eine Empfehlung dafür bekommen). Meine Mutter fragte: Muss das denn sein? Denn aus ihrer Perspektive reichte doch die Realschule, meine Brüder waren da schließlich auch. Ja, ich weiß, aus der Sicht von weißen privilegierten Eltern, für die gar nichts anderes infrage kommt, als ihre gut frisierten und angezogenen Pauls und Ellas aufs Gymnasium zu schicken, ist das unvorstellbar. Aber für meine Eltern hatte das Gymnasium fast schon etwas Bedrohliches. Es war eine andere Welt. Für mich auch, deshalb wollte ich unbedingt hin. Schließlich überredete meine Klassenlehrerin meine Mutter, mich aufs Gymnasium zu schicken.
Bei uns zu Hause gab es nur wenige Bücher, sie zogen erst ein, als einer meiner älteren Brüder einen Bibliotheksausweis bekam. Bei uns gab es Kartoffeln und Soße und Fleisch. Bei uns gab es Diskussionen über Geld, weil es nicht da war. Bei uns gab es Diskussionen über Politik, weil sie Auswirkungen auf unser Leben hatte. Bei uns gab es Liebe und Neid. Bei uns gab es Werte und Streit.
Die Sommer verbrachten wir draußen, im Garten, auf den Feldern und im Freibad. Urlaub als Familie, das gab es bei uns nicht. Urlaub war Luxus, und Luxus konnten wir uns nicht leisten. Luxus war für die anderen.
Auf dem Gymnasium angekommen, ging ich mit Kindern zur Schule, deren Eltern Ärzt*innen oder Lehrende waren. Sie fuhren mit dem Fahrrad zur Schule und spielten nachmittags Handball. Ich stand um kurz vor sechs auf, um den Bus zu erwischen, der zwei Mal am Tag von unserem Dorf zur Schule fuhr. Und nachmittags fuhr ich wieder mit dem Bus zurück. Abends fuhr kein Bus mehr, deshalb kamen für mich auch keine Nachmittagsaktivitäten in der Stadt infrage.
Später wollte ich studieren, konnte aber nicht: «Das können wir uns nicht leisten.» Seitdem ich schreiben konnte, wollte ich Journalistin werden. Im Schulpraktikum mit 16 schrieb ich Filmkritiken für das Jugendmagazin der Kleinstadt, in der ich zur Schule ging. Aber ohne Studium kein Journalismus, das war mein Dilemma. Nach vielen Tränen und Schreien in Kissen fand ich mich damit ab, eine Ausbildung zu machen. Dann wenigstens irgendwas mit Medien, ich wurde Mediengestalterin.
«Der Stallgeruch kann über Karriere entscheiden», lautet die Überschrift einer Pressemitteilung des Vereins Charta der Vielfalt. Bei Stallgeruch denke ich an meinen Vater, der den Sommerurlaub seines Über-Vollzeitjobs auf dem Feld bei der Ernte verbrachte statt mit seinen Kindern im Urlaub. Der mehrmals am Tag duschte, weil er entweder nach Schweiß oder nach Stall roch.
Ich selbst habe immer gearbeitet. Im Bürobedarfsladen, im Schmuckladen, putzen im Krankenhaus, kellnern im Café, Pakete packen in der Fabrik, Obst und Gemüse im Bioladen einräumen, privilegierte Leute abkassieren. Damit ich mir unbezahlte Praktika im Journalismus leisten konnte. Über meine anderen Jobs sprach ich dort nicht, ich schämte mich für sie. Dafür, dass ich sie brauchte.
Irgendwann bei einem Bewerbungsgespräch als Bildungsredakteurin – ich wusste mittlerweile, dass meine Herkunft auch ein Vorteil für meine Arbeit als Journalistin sein konnte – erzählte ich von meinem Zugang zu Bildung. Davon, dass ich immer gearbeitet und nie studiert hatte. Der Leiter des Ressorts konnte es erst nicht fassen, dann sagte er lachend zu seinem Kollegen: «Das ist ja ganz anders als bei uns Professoren-Söhnen!» Den Job bekam eine andere, studierte Person.
Während einer Hospitanz bei einer großen Wochenzeitung sollte ich in der Redaktionskonferenz vorgestellt werden. Kurz vor der Konferenz lehnte sich der Ressortleiter über den Tisch zu mir: «Wo hast du noch mal studiert?» «Nirgendwo», antwortete ich. Seine Vorstellung meiner Person fiel dann recht kurz aus. Einige Tage später während einer Ressortkonferenz scherzte der Ressortleiter mit dem anderen Hospitanten über ihre Zeit in Harvard: «Hast du deinen Harvard-Hoodie noch?»
Von 100 Kindern aus nichtakademischen Familien beginnen nur 27 ein Studium, obwohl doppelt so viele das Abitur bestehen. Von 100 Kindern von Akademiker*innen studieren dagegen 79. Ich habe nie studiert, hatte keinen Harvard-Hoodie und den Benetton-Pullover nur geschenkt bekommen. Stattdessen kenne ich mich mit Kontopfändungen, Arbeitnehmer*innen-Rechten und wirklichem Stallgeruch aus. Viele Entscheidungen konnte ich nicht treffen, meine soziale Herkunft hat die Entscheidungen getroffen. Meine Herkunft hat entschieden, ob ich mir ein Studium leisten konnte oder nicht. Meine Herkunft hat entschieden, welche Bücher ich las und ob überhaupt, welche Türen sich mir öffneten und welche mir verschlossen blieben. Meine Herkunft hat entschieden, welche Pullover ich tragen kann – und welche nicht.
Der Pullover, den meine Eltern mir mitgegeben haben, besteht aus Stolz und Würde. Genäht wurde er mit der Überzeugung, dass es Dinge gibt, die man mit Geld nicht kaufen und auch nicht bewerten kann. Dass der Pullover mir oft zu klein war und manchmal gekratzt hat, ist nicht der Fehler meiner Eltern. Es ist der Fehler eines Systems, das vor allem Pullover sieht und nicht die Menschen darin und ihre Möglichkeiten.
Meine Voraussetzungen für meine Möglichkeiten: Ich bin eine weiße cis Frau[1] ohne Behinderung. Über meine Herkunftsfamilie habe ich nun schon ein bisschen erzählt. Dann gibt es noch eine neue Familie, meine. Ich bin Mutter von zwei Kindern, das erste ist im Alter von vier Jahren gestorben, das zweite ist heute neun Jahre alt und wird gemeinsam getrennt von mir und seinem Vater begleitet. Dieses Buch kann ich schreiben, weil wir uns die Fürsorgetätigkeiten teilen. Ich schreibe am liebsten und am besten nachmittags und am frühen Abend – also genau dann, wenn das Kind aus der Schule kommt oder später dann ins Bett gebracht werden will. Ohne einen zweiten Elternteil könnte ich keine (Buch-)Autorin sein, denn die Betreuung zu bezahlen, könnte ich mir aktuell nicht leisten. (Ich habe übrigens noch nie ein Buch gelesen, in dem ein Mann erklärt, dass er nur durch die Aufteilung der Care-Arbeit ein Buch schreiben konnte, na ja.) Und ohne Geld würde es dieses Buch ebenfalls nicht geben.
Dass ich dieses Buch schreiben kann, hat auch mit Geld zu tun. Und mit dem Status, der aus Geld entsteht. Nicht nur aus Geld, aber auch. Und mit den Dingen, die mit Geld zu tun haben. Die richtigen Klamotten, die richtigen Codes, die richtige Sprache. Mit einem bestimmten Status hören Menschen zu. Und ihnen wird anders zugehört.
Ich kenne das aus meiner Arbeit als Autorin und Journalistin. Menschen, die wenig Geld und einen geringen sozialen Status haben, werden oft infrage gestellt. Menschen mit Geld und Status eher nicht. Ich kann dieses Buch schreiben, weil ich einen bestimmten Status habe. Mir wird zugehört, das ist ein großes Privileg. Und es ist unfair, dass es anderen Menschen nicht zuteilwird. Auch deshalb schreibe ich in diesem Buch nicht nur meine Geldgeschichte auf, sondern auch die von anderen Menschen, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Und ich bin dankbar, dass sie es getan haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und doch so dringend nötig.
Dieses Buch schreibe ich in der Zeit zwischen zwei Jobs. Ich beziehe Arbeitslosengeld und habe eine Rate meines Buchvorschusses auf meinem Konto. (Autor*innen bekommen für das Schreiben von Büchern einen Vorschuss. Er soll ihnen Zeit und Raum geben für das Schreiben. Meistens leben sie aber nicht nur davon, sondern haben andere Jobs oder Projekte, die sie finanzieren – so wie ich.)
Ich habe zwei Konten, ein privates und ein Geschäftskonto. Nachdem ich meine Miete überwiesen habe, bleiben für mein Kind und mich 600 Euro im Monat. Ungefähr ein Mal pro Monat habe ich eine Lesung oder moderiere eine Veranstaltung, das Honorar kommt dann dazu. Auch an diesen Abenden brauche ich eine Betreuung für mein Kind. (Ich schreibe das vor allem, um deutlich zu machen, welche Kosten ich hätte, wenn es nicht den zweiten Elternteil zu meinem Kind geben würde.)
Ich besitze zwei EC-Karten und eine Kreditkarte, für die ich aber den Code vergessen habe. Ich bestelle mir manchmal Dinge, um mich für etwas zu belohnen, und schicke sie dann wieder zurück, weil ich weiß, dass ich sie mir eigentlich nicht leisten kann. In meinem Portemonnaie habe ich 26,88 Euro (ich habe gerade nachgezählt). Ich habe kein Erspartes oder Vermögen (sondern muss immer lachen, wenn das in irgendwelchen Anträgen abgefragt wird). Übrigens, ziemlich krasses Wort. Vermögen. Es hat zwei Bedeutungen: Besitz, aber auch die Leistungsfähigkeit oder das Können einer Person. Als Synonyme werden im Online-Lexikon angezeigt: Befähigung, Begabung, Eignung, Fähigkeit, Fertigkeit, Kompetenz, Kraft, Macht, Möglichkeiten. Das Wort klingt, als wäre man selbst verantwortlich für das eigene Vermögen. Dabei ist das in den seltensten Fällen so, aber dazu später mehr.
Als ich den Antrag für mein Arbeitslosengeld abschickte, fand ich in meinen Unterlagen (klingt aufgeräumter, als es ist) eine Auflistung meiner Versicherungszeiten. Ich bezog mehrfach in meinem Leben Hartz IV, habe aber auch immer mal wieder für ein bis zwei Jahre okay verdient. Vor allem okay, weil ich damals allein lebte, ohne Partner*in, ohne Kind, nur verantwortlich für mich selbst. Richtig viel verdient, sodass ich wirklich sorglos leben konnte, habe ich bis jetzt noch nie. Das liegt zum einen daran, dass ich durch die Zeiten, in denen ich wenig Geld hatte, immer auch Schulden gemacht habe, die ich dann in den besseren Zeiten abbezahlen musste. Ich spreche nicht von großen Schulden bei einer Bank (abgesehen vom Dispokredit, den ich eigentlich immer ausgereizt habe), sondern von Menschen aus meinem Umfeld, die mir Geld liehen, wenn ich nicht mehr weiterwusste. Viele von ihnen stehen in der Danksagung dieses Buchs.
Was für mich immer ein großer Schock war und ist: die Steuererklärung. Als teilweise selbstständig arbeitende Person weiß ich, dass ich Rücklagen für das Finanzamt brauche. Diese Rücklagen wirklich nicht auszugeben, das habe ich bis heute nicht geschafft. Genauso wenig, wie etwas zu sparen. Eine Steuererklärung bedeutet für mich noch immer ein ungutes Gefühl im Bauch beim Gang zum Briefkasten. Auch, weil es eine Zeit gab, in der ich Angst hatte, dass eine Person vom Finanzamt vor der Tür steht, wenn es klingelt. Irgendwann gipfelte meine finanzielle Situation in einer Kontopfändung, weil ich meine Schulden beim Finanzamt nicht zahlen konnte. Überstanden habe ich das übrigens vor allem, weil ich Freund*innen hatte. Die Menschen aus der Danksagung. Und weil ich eine Schuldner*innenberatung in Anspruch genommen habe, die mir über den schlimmsten Berg geholfen hat. Vor allem, indem sie mit mir Unterlagen aufgeräumt und Unternehmen angeschrieben hat, um Ratenzahlungen zu erbitten. Auch so ein Punkt, an dem ich mich viel geschämt habe.
Wo genau stehe ich eigentlich, zwischen Armut und Reichtum? Irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Dazwischen, was meine gesellschaftliche Position angeht, und dazwischen, was Einkommensverhältnisse angeht.
Hilfreich für meine korrekte Einschätzung ist für mich ein Online-Rechner, der von Zeit Online entwickelt wurde.[2] Dieser Online-Rechner basiert auf einem Konzept des Bremer Soziologen Olaf Groh-Samberg. Er hat gemeinsam mit seinem Team Dimensionen von Wohlstand miteinander verrechnet: Einkommen, Vermögen, die Wohnsituation und die Jobsituation. Die Forschenden haben daraus sechs Gruppen gebildet: Armut, Prekariat (bezeichnet Menschen, die von Armut bedroht sind und wenig Aufstiegschancen haben), untere Mitte, Mitte, Wohlstand und Wohlhabenheit. Um sich selbst in einer «sozialen Lage» zu verorten, beantwortet man online Fragen. Zum Haushaltseinkommen, zum Haushaltsvermögen, wie viele Menschen im Haushalt leben, wie alt sie sind, wie groß die Wohnung oder das Haus ist, ob man zur Miete wohnt oder nicht.
Mein Ergebnis steht in einem Kästchen neben dem Rechner: «Mit Ihren Angaben befinden Sie sich in der sozialen Lage untere Mitte, so wie 12,1 Prozent der Menschen in Deutschland.» Weiter unten dann noch ein paar Beschreibungen zu dieser Lage: Menschen aus der unteren Mitte seien zu 34 Prozent politisch interessiert, besuchten zu 23 Prozent Theater und Museen und seien zu 52 Prozent zufrieden mit ihrem Leben.
Die Website habe ich mehrere Tage geöffnet auf meinem Computer, bis ich aus Versehen auf etwas klicke: «Person entfernen». Und ich sehe, dass dieser Klick meine Lage verändert. Mit dem Klick bin ich Teil der Mitte. Mit dem Klick kickte ich mein Kind aus der Berechnung. Es ist für mich so erschreckend wie einleuchtend: Der Fakt, dass ich Mutter bin, sorgt für meine finanzielle Unsicherheit. Und gleichzeitig dafür, dass es mir wichtiger ist, nicht mehr finanziell unsicher zu sein. Oder mich zumindest mit meiner Abwehr gegenüber finanzieller Sicherheit zu beschäftigen.
Verändert hat sich mein Verhältnis zu Geld erst nachhaltig, seitdem ich Mutter bin. Es ist ein Unterschied, für sich selbst verantwortlich zu sein und gerade so über die Runden zu kommen, die letzten Tage des Monats von Nudeln mit Ketchup zu leben. Oder ein Kind zu haben, das fragt: Warum kann ich das nicht haben? Oder ein Kind zu haben, dem man keine neuen Herbstschuhe kaufen kann, weil das Geld fehlt. Und es ist Herbst.
In einer für mich schwierigen Geld-Zeit stand ich mal mit meiner Tochter an einer Supermarktkasse. Als ich bezahlen wollte, funktionierte meine EC-Karte nicht. Sie war überzogen, und so stand auf dem Kartenlesegerät: «Vorgang nicht möglich». Wir mussten den Supermarkt ohne den Einkauf – unter anderem ein Eis für mein Kind – verlassen. Die Dinge für mich selbst, die ich hatte kaufen wollen, das Schamgefühl gegenüber der Kassiererin und den Menschen hinter mir in der Schlange – alles unerheblich angesichts des beschissenen Gefühls meinem Kind gegenüber. Seit diesem Tag wartet sie immer mit dem Auspacken vom Eis, bis der Bezahlvorgang abgeschlossen ist. Meine Definition von Wohlstand: kein Bauchweh haben zu müssen, wenn ich mit EC-Karte zahle. Keine Sorge haben zu müssen, dass dort «Vorgang nicht möglich» steht. Einfach Karte hinhalten, PIN eingeben, Einkauf einpacken. Was für viele selbstverständlich ist, ist für andere Luxus.
Ein Grund (es gibt ja meistens mehr als einen) für meine unsichere finanzielle Lage, Sie erinnern sich vielleicht an den Anfang des Buchs: Mir ist Geld irgendwie unangenehm. Ich möchte am liebsten so wenig wie möglich damit zu tun haben. Damit gehöre ich zu einem Drittel der Geld-Typen. Zum «Typ Mensch, der Geld allgemein meidet», so beschreibt ihn Brad Klontz, der Geld-Typen psychologisch untersucht hat. Für diese Typen sei es vor allem wichtig, von Geld nicht korrumpiert zu werden. Darin finde ich mich sehr wieder. Neben meinem Geld-Typ gibt es noch die Menschen, die Geld verehren und die viel Zeit und Energie in die Vermehrung von Geld stecken. Die dritte Gruppe sind Menschen, für die Geld vor allem ein Sicherheitspuffer für schlechte Zeiten ist.
Mir ist Geld unangenehm, deshalb möchte ich es auch nicht verhandeln. Und – das fällt mir nicht leicht, es zu schreiben – ich denke auch, dass ich es nicht verdient habe. Woher dieser Gedanke kommt? Auch dafür gibt es mehr als eine Erklärung.