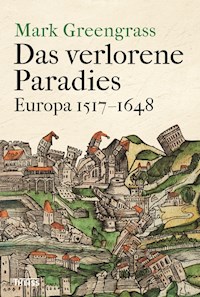
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ob Bauer oder Prinz, niemand blieb unberührt von den gesellschaftlichen Umwälzungen des 16. Jahrhunderts. Martin Luthers Kampfansage an die katholische Obrigkeit wirbelte die Grundfesten der christlichen Religion durcheinander. Die Glaubenskriege und das Ringen um die Vorherrschaft in Europa, aber auch die europäische Expansion und die naturwissenschaftliche Revolution verwandelten den ganzen Kontinent. Die Idee einer geeinten westlich-christlichen Glaubensgemeinschaft musste weichen. Es entstand Europa, wie wir es heute kennen. Mark Greengrass ist einer der führenden britischen Historiker. Brillant analysiert er die großen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Entwicklungen vor und während des Dreißigjährigen Kriegs. Er rückt dabei immer wieder die historischen Zeitgenossen in den Mittelpunkt seiner Erzählung, so entsteht ein lebendiges Bild dieser Umbruchzeit. Seine meisterhafte Darstellung lässt uns verstehen, was Europas heutiger Identität zugrunde liegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1441
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mark Greengrass
Das verlorene Paradies
Europa 1517–1648
Aus dem Englischen vonMichael Haupt
Impressum
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertungist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere fürVervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherungin und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Für die englischsprachige Originalausgabe:Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel „Christendom Destroyed.Europe 1517–1648“ bei Penguin Books Ltd, London;Copyright © 2014 by Mark Greengrass (the author has asserted his moral rights);all rights reserved
Für die deutschsprachige Ausgabe:Der Theiss Verlag ist ein Imprint der WBG.© 2018 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), DarmstadtDie Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht.Übersetzung: Michael Haupt, HanstedtFachlektorat: Daphne Schadewaldt, WiesbadenSatz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. DonauEinbandabbildung: „Die Offenbarung“; Holzschnitt aus der Bibel vonHans Schönsperger, 1523 (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel)Einbandgestaltung: Jutta Schneider, Frankfurt/M.
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-3661-3
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:eBook (PDF): 978-3-8062-3756-6eBook (epub): 978-3-8062-3757-3
Für Emily
Menü
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Buch lesen
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhalt
Einleitung
1. Das Ende des westlichen Christentums
Vom „silbernen Zeitalter“ zum „eisernen Jahrhundert“
2. Ressource Mensch
3. Stadt und Land
4. Schätze und Geschäfte
5. Adlige Beschäftigungen
Der Griff nach der Welt
6. Europa in der Welt
7. Naturbeobachtung
8. Kommunikationen
Die Heimsuchung des Christentums
9. Politik und Reich im Zeitalter Karls V.
10. Schisma
11. Reaktion, Repression, Reform
Christliche Staaten im Widerstreit
12. Konflikte im Namen Gottes
13. Leben mit religiösen Spaltungen
14. Die Kirchen und die Welt
15. Die Kreuzzugsidee verblasst
Christliche Staaten in Auflösung
16. Das Geschäft der Staaten
17. Staaten in Konfrontation
18. Europa im Krieg
19. Zeit der Wirren in Ost und West
Schlussbemerkung: Europas Paroxysmus
Anhang
Danksagung
Karten
Lektürehinweise
Abbildungsnachweise
Verzeichnis der Stammbäume
Register
Einleitung
Der Holländer David de Vries war stolz darauf, die Welt gesehen zu haben. 1655 veröffentlichte er in seiner Muttersprache den Bericht über seine sechs Reisen, die ihn in die Welt des Mittelmeers, in den Fernen Osten, nach Neufundland, in die Karibik und nach Süd- und Nordamerika geführt hatten. De Vries war als Sohn holländischer Eltern 1593 in La Rochelle geboren worden. Er ließ sich zum Artilleriemeister ausbilden, beherrschte mehrere europäische Sprachen, war ein erfahrener Navigator, ein versierter Geschäftsmann, ein scharf beobachtender Autodidakt. Er trug keine Schuld daran, dass seine kolonialen Unternehmungen – am Delaware (damals South River; 1633), am Oyapock in Guyana (1634) und auf Staten Island (1638–1643) – sämtlich fehlschlugen. Von Sponsoren zugesagte Gelder blieben aus, der Umgang mit der indigenen Bevölkerung war schwierig, konkurrierende Unternehmen erwiesen sich als feindselig. De Vries wusste, wem er Loyalität schuldete. Seine Heimat waren die Niederlande, die Stadt Hoorn seine patria. Wäre es ihm gelungen, in Nieuw Nederland, das er häufig erwähnte, eine koloniale patroonschap – Herrschaft über Landeigentum – zu errichten, hätte er sie nach dem Modell der Güter des holländischen Landadels gestaltet. Er war ein Calvinist, der sich am Bau der ersten protestantischen Kirche auf Staten Island beteiligt hatte. De Vries begriff Europa als Teil der großen weiten Welt. Auf der Fahrt nach St. John’s in Neufundland bewunderte er die riesigen Eisberge, und nach der Ankunft im Jahr 1620 berichtete er von den Seglern aus Holland, dem Baskenland, Portugal und England, die in den Gewässern dort Fischfang und Handel trieben. Da er seinen Blick bereits vorab durch die Lektüre anderer Reiseberichte geschärft hatte, konnte er sich den Bräuchen der in Neufundland lebenden Indigenen anbequemen. Als er 1640 den Gouverneur der neuen englischen Kolonien am James River besuchte, wurde er mit einem Glas venezianischen Weins empfangen und nahm Platz neben einem englischen Kolonisten, der ebenfalls Ende der 1620er-Jahre die Ostindischen Inseln befahren hatte. De Vries berichtet von der angenehmen Unterhaltung mit dem Engländer, der bemerkte, Berge könnten einander nicht begegnen, wohl aber Männer, die auszögen, die Welt zu sehen.
Wie an ihrer Kleidung, ihren Essgewohnheiten und ihrem Betragen kenntlich, waren es Europäer, die sich der Tatsache, auf einem anderen Kontinent zu sein, bewusst waren, da sie (so de Vries) „die vier Ecken der Welt angesteuert hatten“. An der Laufbahn des Holländers zeigten sich die weiter gewordenen Horizonte seiner Generation, die dadurch sich bietenden Möglichkeiten und Herausforderungen, wurde eine außergewöhnliche Vielfalt von Kontakten und Kommunikationswegen sichtbar, die alte Loyalitäten und Zugehörigkeitsgefühle infrage stellte. Diese neue Auffassung von Europa als einer im Rahmen der weiteren Welt zu begreifenden geographischen Einheit wäre ein Jahrhundert zuvor noch nicht möglich gewesen. Im 16. und frühen 17. Jahrhundert verlor die ältere Vorstellung an Strahlkraft, die unter „Europa“ die „Christenheit“ verstand. Dieser Niedergang und die mit ihm einhergehenden tief greifenden Wandlungsprozesse sind Gegenstand dieses Buches.
„Christenheit“ beschwört, wie die Sage von Camelot, eine imaginierte Vergangenheit herauf. Im Mittelalter umriss der lateinische Ausdruck für „Christenheit“ – christianitas oder corpus Christianorum – etwas anderes, nämlich eine imaginierte Gegenwart und Zukunft für eine Welt, die durch die christlichen Glaubensinhalte und Bestrebungen vereint war. Diese Glaubensgemeinschaft trat hervor, während das Römische Reich im Westen seinem Untergang entgegenstrebte. Das Christentum, das in dessen Überresten Wurzeln schlug, befand sich anfänglich am westlichen Rand einer viel größeren christlichen Welt, deren Kerngebiet weiter östlich lag, dort, wo der Vordere Orient an das weiterhin aktive Oströmische (Byzantinische) Reich grenzte. Allmählich jedoch, und begünstigt durch wechselseitige Entfremdungsprozesse, trennten sich die Wege des westlichen und des östlichen Christentums, bis 1054 der Papst in Rom und der Patriarch in Konstantinopel einander gegenseitig exkommunizierten. Seit diesem tiefen Einschnitt bildeten die römischen Christen die westliche Christenheit, während sich in Griechenland, auf dem Balkan und in Russland das orthodoxe Christentum ausbreitete.
Im ersten Jahrtausend der Existenz einer westlichen Christenheit entwickelte sich das Christentum ohne genaue Auffassung davon, wo sein Zentrum lag, weshalb es auch keine Vorstellung von seiner Peripherie besaß. Es existierte (um die Ausdrucksweise eines ausgezeichneten Mediävisten zu benutzen) als eine Reihe von „Mikro-Christentümern“, die in ihrer Gesamtheit eine Art „geodätischer Kuppel“ aus in sich geschlossenen Segmenten bildeten. Der Handel mit „symbolischen Gütern“ (Reliquien, aber auch Menschen wie etwa Missionaren und Heiligen) trug das Charisma heiliger Macht von Ort zu Ort – und zugleich damit die Werte und Bestrebungen der Glaubensgemeinschaft von einem Segment zum nächsten. Im Hochmittelalter dann, nach dem Bruch mit dem Osten, entwickelte das westliche Christentum ein genaueres Gespür für das Verhältnis von Zentrum und Peripherie, indem sich zwei geographische und ideologische Einheiten deutlich herauskristallisierten: das Papsttum und das Heilige Römische Reich. Zuversichtlich baute man auf den Universalismus, während die jeweiligen Ansprüche im Wettstreit zwischen Theologen, Rechtsgelehrten, politischen Theoretikern und Intellektuellen formuliert wurden. Unterstützt wurde dieses Ideal durch die wirtschaftlichen Wandlungsprozesse jener Epoche: das beeindruckende Wachstum der Märkte und den interregionalen wie internationalen Handel, sowie durch die Heiratspolitik und die diplomatischen Bündnisse der Aristokratie. „Christentum“ war die Art und Weise, in der die gebildeten Zeitgenossen im 12. und 13. Jahrhundert die Welt der römischen Christen im westlichen Europa verstanden.
Für diese Glaubensgemeinschaft war die römisch-katholische Kirche die tragende Säule. Die geistigen Eliten des westlichen Christentums hatten sich um eine internationale Sprache (das Lateinische im Gegensatz zum Griechischen), ein gemeinsames Curriculum (das sich in Sachen Philosophie und Logik an den Werken des Aristoteles orientierte) und eine bestimmte Art des Lehrens und Lernens (die Scholastik) gebildet. Wie Macht in theokratischer und bürokratischer Hinsicht zu begründen, auszuüben und zu legitimieren sei, war päpstlichen Gesandten und Ratgebern von Fürsten gleichermaßen vertraut. Die Kreuzzüge wurden zum ehrgeizigsten Projekt des westlichen Christentums. Vor allem aber fand die lateinische Christenheit ihren Ausdruck in tradierten und regelmäßig praktizierten Glaubensriten, die sich jener bereits existierenden vieldimensionalen, geheiligten Landschaft aus Reliquienschreinen, Pilgerstätten, Heiligenkulten und Festlichkeiten einschrieben. Die Taufe war ein universeller Initiationsritus. Die nicht christlich Getauften – Juden und Moslems – lebten im Hochmittelalter in beträchtlicher Anzahl an den Rändern des westlichen Christentums und wurden genau deshalb toleriert, weil sie nicht der Glaubensgemeinschaft angehörten. Doch als christliche Königreiche die Grenzen des Christentums in Spanien und Süditalien weiter nach Süden ausdehnten, wurden sie zunehmend als bedrohliche Vertreter jener Mächte angesehen, die nicht zum Christentum gehörten.
Das Christentum fühlte sich schnell bedroht, doch waren seine gefährlichsten Feinde keineswegs die Nichtchristen. Wer an den Schalthebeln der Macht saß, hatte vor allem von ganz anderer und sehr heterogener Seite Unbill zu erwarten, nämlich seitens all derjenigen, die besondere, lokale Loyalitäten hegten, weswegen sie mit den übergreifenden Bestrebungen des Christentums wenig oder nichts anfangen konnten. Das westliche Europa war übersät mit Tausenden von Dörfern und Kirchspielen, deren Einwohner häufig genug ihren adligen Herren auf eine Weise verpflichtet waren, die sie zu Leibeigenen machte. Den universellen Ordnungsprinzipien von Kirche und Heiligem Römischem Reich (jenem mitteleuropäischen Herrschaftsgebilde, dessen Name seinen Anspruch ausdrückte, Nachfolger des Römischen Reichs und zugleich die zeitgemäße Form universeller Herrschaft zu sein) standen solche Bindungen entgegen. Neben den Landgemeinden gab es Städte, die vom Wirtschaftswandel des Hochmittelalters profitierten. Allerorten wurden Bürokratie und kosmopolitischer Ehrgeiz der international agierenden Ordnungsmächte mit Misstrauen betrachtet. Je stärker das Bewusstsein von Zentrum und Peripherie im Christentum wuchs, desto mehr Menschen ärgerten sich über die Zeit, die sie benötigten, um von höheren Stellen Genehmigungen für dieses oder jenes einzuholen. Viele waren es leid, die universelle Kirche durch Abgaben finanzieren zu müssen, und misstrauten dem aufgeblähten, übernationalen Projekt namens Kreuzzug. Ab dem 12. Jahrhundert wuchsen sich diese Gefühle zu Streitsucht oder gar Ketzertum aus, wobei Letzteres durch sein epidemisches Auftreten ein gravierendes Problem darstellte. Dies wurde gerade von denen, die sich den christlichen Idealen am stärksten verpflichtet fühlten, als Bedrohung empfunden.
Das Vertrauen in diese Ideale schwand dahin, als die europäische Wirtschaft infolge der Pest in die Krise geriet. Leibeigenschaft und Pflichten gegenüber den Herren wurden von den Abhängigen unter Verweis auf das, was sie ihr gutes, altes Recht nannten, infrage gestellt. Zwar bestanden die christlichen Glaubensformen und -praktiken fort, und die heiligen Wege und Stätten erblühten stärker als je zuvor, doch nahm die lokale Glaubwürdigkeit des Christentums in dem Maß ab, in dem es zum Gegenstand konkurrierender Ansprüche darauf wurde, die traditionelle Gesellschaftsordnung zu repräsentieren. Auch das „Abendländische Schisma“ (1378–1417) war der Idee universeller Loyalität abträglich. Da es nun zwei Päpste gab, teilten sich die Christen in solche, die Rom die Treue hielten, und andere, die das Avignoneser Papsttum unterstützten, wobei der Papst in Südfrankreich von seinen Feinden als Marionette an den Fäden einer spalterischen französischen Monarchie hingestellt wurde. Der Streit endete mit einem Kompromiss, doch war die moralische Autorität des Papsttums dauerhaft beschädigt. Nunmehr traten auch die Gefahren eines Bündnisses zwischen unzufriedenen lokalen Kräften und den Vertretern einer neuen säkularen, jedoch nicht ans Reich gebundenen Macht zutage, denn der Kompromiss war mittels der Autorität eines ökumenischen Konzils zustande gekommen. Ein Konzil nährte die – für Theokraten und Bürokraten besorgniserregende – Auffassung, eine solche Versammlung stehe über dem Papst. Dergleichen war schon zwei Jahrhunderte früher erörtert worden, wurde jetzt aber mit größerem Nachdruck vorgetragen. Die Idee war ihrem Wesen nach radikal, obschon die meisten „Konziliaristen“ gemäßigt waren und das Konzil nur als Möglichkeit sahen, auf angenehme Weise aus einer Zwangslage herauszukommen. Keineswegs begriffen sie es als Mechanismus zur Zerstörung der päpstlichen Universalmonarchie und schon gar nicht als Möglichkeit, auf unorthodoxe Weise Lehrautorität zu erlangen. Genau das aber erreichte die Reformation als implizite Erbin der Konzilsbewegung.
Somit lautete die zentrale Frage in der europäischen Geschichte des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, was mit dem Christentum geschehen würde – mit den Institutionen, die sein Gravitationszentrum bildeten und, mehr noch, mit der Glaubensgemeinschaft, die sein Fundament darstellte. Was sollte, wurde das Christentum zerstört, an seine Stelle treten? Es setzte ein Prozess ein, in dem das Christentum zunehmend hinter Europa (hier verstanden als geographischer Begriff in einem Verhältnis der Distanz zu anderen Weltteilen) verschwand. „Christentum“ und „Europa“ unterschieden sich grundlegend: Ersteres erhob Anspruch auf die Treue all derer, die mit der Taufe Angehörige der Glaubensgemeinschaft geworden waren und ihr Verhältnis zur äußeren Welt dementsprechend gestalteten. Europa dagegen beanspruchte keine Einheit, die über die von ihm repräsentierte geographische Landmasse und ein zunehmendes Bewusstsein moralischer und zivilisatorischer Überlegenheit der hier beheimateten Staaten und Völker hinausgegangen wäre. Das westliche Christentum war ein großes Projekt, das auf die europäische Einheit zielte und ein Jahrtausend brauchte, um zur Reife zu gelangen – während seine Zerstörung sich ebenso schnell wie vollständig vollzog. Nach kaum mehr als einem Jahrhundert war von diesem Projekt nur noch der Traum übrig geblieben. Gewaltige Kräfte vollendeten das Zerstörungswerk und veränderten Europa von Grund auf. Ihr Zusammenspiel steht im Mittelpunkt des ersten Kapitels.
1. Das Ende des westlichen Christentums
Als Thomas Cockson 1609 nach dem umstrittenen Waffenstillstand zwischen dem katholischen Spanien und der gerade im Entstehen begriffenen Republik Holland seinen Kupferstich mit dem Titel The Revells of Christendome (Die Vergnügungen des Christentums) veröffentlichte, bediente er sich bereits bekannter satirischer Darstellungsweisen, um das Christentum zu verspotten. Ganz oben am Tisch steht Papst Paul V., während zu seiner Linken, dem Betrachter zugewandt, drei europäische Könige sitzen (Heinrich IV. von Frankreich, Jakob I. von England und Christian IV. von Dänemark). Ihnen gegenüber haben sich drei katholische Mönche niedergelassen, die mit den Königen würfeln, Backgammon und Karten spielen – um die Zukunft Europas. Ein Hund uriniert auf den Fuß eines Mönchs. Was der Stich sagen will, ist deutlich: Das Schicksal des Christentums liegt in dieser Runde niemandem am Herzen, es ist zu einem Witz geworden. Viele der Elemente, die zum Ende des westlichen Christentums beitrugen, waren in Europa schon vor 1500 wirksam, doch erst, als sie vollzählig waren und interagierten, war das Schicksal des Christentums beschlossene Sache.
Der Einfluss der Renaissance
Schon lange vor 1517 hatte die Wiederentdeckung klassischer Texte und Ideen in den städtischen Kulturen Norditaliens, Flanderns und des Rheinlands begonnen. Bis dahin war die Scholastik die allgemein akzeptierte Verfahrensweise gewesen, um die philosophischen Probleme der europäischen Eliten anzugehen, und mit der Scholastik war die Vorherrschaft der aristotelischen Philosophie einhergegangen. Das wurde nun infrage gestellt. Die humanistischen Gelehrten sahen es als ihre Aufgabe an, die Texte der klassischen Antike unverfälscht wiederherzustellen und mit den Gedanken ihrer Verfasser in einen kritisch prüfenden Dialog zu treten. Die humanistisch inspirierten Lehrer betonten die Bedeutung der persuasio (Überzeugung): Gelernt werden sollte das geordnete Vortragen von Argumenten, um andere Menschen für die eigenen Ansichten zu gewinnen. Ihre Schüler lernten mit den lateinischen Texten (überwiegend von Cicero) eine neue Sprache und erfuhren etwas über die angemessene Lenkung eines Gemeinwesens. Das führte zu veränderten Vorstellungen über die Beziehung zwischen Herrschern und Beherrschten, über das Politische und das Gesellschaftliche und zu einem anderen Universalismus – der „Öffentlichkeit“ (lateinisch publicum) – als dem tradierten des „Christentums“.
„Öffentlichkeit“ war die größte begrifflich fassbare universitas, in den Augen des römischen Rechts eine fiktive Person, unterschieden von denen, die sie erschufen, eine Gesamtheit, die eine lebende Person nachzuahmen vermochte, Rechte und Pflichten sich aneignen und andere damit beauftragen konnte, sie in ihrem Namen wahrzunehmen. Die universitas einer Republik (einer „öffentlichen Sache“) verkörperte den Willen ihrer Mitglieder. Es konnte eine Vielzahl von Republiken geben, wobei einige virtueller waren als andere. So nutzte etwa die „Gelehrtenrepublik“ den Wandel der Kommunikationsmöglichkeiten und wurde von den humanistischen Gelehrten jener Epoche lebhaft gefördert. Ebenso aber spiegelte sich in ihr die Geschichte von Europas „geistigem Kapital“, das zunehmend aus den Händen einer kleinen geistlichen und höfisch-bürokratischen Elite in einen so vielschichtigen wie kosmopolitischen Markt von Produzenten und Konsumenten überging, auf dem Verleger, Drucker, Graphiker, Bibliothekare und Leser unterschiedlicher Provenienz ihre jeweiligen Interessen vertraten. Wie dieser Markt funktionierte, hing von den lokalen Gegebenheiten ab, was erklärt, warum die intellektuelle wie die soziale „Geometrie“ der Renaissance so verschieden ausfiel. Ihr Einfluss wechselte von Region zu Region, wobei die unterschiedlichen Konturen durch religiöse Spaltungen noch verstärkt wurden. Zu ihren wichtigen Komponenten zählten die Fürstenhöfe, und die Renaissance wandelte sich bereitwillig zu einer höfischen Kultur, indem sie sich den am Hof herrschenden Bedürfnissen und Bestrebungen anpasste. Wie die großen wissenschaftlichen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts besaß auch die Renaissance die Macht, zu verwandeln und zu zerstören. Sie konnte kirchliche und politische Obrigkeiten zementieren oder untergraben. Sie konnte grundlegende Vorstellungen über Gottes Vorsehung in der Welt infrage stellen oder bekräftigen. Ihre Pädagogiken zeigten auf ganz neue Weise, wie man lernen konnte, sich selbst, die Welt und ihren Schöpfer zu begreifen.
Neben anderen Dingen entdeckten die humanistischen Gelehrten, dass die antike Philosophie ihre eigene Geschichte hatte. Um Aristoteles zu verstehen, musste man ihn in den Zusammenhang mit all jenen Denkern stellen, mit denen er sich auseinandersetzte. Dadurch war er keine einzigartige Autorität mehr, die allein Wahrheit und Legitimität verlieh. Dieser Prozess hatte damit begonnen, dass man den griechischen Text der Schrift Leben und Lehre der Philosophen von Diogenes Laertius übersetzte, veröffentlichte und popularisierte. Nun verfügte man über eine Genealogie für die miteinander wetteifernden „Sekten“ der griechischen Philosophen und konnte Ansichten, die im Mittelalter randständig geblieben waren, Glanz verleihen. Die Lehrer brachten ihren Studenten den Aristoteles nun in dieser vielschichtigeren Traditionslinie nahe und nahmen die Argumente und Debatten der griechischen Welt ernst. Einige Philosophen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts orientierten sich an den antiken Schulen der Epikureer, Stoiker, Platoniker und pyrrhonischen Skeptiker. So verlor die antike Philosophie ihre bisherige Rolle als Magd der christlichen Theologie und als Instrument zur Konstruktion einer universellen Ordnung, was die Philosophen freilich nicht daran hinderte, einem grundlegenden Ensemble von Wahrheiten nachzuforschen. Einige meinten, man könne, wie in jeder Genealogie, die Linie zu einer Urahnenschaft zurückverfolgen, von der sich auf alle Nachfolger ewig gültige Spuren vererben würden. Ein Beispiel dafür ist Francesco Patrizi da Cherso, der in seiner Nova de universis philosophia (Neue Universalphilosophie, 1591) die Schriften des Aristoteles über Platon zu Solon und Orpheus zurückverfolgte und noch weiter zum biblischen Bericht über die Erschaffung der Welt und zum Mystizismus der Ägypter, wie er in den Werken des Hermes Trismegistos gedeutet wird. Die hermetischen Schriften, die gut 1100 Jahre vor Platon entstanden sein sollen, enthielten, so behauptete Patrizi, mehr Weisheit als die „gesamte Philosophie des Aristoteles“. Andere zogen es vor, die Gemeinsamkeiten zwischen Platon und Aristoteles zu betonen, die ihrer Ansicht nach trotz der unübersehbaren Differenzen auf eine dem antiken Denken zugrunde liegende „Harmonie“ verwiesen.
Gerade als dieser Synkretismus im Begriff war, sich zu konsolidieren, erhoben sich die radikal skeptischen Stimmen derer, die den griechischen Philosophen Sextus Empiricus gelesen hatten. Sextus Empiricus hatte die Auseinandersetzungen zwischen seinen Kollegen dazu benutzt, um nicht nur des Aristoteles Bemühungen, Wahrheit zu erlangen, grundsätzlich in Zweifel zu ziehen. Folgte man seiner Argumentation (und einige bedeutende Denker, wie etwa Michel de Montaigne, taten es), so steckte die klassische Philosophie voller Irrtümer. Gianfrancesco Pico della Mirandola, der Martin Luther der Philosophie des 16. Jahrhunderts, schrieb in seinem 1520 veröffentlichten Examen vanitatis doctrinae gentium (Untersuchung über die Nichtigkeit der heidnischen Lehren): „Die gesamte Lehre der Heiden steckt voller Aberglauben, Ungewissheit und Irrtum.“ Erst einem Genie wie René Descartes gelang es, diesen Pyrrhonismus zum Fundament einer Universalphilosophie zu machen, die eine neue, auf Experimenten beruhende Physik zu stützen in der Lage war. Doch konnte mittlerweile niemand mehr ernsthaft die Auffassung vertreten, das Christentum sei auf der Grundlage radikalen Zweifels bunt zusammengewürfelt worden.
Humanistisch gebildete Geographen, Ärzte und Naturforscher waren gleichermaßen von der Wichtigkeit direkter praktischer Erfahrung und vom Wert des Experimentierens überzeugt. Dadurch veränderte sich das Bild, das man sich von der Welt der Natur machte. Europas geographische Entdeckungen jenseits seiner Grenzen trugen dazu bei, die natürliche Welt für ein Füllhorn reicher und seltener Phänomene, für ein Schatzhaus voller Geheimnisse zu halten. Diese Welt sollte von jenen entschlüsselt werden, die von dem dafür notwendigen Code wussten. Astrologen, Alchemisten, Kosmographen, Naturmagier und unorthodox praktizierende Mediziner wetteiferten miteinander um Erklärungen dafür, wie jene ungeheure Vielfalt der Natur auf geordnete, die Materie betreffende Grundsätze zurückgeführt werden könne. Zumindest aber wollte man zeigen, dass diese Vielfalt der empirischen Forschung zugänglich sei. Einige der Naturkundler suchten solche Prinzipien in übernatürlichen Mächten – in einer Zauberkraft, die der Natur innewohnte wie ein im Erdgeschehen verborgener Geist, oder die durch Wärme und Bewegung der Lüfte übertragen wurde. Den Philosophen gleich kritisierten diese Naturkundler die aristotelischen Auffassungen; hauptsächlich hielten sie seine Vorstellungen von Materie für zu abstrakt. Ihr Wissen und ihre Einsichten umhüllten sie mit einer Aura des Geheimnisvollen, um sie vor ihren zahlreichen Kritikern zu schützen und so ihren Ruf zu vermehren, wonach sie über außerordentliche Weisheit und Macht verfügten. Doch gab es auch die entgegengesetzte Auffassung, die besagte, dass menschliches Wissen begrenzt sei, weshalb es einem einzelnen Menschen nicht gelingen könne, in die Geheimnisse der Natur einzudringen. Das müsse vielmehr Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung vieler Forscher sein, die die praktischen Aspekte des Wissens ebenso wie die unterschiedlichen Möglichkeiten der Interpretation berücksichtigten.
Nirgendwo machte sich der Einfluss solcher Veränderungen auf die Idee von der Christenheit stärker bemerkbar als in der Kosmologie. Das heliozentrische Universum des Kopernikus verdankte sich in nicht geringem Maß der Wiederbelebung alternativer Kosmologien der klassischen Antike, die den auf aristotelischen Anschauungen basierenden Konsens infrage stellten. War aber die Erde nichts weiter als ein um die Sonne sich drehender Planet wie andere auch, wurde das Universum im Vergleich zur Erde unfassbar groß – „unermesslich“, wie Kopernikus einräumte. Diese Unermesslichkeit rührte daher, dass man zwischen der Orbitalbahn des Saturn und der Sphäre der Sterne eine enorme Entfernung anzunehmen gezwungen war. Gehörte die Erde zu den Planeten, waren die Prozesse des Entstehens und Vergehens, die Aristoteles anhand von Vorgängen in der Natur und auf der Erde erklärt hatte, nunmehr plausibler durch den Einfluss der Sonne oder die Bewegung und Stellung der Erde im Hinblick auf die Sonne und die anderen Planeten zu erklären. Am besten aufgehoben hatte sich das Christentum inmitten eines konzentrischen und anthropomorphen Universums gefühlt, doch der Heliozentrismus hatte es nun aus dem Zentrum der Schöpfung entfernt.
Natürlich gab es noch die Sittenwächter des Christentums, Papsttum und Inquisition. Beide wachten scharf über Versuche, das heliozentrische Weltbild zu propagieren. Verdächtigt wurden, in unterschiedlichem Maß, etwa der für seine brillante Eigenwerbung bekannte Arzt und Alchemist Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim), der Magier und Astrologe John Dee, der Theologe und Kosmograph Giordano Bruno sowie die Naturphilosophen Francesco Patrizi und Galileo Galilei. Im Februar 1600 verbrannte die Kirche Giordano Bruno auf einem Scheiterhaufen in Rom. Ein Jahr später wurde der Dominikaner Tommaso Campanella im Castel Nuovo in Neapel 40 Stunden lang brutal gefoltert, weil er an einem Volksaufstand teilgenommen hatte. Ein Vierteljahrhundert verbrachte er im Castel Nuovo als Gefangener, wobei er gegen die „vergifteten Wurzeln“ der heidnischen aristotelischen Philosophie wütete. Er träumte von der radikalen Transformation einer Welt, der er nicht mehr wirklich angehörte. Das Problem für radikale Denker in dieser Zeit bestand darin, dass sowohl die augenblicklichen Umstände wie auch die Zufälligkeit ihres Aufenthaltsorts darüber entschieden, ob und inwiefern ihre Ideen als Herausforderung verstanden wurden. Dergestalt gab es kein „Ende“ der Renaissance, sondern nur eine fortwährende Neuverhandlung ihrer Möglichkeiten, alte Gewissheiten im Rahmen neuer Zusammenhänge zu zerstören.
Die protestantische Reformation
Im Zentrum der Bewegung für einen religiösen Wandel stand die protestantische Reformation, ein Bruch im westlichen Christentum, der so spektakulär und dauerhaft war wie die Spaltung zwischen West- und Ostkirche im 11. Jahrhundert. Kompliziert wurde die Angelegenheit dadurch, dass sich der schmerzliche Bruch gewaltsam vollzog. Martin Luther war der Überzeugung, das Christentum müsse wegen der Flegel und Huren in Rom zugrunde gehen. Im Mai 1520 veröffentlichte der Leipziger Franziskaner Augustin von Alveld eine Flugschrift in deutscher Sprache, um die Behauptung zu verteidigen, der Papst genieße durch göttliches Recht die Oberhoheit über die Christenheit. Luther wetterte gegen den „Alvelder Esel“ mit der Bemerkung, dass der Papst und seine „Romanisten“ das Papsttum zur „roten Hure zu Babylon“ gemacht hätten und der päpstliche Antichrist die Schuld am Zustand des Christentums trage. Zu dieser Zeit war Luther durch das Studium von Bibel und Kirchengeschichte zu der streitbaren Auffassung gelangt, er wisse von Gottes Wahrheit und wie sie zu beweisen sei. „Allein durch den Glauben“ (sola fide) gelange man dorthin, und „allein durch die Schrift“ (sola scriptura) werde die Wahrheit erwiesen. Die Autorität des Papstes aber war menschlichen, nicht göttlichen Ursprungs, und die letztendliche Autorität kam nicht den Päpsten, den Konzilen oder den Kirchenvätern zu, sondern allein der Bibel. Nur auf diese Weise, so Luther, könne das Christentum zu seinen Wurzeln – dem Evangelium Christi – zurückkehren. Die Bibel verzeichnete Gottes Versprechen an die Menschheit seit Anbeginn der Welt. Dieses Versprechen wurde im Alten Testament erneuert und schließlich in Christus erfüllt. Nichts konnte in wortwörtlicherem Sinn wahr sein als dies Versprechen, da Gott selbst im Glauben vertraut werden muss.
Dieser reduktionistische und nachdrückliche Wahrheitsanspruch hatte weitreichende Folgen, einschließlich des unwiderruflichen Bruchs mit der katholischen Kirche und einer großen Uneinigkeit der protestantischen Theologen darüber, wie wortwörtlich man die Schrift denn nun nehmen solle. Für Luther waren die Ausdrücke „Christentum“, „Kirche“ und „christliche Gemeinschaft“ Synonyme. Sie alle bezeichneten ein virtuelles Gemeinwesen, nämlich jene Gemeinschaft der Heiligen, auf die Christus sich bezog, als er sagte: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Es sei eine Lüge, zu behaupten, das Christentum befinde sich in Rom oder überhaupt an einem bestimmten Ort. Die wahre Kirche kannte keine äußeren Formen, keine besonderen Gewänder oder Gebete, keine Bischöfe oder Bauwerke. Damit schrumpfte die Landschaft des Heiligen beträchtlich. Luther zufolge war es allein der Glaube, der aus allen Gläubigen wahre Priester machte und die Welt, die sie zufällig bewohnten, in eine christliche Ordnung brachte.
Luther gelang es auf glänzende Weise, und dies vor allem in Deutschland, bereits vorhandene und lokal durchaus verschiedene Vorbehalte gegen die katholische Kirche zu mobilisieren. Wenn Rom die Ursache für das Krebsgeschwür war, das das Christentum befallen hatte, musste man eingreifen und den Tumor entfernen. Die Christen sollten handeln wie Kinder, deren Eltern verrückt geworden waren, oder wie jemand, der ein Gebäude brennen sieht und nun die Pflicht hat, Alarm zu schlagen und das Feuer zu bekämpfen. Dafür waren insbesondere die Könige, Fürsten und Adligen verantwortlich; ihre Aufgabe war es, Luther zufolge, Gotteslästerung zu verhindern oder auch, dass jemand Schande über den göttlichen Namen bringe. Luther wollte das Christentum stärken, nicht zerstören oder ersetzen. Doch indem er Autorität und Legitimation innerhalb des Christentums völlig neu verortete, traf er die vereinte Glaubensgemeinschaft an ihrer empfindlichsten Stelle. 1520 war Luther da ganz unzweideutig: Keine Person ist mit universeller Autorität ausgestattet, vielmehr sind in Wahrheit alle Christen rangmäßig gleiche Mitglieder einer christlichen Gemeinschaft, in der Taufe, Evangelium und Glaube allein „ein christlich heilig Volk“ schaffen. Es gibt, was den Status als Christen angeht, keinen Unterschied zwischen Laien und Priestern oder zwischen Fürst und Volk. Das war von spektakulärer Einfachheit, warf in der Praxis aber mehr Fragen auf, als es beantwortete. Wie sollte sich ein Christenvolk realiter organisieren? Wie sollte es geeignete Pastoren finden, und worin bestanden deren Pflichten und Verantwortlichkeiten? Welche Rolle kam unter solchen Umständen dem Herrscher zu? Wie sollte sich die Bevölkerung verhalten, wenn Fürst oder Rat ihren christlichen Pflichten nicht nachkamen? Wem kam es zu, die wahre Glaubenseinheit zu verkünden und durchzusetzen? Wessen Aufgabe war es, das Christentum zu verteidigen?
Den theologischen Gräben, die sich in der Reformation auftaten, lag eine Transformation zugrunde, die das Wesen und die Äußerungsformen heiliger Macht betraf. Eine der fundamentalsten Veränderungen betraf das Verhältnis zwischen kirchlichen und staatlichen Institutionen. Zwar behielten Luther und die anderen Reformatoren augenscheinlich die Trennung zwischen kirchlicher und ziviler Jurisdiktion bei, doch übten die religiösen Veränderungen Druck auf die Beziehung aus, was zu einer unbehaglichen, nicht reibungsfreien Nähe führte. Luther gab vor, die „zwei Reiche“ von Kirche und Staat unverändert aufrechtzuerhalten, vergrößerte in Wirklichkeit jedoch den Spielraum des Letzteren und schwächte die Erstere. Diese Umverteilung von Macht veränderte im protestantischen Europa die Auffassung von religiöser Wahrheit. Es war nunmehr eine von Gott erklärte und von der Heiligen Schrift garantierte, eine in Bekenntnissen verkörperte Wahrheit, gelebt in konfessionell gestalteten Gemeinden, in denen die Instrumente der Obrigkeit Leben und Verhalten der Menschen formten und überwachten. Dagegen trat die Auffassung, die Menschheit sei an Gottes Werk – der Erlösung seiner Schöpfung – beteiligt, in den Hintergrund. Gott hatte eine natürliche Welt erschaffen, in der die Sünden der Menschheit ein Tatbestand waren, der reguliert, kontrolliert und begrenzt werden musste. Diese Grenzen wurden von einer staatlichen Macht bewacht, die ihrerseits in eine theologisch-politische Vorstellungswelt eingebettet war, in der Gottes Macht das Vorbild für die Macht des Staates darstellte – beide waren allmächtig und unwiderstehlich.
Die römisch-katholische Kirche
Was blieb nun der katholischen Kirche? Ihren Anspruch, der spirituelle Führer dessen zu sein, was vom Christentum übrig geblieben war, hielt sie jedenfalls aufrecht. Doch was das angesichts der Tatsache, dass das protestantische Europa diesen Anspruch verworfen hatte, bedeuten konnte, musste erst noch entschieden werden. Anfänglich konzentrierte die katholische Kirche ihre Anstrengungen auf das Kernland des westlichen Europas. Diese Bemühungen führten schließlich zu einer systematischen Auseinandersetzung mit dem Protestantismus auf dem Konzil zu Trient (1545–1563) und sollten weithin mit der Vormachtstellung der spanischen Habsburgermonarchie und ihren Konflikten (insbesondere mit den Osmanen) in eins gesetzt werden. Zugleich aber bewahrte die katholische Kirche die Verbindung zu ihrer angestammten Tradition, indem sie sich durch eine spirituelle und religiöse Neubelebung jener lokalen Wurzeln versicherte, von denen die protestantische Rhetorik sie hatte lösen wollen. Nun fand auch die katholische Kirche, wie bereits der Protestantismus, ihre Einheit in der Konfessionalität. Die Organisation blieb theokratisch und bürokratisch, was jedoch durch das Aufblühen von Ordensgemeinschaften verdeckt wurde. Neben Neugründungen wie Jesuiten und Kapuzinern erfuhren auch ältere Orden wie Franziskaner und Dominikaner eine Wiederbelebung. Sie alle fühlten sich herausgefordert durch die Probleme, denen sich die Christenheit gegenübersah. Diese organisatorische Einheit bildete die Grundlage für den Kampf gegen die theologischen Abspaltungen des Protestantismus und seine – wie es von den Verteidigern der Tradition empfunden wurde – Inkohärenz in Fragen der Autorität.
Schlussendlich hing die Wiederbelebung der katholischen Kirche von der Neuverhandlung der Beziehung zwischen der Kirchenhierarchie und den Gemeinden vor Ort ab. Im Mittelpunkt stand dabei das Ziel, den Menschen Zugang zum Heiligen und zur Erlösung zu verschaffen. Zugleich sollte beseitigt werden, was die Hierarchie als „abergläubische“ Auswüchse ansah, die zu früherer Zeit in die Heilslandschaft eingedrungen waren, desgleichen die Reste „heidnischer“ Kulte und Glaubensformen bei jenen Völkern, die außerhalb Europas erst kürzlich zum Christentum bekehrt worden waren. Das letztere Vorhaben wurde zum Ausgangspunkt für das bemerkenswerte missionarische und kirchliche Bemühen um „spirituelle Landgewinne“ in den Kolonien, wodurch die altgedienten universellen Werte des Christentums in das neue Gewand einer globalen Christenheit gehüllt wurden.
Das Überleben des Christentums
Die Reformatoren waren ebenso wie die Verteidiger der alten Ordnung ganz grundsätzlich davon überzeugt, dass sie das Christentum vor der Zerstörung bewahrten. Beide Seiten verkündeten ihre Wahrheiten als dermaßen selbstverständlich, dass der Schluss gezogen werden musste, nur ein vollständiger Sieg über die jeweils andere Seite könne das Christentum wirklich retten. Zugleich behielt das Christentum für die gewöhnlichen Menschen durchaus seine Bedeutung. Ein frommer Mailänder Bürger, der mit Predigten groß geworden war, welche die Bedrohung der Christenheit durch die Osmanen betonten, konnte 1565 beten, Gott möge seine Familie und die ganze Christenheit „in vollkommener Einheit und Liebe“ erhalten. Reisende formulierten damals immer noch, sie würden die Christenheit „ansteuern“, dort „ankommen“ oder sie „verlassen“, und doch waren nur die wenigsten in Richtung Jerusalem unterwegs. Die Reformatoren hielten die Pilgerfahrt zu den heiligen Stätten ohnehin für unwichtig. Für den englischen Geistlichen Samuel Purchas hatte sich Jerusalem nach Westen verlagert: „Jesus Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, hat dem undankbaren Asien, wo er geboren wurde, schon lange die Scheidungsurkunde überreicht, ebenso Afrika, dem Ort seiner Flucht und Zuflucht, und er ist mittlerweile fast ganz nach Europa gekommen“, schrieb er in Purchas his Pilgrimage (1613), einer Sammlung von Reiseberichten, welche die geographische Vielfalt von Gottes Schöpfung veranschaulichen sollte. Selbst Katholiken konnten eine Pilgerfahrt im bequemen heimischen Lehnstuhl unternehmen, indem sie einen der vielen veröffentlichten Berichte zur Hand nahmen, die die Bedürfnisse der Neugierigen wie der Frommen gleichermaßen bedienten.
Wenn es aber passte, konnte selbst der glühendste Protestant an das Bewusstsein einer wesenhaften Einheit aller christlichen Völker appellieren. Thomas Morus, einstmals Lordkanzler von England, wurde für die Behauptung hingerichtet, das Christentum sei ein „common corps“, eine gemeinsame Körperschaft. Ein späterer Nachfolger, Francis Bacon, hätte ein solches Opfer wohl nicht gebracht, appellierte aber an dasselbe Bewusstsein, als er 1617 die Einrichtung eines internationalen Gerichtshofs forderte, der zwischenstaatliche Auseinandersetzungen beilegen sollte, um „das Vergießen christlichen Blutes“ zu verhindern. Bacons Zeitgenosse Edwin Sandys gab in Europae speculum (1605) dem Wunsch Ausdruck, „das Christentum versöhnt zu sehen“, eine Geisteshaltung, die, wie er schrieb, von seinem Herrn, König Jakob I., zur politischen Leitlinie erhoben werden sollte. Keiner der Nachfolger des Erasmus von Rotterdam legte je wieder so viel an Geschichte und Bedeutung in den Terminus christianitas wie der Humanist selbst, doch sahen auch sie Kriege zwischen christlichen Staaten noch in gewisser Weise als „Bürgerkriege“ und wollten, wie er, Möglichkeiten finden, mit der religiösen Vielfalt zu leben.
Das Nachlassen der Kreuzzüge
Im 16. und frühen 17. Jahrhundert schien das Christentum in seinen südöstlichen und südlichen Randgebieten am stärksten durch die wachsende Macht des Islams bedrückt und bedrängt. Seit dem Fall von Konstantinopel 1453 war die militärische Macht der Osmanen zu Land und zur See wieder angewachsen. 1520 hatte sich das Osmanische Reich Griechenland, die Ägäis sowie die dalmatische Adriaküste in Bosnien einverleibt und sich die Oberhoheit über den Balkan gesichert. Der Sieg über die ungarische Armee in der Schlacht von Mohács (1526) garantierte den Einfluss auf die Große Ungarische Tiefebene und die Karpaten; Transsylvanien und Moldau wurden zu Vasallenstaaten. So entstand eine lange, schwer zu kontrollierende Grenze, die ungemütlich nahe an Wien vorbeiführte. Als Süleyman I. 1566 starb, lebten mehr als 15 Millionen Menschen unter osmanischer Herrschaft; die Osmanen regierten ein gewaltiges eurasisches Landreich, dessen Zentrum Istanbul (Konstantinopel) war. Kluge europäische Beobachter bewunderten die Struktur und Großartigkeit des osmanischen Staats und fürchteten Disziplin und Umfang seiner Armeen. Istanbul selbst war das Aushängeschild des Reichs, eine große Stadt, die 1566 mehr als eine Viertelmillion Einwohner hatte und mit dem prächtigen Großen Basar, dem Topkapi-Palast und den vielen Moscheen mit ihren zugehörigen Schulen, Krankenhäusern und Hamams beeindruckend ausgestattet war.
Die Osmanen betrieben auch den Flottenbau, um Seemacht zu werden. Im 16. Jahrhundert erlangten und bewahrten sie die Vormacht im östlichen Mittelmeer. Die Eroberung von Ägypten und Syrien (1517) sowie die Einnahme von Rhodos (1522) waren das Vorspiel zum Versuch, jene nordafrikanischen Küsten zu kontrollieren, die zentrale Passagen im Mittelmeer wie etwa die Straße von Sizilien beherrschten. Die Osmanen arbeiteten dabei mit Mittelsmännern – von ihnen lizenzierte moslemische Piraten und lokale Statthalter, die militärische Ränge erhielten. Die Gewässer des südlichen Mittelmeers blieben noch weit bis ins 17. Jahrhundert hinein für europäische Schiffe gefährlich.
Hat aber diese osmanische Expansion den Kreuzzugsmythos wieder belebt? Hat das Mittelmeer in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einen „Clash der Kulturen“ erlebt? Jedenfalls scheint das Papsttum in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mehr von den türkischen Ungläubigen beunruhigt gewesen zu sein als von den protestantischen Ketzern. Seine diplomatischen Initiativen zielten auf die Errichtung einer „Heiligen Liga“ gegen die Ungläubigen, die schließlich von Papst Pius V. ins Werk gesetzt wurde. Vor den letzten beiden Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts investierten die Päpste mehr Ressourcen in den Kampf gegen die Osmanen als gegen die Protestanten. Dabei bedienten sie sich nicht nur aus den eigenen Schatztruhen, sondern profitierten auch von den Ablasszahlungen, die die Gläubigen an andere zum Kampf gegen die Türken bereite Kräfte leisteten. Die päpstliche Rhetorik war ein Widerhall der Mobilisierung zum Kreuzzug, wie sie im Mittelalter gang und gäbe gewesen war. Kaiser Karl V. und sein Sohn Philipp II. nahmen ihrerseits die osmanische Bedrohung zum willkommenen Anlass, um ihre Ansprüche auf fürstliche Vorrangstellung zu untermauern. In dieser Epoche bildete die Mobilisierung gegen die Osmanen das Mittel zum Erhalt des Christentums trotz der tiefen konfessionellen Spaltung in seinem Herzen.
In seiner Gegnerschaft zum Islam blieb für das westliche Christentum das Bild des türkischen Ungläubigen von zentraler Bedeutung: Die latente Angst vor der türkischen Gefahr konnte sich auch weiterhin manifestieren und Loyalitätsverhältnisse bekräftigen, vor allem natürlich in jenen Gebieten, die den osmanischen Expansionsgelüsten direkt ausgesetzt waren. Doch drückte sich der Antagonismus nicht mehr in einem konkreten Projekt – der Eroberung des Heiligen Landes – aus. Vielmehr war aus dem „Kreuzzug“ ein „Heiliger Krieg“ geworden, dessen Ziel ein unbestimmterer und eher defensiv orientierter „Schutz“ der christlichen Welt vor dem gemeinsamen aggressiven Feind war. Allbeherrschend war demzufolge die Furcht, das Christentum könne überwältigt werden. Nachdem die Osmanen versucht hatten, Wien zu erobern (1529), berichtete der dortige Botschafter Karls V., Roberto Niño, der den Habsburgern als Horchposten für die Vorgänge in der osmanischen Welt diente, von der Flottenaufrüstung Süleymans des Prächtigen und dessen Plänen, in Italien einzufallen und auf Rom zu marschieren: „Süleyman träumt von dieser Stadt und wiederholt endlos: ‚Nach Rom, nach Rom!‘“ 1566 veröffentlichte der venezianische Kosmograph Jeronimo Ruscelli eine Sammlung von Emblemen auf zeitgenössische Herrscher, die deren geheime Absichten enthüllen sollte. Süleyman war durch vier Kerzenhalter dargestellt, von denen nur einer eine brennende Kerze trug. Ruscellis Deutung machte keine Umschweife: Die vier Kerzen standen für die damals bekannten Kontinente. In dreien waren die Osmanen bereits präsent, und schon bald würden sie auch auf dem vierten (den neu entdeckten Amerikas) auftauchen. Süleymans Plan war, als Weltherrscher das Licht des Islams auf allen vier Kontinenten zu entzünden.
Eine weitere Quelle der Furcht bildeten christliche „Renegaten“, also jene, die „türkisch geworden“ waren – ein Aspekt, der in Flugschriften eifrig diskutiert wurde. Nicht alle dieser Abtrünnigen waren durch die Umstände dazu gezwungen worden. Hatten nicht beispielsweise die Einwohner der ägäischen Inseln Naxos und Scarpanto (Karpathos) die Osmanen in den Anfangsjahren des 16. Jahrhunderts als „Befreier“ von christlicher Unterdrückung begrüßt? Hatten die Osmanen ihre Macht in der Ungarischen Tiefebene nicht auch deshalb konsolidieren können, weil ihre Herrschaft in dieser bäuerlichen Welt auf stillschweigende Akzeptanz stieß? Und rührte das nicht daher, dass die Bewohner sich von der Einführung der osmanischen Justiz die Minderung ihrer feudalen Belastungen durch die christliche Herrschaft ersehnten?
Freilich wurden aus der Angst, von den Türken überrannt zu werden, von den Zeitgenossen unterschiedliche Schlüsse gezogen. So nahm etwa Erasmus von Rotterdam die Gefahren einer osmanischen Expansion ernst, sah aber anfänglich die einzig mögliche Reaktion darauf in der Stärkung des Christentums durch innere Reformen. Später allerdings, nach der Belagerung Wiens, änderte er seine Auffassung. Er meinte nun – und sprach damit implizit die Lutheraner an –, dass die Christen individuell wie kollektiv die Pflicht hätten, den an der Front Leidenden mit Waffengewalt zu Hilfe zu kommen. Aber Luther wie nach ihm Calvin sahen in der osmanischen Bedrohung einen warnenden Fingerzeig Gottes, der auf die Notwendigkeit innerer Reformen hinwies, und lehnten es ab, der äußeren Bedrohung mit Waffen zu begegnen.
Für andere wiederum wandelte sich die tradierte Figur des türkischen Ungläubigen zu einer komplexeren, weniger stark religiös definierten Verkörperung des fremden „Anderen“, für dessen „Barbarentum“ und „Despotismus“ sich Entsprechungen fanden in der weiteren Welt, wo sich die Europäer zunehmend umtaten. Im Gegenzug wich die Vorstellung einer dauerhaften Feindschaft zwischen Christenheit und Osmanischem Reich einer zögerlichen Koexistenz, die die Rede von der Unversöhnlichkeit widerlegte. Mit dem Kreuzzugsgedanken verfiel auch das Christentum. Geographisch und kulturell formte sich Europa, indem es, wie in einen Spiegel, nicht nur nach Amerika, sondern auch zur Levante blickte.
Der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs
Im Oktober 1520 wurde Karl von Habsburg, Herzog von Burgund, Thronerbe von Kastilien und Aragón, in Aachen zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gekrönt. Hinter den riesigen Bronzetüren des Doms erwartete ihn eine bis ins Kleinste durchgestaltete Zeremonie. Ihm wurden Schwert und Ring seines illustren Vorgängers und Namensvetters – das war Karl der Große – überreicht und die Kaiserkrone Ottos des Großen aufs Haupt gesetzt. Zudem erhielt er das kaiserliche Zepter, den Reichsapfel und den sternenbestickten Mantel sowie etliche Reliquien, zu denen auch die Heilige Lanze gehörte, mit der Christus am Kreuz in die Seite gestochen worden war. Das alles waren die Sinnbilder des heiligen Erbes einer universellen Monarchie. Die Krone, achteckig wie der Dom, verwies auf das himmlische Jerusalem. Der Reichsapfel repräsentierte den Globus, und der Mantel besagte, dass Karl der Schutzherr des Christentums war und als Christi weltlicher Stellvertreter über den Kosmos herrschte. Formell jedoch war Karl „erwählter Kaiser“ mit dem Titel Romanorum rex semper augustus, bis er durch eine weitere Krönung vom Papst endgültig eingesetzt wurde. Reich und Papsttum waren die beiden Säulen des Christentums. Dieses Folgeereignis fand im Februar 1530 zu Bologna an Karls 30. Geburtstag statt. Karl V. war der letzte Herrscher in Europa, zu dessen Gunsten ein Anspruch auf universelle Monarchie erhoben wurde und für den ein solcher Anspruch noch Bedeutung hatte. Er war auch der letzte Herrscher, der von einem Papst eingesetzt und in Aachen gekrönt wurde. Als Karl 1556 abdankte, war das Heilige Römische Reich keine Säule des Christentums mehr, sondern nur noch ein dynastisches Instrument der Habsburger, zum Gebrauch in deutschen Landen.
In dynastischer Hinsicht kannte Karl V. nicht seinesgleichen. Im Alter von 25 Jahren hatte er Anspruch auf 72 dynastische Titel, 27 Königtümer, 13 Herzogtümer, 22 Grafschaften und andere Feudalherrschaften, die sich vom Mittelmeer bis zum Ostseeraum und über die Neue Welt erstreckten. Damit waren ihm an die 28 Millionen Menschen auf diese oder jene Weise treuepflichtig – fast 40 Prozent von Westeuropa. Sein Kanzler, Mercurino Gattinara, ermahnte ihn: „Gott war Euch äußerst gnädig. Er hat Euch über alle Könige und Fürsten in der Christenheit erhoben und Euch eine Macht verliehen, die seit Eurem Vorfahren, Karl dem Großen, kein Souverän je besessen hat. Er hat Euch auf den Weg zu einer Weltmonarchie, zur Vereinigung der gesamten Christenheit unter einem einzigen Hirten geschickt.“ Gattinara machte es sich zur Aufgabe, ein glaubhaftes Bild des Monarchen als weltlicher Führer der Christenheit zu entwerfen.
Karl selbst zog niemals ernsthaft in Betracht, ein vereintes, autonomes Herrschaftsgebilde zu schaffen, und spielte das Erbe Karls des Großen nicht in den Vordergrund. Ihm war darum zu tun, die Rechte und Privilegien derjenigen zu respektieren, die lokale Identitäten verkörperten, weshalb er universelle Herrschaft fast ausschließlich als Wächter über den Glauben beanspruchte. Doch um sein Image bemühte Berater entwarfen ein Amalgam aus christlichem und klassischem imperium, wobei sie auf die politischen Implikationen humanistischer Überzeugungsrhetorik rekurrierten und neue Formen der mechanischen Reproduktion und Verbreitung nutzten: die Drucktechnik, Stiche, aber auch Münzen, Medaillen oder Wandteppiche. Kein politischer Führer des mittelalterlichen Christentums war je so bewusst etabliert worden – in so unterschiedlichen Medien, für so viele verschiedene Zielgruppen und mit so vielfältigen Absichten – wie Karl V. Die Krönung zu Aachen bildete dafür das Grundmuster: Detaillierte Darstellungen der Zeremonie zirkulierten in unterschiedlichen Sprachen zusammen mit Holzschnitten, Medaillen und Kupferstichen, die den Kaiser gemäß deutscher Mode mit eckigem Bart und langem Haar zeigten. Ein Jahrzehnt später war Karl ein römischer Kaiser mit kurzem Haar und Bart, ein Impresario militärischer Siege und ein Friedensstifter für Europa. Die Berichte von Karls Triumphzug durch Bologna schildern, wie er die extra für diesen Anlass geprägten Münzen mit der Abbildung der Säulen des Halbgotts Herkules und mit Karls Motto „Plus ultra“ (Noch weiter) in die Menge warf und dabei „Largesse! Largesse!“ schrie, während auf den Straßen der Singsang „Imperio! Imperio!“ erscholl.
Doch erkannten selbst diejenigen, die mit Karls Sache sympathisierten, dass diese Vision zunehmend geringere Realisierungschancen hatte. Der Anspruch, Wächter des Christentums zu sein, geriet ins Zwielicht, als kaiserliche Truppen im Mai 1527 im Sacco di Roma die heilige Stadt verwüsteten. Die protestantische Reformation erteilte jeglicher Vision einer einigen res publica christiana in Deutschland, ganz zu schweigen von Europa, eine Absage. Karls militärische Erfolge spiegelten, wie seine diplomatischen Initiativen, zunehmend die Imperative der Habsburgerdynastie. Was Karl betrieb, war eine Art von indirektem Imperialismus, wobei die universelle Monarchie die Hintertür zur Hegemonie einer glücksverwöhnten Fürstenfamilie bildete. Protestantische wie auch katholische deutsche Fürsten sahen in Karls Anspruch auf ein geheiligtes imperium eine Bedrohung für die Freiheiten der deutschen Nation. In Italien, wo Karls dynastische Erbschaften das Königreich von Sizilien und Neapel wie auch eine Reihe von Territorien nördlich der päpstlichen Besitztümer umfassten, wurde der Anspruch auf die universelle Monarchie am nachdrücklichsten erhoben und ebenso nachdrücklich bestritten. Karls französischer Gegner, Franz I., wollte den imperialen Ambitionen das Wasser abgraben, wo immer es nur ging. Französische Humanisten reagierten auf Karls Vorhaben mit Gegenentwürfen einer durch göttliche Vorsehung bestimmten, gar messianischen Monarchie, die dazu auserkoren war, die Freiheiten und Privilegien der politischen Ordnung Europas gegen die habsburgische Hegemonie zu verteidigen.
Die dynastische Herrschaft
Wenn nun der Kaiser das Christentum nicht mehr schützte, wer dann? Die Amtsgewalt – die Macht des Schwertes – lag hauptsächlich in den Händen dynastischer Fürsten. Dynastische Herrschaft (beruhend auf Erbfolge) war die Grundlage politischer Ordnung. Ihre Attraktivität lag in der durch Abstammung begründeten Legitimität. Wurde dieses Herrschaftsprinzip noch durch den Anspruch auf absolute Autorität verstärkt, konnte es in der aristokratischen und patrimonialen Welt der Fürstenhöfe Ressourcen mobilisieren. In deren informellen Machtstrukturen konnten die Fürsten sich bestimmter Hebel bedienen: der introvertierten Kultur der Gunstgewährung und des den Ehrenkodizes innewohnenden Konkurrenzdenkens. Es fiel den Herrschern nicht schwer, das egoistische Streben der Personen in ihrem Umfeld – nach einem Amt für sich, für Freunde und Angehörige – zu begreifen und zu nutzen. Als Form der Institutionalisierung politischer Ordnung war die dynastische Herrschaft nie überzeugender als zu der Zeit, da sie eine Alternative zu den religiösen Spaltungen und sozialen Wirrnissen der nachreformatorischen Epoche anzubieten schien. Allerdings konzentrierten sich die gerade in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts virulenter werdenden politisch-religiösen Gewalttaten in Westeuropa, wo die Staatsmacht schon sehr früh Fuß zu fassen begonnen hatte. Die augenfälligsten Gewaltakte wurden entweder von schwachen Herrschern angestiftet oder von ihrer Schwäche stark begünstigt. Die dynastische Monarchie war an den religiös grundierten Auseinandersetzungen der nachreformatorischen Zeit ebenso beteiligt wie an deren späterer Eindämmung.
Der dynastische Staat erfuhr vor allem deshalb eine Stärkung, weil die Fähigkeit, Streitkräfte aus zunehmender Entfernung auszuheben und in Gang zu setzen, in dieser Periode beträchtlich wuchs. Ebenso nahm, und dies oftmals dramatisch, die Durchsetzungskraft bei der Eintreibung von Steuern zu, und es wuchs die Zuversicht, wirtschaftliche Aktivitäten aller Art überwachen, kontrollieren und daraus Einkünfte generieren zu können. Vor allem aber veränderte die Möglichkeit, sich auf der Grundlage solchen Machtzuwachses Kredite zu verschaffen, das Wesen der Staatsmacht im Vergleich zu anderen Formen von Macht in der Gesellschaft. Europas erstes koloniales Unternehmen wäre ohne staatliche Unterstützung nicht möglich gewesen. Das soll keine Bestätigung der tradierten Auffassung sein, diese Epoche habe den Aufstieg des „modernen Staates“ gesehen. Tatsächlich spielte sich etwas ganz anderes ab. Jenseits von Beamtentum und Steuerpacht, von Stammrollen und Kolonialsiedlungen malte sich die kollektive Fantasie ein christliches Gemeinwesen aus, in dem das Verhältnis zwischen Herrscher und Beherrschten ein moralisches war. Aus praktischen Gründen waren die staatlichen Verwaltungsmechanismen lokal, breit gestreut und schwach, während im Zentrum die Staatsmacht schnell zur Zielscheibe höfischer Rivalitäten, Fraktionen und Spaltungen wurde. Auf lokaler Ebene lag sie häufig in den Händen von Drahtziehern, adligen Granden und ihren Vasallen. Mochten die Staatsmänner und -frauen jener Epoche auch nach vorne schauen, lässt sich hinter ihrem Verhalten doch nur schwer die kohärente Vision eines ordnenden Staates entdecken, der von allen Bürgern Gehorsam und Loyalität verlangte. Viel einfacher lassen sich ihre Machtspiele aufdecken – wie sie ihre Gegner erniedrigten und sich das Machtmonopol sicherten. Wenn es darum ging, Loyalität und Gehorsam der Untertanen einzufordern, gebärdete sich die frühmoderne, nicht-militärische Macht prinzipiell „performativ“: „Macht“ war Bauchrednerei für die Zuschauertribüne. Schon für das Christentum waren die lokalen Strukturen in Europa der Schwachpunkt gewesen; für den dynastischen Staat sollten sie die Achillesferse sein.
Die dynastische Herrschaft nämlich beruhte auf der Logik der Genealogie und damit auf der Zufälligkeit von Geburt und Tod. Sie missachtete lokale kulturelle Identitäten ebenso wie Privilegien und Eigenarten der Rechtsprechung. In den von ihr regierten Staatsgebilden schuf sie Einheiten ohne inneren Zusammenhang und mit völlig unterschiedlichen Traditionen von Recht und Religion, die für die konfessionellen Spaltungen der nachreformatorischen Welt besonders anfällig waren. Die der dynastischen Herrschaft innewohnenden Konkurrenzinstinkte zerstörten jegliche Chancen auf eine an einem Ideal ausgerichtete Zusammenarbeit. In internationaler Hinsicht sorgte diese Herrschaftsform beständig für Instabilität und kriegerische Auseinandersetzungen. Die Fähigkeit der Dynasten Europas, Macht zu mobilisieren, forderte in immer höherem Maß den Preis interner Konflikte, wogegen die eurasischen Machtstrukturen, mit denen die Dynasten nun im Wettstreit lagen, davon frei waren. Eine Folge heftigster regionaler Konflikte unterminierte die Fähigkeit des Christentums, Ressourcen und Energien in die koloniale Expansion zu investieren; vielmehr vollzog sich der umgekehrte Prozess: Der Reichtum der Neuen Welt finanzierte die dynastischen Ambitionen der Alten Welt. Hieraus entstand binnen Kurzem jener Mahlstrom, der Europa in den Abgrund des Dreißigjährigen Krieges zog. Im Gegensatz zu den Dynasten waren Adlige, bisweilen im Bündnis mit repräsentativen Institutionen, häufig in einer besseren Position, um lokale Wünsche und Begehren zu verstehen und die Bindung an landesübliche Institutionen und Gebräuche gegen die zentralisierenden Bestrebungen der Fürsten auszunutzen.
Das Hauptproblem bestand darin, dass die von dynastischer Herrschaft erzeugten Loyalitäten grundsätzlich nur schwache Bindungskräfte entwickelten. Es war schon ein Glücksfall, wenn es dynastisch regierten Staaten gelang, sich mit den stärkeren Identitäten von Religion oder patria zu verbinden. Im Allgemeinen mussten sie die Grenzen akzeptieren, die der von ihnen betriebenen politischen Integration gesetzt waren – und damit auch den fortwährenden Wirbel von Fraktionen, Lobbys und Netzwerken an ihren Höfen sowie lokale Autonomiebestrebungen, die sich am deutlichsten artikulierten, wenn es darum ging, die Peripherien und Kolonien Europas zu regieren. Der Versuch, die Stärkung der dynastischen Monarchie mit umfassenderen Loyalitäten zu verbinden, machte nur die Vergeblichkeit solcher Ansprüche offenkundig. Dem dynastischen Staat fehlte eine überzeugende Ideologie. Sein politisches Modell ging am Kern des christlichen Gemeinwesens vorbei: an der Stärkung des Gemeinwohls und der rechten Beziehung zwischen politischer Obrigkeit und Bevölkerung. Im Kontext der Reformation mündeten diese Ideale in die Auffassung, dass die Menschen für ihr Tun zuerst und zumeist Gott verantwortlich waren. Die daraus sich ergebenden Aufforderungen – zum Gemeinwohl beizutragen und Gottes Wille auf Erden zu tun – veränderten die Grundregeln der Politik im späteren 16. Jahrhundert, nicht zuletzt deshalb, weil diese rasch den neuen Kräften eines durch den Wandel der öffentlichen Medien vervielfältigten Informationsflusses angepasst wurden. So entstanden auf allen möglichen Ebenen Modelle für politischen Zusammenschluss und politisches Engagement. Nicht nur in kleinen, unabhängigen, militärisch eher schwachen Städten und Republiken ließen sich gottesfürchtige und wohlmeinende Notabeln von der Überzeugung leiten, dass sie an Entscheidungen beteiligt werden sollten, die zu wichtig waren, um sie allein den Herrschern zu überlassen. Die dynastischen Staaten standen hilflos den Forderungen derjenigen gegenüber, die erwarteten, in die zukünftige Entwicklung des Gemeinwesens einbezogen zu werden. In der Politik der nachreformatorischen Zeit war die Spannung zwischen Herrschern und Beherrschten ein grundlegendes Element.
Die christlichen Gemeinwesen im religiösen Konflikt der Nachreformationszeit
Die Humanisten hatten die Idee eines „Gemeinwesens“ (res publica) populär gemacht, wobei jede Form legitimer Herrschaft ein solches Gemeinwesen sein konnte. Das war wichtig, weil es in Europa so unterschiedliche Herrschaftsformen gab. Neben dem Heiligen Römischen Reich und Erbdynastien gab es Wahlmonarchien, Stadtstaaten und Republiken. Christliche Gemeinwesen zogen ihre Legitimität aus der Beziehung zwischen Herrschern und Beherrschten, einer gegenseitigen Verpflichtung, in der der Gehorsam der Untertanen zwar natürlich und gottgewollt war, doch rechtens erst durch die Verpflichtung des christlichen Fürsten oder der Obrigkeit wurde, Gottes Geboten zu gehorchen und im Interesse des Volkes gerecht zu regieren. Ein Herrscher, der sich nicht daran hielt, war ein Tyrann. Die christliche Obrigkeit hatte die Aufgabe, die rechte Religion zu verteidigen, Recht zu sprechen und den Frieden zu fördern. Als Folge der Reformation entstand das grundlegende Problem, wie die widersprüchlichen Ziele, die sich aus dem religiösen Pluralismus für die Herrscher ergaben, in Einklang gebracht werden konnten. Wenn sie nicht die rechte Religion verteidigten, waren raison d’être und Einheit des christlichen Gemeinwesens bedroht. Taten sie es aber, riefen sie die Gefahr herauf, dass religiöse Spaltungen das Gemeinwesen zerrissen und Eintracht, Frieden und Harmonie – für seine Existenz ebenso wichtig – zerstört wurden. Die Herrscher vor allem in den mittleren Breiten Europas, wo religiöse Loyalitäten bis 1648 ein gewaltiges Problem darstellten, standen vor einem unlösbaren Rätsel. In Mitteleuropa waren die Risiken sektiererischer Gewalt am größten und wirkten sich religiös motivierte Spannungen gleich auf jeden Aspekt des öffentlichen und privaten Lebens aus. So unvorhersehbar und vielgestaltig, wie diese Spannungen waren, griffen sie auf andere, bereits bestehende Konfliktbereiche über. Sie manifestierten sich auf allen Ebenen der Gesellschaft und erwiesen sich für die Obrigkeiten in einem christlichen Gemeinwesen als besonders schwer zu handhaben. Religiöse Konflikte kompromittierten Regenten, indem sie sie zur Parteinahme für die eine oder die andere Seite zwangen. Das belastete die wechselseitige Verpflichtung (und das Vertrauen) zwischen Regent und Volk.
Die Rechtfertigung für das Christentum hatte darin bestanden, dass es ein Ensemble von Idealen und Institutionen zur Verfügung stellte, durch die der Frieden innerhalb der Glaubensgemeinschaft gefördert und verwirklicht werden konnte. In der nachreformatorischen Welt besetzte der religiöse Konflikt genau jene Stelle, wo zuvor der Brennpunkt für die Einheit des Christentums gelegen hatte. Was einst ein Mittel der Versöhnung gewesen war, wurde nun zum Instrument der Zwietracht. Die Welt wurde gefährlicher und gespaltener durch neue, erratisch verlaufende Glaubensgrenzen, die nicht, wie die einstigen Grenzen des Christentums, die Peripherie der Glaubensgemeinschaft markierten und sie von der Außenwelt absetzten, sondern deren Mitte durchzogen. Die neue Glaubensgrenze trennte diverse protestantische Denominationen im Norden vom Katholizismus im Süden und brachte damit christliche Gemeinwesen in Konfrontation zueinander. Im Bewusstsein der Menschen verschärften sich diese Trennungen in dem Maß, in dem widerstreitende religiöse Identitäten aus den gegenläufigen Prozessen der Reformation selbst entstanden.
Und es gab noch weitere Veränderungen, die die Eindämmung der religiösen Konflikte erschwerten. Zum einen veränderte sich das Wesen der Religion selbst. Die Reformation brachte eine Vielzahl von Glaubensrichtungen hervor, deren Anhänger jeweils mit voller Überzeugung argumentierten und Legitimität aufgrund einer behaupteten Kontinuität mit der Vergangenheit beanspruchten. In diesem Prozess wurde das Christentum ein umstrittenes Erbe, mit dessen Zerlegung die Humanisten bereits begonnen hatten, als sie ein von Verfall und Korruption gezeichnetes „Mittelalter“ aussonderten. In der neuen, von Vielfalt geprägten Glaubenslandschaft wurde „Religion“ (etikettiert als „rechte“, „reformierte“, „katholische“) zum Mittel, um wahre Glaubensüberzeugungen von falschen zu trennen. Religion konsolidierte sich immer weiter rund um das, was die Menschen, losgelöst von den religiösen Ritualen, die sie vollzogen, „glaubten“. Diese Loslösung zeigte sich am deutlichsten in dem zunehmend „konfessionalisierten“ Wesen von Religion in der nachreformatorischen Zeit. Die religiösen Konfessionen (Lutheraner, Calvinisten, Anglikaner) wollten definieren, was die Menschen zu glauben hatten – und wurden zum Fundament für riesige Investitionen in Bildung und Überzeugungsarbeit durch Kirche und Staat. Doch war es für beide schwieriger, Konformität für eine konfessionelle Ausprägung von Glauben durchzusetzen als zuvor für eine einheitliche Glaubensgemeinschaft, in der das Brauchtum (dessen Befolgung auch durch Nicht-Theologen leicht eingeschätzt werden konnte) die Glaubensüberzeugungen der betreffenden Individuen und Gemeinschaften widergespiegelt hatte.
Es gab in nachreformatorischer Zeit viele Orte, an denen religiöse Konformität sich nicht verwirklichen ließ. Christliche Fürsten fanden Gründe, innenpolitischen Frieden für wichtiger zu halten als religiöse Einheitlichkeit, weshalb religiöse Auseinandersetzungen mithilfe von Rechtsmitteln beigelegt werden sollten. Doch waren in den Augen ihrer konfessionellen Gegner solche Versuche, mit der religiösen Vielfalt zu leben, das deutlichste Zeichen für den endgültigen Verfall des Christentums. Derartiger Pluralismus könne nur in der Katastrophe enden. Indem sie die Probleme verwischten und ihrer Verantwortung nicht nachkamen, riskierten Herrscher, die den Pluralismus zuließen, nicht nur Gottes Zorn, sondern machten die unvermeidliche und ultimative Konfrontation umso gewalttätiger und zerstörerischer. Derlei Prophezeiungen neigten zur Selbsterfüllung. Es gab keine Lektion in religiöser Toleranz, die nicht verlernt werden konnte. Jede Generation musste von Neuem entdecken, wie gefährlich einfach es war zu glauben, die Verfügung religiöser Konformität sei der direkte Weg zur Lösung jener Probleme, die aus dem religiösen Dissens erwuchsen.
Die religiös motivierten Konflikte der nachreformatorischen Periode ließen die Einigkeit im Rahmen konfessionalisierter Glaubensüberzeugungen so wichtig erscheinen wie nie zuvor. Christliche Gemeinwesen sollten, so die Erwartung, konfessionelle Konformität als notwendige Bedingung für die politische Einheit durchsetzen und aufrechterhalten. Die mit der Reformation verbundenen kirchlichen Wandlungsprozesse (mitsamt der katholischen Reaktion darauf) veränderten die Beziehung zwischen Kirchen und Herrschern, wobei die „Geometrie“ dieser Beziehung höchst unterschiedlich ausfiel. In einigen Teilen des protestantischen Europas gab es Staatskirchen, in anderen Amtskirchen, die zum Staat eine eher lockere Beziehung unterhielten oder ganz unabhängig waren. Im katholischen Europa unterhielten Kirche und Staat eine Partnerschaft, in der es genügend Raum gab für gegenseitige Missverständnisse und Enttäuschungen. Im Allgemeinen jedoch erlangten die Staaten mehr Befugnisse über kirchliche Angelegenheiten, und damit einher ging eine größere Verantwortlichkeit für die Erhaltung der rechten Religion. Die Herrscher sahen sich nun häufiger Appellen seitens der Geistlichkeit ausgesetzt, die mit Nachdruck forderte, der Fürst solle seiner Pflicht nachkommen und den wahren Glauben fördern. Die Geistlichen verlangten vom Regenten, in umstrittenen Angelegenheiten – kirchlich-institutionelle Strukturen, Disziplin und sogar Glaubenssätze betreffend – zu entscheiden, während sie ihm zugleich den Vorwurf machten, er mische sich in Rechte und Besitztümer der Kirche ein. So geriet nicht nur die Beziehung zwischen Herrschern und Beherrschten mitsamt ihren gegenseitigen Verpflichtungen, sondern auch das Verhältnis von Kirche und weltlicher Obrigkeit unter Druck.
Solche Spannungen nahmen in dem Maß zu, in dem sich Rolle und Funktion staatlicher Macht veränderten. Das in ihrem Namen gesprochene Recht breitete sich aus und vereinnahmte auch lokale Rechtsverhältnisse. Die Herrscher erwarteten von ihren Ländereien und Untertanen höhere Steuereinnahmen. Veränderungen im Militärwesen demonstrierten der Bevölkerung die obrigkeitliche „Macht des Schwertes“ mit größerem Nachdruck. Ferner bestand ein erhöhter Bedarf an Spezialisten, um der komplexer gewordenen Aufgabe nachzukommen, das wirtschaftliche, soziale und öffentliche Leben rechtlich und administrativ zu kontrollieren. Von verschiedenen Seiten wurden Forderungen laut, das Steuersystem auf ein größeres Spektrum an Produkten und Dienstleistungen auszuweiten, den Wirtschaftswettbewerb zwischen den Staaten zu fördern und soziale Disziplin wie auch moralische Konformität durch Staat und Kirche zu fördern. Zugleich wurde der Zusammenhalt in den lokalen Gemeinschaften schwächer, was die Loyalität der zuständigen Obrigkeiten beschädigte, bei denen bisher die Auffassung von einer gegenseitigen Verpflichtung zwischen Herrschern und Beherrschten am stärksten verwurzelt gewesen war.
Um 1600 waren die christlichen Gemeinwesen in Europa die politischen Überbleibsel des christlichen Ideals einer Glaubensgemeinschaft, und dabei durch die reformationsbedingten Spaltungen starkem Druck von innen wie außen ausgesetzt, verwundbar durch die explosive Mischung aus Religion und Politik. Selbst in jenen Gemeinwesen, in denen ein gewisses Maß an religiösem Pluralismus erreicht worden war, erwiesen sich die Ergebnisse als instabil, weil sie von einem ausgewogenen Kräfteverhältnis zwischen den Religionen abhingen. Das aber wurde auch durch die Argumente und Strategien all jener gefährdet, die religiöse Vielfalt grundsätzlich ablehnten. Wo die Mischung aus religiösen und politischen Zwistigkeiten zu Kriegen und Konflikten führte, wurde offenbar, wie schwach die Bande des Vertrauens zwischen den Völkern Europas und ihren Herrschern bereits geworden waren. Die ersten Zeichen demographischer und wirtschaftlicher Schwäche kündigten das nahende Ende des „silbernen Zeitalters“ an, was die Brüchigkeit des Vertrauensverhältnisses nur verstärkte.
In den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts gab es wieder ein gewisses Maß an Stabilität und damit eine momentane Erholung, was die Menschen zu der Vorstellung veranlasste, dass die grundlegenden Probleme der nachreformatorischen Politik wenn nicht gelöst, so doch wenigstens im Zaum gehalten werden konnten. Einige Herrscher waren ganz bewusst bestrebt, sich vom zentralen Wert eines christlichen Gemeinwesens – der gegenseitigen Verpflichtung von Herrschern und Untertanen, für das Gemeinwohl einzustehen – zu distanzieren. Sie beriefen sich auf die Tradition der theokratischen Monarchie, wonach der Regent nur Gott allein verantwortlich sei, und sahen sich selbst als Verkörperung der Geschicke des „Staats“ – ein konfessionell neutraler Begriff, der nun eine politische Gesamtheit bezeichnete. In dieser Hinsicht waren sie absolute Monarchen, und die Dynastie der Bourbonen, die ein nach den „Religionskriegen“ allmählich wiedervereintes französisches Königreich regierte, diente anderen Regenten als Vorbild. Ihrem eigenen Bekunden nach standen diese Herrscher über den fundamentalen Spannungen der nachreformatorischen Politik. Sie konnten Gesetze für die religiöse Uniformität erlassen oder den religiösen Pluralismus dekretieren, diplomatische Bündnisse unter oder ohne Berücksichtigung religiöser Spaltungen schließen – ganz so, wie es ihnen richtig und dem Wohl des Staates dienlich zu sein dünkte. Diese Form absoluter Herrschaft wirkte gerade in jenen Fürstentümern deplatziert, in denen die Idee eines christlichen Gemeinwesens inklusive der Vorstellung einer gegenseitigen Verpflichtung zwischen Herrscher und Untertanen noch lebendig war, beziehungsweise generell dort, wo sich die destruktivsten Kräfte der nachreformatorischen Auseinandersetzungen wenig bemerkbar gemacht hatten.
Europa in maximaler Erschütterung
Während der 1550er-, der 1590er-Jahre und dann wieder seit den 1620er-Jahren erreichten die militärischen Aktivitäten in Europa ein nie zuvor gekanntes Ausmaß. Die Erholung zu Beginn des 17. Jahrhunderts war nur Schein gewesen. Europa stürzte in einen immer stärker um sich greifenden Wirbel aus miteinander verbundenen Kriegen von großer Zerstörungskraft, die ihren Höhepunkt in den späteren 1640er-Jahren erreichten. Diese Konflikte verschärften das wirtschaftliche Auseinanderdriften in Europa und schwächten den sozialen Zusammenhalt. Die 1590er-Jahre waren das Vorzeichen für kommenden, länger anhaltenden Unfrieden: Der Dreißigjährige Krieg umfasst drei gleichzeitige und miteinander verbundene Konflikte, von denen nur der erste 30 Jahre dauerte, nämlich der Krieg in Deutschland – von 1618 bis 1648 –, in den die Nachbarstaaten verwickelt wurden. Der zweite Konflikt war eine erneute Auseinandersetzung zwischen den spanischen





























