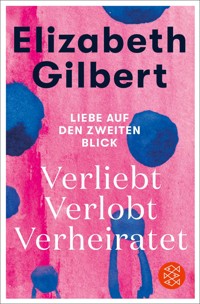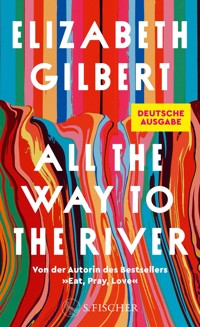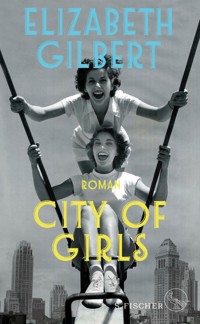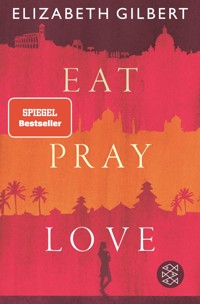14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gibt es eine Erklärung für die Liebe? Die bewegende und abenteuerliche Geschichte einer außergewöhnlichen Frau. »Das Wesen der Dinge und der Liebe« erzählt die Geschichte von Alma Whittaker, einer Frau, die sich den Pflanzen verschrieb, die Naturgesetze erforschte und versuchte, das Wesen der Liebe zu ergründen. Alma wird in die Aufbruchsphase Amerikas geboren, in eine Zeit, in der die Welt erforscht und Altes durch Neues abgelöst wird. Ihr umtriebiger Vater ist mit Pflanzenhandel reich geworden und der jungen Alma fehlt es an nichts, auch nicht an Bildung. Sie wächst auf zwischen den Pflanzen der prächtigsten Gewächshäuser. Ihre ganze Leidenschaft gilt der Natur, und während ihrer Studien, die sie ihr ganzes Leben begleiten, gelingen ihr ähnlich revolutionäre Einsichten, wie sie später Charles Darwin der Welt vorführen wird. Doch in mancher Hinsicht scheinen ihre Erkenntnisse nicht auszureichen. Gibt es eine wissenschaftliche Erklärung, warum sich der Mensch nach Liebe sehnt? Was ist Liebe überhaupt? Warum sind wir mutig, wie ihre Adoptivschwester Prudence, die sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzt? Ein großer Roman über ein ganzes Jahrhundert, über Vernunft und Gefühle – und alles, was dazwischen liegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 952
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Elizabeth Gilbert
Das Wesen der Dinge und der Liebe
Roman
Über dieses Buch
»Das Wesen der Dinge und der Liebe« erzählt die Geschichte von Alma Whittaker, einer Frau, die sich den Pflanzen verschrieb, die Naturgesetze erforschte und versuchte, das Wesen der Liebe zu ergründen. Alma wird in die Aufbruchsphase Amerikas geboren, in eine Zeit, in der die Welt erforscht und Altes durch Neues abgelöst wird. Ihr umtriebiger Vater ist mit Pflanzenhandel reich geworden und der jungen Alma fehlt es an nichts, auch nicht an Bildung. Sie wächst auf zwischen den Pflanzen der prächtigsten Gewächshäuser. Ihre ganze Leidenschaft gilt der Natur, und während ihrer Studien, die sie ihr ganzes Leben begleiten, gelingen ihr ähnlich revolutionäre Einsichten, wie sie später Charles Darwin der Welt vorführen wird.
Doch in mancher Hinsicht scheinen ihre Erkenntnisse nicht auszureichen. Gibt es eine wissenschaftliche Erklärung, warum sich der Mensch nach Liebe sehnt? Was ist Liebe überhaupt? Warum sind wir mutig, wie ihre Adoptivschwester Prudence, die sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzt? Ein großer Roman über ein ganzes Jahrhundert, über Vernunft und Gefühle – und alles, was dazwischen liegt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Elizabeth Gilbert, geboren 1969, wuchs auf einer Weihnachtsbaumfarm in Connecticut auf. Nach dem Studium in New York arbeitete sie u. a. als Journalistin für die »New York Times« und begann, Bücher zu schreiben. Das »Time Magazine« wählte sie unter die hundert einflussreichsten Menschen der Welt. Der internationale Durchbruch kam 2006 mit ›Eat Pray Love‹, einem Weltbestseller, in dem die Hauptfigur Elizabeth auf Weltreise geht und zu sich selbst findet: Dolce Vita in Italien, Meditation in Indien und das Glück auf Bali. 2010 wurde ›Eat Pray Love‹ mit Julia Roberts in der Hauptrolle verfilmt. Nach »Big Magic« (2015) erschien 2019 ihr Roman »City of Girls«, der wochenlang auf der New York Times-Bestsellerliste stand. Elizabeth Gilbert lebt in New Jersey.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »The Signature of All Things« bei Viking, New York
Copyright © 2013, Elizabeth Gilbert
All rights reserved
© der deutschen Übersetzung: 2013 Bloomsbury Berlin in der Piper Verlag GmbH, Berlin und München
Für diese Ausgabe:
© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hißmann Heilmann Hamburg
Coverabbildung: Erika Brothers / Arcangel Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491672-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
Prolog
Teil 1 Der Fieberbaum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Teil 2 Die Pflaume von White Acre
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Teil 3 Verstörende Botschaften
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Teil 4 Missionen und ihre Folgen
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Teil 5 Die Hüterin der Moose
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Danksagung
Was Leben ist, wissen wir nicht.
Was Leben macht, wissen wir genau.
Lord Perceval
Prolog
Zusammen mit dem neuen Jahrhundert erblickte Alma Whittaker am 5. Januar des Jahres 1800 das Licht der Welt.
Es dauerte nicht lange, da gab es bereits allerlei Meinungen zu ihr.
Als Almas Mutter den Säugling zum ersten Mal sah, war sie durchaus zufrieden mit dem Ergebnis. Beatrix Whittaker hatte in puncto Nachkommenschaft bis zu diesem Tag wenig Glück gehabt. Ihre ersten drei Versuche, ein Kind zu bekommen, waren wie traurige Bächlein versiegt, anstatt zu wachsen und anzuschwellen. Ihr jüngster Versuch – ein nahezu vollkommener Sohn – hatte es bis zur Schwelle des Lebens geschafft, sich just am Morgen seiner Geburt jedoch eines anderen besonnen: Er kam bereits tot zur Welt. Nach solchen Verlusten ist jedes Kind, das überlebt, ein gelungenes Kind.
Den kräftigen Säugling im Arm, flüsterte Beatrix in ihrer holländischen Muttersprache ein Gebet. Sie betete, ihre Tochter möge zu einer gesunden, vernünftigen, intelligenten jungen Frau heranwachsen, sich nicht in Gesellschaft allzu gepuderter Mädchen begeben, nicht über vulgäre Geschichten lachen, sich nicht mit leichtsinnigen Männern an Kartentische setzen, keine französischen Romane lesen und sich nicht schlimmer als wilde Indianer benehmen oder sonst wie dem Ruf einer guten Familie Schaden zufügen, mit anderen Worten een onnozelaar werden, ein Einfaltspinsel. Darin gipfelte ihr Segenswunsch – oder das, was bei einer strengen Frau wie Beatrix Whittaker als Segenswunsch gelten darf.
Die Hebamme, eine deutschstämmige Einheimische, war der Ansicht, dass es eine anständige Geburt in einem anständigen Haus gewesen sei, also müsse Alma Whittaker auch ein anständiges Baby sein. Die Kammer geheizt, Suppe und Bier umsonst, und dazu eine Mutter, so robust, wie es von einer Holländerin nicht anders zu erwarten war.
Zudem wusste die Hebamme, dass sie ihren Lohn bekommen würde, und zwar einen stattlichen. Jedes Baby, das Geld bringt, ist ein willkommenes Baby. Also gab auch sie Alma ihren Segen, wenn auch ohne große Inbrunst.
Hanneke de Groot hingegen, die Hauswirtschafterin des Anwesens, war weniger begeistert. Das Baby war kein Junge und nicht einmal hübsch. Es hatte ein Gesicht wie ein Pfannkuchen und war so blass wie ein ausgeblichener Dielenboden. Es würde Arbeit machen, wie alle Kinder. Und wie alle Arbeit würde auch diese vermutlich auf ihren Schultern landen. Trotzdem segnete sie das Kind, denn das Segnen eines Babys ist Pflicht, und Hanneke de Groot war ein pflichtbewusster Mensch. Hanneke zahlte die Hebamme aus und wechselte die Bettlaken. Dabei half ihr mehr schlecht als recht eine junge Magd – ein schwatzhaftes Mädchen vom Land und neuester Zuwachs der Hausgemeinschaft –, die lieber das Baby angaffte, als die Kammer aufzuräumen. Der Name dieser Magd tut hier nichts zur Sache, denn Hanneke de Groot würde sie am nächsten Tag als unbrauchbar entlassen und ohne Empfehlungsschreiben fortschicken. Doch an diesem Abend ließ die unbrauchbare Magd, die sich selbst nach einem Baby sehnte, nicht von dem Neugeborenen ab und gewährte der jungen Alma einen warmen, herzlichen Segenswunsch.
Dick Yancey – ein großgewachsener, imposanter Mann aus Yorkshire, der mit eiserner Hand die internationalen Geschäftsinteressen des Hausherrn vertrat (und zufällig in jenem Januar auf dem Anwesen der Whittakers weilte, wo er auf Tauwetter im Hafen von Philadelphia wartete, um sich nach Niederländisch-Ostindien zu begeben) – hatte zu dem Neugeborenen nicht viel zu sagen. Fairerweise wollen wir nicht verschweigen, dass Plaudereien generell nicht seine Stärke waren. Als Mr Yancey erfuhr, dass Mrs Whittaker ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht hatte, runzelte er nur die Stirn und sagte, wortkarg wie immer: »Hartes Geschäft, das Leben.« War das eine Segnung? Schwer zu sagen. Entscheiden wir im Zweifel zu seinen Gunsten und betrachten es als solche. Bestimmt sollte es kein Fluch sein.
Was nun Almas Vater betraf – Henry Whittaker, den Hausherrn –, so freute sich dieser über sein Kind. Ja, er war sogar hocherfreut. Es störte ihn weder, dass das Baby kein Junge, noch dass es nicht hübsch war. Er gab Alma zwar nicht seinen Segen, aber nur deshalb, weil er nichts von Segenswünschen hielt. (»Worum Gott sich kümmert, das geht mich nichts an«, sagte er häufig.) Nichtsdestotrotz bewunderte Henry sein Kind ohne Wenn und Aber. Was auch nicht weiter erstaunlich war: Schließlich hatte er es gezeugt, und Henry Whittaker neigte zu bedingungsloser Bewunderung für alle seine Erzeugnisse. Zur Feier des Tages pflückte er in seinem größten Gewächshaus eine Ananas und gab sie, zu gleichen Teilen aufgeschnitten, seinen Bediensteten. Draußen schneite es, ein pennsylvanischer Winter par excellence, doch dieser Mann besaß mehrere selbstentworfene, mit Kohle beheizte Treibhäuser – die ihm nicht nur den Neid jedes Gärtners und Botanikers auf dem amerikanischen Kontinent einbrachten, sondern auch einen unerhörten Reichtum –, und wenn er im Januar eine Ananas haben wollte, bei Gott, dann bekam er im Januar eine Ananas. Und auch Kirschen im März.
Anschließend zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück und schlug das Wirtschaftsbuch auf, in dem er wie jeden Abend alle offiziellen wie auch vertraulichen Vorgänge auf dem Anwesen festhielt. »Eine ehrbare noia mittreisende ist Zu uns geschtossen«, fing er an und notierte sodann die Einzelheiten, den zeitlichen Ablauf und die Kosten von Alma Whittakers Geburt. Sein Umgang mit der Feder war beschämend. Die Sätze glichen überfüllten Dörfern, in denen Groß- und Kleinbuchstaben in drangvoller Enge nebeneinanderlebten, ein Drunter und Drüber, als wollte jeder von ihnen der Buchseite entfliehen. Seine Rechtschreibung war mehr als willkürlich und seine Zeichensetzung Grund genug für traurige Stoßseufzer.
Aber Henry schrieb seinen Bericht dennoch nieder. Es war ihm wichtig, den Überblick zu behalten. Er wusste zwar, dass diese Seiten für jeden gebildeten Menschen ein haarsträubender Anblick gewesen wären, doch er wusste auch, dass niemand sie jemals zu Gesicht bekommen würde – mit Ausnahme seiner Frau. Wenn Beatrix wieder bei Kräften war, würde sie sein Gekrakel wie immer in ihre elegant geführten Wirtschaftsbücher übertragen, wo es als offizieller Haushaltsbericht firmieren würde. Sie war seine Partnerin – und machte ihre Sache wirklich gut. Sie übernahm diese Aufgabe für ihn … neben hundert anderen.
Sie würde sich, so Gott es wollte, binnen kurzem wieder daransetzen.
Der Schreibkram türmte sich bereits.
Teil 1Der Fieberbaum
Kapitel 1
In den ersten fünf Jahren ihres Lebens war Alma Whittaker – wie wir alle in unserer frühesten Jugend – tatsächlich nur eine Mitreisende in dieser Welt, weshalb ihre Geschichte zu diesem Zeitpunkt weder ehrbar noch sonderlich interessant war, wenn man von der Tatsache absieht, dass dieser unscheinbare Knirps ohne Krankheiten oder sonstige Zwischenfälle durchs Leben ging und von einem Reichtum umgeben war, der im damaligen Amerika und selbst im eleganten Philadelphia seinesgleichen suchte. Wie es ihr Vater zu solchem Wohlstand gebracht hatte, ist hingegen eine erzählenswerte Geschichte, der wir uns widmen wollen, während wir darauf warten, dass das Mädchen heranwächst und wieder interessant für uns wird. Tatsächlich war es im Jahre 1800 genauso ungewöhnlich wie zu allen Zeiten, dass ein in armen Verhältnissen geborener, des Schreibens und Lesens praktisch unkundiger Mann reichster Bürger seiner Stadt wurde. Insofern sind Henry Whittakers Wege zum Erfolg außerordentlich interessant – wenn auch nicht unbedingt ehrbar, woraus er selbst im Übrigen keinen Hehl gemacht hätte.
Henry Whittaker wurde 1760 in Richmond geboren, einem an der Themse gelegenen Dorf unterhalb von London. Er war der jüngste Sohn mittelloser Eltern, die schon ein paar Kinder zu viel hatten. Er wuchs in zwei kleinen Zimmern auf, gestampfter Lehmboden, ein einigermaßen passables Dach, auf der Kochstelle fast täglich eine Mahlzeit, eine Mutter, die nicht trank, und ein Vater, der seine Angehörigen nicht schlug – mit anderen Worten eine nahezu vornehme Herkunft, verglichen mit vielen anderen Familien seiner Zeit. Seine Mutter besaß hinter dem Haus ein staubiges Stückchen Erde, wo sie – wie eine richtige Dame – nur zur Dekoration Rittersporn und Lupinen zog. Aber Henry ließ sich von Rittersporn und Lupinen nicht täuschen. Seine ganze Kindheit hindurch trennte ihn, wenn er schlief, nur eine Wand von den Schweinen, und es gab keinen Moment in seinem Leben, in dem er die Armut nicht als demütigend empfand.
Vielleicht hätte Henry die Kränkung weniger stark empfunden, wenn er den Reichtum, an dem er sein armseliges Leben messen konnte, nicht vor Augen gehabt hätte – doch der Junge erlebte schon als Kind, was Wohlstand bedeutet. Königlicher Wohlstand. In Richmond gab es einen Palast und auch einen Lustgarten namens Kew, um dessen sachkundige Pflege sich Prinzessin Auguste kümmerte. Sie hatte sich aus Deutschland ein ganzes Gefolge von Gärtnern mitgebracht, die darauf brannten, ein echtes, aber bescheidenes englisches Wiesengebiet in eine falsche, aber majestätische Landschaft zu verwandeln. Ihr Sohn, der zukünftige George III., verbrachte als Kind jeden Sommer dort. Als George König wurde, wollte er Kew zu einem botanischen Garten umgestalten, der seinen Konkurrenten auf dem Festland in nichts nachstehen sollte. Im Bereich der Botanik waren die Engländer auf ihrer kalten, nassen, abgeschiedenen Insel im Vergleich zum restlichen Europa ins Hintertreffen geraten, ein Rückstand, den George III. unbedingt aufholen wollte.
Henrys Vater war Obstgärtner in Kew – ein bescheidener, von seinen Dienstherren respektierter Mann, soweit man einen bescheidenen Obstgärtner respektieren kann. Mr Whittaker hatte ein Händchen für Obstbäume, denen er mit großer Achtung begegnete. (»Sie geben dem Land etwas für seine Mühe zurück«, pflegte er zu sagen. »Im Gegensatz zu den anderen.«) Einmal hatte er den Lieblingsapfelbaum des Königs gerettet, indem er einen Sprössling des dahinsiechenden Baums auf einen robusteren Wurzelstock pfropfte. Noch im selben Jahr hatte der neue Spross Früchte getragen und bald scheffelweise Äpfel hervorgebracht. Für dieses Wunder hatte der König höchstpersönlich Mr Whittaker den Spitznamen »Der Apfelmagier« gegeben.
Bei allem Talent war der Apfelmagier ein einfacher Mann mit einer scheuen Ehefrau. Nichtsdestotrotz bekamen die beiden, aus welchem Grund auch immer, sechs ruppige, geradezu brutale Söhne, darunter ein Junge, den man den »Schrecken von Richmond« nannte, und zwei weitere, die in Wirtshausprügeleien ihr Leben ließen.
Henry, der jüngste, war in gewisser Weise der ruppigste von allen, aber vielleicht musste er das ja sein, um sich gegen seine Brüder zu behaupten. Er war ein störrischer, hartnäckiger, magerer kleiner Kerl und ein Ausbund an ungezügeltem Erfindungsreichtum. Bei ihm konnte man sich darauf verlassen, dass er die Schläge der Brüder stoisch ertrug und immer wieder die eigene Unerschrockenheit unter Beweis stellte, wenn andere ihn dazu provozierten. Doch auch ohne seine Brüder verfügte Henry über eine gefährliche Experimentierfreude und einen gewagten Hang zum Zündeln, er war ein auf Dächern herumtollender Spottvogel, der die Hausfrauen verhöhnte, eine Gefahr für alle kleineren Kinder, kurzum ein Junge, bei dem es niemanden überrascht hätte, wenn er von einem Kirchturm gestürzt oder in der Themse ertrunken wäre – wenngleich es zu derlei Dingen, dem Zufall sei’s gedankt, niemals kam.
Im Gegensatz zu seinen Brüdern hatte Henry allerdings eine rettende Eigenschaft. Eigentlich sogar zwei, um genau zu sein: Er war intelligent, und er interessierte sich für Bäume. Es wäre übertrieben, zu behaupten, dass er Bäume genauso verehrte wie sein Vater, aber er interessierte sich für sie, weil sie in seiner ärmlichen Welt zu den wenigen Dingen gehörten, die er ohne weiteres studieren konnte und somit studieren wollte. Die Schreibkunst, das Bogenschießen, Reiten, Tanzen, Latein – das alles war Henry verwehrt. Doch er hatte die Bäume und seinen Vater, den Apfelmagier, der es geduldig auf sich nahm, ihn zu unterrichten.
So lernte Henry alles über die Werkzeuge des Pfropfens, über Lehm, Wachs und Messer und darüber, wie man mit kluger Hand Pflanzen beschnitt. Er lernte, wie man Bäume im Frühling umpflanzte, wenn der Boden feucht und dicht war, oder im Herbst, wenn der Boden locker und trocken war. Er lernte, wie man Aprikosen mit Pfählen stützte, um sie vor Wind zu schützen, wie man in der Orangerie Zitrusgewächse züchtete, wie man mit Rauch dem Mehltau auf den Stachelbeeren zu Leibe rückte, wie man den Feigen ihre kranken Teile abschnitt und wann man es sein lassen konnte. Er lernte, wie man ohne Gefühlsduselei oder schlechtes Gewissen einem alten Baum die ramponierte Rinde abzog, damit sich für die kommenden Jahreszeiten wieder Leben in ihm regte.
Henry lernte viel von seinem Vater, obgleich er sich auch für ihn schämte, denn er spürte seine Schwäche. Wenn Mr Whittaker wirklich der große Apfelmagier war, überlegte Henry, warum hatte sich die Bewunderung des Königs dann in keinerlei Wohlstand niedergeschlagen? Dümmere Männer waren reich – und zwar in großer Zahl. Warum lebten die Whittakers immer noch bei den Schweinen, wo doch die weiten grünen Rasenflächen des Palastes und die hübschen Häuser der Maid of Honor Row, in denen die Bediensteten der Königin auf französischem Leinen schliefen, so nah waren? Einmal war Henry auf eine mächtige Gartenmauer geklettert und hatte heimlich eine Lady in ihrem elfenbeinfarbenen Kleid beim Dressurreiten beobachtet, auf einem makellos weißen Pferd, während ein Diener zu ihrer Erheiterung Geigenmusik spielte. Hier in Richmond gab es Leute, die so lebten. Und die Whittakers hatten nicht einmal einen Fußboden.
Aber Henrys Vater kämpfte um nichts. Seit dreißig Jahren empfing er klaglos denselben kümmerlichen Lohn und hatte sich auch niemals darüber beschwert, selbst bei übelstem Wetter so lange im Freien arbeiten zu müssen, dass es ihm die Gesundheit ruiniert hatte. Henrys Vater hatte den vorsichtigsten Weg durchs Leben gewählt, insbesondere im Umgang mit Höhergestellten – und wer stand in seinen Augen eigentlich nicht höher als er? Er legte großen Wert darauf, niemanden zu kränken und sich niemals einen Vorteil zu verschaffen, selbst wenn ihm dieser fast in den Schoß fiel. »Sei niemals dreist, Henry«, erklärte Mr Whittaker seinem Sohn. »Man kann das Schaf nur ein Mal schlachten. Wenn du aber vorsichtig bist, kannst du es jedes Jahr scheren.«
Was konnte Henry angesichts eines so schwachen, genügsamen Vaters vom Leben erwarten, wenn er nicht mit eigenen Händen danach griff? Ein Mann sollte zulangen, nahm er sich vor, als er gerade erst dreizehn war. Ein Mann sollte täglich ein Schaf schlachten.
Aber wo war das Schaf zu finden?
Dies war der Zeitpunkt, da Henry Whittaker zu stehlen begann.
Schon um das Jahr 1775 waren die Gärten von Kew eine botanische Arche Noah mit einer Tausende von Exemplaren umfassenden Sammlung, die durch wöchentliche Lieferungen ständig erweitert wurde – Hortensien aus dem Fernen Osten, Magnolien aus China, Farne von den Westindischen Inseln. Zudem hatte Kew einen neuen, ehrgeizigen Direktor: Sir Joseph Banks, frisch heimgekehrt von seiner triumphalen Weltreise als leitender Botaniker auf Kapitän Cooks Endeavor. Banks, der ohne Salär arbeitete (ihn interessierte nach eigener Auskunft nur der Ruhm des Britischen Weltreichs, wiewohl einige Zeitgenossen andeuteten, dass er sich vielleicht doch auch ein kleines bisschen für den Ruhm von Sir Joseph Banks interessierte), hatte sich mit furioser Leidenschaft dem Sammeln von Pflanzen verschrieben, um einen aufsehenerregenden botanischen Garten von Rang und Namen zu schaffen.
Oh, Sir Joseph Banks! Dieser gutaussehende, lasterhafte, ehrgeizige, wetteifernde Abenteurer! Er war alles, was Henrys Vater nicht war. Im Alter von dreiundzwanzig Jahren hatte eine üppige Erbschaft von jährlich sechstausend Pfund Joseph Banks zu einem der reichsten Männer Englands gemacht. Der attraktivste dürfte er wohl auch gewesen sein. Banks hätte ein luxuriöses Leben im Müßiggang führen können, doch stattdessen strebte er danach, der verwegenste unter den botanischen Forschern zu werden – ein Ruf, dem er folgte, ohne auch nur im Geringsten auf Prunk und Glanz zu verzichten. Finanziell hatte Banks aus eigener Tasche beträchtlich zu Kapitän Cooks erster Expedition beigetragen, was ihm erlaubte, zwei schwarze Diener, zwei weiße Diener, einen zusätzlichen Botaniker, einen wissenschaftlichen Sekretär, zwei Maler, einen Zeichner und zwei italienische Windspiele mit auf das enge Schiff zu nehmen. Im Laufe seines zweijährigen Abenteuers hatte Banks tahitianische Königinnen verführt, an Stränden nackt mit Wilden getanzt und im Mondlicht jungen heidnischen Mädchen beim Tätowieren ihrer Gesäßbacken zugesehen. Er hatte einen Tahitianer namens Omai mit nach England genommen, den er dort wie ein Haustier hielt, und zudem an die viertausend Pflanzenproben heimgebracht – von denen knapp die Hälfte der wissenschaftlichen Welt bis dahin unbekannt war. Sir Joseph Banks war der berühmteste und draufgängerischste Mann Englands, und Henry bewunderte ihn ungemein.
Trotzdem bestahl er ihn.
Eigentlich lag es nur daran, dass sich eine Gelegenheit bot, und zwar eine unübersehbare. Banks genoss in wissenschaftlichen Kreisen nicht nur den Ruf eines großen botanischen Sammlers, sondern auch den eines großen botanischen Geizhalses. Als Gentleman teilte man in jener Zeit auch als Botaniker seine Entdeckungen höflich mit anderen Forschern, doch Teilen war nicht Banks’ Sache. Aus aller Welt kamen Professoren, Würdenträger und Sammler mit der begründeten Hoffnung nach Kew, Samen und Ableger zu erhalten und vielleicht auch Proben aus Banks’ umfangreichem Herbarium – doch Banks wies sie alle ab.
Der junge Henry bewunderte den botanischen Geiz des Joseph Banks (er hätte seine Schätze auch nicht geteilt, wenn er welche gehabt hätte), doch bald erkannte er, dass die verärgerten Gesichter der abgewimmelten internationalen Besucher seine Chance waren. Wenn er vor der Anlage von Kew darauf wartete, dass sie die Gärten verließen, bekam er mit, wie sie Sir Joseph Banks auf Französisch, Deutsch, Holländisch oder Italienisch verfluchten. Dann ging Henry auf sie zu, fragte die Männer, welche Pflanzen sie wünschten, und versprach, selbige bis Ende der Woche zu besorgen. Immer war er mit einem Papierblock und einem Zimmermannsbleistift ausgerüstet. Wenn die Männer kein Englisch sprachen, ließ Henry sie aufzeichnen, was sie brauchten. Alle waren exzellente botanische Zeichner und konnten ihm ihre Wünsche mühelos vermitteln. Am späten Abend huschte Henry dann in die Treibhäuser, vorbei an den Arbeitern, die in kalten Nächten die riesigen Öfen befeuerten, und stahl Pflanzen für Geld.
Er war genau der Richtige dafür. Pflanzenbestimmung war seine Stärke, er hatte Geschick im Umgang mit den empfindlichen Ablegern, war in den Gärten ein so vertrautes Gesicht, dass er keinen Verdacht erregte, und versiert im Verwischen seiner Spuren. Das Beste aber war, dass er offenbar keinen Schlaf brauchte. Tagsüber arbeitete er mit seinem Vater in den Obstgärten, und nachts stahl er – seltene, wertvolle Gewächse, Frauenschuh, tropische Orchideen und fleischfressende Wunderpflanzen aus der Neuen Welt. Er verwahrte die botanischen Zeichnungen, welche die distinguierten Gentlemen für ihn anfertigten, und studierte sie so lange, bis er von allen Pflanzen, nach denen die Welt verlangte, jeden Staubbeutel und jedes Blütenblatt kannte.
Wie alle guten Diebe war Henry überaus gewissenhaft, was die eigene Sicherheit betraf. Niemandem vertraute er sein Geheimnis an, und die Einkünfte vergrub er an verschiedenen Stellen in den Gärten von Kew. Niemals gab er auch nur einen Viertelpenny davon aus. Er ließ sein Silber still im Boden schlummern wie einen guten Wurzelstock. Es sollte wachsen und gedeihen und irgendwann so gewaltig hervorbrechen, dass er sich damit das Recht erkaufen konnte, ein reicher Mann zu werden.
Binnen eines Jahres hatte Henry mehrere Stammkunden. Einer von ihnen, ein alter Orchideenzüchter vom Botanischen Garten in Paris, machte dem Jungen das vielleicht erste Kompliment seines Lebens: »Du bist ein nützlicher kleiner Spitzbube, dem es nicht widerstrebt, sich die Finger schmutzig zu machen, stimmt’s?« Im zweiten Jahr betrieb Henry bereits einen schwungvollen Handel mit exotischen Pflanzen, die er nicht nur an seriöse Botaniker, sondern auch an vermögende Londoner Adelskreise verkaufte, die für ihre Privatsammlungen nach solchen Exemplaren verlangten. Im dritten Jahr schickte er illegale Pflanzenableger nach Frankreich und Italien, sachgerecht in Moos und Wachs verpackt, damit sie die Reise überstanden.
Als das dritte Jahr zu Ende ging, wurde Henry Whittaker erwischt – von seinem eigenen Vater.
Mr Whittaker, der normalerweise über einen festen Schlaf verfügte, hatte eines Nachts bemerkt, dass sein Sohn nach Mitternacht das Haus verließ. Mit bangem Gefühl seinem väterlichen Instinkt folgend, war er dem Jungen bis zum Treibhaus hinterhergeschlichen und hatte alles gesehen, die Suche, den Diebstahl, das fachgerechte Verpacken. Er begriff sofort, dass hier ein Räuber sorgsam zu Werke ging.
Henrys Vater hatte seine Söhne niemals geschlagen, nicht einmal wenn sie es verdienten (und sie verdienten es oft), und auch in dieser Nacht schlug er Henry nicht. Er stellte ihn auch nicht zur Rede. Henry merkte gar nicht, dass er erwischt worden war. Nein, Mr Whittaker tat etwas sehr viel Schlimmeres. Gleich am nächsten Morgen bat er um eine persönliche Audienz bei Sir Joseph Banks. Es war eher ungewöhnlich, dass ein armer Schlucker wie Whittaker überhaupt um ein Gespräch mit einem Gentleman wie Banks ersuchen konnte, aber Henrys Vater hatte sich in dreißig unermüdlichen Arbeitsjahren so viel Respekt erworben, dass seiner Bitte ausnahmsweise stattgegeben wurde. Er war zwar ein armer alter Mann, doch immerhin war er auch der Apfelmagier – der Retter des königlichen Lieblingsbaumes –, und dieser Titel gewährte ihm Einlass.
Mr Whittaker kam Banks fast auf den Knien entgegengerutscht, mit tief gebeugtem Haupt, bußfertig wie ein Heiliger. Er beichtete die beschämende Tat seines Sohnes sowie den Verdacht, dass Henry diesen Diebstahl wahrscheinlich schon seit Jahren begehe. Als Bestrafung bot er die eigene Kündigung an, wenn dafür dem Jungen eine Verhaftung und weiteres Unheil erspart bliebe. Der Apfelmagier versprach, seine Familie aus Richmond wegzubringen und dafür zu sorgen, dass Kew wie auch Sir Joseph Banks persönlich nie wieder durch den Namen Whittaker verunglimpft würden.
Beeindruckt vom ausgeprägten Ehrgefühl des Obstgärtners, lehnte Banks dessen Kündigung ab und schickte nach dem jungen Henry. Auch dies war ein ungewöhnlicher Vorgang. Es kam selten vor, dass sich Sir Joseph Banks mit ungebildeten Gärtnern in seinem Arbeitszimmer traf, und besonders selten kam es vor, dass er sich mit den kriminellen sechzehnjährigen Söhnen von ungebildeten Gärtnern dort traf. Wahrscheinlich hätte er den Jungen einfach festnehmen lassen sollen. Doch auf Diebstahl stand die Hinrichtung durch Erhängen, und selbst Kinder, die deutlich jünger waren als Henry, wurden aufgeknüpft – für deutlich harmlosere Vergehen. Der Übergriff auf seine Sammlung war zwar ärgerlich, aber Banks hatte doch genügend Mitleid mit dem Vater, um dem Problem erst einmal selbst auf den Grund zu gehen, ehe er den Verwalter benachrichtigte.
Als das Problem kurz darauf in Sir Joseph Banks’ Arbeitszimmer erschien, entpuppte es sich als spindeldürrer, schmallippiger, breitschultriger Rotschopf mit milchigen Augen, eingefallener Brust und einer blassen Haut, die schon von Sonne, Wind und Regen gegerbt war. Der Junge war unterernährt, aber hochgewachsen, und er hatte große Hände. Banks sah, dass ein kräftiger Mann aus ihm werden konnte, wenn er nur eine anständige Mahlzeit bekam.
Henry wusste nicht genau, weshalb er in Banks’ Büroräume zitiert worden war, doch er hatte ausreichend Grips, um mit dem Schlimmsten zu rechnen, und war sehr beunruhigt. Dass er Banks’ Arbeitszimmer betreten konnte, ohne am ganzen Leib zu zittern, verdankte er einzig und allein seiner dickhäutigen Sturheit.
Aber du lieber Gott, wie schön dieses Zimmer war! Und wie blendend gekleidet dieser Joseph Banks, mit seiner glänzenden Perücke und dem schimmernden schwarzen Samtanzug, den polierten Schuhschnallen und weißen Strümpfen. Henry war noch nicht ganz durch die Tür, da hatte er schon den Preis des grazilen Mahagoni-Schreibpults taxiert, einen begehrlichen Blick auf die schönen, in Regalen gestapelten Sammelboxen geworfen und das stattliche Porträt von Kapitän Cook bewundert, das an der Wand hing. Teufel noch mal, allein der Rahmen dieses Porträts hatte bestimmt neunzig Pfund gekostet!
Im Gegensatz zu seinem Vater verbeugte sich Henry nicht vor Banks, sondern blieb aufrecht vor dem berühmten Mann stehen und sah ihm direkt in die Augen. Banks, der die ganze Zeit saß, ließ Henry schweigend dastehen, vielleicht in Erwartung einer Beichte oder einer Ausrede. Doch Henry legte weder ein Geständnis ab, noch verteidigte er sich; er ließ auch nicht beschämt den Kopf hängen, und wenn Sir Joseph Banks geglaubt hatte, Henry Whittaker wäre so dumm, in einer derart brenzligen Situation als Erster das Wort zu ergreifen, dann kannte er Henry Whittaker schlecht.
Also befahl Banks nach langem Schweigen: »Dann sag mir doch … warum sollte ich dich nicht an den Galgen von Tyburn bringen?«
Das war’s dann, dachte Henry. Man hat mich geschnappt.
Trotzdem versuchte der Junge mit aller Kraft, einen Plan zu fassen. Er brauchte eine Taktik, und zwar jetzt, in diesem Moment. Schließlich war er nicht sein Leben lang von älteren Brüdern verprügelt worden, ohne etwas übers Kämpfen gelernt zu haben. Wenn ein kräftigerer, stärkerer Gegner den ersten Schlag gelandet hat, muss man rasch das Ruder herumreißen, ehe man unter einem Hagel von Fausthieben am Boden liegt, und am besten funktioniert in solchen Fällen ein Überraschungsangriff.
»Weil ich ein nützlicher kleiner Spitzbube bin, dem es nicht widerstrebt, sich die Finger schmutzig zu machen«, sagte Henry.
Ungewöhnliche Situationen amüsierten Banks, und er lachte vor Überraschung laut auf. »Ich gestehe, dass mir nicht recht einleuchten will, worin dein Nutzen liegen sollte, junger Mann. Was hast du denn für mich getan? Doch nur meine hart erkämpften Schätze geplündert.«
Es war keine Frage, trotzdem antwortete Henry.
»Ja, vielleicht habe ich ein bisschen herumgeschnippelt«, sagte er.
»Du leugnest es also nicht?«
»Alles Geschrei der Welt würde doch auch nichts daran ändern, oder?«
Wieder lachte Banks. Vielleicht glaubte er, dass der Junge eine Masche abzog und den Mutigen spielte, aber Henrys Mut war echt. Genauso wie seine Angst. Und seine fehlende Reue. Reue empfand Henry zeitlebens als Schwäche.
Banks schlug also einen anderen Kurs ein. »Ich muss sagen, junger Mann, dass du deinem Vater in höchstem Maße Kummer bereitet hast.«
»Er mir auch«, gab Henry zurück.
Wieder das überraschte, bellende Lachen. »Tatsächlich? Welches Leid hat dir der gute Mann denn zugefügt?«
»Mich arm gemacht, Sir«, sagte Henry. Plötzlich ging ihm ein Licht auf, und er fügte hinzu: »Er war’s, oder? Hat er mich verraten?«
»Allerdings. Dein Vater ist ein hochanständiger Mensch.«
Henry zuckte die Achseln. »Mir gegenüber ja wohl nicht.«
Banks nahm die Replik nickend zur Kenntnis und gestand Henry diese Einschätzung großzügig zu. Dann fragte er: »Wem hast du meine Pflanzen verkauft?«
Henry zählte die Namen an den Fingern auf. »Mancini, Flood, Willink, LeFavour, Miles, Sather, Evashevski, Fuerele, Lord Lessig, Lord Garner …«
Banks unterbrach ihn mit einer Handbewegung. Mit unverhohlenem Erstaunen musterte er den Jungen. Seltsamerweise hätte er, wäre die Liste belangloser gewesen, vielleicht sogar zorniger reagiert. Aber diese Männer waren die angesehensten Botaniker der damaligen Zeit. Einige von ihnen bezeichnete Banks als Freunde. Wie hatte der Junge sie aufgespürt? Manche waren seit Jahren nicht mehr in England gewesen. Das Kind betrieb ganz offensichtlich Exporthandel. Was war das für ein Feldzug, den diese Kreatur hier vor seiner Nase geführt hatte?
»Woher weißt du eigentlich, wie man mit Pflanzen umgeht?«, fragte Banks.
»Ich kenne die Pflanzen, Sir, hab ich schon immer. Irgendwie weiß ich das alles schon mein Leben lang.«
»Und diese Männer? Geben sie dir Geld?«
»Sonst bekommen sie ja ihre Pflanzen nicht«, sagte Henry.
»Dann musst du gut verdienen. Wirklich, da muss in den letzten Jahren ein Haufen Geld zusammengekommen sein.«
Henry war klug genug, sich dazu nicht zu äußern.
»Was hast du mit dem Geld gemacht, junger Mann?« Banks ließ nicht locker. »Offensichtlich hast du nicht in deine Garderobe investiert. Deine Einkünfte sind ohne jeden Zweifel Eigentum von Kew. Wo ist das ganze Geld?«
»Weg, Sir.«
»Weg? Wohin?«
»Würfelspiel, Sir. Wissen Sie, das Glücksspiel ist meine Schwäche.«
Das mag wahr sein oder auch nicht, dachte Banks. Jedenfalls besaß der Junge eine furchtlose Dreistigkeit, die er bei wilderen Exemplaren der Spezies Mensch schon häufiger angetroffen hatte. Banks war fasziniert. Immerhin war er ein Mann, der sich einen Heiden gewissermaßen als Haustier hielt und der – wie man ehrlicherweise hinzufügen sollte – selbst im Ruf stand, ein halber Heide zu sein. Sein gesellschaftlicher Rang verlangte von ihm, zumindest nach außen hin alles Vornehme, Aristokratische zu bewundern, aber insgeheim war ihm das Ungebändigte, Wilde gar nicht unlieb. Und was war dieser Henry Whittaker doch für ein wilder Vogel! Sir Joseph Banks’ Bereitschaft, dieses kuriose Menschenexemplar den Konstablern zu übergeben, schwand zusehends.
Henry, dem nichts entging, merkte, dass in Banks’ Gesicht etwas geschah – ein Aufscheinen von Neugier, ein Weicherwerden der Züge, der Hauch einer Chance, doch noch sein Leben zu retten. Sein Selbsterhaltungstrieb ließ ihn, den schmalen Lichtstreif der Hoffnung vor Augen, ein letztes Mal vorpreschen.
»Bringen Sie mich nicht an den Galgen, Sir«, sagte Henry. »Sie werden es bereuen, wenn Sie’s tun.«
»Was schlägst du mir stattdessen vor?«
»Lassen Sie mich nützlich sein.«
»Warum sollte ich?«, fragte Banks.
»Weil ich besser bin als die anderen.«
Kapitel 2
So baumelte Henry zu guter Letzt doch nicht am Galgen von Tyburn, und auch der Vater verlor nicht seine Stellung. Wie durch ein Wunder blieben die Whittakers verschont, und Henry ging lediglich ins Exil, von Sir Joseph Banks zur See geschickt, um auszuloten, was die Welt mit ihm anfangen konnte.
Man schrieb das Jahr 1776, und Kapitän Cook war im Begriff, sich auf seine dritte Weltreise zu begeben. Banks nahm an dieser Expedition nicht teil. Er war schlicht und einfach nicht eingeladen worden. Schon zur Teilnahme an der zweiten Reise hatte man Banks nicht aufgefordert, was ihm durchaus zu schaffen machte. Doch durch seine Extravaganz und sein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hatte er Kapitän Cook gegen sich aufgebracht und war schmählich ausgetauscht worden. Cook würde nun mit einem bescheideneren Botaniker reisen, der sich leichter lenken ließ – ein gewisser Mr David Nelson, ein fachkundiger, wenn auch schüchterner Gärtner aus Kew. Banks war sehr darauf erpicht, trotzdem in irgendeiner Weise seine Nase in diese Expedition zu stecken und über Nelsons botanische Erkundungen informiert zu sein. Der Gedanke, dass hinter seinem Rücken bedeutende wissenschaftliche Arbeit geleistet wurde, behagte ihm gar nicht. Daher richtete er es so ein, dass Henry als einer von Nelsons Gehilfen auf die Expedition geschickt wurde, und gab ihm den Auftrag, alles zu beobachten, aufzunehmen und sich einzuprägen, um ihm später davon zu berichten. Henry Whittaker als Informant – gab es eine nützlichere Verwendung für diesen Jungen?
Ihn zur See zu schicken war im Übrigen auch eine gute Methode, ihn für ein paar Jahre von Kew fernzuhalten und aus sicherer Entfernung abzuwarten, welch ein Mensch dieser Henry werden würde. Drei Jahre auf einem Schiff waren ein hinlänglich langer Zeitraum, in dem sich das wahre Temperament des Burschen entfalten konnte. Sollte man ihn irgendwann als Dieb, Mörder oder Meuterer an der Rah aufhängen … nun, das wäre dann Cooks Problem und nicht mehr das von Sir Joseph Banks.
Sollte sich Henry allerdings bewähren, könnte Banks den Jungen nach der Expedition, die ihm gewiss einen Teil seiner Wildheit austreiben würde, für sich nutzen.
So stellte Banks den Knaben denn auch Mr Nelson vor: »Nelson, ich möchte, dass Sie Ihre neue rechte Hand kennenlernen: Mr Henry Whittaker. Seine Familie residiert in Richmond. Er ist ein nützlicher kleiner Spitzbube, und Sie werden bald feststellen, dass er die Pflanzen kennt, ja, immer schon gekannt hat.«
Ehe Banks den Jungen auf die Reise schickte, gab er ihm noch einen letzten, vertraulichen Rat: »Schütze deine Gesundheit an Bord, mein Sohn, indem du jeden Tag Übungen zur körperlichen Ertüchtigung durchführst. Höre auf Mr Nelson – er ist ein Langweiler, doch er weiß mehr über Pflanzen, als du jemals wissen wirst. Den älteren Matrosen wirst du schutzlos ausgeliefert sein, aber du darfst dich nie über sie beschweren, sonst wird es dir schlecht ergehen. Halte dich von Huren fern, wenn du nicht die Franzosenkrankheit bekommen willst. Ihr werdet auf zwei Schiffen segeln, und du wirst auf der Resolution reisen, mit Cook persönlich. Meide ihn. Sprich nicht mit ihm. Und wenn du doch mit ihm sprichst, was du niemals tun solltest, dann sprich vor allem nicht so mit ihm, wie du mit mir gesprochen hast. Er wird es nicht so amüsant finden wie ich. Wir sind nicht vergleichbar, Cook und ich. In Fragen der Etikette ist der Mann ein wahres Monster. Mach dich unsichtbar für ihn, dann lebst du besser. Und als Letztes möchte ich dir noch sagen, dass du dich an Bord der Resolution, wie auf allen Schiffen Seiner Majestät, in einer seltsamen Kamarilla aus Schlägern und Gentlemen wiederfmden wirst. Sei klug, Henry. Nimm dir die Gentlemen zum Vorbild.«
Henry verzog keine Miene. Niemand, nicht einmal ein Joseph Banks, hätte in seinem Gesicht lesen können, wie begierig er den letzten Satz aufsog. In Henrys Ohren klang es, als hätte ihm Banks eine geradezu sensationelle Perspektive eröffnet: die Möglichkeit, eines Tages ein Gentleman zu werden. Ja, nicht nur die Möglichkeit – vielleicht war es in Henrys Ohren sogar ein Befehl, der ihm mehr als gelegen kam: Geh hinaus in die Welt, Henry, und lerne, wie man ein Gentleman wird. Vielleicht würde Banks’ beiläufige Bemerkung in den harten, einsamen Jahren auf See immer mehr an Bedeutung gewinnen. Vielleicht würde Henry an nichts anderes mehr denken. Und vielleicht würde sich Henry Whittaker – dieser ehrgeizige, umtriebige Junge mit seinem Drang nach gesellschaftlichem Aufstieg – daran erinnern wie an ein Versprechen.
Im August des Jahres 1776 stach Henry in See. Zwei Ziele waren für Cooks dritte Forschungsreise gesteckt. Das erste bestand darin, nach Tahiti zu segeln, um Sir Joseph Banks’ Haustier – den Mann namens Omai – in seine Heimat zurückzubringen. Omai war das höfische Leben satt und sehnte sich danach heimzukehren. Er war launisch, fett und unleidlich geworden, und auch Banks hatte genug von seinem Spielzeug. Die zweite Aufgabe bestand darin, an der amerikanischen Pazifikküste nordwärts zu segeln und die Nordwestpassage zu finden.
Henrys Ungemach begann sofort. Er war unter Deck neben den Geflügelställen und Fässern untergebracht. Um ihn herum schimpften die Hühner und Ziegen, doch er schimpfte nicht. Er wurde von erwachsenen Männern, an deren salzigen Händen sich die Haut schuppte und deren Unterarme so breit wie Ambosse waren, drangsaliert, missachtet und gequält. Die älteren Seeleute verhöhnten ihn als Süßwassermatrosen, der nichts von den Härten des Reisens auf hoher See wusste. Bei jeder Expedition gab es Tote, sagten sie, und Henry würde der Erste sein.
Sie unterschätzten ihn.
Henry war der Jüngste, doch wie sich bald zeigen sollte, keineswegs der Schwächste. Das neue Leben war für ihn kaum unbequemer als das, was er ohnehin kannte. Er lernte, was zu lernen erforderlich war. Er lernte, wie man Mr Nelsons Pflanzen zum Zwecke der wissenschaftlichen Dokumentation trocknete, präparierte und in freier Natur zeichnete – unter ständigem Verscheuchen der Fliegen, die sogar während des Mischens in den Pigmenten landeten –, doch er lernte auch, sich auf dem Schiff nützlich zu machen. Er musste die Resolution bis in alle Ritzen mit Essig ausschrubben und wurde genötigt, das Bettzeug der älteren Matrosen nach Ungeziefer zu durchforsten. Er half dem Schiffsfleischer, Schweine zu pökeln und in Fässern zu lagern, und lernte, das Meerwasser-Destillationsgerät zu bedienen. Er lernte auch, die eigene Kotze zu schlucken, anstatt sich die Seekrankheit zur Freude aller Anwesenden anmerken zu lassen. Er überstand Stürme, ohne vor irgendwem Angst zu zeigen. Er aß Haie, und er aß die halb verdauten Fische in den Haibäuchen. Er sah einen älteren Mann, einen erfahrenen Matrosen, über Bord gehen und ertrinken und ein paar andere Männer an Infektionen sterben, doch Henry blieb am Leben.
Er landete in Madeira, in Teneriffa und in der Tafelbucht. Am Kap begegneten ihm zum ersten Mal Vertreter der Niederländischen Ostindien-Kompanie, deren Ernsthaftigkeit, Kompetenz und Reichtum ihn beeindruckten. Er sah Matrosen ihre Heuer an Kartentischen verlieren. Er sah Leute, die sich Geld liehen – bei Niederländern, die offenbar selbst nicht spielten. Auch Henry spielte nicht um Geld. Er sah, wie ein Matrose seines Schiffes, ein Möchtegern-Münzfälscher, erwischt und für sein Verbrechen bis zur Bewusstlosigkeit ausgepeitscht wurde – auf Kapitän Cooks Befehl. Er selbst beging keine Verbrechen. Als sie bei eisigem Wind das Kap umrundeten, zitterte er nachts unter der dünnen Decke, und seine Zähne klapperten so sehr, dass ihm einer herausbrach, doch er klagte nicht. Das Weihnachtsfest beging er auf einer bitterkalten Insel mit Seelöwen und Pinguinen.
Er landete in Tasmanien und sah nackte Eingeborene – »Indianer«, wie die Briten sie und alle kupferfarbigen Menschen nannten. Er sah, wie Kapitän Cook den Indianern zur Feier dieser historischen Begegnung Gedenkmünzen mit dem Porträt von George III. und dem Datum der Expedition gab. Er sah, wie die Indianer sofort auf die Münzen einhämmerten und sie in Angelhaken und Speerspitzen verwandelten. Er verlor noch einen Zahn. Er sah, dass die englischen Matrosen dem Leben eines wilden Indianers keinerlei Wert beimaßen, und er sah, dass Cook vergeblich versuchte, es ihnen beizubringen. Er sah, wie sich Matrosen den Frauen aufzwangen, wenn sie diese nicht beschwatzen konnten, oder die Frauen beschwatzten, wenn sie sich diese nicht leisten konnten, oder wie sie den Vätern die Mädchen einfach abkauften, wenn sie nur etwas Eisen besaßen, das sie gegen Menschenware eintauschen konnten. Er selbst mied alle Mädchen.
Er verbrachte lange Tage an Bord, wo er Mr Nelson beim Zeichnen, Beschreiben, Präparieren und Klassifizieren der botanischen Funde half. Er empfand keine besondere Zuneigung zu Mr Nelson, doch er wollte alles lernen, was dieser schon wusste.
Er landete in Neuseeland, wo es genauso aussah wie in England, bis auf die tätowierten Mädchen, die man für eine Handvoll Nägel kaufen konnte. Er kaufte keine Mädchen. In Neuseeland sah er, wie die Matrosen seines Schiffes einem Vater zwei kräftige, willige Brüder im Alter von zehn und fünfzehn Jahren abkauften. Die eingeborenen Knaben schlossen sich der Expedition als Arbeitskräfte an. Freiwillig, wie sie durchblicken ließen. Doch Henry wusste, dass die Jungen keine Ahnung hatten, was es bedeutete, sein Volk zu verlassen. Sie nannten sich Tibura und Gowah. Sie versuchten sich mit Henry anzufreunden, der ihnen vom Alter her am nächsten war, doch er ignorierte sie. Sie waren Sklaven, und sie waren dem Tode geweiht. Er wollte nicht mit Todgeweihten verkehren. Er sah, wie die neuseeländischen Knaben rohe Hunde aßen und sich vor Heimweh verzehrten. Er wusste, dass sie am Ende sterben würden.
Er segelte weiter nach Tahiti, jenes grüne, buschige, duftende Land. Er sah, dass Kapitän Cook als Heimkehrer begrüßt wurde, als großer König und großer Freund. Schwärme von Indianern schwammen der Resolution entgegen und riefen Cooks Namen. Henry sah, wie Omai – der Eingeborene, der König George III. begegnet war – in seiner Heimat zunächst als Held empfangen und dann zunehmend als Außenseiter angefeindet wurde. Er erkannte, dass Omai kein Zuhause mehr hatte. Er sah, wie die Tahitianer zu englischen Hornpfeifen und Dudelsäcken tanzten, während sich Mr Nelson, Henrys biederer Botaniklehrer, eines Nachts betrank und mit nacktem Oberkörper zu den tahitianischen Trommeln tanzte. Henry tanzte nicht. Er sah, wie Kapitän Cook dem Schiffsbarbier befahl, er solle einem Eingeborenen, der zweimal Eisen aus der Schmiede der Resolution gestohlen hatte, beide Ohren bis zu den Schläfen abschneiden. Er sah, wie einer der tahitianischen Häuptlinge den Engländern eine Katze zu stehlen versuchte und dafür einen Peitschenhieb ins Gesicht erhielt.
Er sah, wie Kapitän Cook über der Matavai-Bucht ein Feuerwerk abbrannte, um die Eingeborenen zu beeindrucken, doch es versetzte sie nur in Panik. In einer ruhigeren Nacht sah er eine Million Lichter am Himmel über Tahiti. Er trank aus Kokosnüssen. Er aß Hunde und Ratten. Er sah Steintempel, die mit Totenschädeln übersät waren. Auf tückischen Pfaden erklomm er Felsklippen, um neben Wasserfällen Farnproben für Mr Nelson zu sammeln, der selbst kein Kletterer war. Er sah, wie sich Kapitän Cook mühte, gegen die Zügellosigkeit unter den ihm anvertrauten Männern vorzugehen und für Ordnung und Disziplin zu sorgen. Alle Matrosen und Offiziere hatten sich in tahitianische Mädchen verliebt, und jeder dieser Frauen wurde nachgesagt, eine besondere, geheime Form des Liebesakts zu beherrschen. Die Männer wollten die Insel nicht mehr verlassen. Henry versagte sich die Frauen. Sie waren schön, ihre Brüste waren schön, ihr Haar war schön, ihr Duft außergewöhnlich, und sie bevölkerten seine Träume – doch die meisten von ihnen hatten bereits die Franzosenkrankheit. Er widerstand hundert betörenden Versuchungen. Er wurde deshalb verhöhnt. Er widerstand dennoch. Er hatte größere Pläne. Er konzentrierte sich auf die Botanik. Er sammelte Gardenien, Orchideenjasmin, Brotfrüchte.
Sie segelten weiter. Auf den Freundschaftsinseln sah er einen Eingeborenen, dem auf Kapitän Cooks Befehl ein Arm abgehackt wurde, weil er auf der Resolution ein Beil gestohlen hatte. Auf denselben Inseln wurden er und Mr Nelson beim Botanisieren hinterrücks von Eingeborenen überfallen, die ihnen nicht nur sämtliche Kleider, sondern – ein sehr viel herberer Schlag – auch ihre Pflanzenproben und Notizbücher abnahmen. Nackt und sonnenverbrannt kehrten sie zitternd aufs Schiff zurück, doch Henry klagte immer noch nicht.
Mit großer Sorgfalt beobachtete er die Gentlemen an Bord und taxierte ihre Verhaltensweisen. Er imitierte ihre Sprache. Er trainierte ihre Diktion. Er verbesserte seine Umgangsformen. Zufällig hörte er, wie ein Offizier zu einem anderen sagte: »Auch wenn die Aristokratie von jeher ein künstliches Konstrukt war, stellt sie doch immer noch das effizienteste Hemmnis gegen den Mob der Ungebildeten und Unreflektierten dar.« Er sah mehrmals, wie Offiziere einem beliebigen Eingeborenen, der adelig aussah oder zumindest der englischen Vorstellung von Adel entsprach, mit Ehrerbietung begegneten. Welche Insel sie auch betraten, die Offiziere griffen sich immer just den braunhäutigen Mann heraus, der eine feinere Kopfbedeckung trug als die anderen, prächtigere Tätowierungen, eine größere Lanze oder mehr Frauen hatte oder aber in einer Sänfte getragen wurde oder der – wenn keins dieser Insignien vorhanden war – einfach nur größer war als die anderen. Mit diesem Mann verhandelten sie, ihm überreichten sie Geschenke, und manchmal erklärten sie ihn zum »König«. Henry schloss daraus, dass englische Gentlemen, wohin sie auch reisten, stets nach einem König suchten.
Henry ging auf Schildkrötenfang und aß Delphine. Er wurde von schwarzen Ameisen zerbissen. Er segelte weiter. Er sah winzige Indianer mit riesigen Muscheln in den Ohren. In den Tropen erlebte er ein Unwetter, das den Himmel in ein abscheuliches Grün tauchte – das Einzige, was den älteren Seeleuten jemals sichtlich Angst einflößte. Er sah die brennenden Berge, die man Vulkane nannte. Sie segelten weiter nordwärts. Es wurde wieder kalt. Er aß wieder Ratten. Sie landeten an der Westküste des nordamerikanischen Kontinents. Er aß Wild und Rentierfleisch. Er sah mit Fellen bekleidete Menschen, die mit Biberpelzen handelten. Er sah einen Matrosen, der mit dem Fuß in der Ankerkette hängenblieb, über Bord gezogen wurde und starb.
Und immer weiter segelten sie nordwärts. Er sah Häuser aus Walrippen. Er kaufte sich ein Wolfsfell. Mit Mr Nelson sammelte er Primeln, Veilchen, Johannisbeeren und Wacholder. Er sah Indianer, die in Erdlöchern lebten und ihre Frauen vor den Engländern versteckten. Er aß gepökeltes, von Maden durchsetztes Schwein. Er verlor einen weiteren Zahn. Er erreichte die Bering-Straße und hörte das Heulen wilder Tiere in der arktischen Nacht. Alles, was er an trockenen Dingen besaß, wurde nass, um alsbald zu gefrieren. Er sah, wie ihm der erste Bart zu wachsen begann. So spärlich er war, sammelten sich doch Eiszapfen darin. Und das Essen fror, ehe er es vertilgen konnte, regelmäßig an seinem Teller fest. Er klagte nicht. Er wollte Sir Joseph Banks nicht zu Ohren kommen lassen, dass er auch nur ein einziges Mal geklagt hatte. Er tauschte seinen Wolfspelz gegen ein Paar Schneeschuhe ein. Er sah, wie der Schiffschirurg Mr Anderson starb und mit den denkbar trostlosesten Aussichten zur See bestattet wurde – in einer ewig gefrorenen, in fortwährende Nacht getauchten Welt. Er sah Matrosen, die zum Scherz Salven von Kanonenschüssen auf die Seelöwen am Ufer abfeuerten, bis es am Strand kein lebendes Geschöpf mehr gab.
Er sah das Land, das die Russen Elaskah nannten. Er half, aus Fichten Bier zu brauen, das den Matrosen zuwider war, doch ein anderes Getränk gab es nicht. Er sah Indianer, die in Verschlägen hausten, keinen Deut komfortabler als die Behausungen der Tiere, die sie jagten und aßen, und er traf Russen, die in einer Walfangstation gestrandet waren. Zufällig hörte er Kapitän Cooks Bemerkung über den leitenden russischen Offizier (ein großgewachsener, gutaussehender blonder Mann): »Er ist offensichtlich ein Gentleman aus gutem Hause.« Überall, sogar in dieser elenden Tundra, war es wichtig, ein Gentleman aus gutem Hause zu sein. Im August gab Kapitän Cook auf. Keine Nordwestpassage in Sicht, und inzwischen versperrten kirchturmhohe Eisberge der Resolution den Weg. Sie nahmen wieder Kurs Richtung Süden.
Fast ohne Halt erreichten sie Hawaii. Nie und nimmer hätten sie dorthin fahren sollen. Hungrig schmachtend im Eis wären sie wohlbehüteter gewesen. Die Könige von Hawaii waren zornig, die Eingeborenen aggressiv, und zudem stahlen sie. Im Gegensatz zu den Tahitianern waren die Hawaiianer keine liebenswürdigen Freunde – überdies waren es Tausende. Doch Kapitän Cook brauchte frisches Wasser und musste bleiben, bis die Laderäume wieder gefüllt waren. Es kam zu zahlreichen Plünderungen seitens der Eingeborenen und zu zahlreichen Strafmaßnahmen seitens der Engländer. Gewehrschüsse fielen, Indianer wurden verwundet, Chiefs in Empörung versetzt, Drohungen ausgestoßen. Einige der Matrosen behaupteten, Kapitän Cook werde immer brutaler, seine Wutausbrüche mit jedem Diebstahl theatralischer, sein Zorn blindwütiger. Doch die Indianer stahlen weiter. Dies konnte nicht geduldet werden. Sie zogen Nägel aus dem Schiff, Boote wurden entwendet, und auch Waffen. Weitere Schüsse fielen, weitere Indianer kamen um. Tagelang hinderte die Wachsamkeit Henry am Schlaf. Niemand schlief.
Kapitän Cook ging an Land, um eine Audienz bei den Häuptlingen zu erwirken und sie zu beruhigen, doch stattdessen traf er auf Hunderte von erbosten Hawaiianern. Innerhalb von Sekunden verwandelte sich die Menge in einen Mob. Henry sah, wie Kapitän Cook getötet wurde – von einer Keule getroffen, die Brust von der Lanze eines Eingeborenen durchbohrt, vermischte sich sein Blut mit den Wellen. Von einem Moment auf den anderen existierte der große Seefahrer nicht mehr. Sein Körper wurde von Eingeborenen fortgeschleppt. Später in der Nacht erfolgte die endgültige Demütigung: Von einem Kanu aus schleuderte ein Indianer einen Teil von Kapitän Cooks Oberschenkel auf die Resolution.
Henry sah, wie die englischen Seeleute zur Vergeltung die gesamte Siedlung niederbrannten. Sie ließen sich nur mit Mühe davon abhalten, alle Indianer der Insel – Männer, Frauen und Kinder – umzubringen. Die Köpfe zweier Indianer wurden aufgespießt – und dies sei nur der Anfang, verkündeten die Seeleute, es sei denn, Kapitän Cooks Leiche werde zurückgegeben, damit man ihn anständig beisetzen könne. Am nächsten Tag trafen die Reste von Cooks Leiche auf der Resolution ein, bis auf Wirbelsäule und Füße, die nie geborgen wurden. Henry sah, wie die sterblichen Überreste seines Kapitäns zur See bestattet wurden. Kapitän Cook hatte niemals auch nur ein Wort an Henry gerichtet, und Henry hatte Cooks Blick stets gemieden. Doch nun lebte Henry Whittaker, und Kapitän Cook war tot.
Er dachte, im Anschluss an dieses Desaster würden sie vielleicht nach England zurückkehren, doch das taten sie nicht. Ein Mann namens Mr Clark wurde Kapitän. Ihre Mission war noch nicht erfüllt, es galt nochmals, die Nordwestpassage zu finden. Als der Sommer zurückkehrte, segelten sie wieder nordwärts, hinein in die schreckliche Kälte. Aus einem Vulkan prasselten Asche und Bimsstein auf ihn nieder. Alles frische Gemüse war längst verzehrt, und sie tranken brackiges Wasser. Haie folgten dem Schiff, um sich am Abwasser der Latrinen zu laben. Henry und Mr Nelson erfassten elf neue Spezies von Polarenten und aßen neun davon. Henry sah einen riesigen weißen Bären hinter dem Schiff herschwimmen, träge paddelnd wie eine fortwährende Drohung. Er sah Indianer, die sich an kleinen, fellbedeckten Kanus festbanden und sie durch die Fluten steuerten, als wären Mensch und Boot zu einem Tier verschmolzen. Er sah Indianer von Hunden gezogen übers Eis gleiten. Er sah, wie Kapitän Cooks Nachfolger – Kapitän Clark – im Alter von achtunddreißig Jahren starb und zur See bestattet wurde.
Nun hatte Henry zwei englische Kapitäne überlebt.
Wieder gaben sie die Nordwestpassage auf. Sie segelten nach Macao. Er sah Geschwader von chinesischen Dschunken und begegnete nochmals Vertretern der Niederländischen Ostindien-Kompanie, die in ihrer schlichten schwarzen Kleidung und ihren einfachen Holzschuhen allgegenwärtig zu sein schienen. Er gewann den Eindruck, dass überall in der Welt irgendjemand einem Holländer Geld schuldete. In China erfuhr Henry von einem Krieg mit Frankreich und einer Revolution in Amerika. Es war das erste Mal, dass er davon hörte. In Manila sah er eine spanische Galeone, beladen mit einem Silberschatz im Wert von angeblich zwei Millionen Pfund. Er tauschte seine Schneeschuhe gegen eine spanische Marinejacke ein. Er erkrankte wie alle an der Ruhr, doch er überlebte. Er erreichte Sumatra und danach Java, wo er nochmals einen Holländer sah, der Geld verdiente. Das nahm er zur Kenntnis.
Ein letztes Mal umrundeten sie das Kap und hielten wieder Kurs auf England. Am 6. Oktober 1780 hatten sie Deptford heil erreicht. Henry war vier Jahre, drei Monate und zwei Tage fort gewesen. Er war nun ein junger Mann von zwanzig Jahren. Während der gesamten Reise hatte er sich gut bewährt. Wie ein Gentleman. Er hoffte und erwartete, dass man genau dies über ihn berichten würde. Er war auch weisungsgemäß ein eifriger Beobachter und botanischer Sammler gewesen und nun bereit, Sir Joseph Banks seinen Bericht kundzutun.
Er verließ das Schiff, bekam seinen Lohn, fand eine Mitfahrgelegenheit nach London. Die Stadt war schmutzig und grauenerregend. 1780 war für England ein fürchterliches Jahr gewesen – Aufruhr, Gewalt, antipäpstlicher Fanatismus, das Haus von Lord Mansfield niedergebrannt, dem Erzbischof von York auf offener Straße die Ärmel abgerissen und ins Gesicht geschleudert, gewaltsam geöffnete Gefängnisse, Ausnahmezustand –, doch Henry wusste von alldem nichts und kümmerte sich nicht darum. Er marschierte schnurstracks zum Soho Square 32, Banks’ Privathaus. Henry klopfte an die Tür und nannte seinen Namen, bereit, seine Belohnung entgegenzunehmen.
Banks schickte ihn nach Peru.
Dies sollte Henrys Belohnung sein.
Sir Joseph Banks war einigermaßen sprachlos, als Henry Whittaker vor seiner Tür stand. Im Laufe der Jahre hatte er den Jungen nicht nur aus den Augen, sondern auch mehr oder weniger aus dem Gedächtnis verloren, wobei er zu klug und zu höflich war, es sich in diesem Moment anmerken zu lassen. Banks beschäftigte sich tagtäglich mit einer atemberaubenden Menge an Informationen und trug ein erhebliches Maß an Verantwortung. Er beaufsichtigte nicht nur die Erweiterung der Gärten von Kew, sondern betreute und finanzierte auch unzählige botanische Expeditionen auf der ganzen Welt. Beinahe jedes Schiff, das in den Jahren nach 1780 in London eintraf, führte wenigstens eine Pflanze, einen Samen, einen Ableger oder eine Knolle für Sir Joseph Banks mit sich. Darüber hinaus war er Teil der feinen Gesellschaft und mischte bei allen wissenschaftlichen Neuerungen in Europa mit, von der Chemie über die Astronomie bis hin zur Schafzucht. Kurzum, Sir Joseph Banks war ein mehr als beschäftigter Gentleman, der in den letzten vier Jahren möglicherweise nicht ganz so viel über Henry Whittaker nachgedacht hatte wie Henry Whittaker über ihn.
Nichtsdestotrotz gewährte er Henry, während er sich peu à peu an den Sohn seines Obstgärtners erinnerte, Einlass in sein Arbeitszimmer und lud ihn zu einem Glas Portwein ein, welches Henry ablehnte. Er bat den Jungen, ihm alles über die Reise zu erzählen. Natürlich wusste Banks bereits, dass die Resolution sicher in England eingetroffen war, und er hatte auch regelmäßig Mr Nelsons Briefe erhalten, doch Henry war der erste Teilnehmer, der – geradewegs dem Schiff entstiegen – leibhaftig vor ihm stand, und so hieß ihn Sir Joseph Banks platzend vor Neugier willkommen. Fast zwei Stunden redete Henry unter Preisgabe sämtlicher botanischer und persönlicher Details. Seine Schilderungen waren vielleicht nicht taktvoll, doch sehr – man muss schon sagen – offen, und genau das machte seinen Bericht so wertvoll. Als Henry fertig war, fühlte sich Banks hervorragend informiert. Er schätzte es, Dinge zu wissen, von denen andere nicht wussten, dass er sie wusste, und nun war er – lange bevor ihm die offiziellen, entsprechend aufbereiteten Logbücher vorlagen – bereits über alles im Bilde, was sich auf Cooks dritter Forschungsreise zugetragen hatte.
Henrys Vortrag beeindruckte Banks. Er sah, dass Henry die vergangenen Jahre genutzt hatte, um die Botanik nicht nur zu studieren, sondern sich vollkommen zu eigen zu machen, und dass er nun das Potential besaß, ein erstklassiger Fachmann zu werden. Banks erkannte, dass er ihn an sich binden musste, ehe ihm andere den Jungen wegschnappten. Schließlich war Banks diesbezüglich selbst kein unbeschriebenes Blatt. Oft setzte er sein Geld und seinen Charme ein, um anderen Institutionen oder Expeditionen junge, verheißungsvolle Männer auszuspannen und sie in den Dienst der Gärten von Kew zu stellen. Und natürlich hatte auch er im Laufe der Jahre einige junge Männer verloren – von vermögenden Grundbesitzern auf sichere, lukrative Gärtnerposten gelockt. Aber den hier, das schwor sich Banks, den würde er nicht verlieren.
Henry mochte schlechterzogen sein, doch das störte Banks nicht, wenn er nur kompetent war. Großbritannien brachte Heerscharen von Naturforschern hervor, allein die meisten waren Hohlköpfe und Dilettanten. Derweil benötigte Banks dringend neue Pflanzen. Er hätte sich gern selbst auf Entdeckungsreise begeben, litt indessen mit seinen fast fünfzig Jahren unter schrecklichen Gichtanfällen. Aufgedunsen und von Schmerzen gepeinigt, war er die meisten Stunden des Tages an seinen Schreibtischsessel gefesselt. Mithin musste er Sammler entsenden. Sie zu finden war jedoch nicht einfach. Es gab nicht so viele kräftige junge Männer, wie man sich hätte erhoffen können – junge Männer, die überdies bereit waren, für dürftige Gehälter in Madagaskar am Fieberfrost zu sterben, vor den Azoren Schiffbruch zu erleiden, in Indien von Banditen überfallen oder auf Grenada gefangen genommen zu werden oder einfach für immer in Ceylon zu verschwinden.
Der Trick bestand darin, Henry das Gefühl zu vermitteln, dass er dazu auserkoren war, auf immer und ewig für Banks zu arbeiten. Er durfte dem Jungen keine Zeit lassen, die Sache abzuwägen oder sich von wem auch immer warnen zu lassen oder sein Herz an ein fesch gekleidetes Mädchen zu verlieren oder eigene Zukunftspläne zu fassen. Banks musste Henry davon überzeugen, dass seine Zukunft bereits beschlossene Sache war und den Gärten von Kew gehörte. Henry war ein selbstbewusster Bursche, doch Banks wusste, dass ihm die eigene Machtposition, sein Reichtum und Ruhm einen beträchtlichen Vorteil verschafften – so beträchtlich, dass es den Anschein haben konnte, er sei ein Vollstrecker der göttlichen Vorsehung. Der Trick bestand nun darin, diese Vorsehung rasch und entschlossen wahr werden zu lassen.
»Ausgezeichnete Arbeit«, sagte Banks, als Henry ihm Bericht erstattet hatte. »Das hast du gut gemacht. Ich werde dich nächste Woche in die Anden schicken.«
Henry musste überlegen: Was waren die Anden? Inseln? Ein Gebirge? Ein Land? So wie die Niederlande?
Doch Banks redete weiter, als wäre bereits alles entschieden: »Ich finanziere eine botanische Forschungsreise nach Peru, die nächsten Mittwoch in See sticht. Du wirst unter der Führung von Mr Ross Niven stehen. Er ist ein zäher, alter Schotte – um ehrlich zu sein, vielleicht schon ein bisschen zu alt – Jedoch nicht weniger robust als alle anderen, die du dort vorfinden wirst. Ich möchte behaupten, dass er sich mit Bäumen auskennt und mit Südamerika auch. Weißt du, für diese Arbeit ziehe ich einen Schotten jedem Engländer vor. Sie sind kaltblütiger und beständiger, verfolgen ihre Ziele mit hartnäckigerem Elan, und genau das erhofft man sich ja von seinen Männern im Ausland. Dein Lohn beläuft sich auf vierzig Pfund pro Jahr, was zwar keine Vergütung ist, von der ein junger Mann in Saus und Braus leben kann, doch es ist ein ehrbarer Posten, der dir die Dankbarkeit des Britischen Weltreichs sichert. Da du noch Junggeselle bist, wirst du gewiss damit auskommen. Je bescheidener du jetzt lebst, Henry, desto reicher wirst du einmal werden.«
Henry schien im Begriff, eine Frage zu stellen, weshalb ihm Banks rasch den verbalen Todesstoß versetzte. »Spanisch sprichst du nicht, oder?«, fragte er missbilligend.
Henry schüttelte den Kopf.
Banks stieß einen übertrieben enttäuschten Seufzer aus. »Nun ja, du wirst es lernen, denke ich. Ich erlaube dir trotzdem, an der Expedition teilzunehmen. Niven spricht Spanisch, wenn auch mit einem kuriosen, schnarrenden Akzent. Irgendwie müsst ihr dort mit der spanischen Regierung zurechtkommen. Weißt du, die Spanier protegieren Peru und sind wirklich ein Ärgernis – allerdings gehört es ihnen ja wohl. Du lieber Himmel, wie gern würde ich dort jeden Urwald durchforsten, wenn ich nur könnte. Ich hasse die Spanier, Henry. Ich hasse die spanischen Gesetze, die alles behindern und zerstören, was ihnen in die Quere kommt. Auch die spanische Kirche ist fürchterlich. Kannst du dir vorstellen, dass diese Jesuiten immer noch glauben, die vier Andenflüsse seien identisch mit den vier Flüssen des Paradieses aus der Genesis? Stell dir das mal vor, Henry! Wie kann man nur den Orinoko mit dem Tigris verwechseln!«
Henry hatte keine Ahnung, wovon der Mann redete, doch er schwieg. In den letzten vier Jahren hatte er gelernt, nur dann den Mund aufzutun, wenn er wusste, wovon er sprach. Ferner hatte er gelernt, dass man durch Schweigen sein Gegenüber mitunter zu der Annahme verleiten konnte, man sei intelligent. Und im Übrigen war er abgelenkt, weil Banks’ Worte in seinem Kopf nachhallten: … desto reicher wirst du einmal werden.
Banks klingelte, und ein bleicher Diener trat mit ausdrucksleerem Gesicht in den Raum, setzte sich an den Sekretär und nahm einige Bögen Schreibpapier daraus hervor. Ohne ein weiteres Wort an den Jungen zu richten, diktierte Banks:
»In Ansehung der Empfehlung, die ich, Sir Joseph Banks, den Königlichen Botanischen Gärten von Kew zuteilwerden lasse … et cetera, et cetera … darf ich Sie im Namen Ihrer Lordschaften in Kenntnis darüber setzen, dass Sie, Henry Whittaker, für den Botanischen Garten Seiner Majestät zum Pflanzensammler ernannt werden … et cetera, et cetera … als Vergütung für Ihre Verpflegungs-, Lohn- und sonstigen Unkosten wird Ihnen ein Gehalt von jährlich vierzig Pfund gewährt, et cetera, et cetera, et cetera …«
Schrecklich viele et ceteras für vierzig Pfund im Jahr, dachte Henry später, aber hatte er überhaupt eine andere Wahl für seinen zukünftigen Werdegang? Es folgte ein beflissenes Federkratzen, dann wedelte Banks zum Trocknen der Tinte träge mit dem Blatt durch die Luft und sagte: »Dein