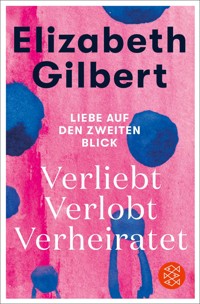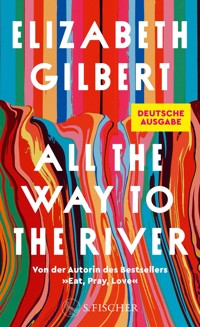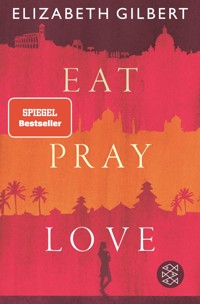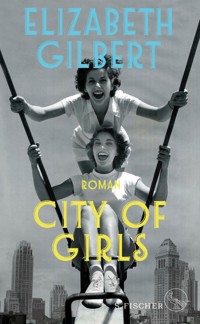
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Elizabeth Gilbert, Autorin des Weltbestsellers »Eat Pray Love«, schenkt uns mit ihrem Roman »City of Girls« eine »Hymne auf die Freuden des Lebens.« (Evening Standard) Das Leben ist wild und gefährlich. Wer sich ihm kopfüber anvertraut, gerät in einen Wirbel von Leidenschaft und Liebe. So geschieht es Vivian, die aus der Provinz in die große Stadt geschickt wird. Über Nacht findet sie sich im Glamour New Yorks wieder – in den turbulenten Vierzigern mit Musicals, Bars, Jazz und Gangstern. Als ihr im Privaten ein Fehler unterläuft, kommt es zu einem öffentlichen Skandal, der ihre Welt auf den Kopf stellt. Sie wird Jahre brauchen, um ihn zu verstehen. Vivian findet schließlich einen Anker in ihrer besten Freundin Marjorie. Gemeinsam eröffnen sie das exklusivste Schneideratelier der Stadt. Tagsüber näht Vivian mit Hingabe und Phantasie die schönsten Brautkleider Manhattans, abends feiern sie gemeinsam Partys auf dem Dach. Und sie findet einen Weg, alles wieder gut zu machen, ohne sich untreu zu werden. Der Roman, von den Medien als betörender Mix aus Charme und Witz gefeiert, stand nach Erscheinen monatelang auf der »New York Times«-Bestsellerliste. »Atemberaubend« Lisa Taddeo, Autorin von »Three Women - Drei Frauen« Ein Roman wie »Diamanten in Champagner.« Washington Post »Eine Sensation« Cosmopolitan »Das Buch des Sommers« Elle
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 687
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Elizabeth Gilbert
City of Girls
Roman
Über dieses Buch
Der Roman funkelt wie »Diamanten im Champagner«.
Washington Post
Das Leben ist zu flüchtig, zu gefährlich und zu kostbar, um es nicht voll und ganz zu genießen. Nach einer Jugend in der Provinz und dem Rausschmiss aus dem College, stürzt sich die 19-jährige Vivian kopfüber in das wilde Leben Manhattans der Vierziger: Musicals, Bars, Jazz und Gangster. Um jede Ecke biegt eine neue Liebe, erst recht im Lily Playhouse, dem sympathisch heruntergekommenen Theater, für das sie Kostüme näht. Ein Schatten scheint sich über sie zu legen, doch sie lernt und bleibt sich selber treu.
Mit betörender Leichtigkeit, Witz, Charme und einer Heldin zum Verlieben gelingt Elizabeth Gilbert eine »Hymne auf die Freuden des Lebens« (Evening Standard).
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Elizabeth Gilbert wurde 1969 geboren. Nach dem Studium in New York arbeitete sie als Journalistin und begann, Bücher zu schreiben. 2006 erschien der Weltbestseller »Eat Pray Love«, der mit Julia Roberts in der Hauptrolle verfilmt wurde. Nach »Big Magic« (2015) erschien 2019 der Roman »City of Girls« und 2025 das Memoir »All the Way to the River«. Elizabeth Gilbert lebt in New Jersey.
Britt Somann-Jung ist Lektorin und Übersetzerin und lebt mit ihrer Familie in Hamburg. Für S. Fischer übersetzte sie bislang »Frauen und Kleider« von Sheila Heti, Heidi Julavits und Leanne Shapton (zusammen mit Sophie Zeitz), »Wunde Punkte« von Matt Sumell sowie »Big Magic« von Elizabeth Gilbert.
Impressum
Deutsche Erstausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Copyright © 2019 by Elizabeth Gilbert
All rights reserved.
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »City of Girls« bei Riverhead Books, an imprint of Penguin Random House LLC, New York.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung von Fotos von © ullstein bild - mirrorpix und © ullstein bild - Roger-Viollet/Laure Albin Guillot
ISBN 978-3-10-403652-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für Margaret Cordi –
meine Augen, meine Ohren, meine geliebte Freundin
»Du wirst immer wieder Dummheiten begehen,
aber begeh sie mit Begeisterung.«
Colette
New York City, April 2010
Neulich habe ich einen Brief von seiner Tochter bekommen.
Angela.
Ich habe in all den Jahren oft an sie gedacht, aber mit diesem Brief hatten wir erst zum dritten Mal miteinander zu tun.
Beim ersten Mal, 1971, hatte ich ihr Hochzeitskleid genäht.
Beim zweiten Mal hatte sie mir geschrieben, dass ihr Vater gestorben sei. Das war 1977.
Nun schrieb sie mir, um mich darüber zu informieren, dass ihre Mutter nicht mehr lebte. Ich bin mir nicht sicher, welche Reaktion sie von mir erwartete. Sie dürfte sich gedacht haben, dass die Neuigkeiten mich aus dem Tritt bringen würden. Wobei ich ihr keine Böswilligkeit unterstelle. So tickt Angela nicht. Sie ist ein guter Mensch. Wichtiger noch, ein interessanter Mensch.
Es überraschte mich allerdings, dass Angelas Mutter so lange durchgehalten hatte. Ich dachte, sie wäre schon vor einer Ewigkeit gestorben. Das waren ja weiß Gott die meisten. (Aber warum sollte mich jemandes Langlebigkeit überraschen, da ich mich doch selbst ans Dasein klammerte wie eine Seepocke an einen Schiffsrumpf? Ich konnte nicht die einzige steinalte Dame sein, die durch New York City wackelte und finster entschlossen war, weder von ihrem Leben noch von ihrer Immobilie zu lassen.)
Doch es war die letzte Zeile von Angelas Brief, die mich am stärksten erschütterte.
»Vivian«, schrieb Angela, »nun, da meine Mutter nicht mehr ist, frage ich mich, ob Sie sich im Stande sehen, mir zu erzählen, was Sie für meinen Vater waren?«
Tja.
Was war ich denn für ihren Vater?
Nur er hätte diese Frage beantworten können. Und da er sich entschieden hatte, nie mit seiner Tochter über mich zu sprechen, steht es mir nicht zu, Angela zu erzählen, was ich für ihn war.
Ich kann ihr allerdings erzählen, was er für mich war.
1
Im Sommer 1940, als ich neunzehn Jahre alt und ein Dummkopf war, schickten meine Eltern mich zu Tante Peg, der eine Theaterkompanie in New York City gehörte.
Ich war unlängst vom Vassar College freigestellt worden, da ich nie am Unterricht teilgenommen hatte und folglich durch sämtliche Prüfungen des ersten Studienjahrs gefallen war. Ich war nicht ganz so dumm, wie meine Zensuren vermuten ließen, aber es ist anscheinend nicht hilfreich, wenn man nicht lernt. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, weiß ich nicht mehr genau, was ich mit all der Zeit angefangen habe, als ich eigentlich im Unterricht hätte sitzen sollen, aber so wie ich mich kenne, war ich wohl schrecklich beschäftigt mit meinem Aussehen. (Ich erinnere mich noch, dass ich in jenem Jahr versuchte, eine »reverse roll« hinzubekommen – eine Frisur, die für mich ungeheuer wichtig und auch recht schwierig war, aber so gar nicht typisch Vassar.)
Ich hatte meinen Platz am Vassar nie gefunden, obwohl es dort durchaus Plätze zu finden gab. An der Schule existierten alle möglichen Arten von Mädchen und Cliquen, aber keine weckte meine Neugier, in keiner erkannte ich mich wieder. In jenem Jahr waren da die Revolutionärinnen, die in seriösen schwarzen Hosen über internationale Unruhen diskutierten, aber internationale Politik interessierte mich nicht. (Tut es heute noch nicht. Aber die schwarzen Hosen bemerkte ich durchaus, denn sie waren ausnehmend schick – allerdings nur, wenn die Taschen nicht beulten.) Dann gab es die kühnen akademischen Vorkämpferinnen, die dazu bestimmt waren, Ärztinnen oder Anwältinnen zu werden, lange bevor es üblich wurde. Sie hätten mich interessieren sollen, aber das taten sie nicht. (Schon allein deshalb, weil ich sie nicht auseinanderhalten konnte. Sie trugen alle die gleichen ungestalten Wollröcke, die aussahen, als hätte man sie aus alten Pullovern zusammengenäht, und das schlug mir aufs Gemüt.)
Es war nicht so, dass Vassar gänzlich frei von Glamour war. Ein paar sentimentale, rehäugige Mediävistinnen waren ziemlich hübsch, genau wie einige künstlerische Mädchen mit langem, wichtigtuerischem Haar und ein paar vornehme Salonlöwinnen mit Profilen wie italienische Windspiele – doch ich freundete mich mit keiner von ihnen an. Vielleicht weil ich spürte, dass an dieser Schule alle klüger waren als ich. (Das war nicht allein jugendliche Paranoia; bis heute bin ich davon überzeugt, dass sie es tatsächlich waren.)
Um ehrlich zu sein, verstand ich nicht, was ich am College sollte, außer einer Bestimmung zu folgen, deren Sinn zu erklären sich niemand bemüht hatte. Von frühester Kindheit an war mir erzählt worden, dass ich einmal ans Vassar College gehen würde, aber niemand hatte mir gesagt, warum. Wozu das alles? Was genau sollte es mir bringen? Und warum war ich in diesem mickrigen kleinen Wohnheimzimmer mit einer todernsten künftigen Sozialreformerin untergebracht?
Ich hatte vom Lernen doch damals schon genug. Jahrelang hatte ich in Troy, New York, an der Emma Willard School for Girls gepaukt, mit ihrem brillanten, rein weiblichen Kollegium aus Seven-Sisters-Absolventinnen – genügte das denn nicht? Seit ich zwölf Jahre alt war, besuchte ich ein Internat; vielleicht hatte ich einfach das Gefühl, mein Soll erfüllt zu haben. Wie viele Bücher muss man lesen, um zu beweisen, dass man Bücher lesen kann? Ich wusste bereits, wer Karl der Große war, also sollte man mich gefälligst in Ruhe lassen – so sah ich das.
Außerdem hatte ich schon recht früh in meinem zum Scheitern verurteilten ersten Jahr am Vassar eine Bar in Poughkeepsie entdeckt, in der man bis spät nachts billiges Bier und Live-Jazz bekam. Ich fand einen Weg, mich vom Campus zu schleichen und die Bar zu frequentieren (mein ausgefeilter Fluchtplan beinhaltete ein unverschlossenes Waschraumfenster und ein verstecktes Fahrrad – glaub mir, ich war der Fluch der Hausaufsicht), was es mir erschwerte, am nächsten Morgen lateinische Konjugationsformen aufzunehmen, da ich meistens verkatert war.
Und es gab weitere Hindernisse.
Zum Beispiel hatte ich jede Menge Zigaretten zu rauchen.
Ich war also beschäftigt.
Und so kam es, dass ich in einem Jahrgang mit 362 aufgeweckten jungen Vassar-Frauen den 361. Rang belegte – eine Tatsache, die meinen Vater zu der entsetzten Frage veranlasste: »Mein Gott, was hat denn nur das andere Mädchen getrieben?« (Sich Kinderlähmung zugezogen, wie sich herausstellte, das arme Ding.) Also schickte Vassar mich nach Hause – verständlicherweise – und bat freundlich darum, dass ich nicht zurückkehren möge.
Meine Mutter hatte keine Ahnung, was sie mit mir anstellen sollte. Schon zu guten Zeiten hatten wir uns nicht besonders nahegestanden. Sie war eine begeisterte Reiterin, aber da ich weder ein Pferd noch von Pferden fasziniert war, hatten wir uns nie viel zu sagen gehabt. Mit meinem Scheitern hatte ich sie so über die Maßen blamiert, dass sie meinen Anblick kaum ertrug. Anders als ich hatte meine Mutter sich am Vassar College ziemlich gut geschlagen, herzlichen Dank auch. (Abschlussklasse 1915. Geschichte und Französisch.) Ihr Status als Alumna – wie auch ihre großzügige jährliche Spende – hatte mir den Zugang zu jener heiligen Institution ermöglicht, und nun das. Wann immer sie mir in den Fluren unseres Hauses begegnete, nickte sie mir zu wie eine professionelle Diplomatin. Höflich, aber unterkühlt.
Auch mein Vater wusste nicht, was er mit mir anfangen sollte, aber er war so mit der Leitung seiner Hämatit-Mine beschäftigt, dass er sich mit seiner problematischen Tochter nicht allzu sehr befasste. Ich hatte ihn enttäuscht, ja, aber er hatte größere Sorgen. Er war Industrieller und Isolationist, und der eskalierende Krieg in Europa ließ ihn um die Zukunft seines Unternehmens fürchten. Ich nehme an, das lenkte ihn ab.
Mein älterer Bruder Walter wiederum war in Princeton, wo er Großes vollbrachte und keinen Gedanken an mich verschwendete, außer, mein verantwortungsloses Verhalten zu missbilligen. Walter hatte noch nie etwas Verantwortungsloses getan. Von seinen Mitschülern im Internat war er derart respektiert worden, dass er den Spitznamen – und das denke ich mir nicht aus – der Botschafter erhielt. Jetzt studierte er Ingenieurwesen, weil er eine Infrastruktur schaffen wollte, die den Menschen überall auf der Welt eine Hilfe war. (Der Liste meiner Vergehen hingegen war hinzuzufügen, dass ich mir nicht einmal sicher war, was das Wort »Infrastruktur« bedeutete.) Obwohl Walter und ich dem Alter nach nah beieinander waren – nur zwei Jahre Abstand –, waren wir seit unserer Kindheit keine Spielkameraden mehr. Mein Bruder hatte sich von allem Kindischen verabschiedet, als er etwa neun Jahre alt war, und zu diesem Kindischen gehörte auch ich. Ich war nicht Teil seines Lebens, und dessen war ich mir bewusst.
Und auch für meine Freunde ging das Leben weiter. Sie strebten ans College, in Berufe, Ehen und Erwachsensein – alles Themen, die ich weder interessant fand noch verstand. Es war also niemand da, der sich um mich kümmerte oder mich unterhielt. Ich war gelangweilt und antriebslos. Meine Langeweile fühlte sich an wie ein quälender Hunger. Die ersten beiden Juniwochen verbrachte ich damit, wieder und wieder einen Tennisball gegen unsere Garagenwand zu pfeffern und dabei »Little Brown Jug« zu pfeifen, so lange, bis meine Eltern es schließlich leid waren und mich zu meiner Tante in die Stadt verfrachteten. Und ganz ehrlich, wer konnte es ihnen verdenken?
Natürlich hätten sie sich sorgen können, dass New York mich in eine Kommunistin oder Drogensüchtige verwandeln würde, aber das war wohl immer noch besser, als bis in alle Ewigkeit zuzuhören, wie die Tochter einen Tennisball gegen eine Wand warf.
So kam ich damals in die Stadt, Angela. Damit fing alles an.
Sie schickten mich mit dem Zug nach New York – und was war das für ein phantastischer Zug. Der Empire State Express, direkt von Utica. Ein chromglänzendes Transportgeschoss für törichte Töchter. Ich sagte Mutter und Dad höflich Lebwohl, übergab mein Gepäck einem Träger und kam mir ziemlich wichtig vor. Die Fahrt verbrachte ich im Speisewagen, wo ich Malzmilch süffelte, Birnen in Sirup aß, Zigaretten rauchte und in Zeitschriften blätterte. Ich wusste, dass ich verbannt wurde, aber immerhin … mit Stil!
Die Züge waren damals so viel besser, Angela.
Ich gelobe, mich auf diesen Seiten nicht darin zu ergehen, dass zu meiner Zeit alles besser war. In meiner Jugend habe ich es gehasst, wenn alte Leute so rumjammerten. (Keinen interessiert’s! Keinen interessiert dein goldenes Zeitalter, du geschwätzige Ziege!) Und lass mich dir auch versichern: Ich weiß sehr wohl, dass vieles in den 1940er Jahren nicht besser war. Deodorant und Klimaanlagen zum Beispiel waren beklagenswert unzulänglich, weshalb die Leute stanken wie verrückt, vor allem im Sommer, und außerdem hatten wir Hitler. Aber die Züge waren damals zweifellos besser. Wann bist du auf einer Zugfahrt zum letzten Mal in den Genuss einer Malzmilch und einer Zigarette gekommen?
Ich bestieg den Zug in einem fröhlichen kleinen blauen Kunstseidekleid mit Lerchendruck, gelber Stickerei am Halsausschnitt, einem relativ schmalen Rock und tiefen Taschen auf Hüfthöhe. Ich kann mich an dieses Kleid noch so lebhaft erinnern, weil ich, erstens, niemals vergesse, was jemand getragen hat, nie, und weil ich es, zweitens, selbst genäht hatte. Es war mir wirklich gut gelungen. Der Rock – der bis zur Wadenmitte reichte – bestach mit seinem koketten und effektvollen Schwung. Ich weiß noch, dass ich extra Schulterpolster eingenäht hatte, in dem verzweifelten Bemühen, wie Joan Crawford auszusehen – wobei ich mir nicht sicher bin, ob das funktionierte. Mit meinem einfachen Glockenhut und der von Mutter geborgten schlichten blauen Handtasche (voll mit Kosmetik und Zigaretten), sah ich wohl kaum wie eine Leinwandgöttin aus, sondern vielmehr wie das, was ich war: eine neunzehnjährige Jungfrau auf dem Weg zu Verwandten.
Nach New York begleitet wurde diese neunzehnjährige Jungfrau von zwei riesigen Koffern – der eine gefüllt mit meinen Kleidern, die ordentlich in Seidenpapier eingeschlagen waren, und der andere vollgestopft mit Stoffen, Besatz und Nähzeug, damit ich noch mehr Kleider anfertigen konnte. Mit dabei war außerdem eine stabile Kiste mit meiner Nähmaschine – ein schweres, unhandliches Biest, das schlecht zu transportieren war. Aber sie war meine verrückte, schöne Seelenverwandte, ohne die ich nicht leben konnte.
Also kam sie mit.
Diese Nähmaschine – und alles, worum sie mein Leben in der Folge bereicherte – verdankte ich Großmutter Morris, also lass uns einen Moment bei ihr verweilen.
Wenn du das Wort »Großmutter« liest, ersteht vor deinem geistigen Auge möglicherweise das Bild einer süßen kleinen alten Dame mit schlohweißem Haar. Das ist nicht meine Großmutter. Meine Großmutter war eine große, leidenschaftliche, alternde Kokette mit mahagonibraun gefärbtem Haar, die sich in einer Wolke aus Parfüm und Klatsch durchs Leben bewegte und sich kleidete wie eine Zirkusvorstellung.
Sie war die schillerndste Frau der Welt – schillernd in jeder Hinsicht. Großmutter trug Knautschsamtkleider in erlesenen Farben – Farben, die sie nicht rosa, weinrot oder blau nannte, wie der Rest der phantasielosen Menschheit, sondern »Rosenasche«, »Korduan« oder »della Robbia«. Sie hatte Ohrlöcher, was für ehrenwerte Damen damals unüblich war, und besaß mehrere üppig bestückte Schmuckkästchen, die mit einem endlosen Wirrwarr aus billigen und teuren Ketten, Ohrringen und Armbändern gefüllt waren. Sie hatte ein Kostüm für ihre nachmittäglichen Autofahrten aufs Land, und ihre Hüte waren so groß, dass sie im Theater einen eigenen Sitzplatz beanspruchten. Sie mochte Kätzchen und Versandhauskosmetik, ergötzte sich schaudernd an Schmierblattberichten über spektakuläre Mordfälle und war bekannt dafür, romantische Gedichte zu verfassen. Doch vor allem verehrte meine Großmutter das Schauspiel. Sie besuchte jedes Stück und jede Aufführung, die in der Stadt gastierte, und schwärmte überdies für Filme. Ich begleitete sie oft, da wir genau den gleichen Geschmack hatten. (Großmutter Morris und ich wurden vor allem von Geschichten angezogen, in denen unschuldige Mädchen in luftigen Kleidern von gefährlichen Männern in düsteren Hüten entführt und dann von anderen Männern mit stolzem Kinn gerettet wurden.)
Natürlich liebte ich sie.
Der Rest der Familie allerdings nicht. Meine Großmutter war allen peinlich außer mir. Vor allem war sie ihrer Schwiegertochter (meiner Mutter) peinlich, die keine frivole Person war und beständig zusammenzuckte über Großmutter Morris, die sie einmal »diesen schwärmerischen ewigen Backfisch« nannte.
Überflüssig zu erwähnen, dass Mutter keine romantischen Gedichte schrieb.
Aber es war Großmutter Morris, die mir das Nähen beibrachte.
Meine Großmutter war eine meisterliche Schneiderin. (Sie hatte es wiederum von ihrer Großmutter gelernt, die es nicht zuletzt dank ihres Geschicks mit der Nadel geschafft hatte, in nur einer Generation vom eingewanderten walisischen Dienstmädchen zur vermögenden amerikanischen Dame aufzusteigen.) Meine Großmutter wollte auch aus mir eine Meisterschneiderin machen. Wenn wir nicht gerade zusammen in Filmtheatern Toffee aßen oder uns Zeitschriftenartikel über den weißen Sklavenhandel vorlasen, nähten wir also. Und das war eine ernste Angelegenheit. Großmutter Morris hatte keine Scheu, Spitzenleistungen von mir zu fordern. Sie machte zum Beispiel zehn Stiche in ein Kleidungsstück und ließ mich dann die nächsten zehn machen – und wenn meine nicht so perfekt waren wie ihre, löste sie meine wieder auf und ließ sie mich wiederholen. Sie lotste mich durch die Handhabung solch unmöglicher Materialien wie Netzgewebe und Spitze, bis mir kein Stoff mehr Angst einjagen konnte, egal, wie widerspenstig. Und dann der Aufbau! Die Wattierung! Der Schnitt! Im Alter von zwölf Jahren konnte ich mühelos ein Korsett nähen (mit Fischbein und allem) – auch wenn außer Großmutter Morris seit circa 1910 niemand mehr ein Fischbeinkorsett benötigt hatte.
So streng sie an der Nähmaschine auch sein konnte, machte ihr Regiment mich nicht mürbe. Ihre Kritik traf mich zwar, aber sie schmerzte nicht. Ich war fasziniert genug von Kleidern, um lernen zu wollen, und ich wusste, dass sie meine Begabung nur fördern wollte.
Ihr sparsames Lob spornte mich an. Ich wurde geschickt.
Als ich dreizehn war, kaufte Großmutter Morris mir die Nähmaschine, die mich eines Tages im Zug nach New York City begleiten sollte. Es war eine schlanke, schwarze Singer 201 von mörderischer Kraft (man konnte damit sogar Leder nähen; ich hätte einen Bugatti aufpolstern können!). Bis heute hat mir niemand je ein besseres Geschenk gemacht. Ich nahm die Singer mit ins Internat, wo sie mir in einer Gemeinschaft privilegierter Mädchen, die sich alle gut anziehen wollten, aber nicht unbedingt die nötigen Fähigkeiten besaßen, eine enorme Macht verlieh. Sobald sich herumgesprochen hatte, dass ich alles nähen konnte – und das konnte ich wirklich –, klopften die Mädchen der Emma Willard ständig an meine Tür und flehten mich an, ihre Taillen zu weiten, einen Saum auszubessern oder das Abendkleid der älteren Schwester aus dem letzten Jahr so zu ändern, dass es ihnen genau jetzt passte. Ich verbrachte diese Jahre über meine Singer gebeugt wie ein Maschinengewehrschütze, und es war die Sache wert. Ich wurde beliebt – und das ist streng genommen das Einzige, was an einem Internat zählt. Oder irgendwo sonst.
Ich sollte erwähnen, dass meine Großmutter mich das Nähen auch deshalb lehrte, weil ich eine eigentümliche Figur hatte. Von frühester Kindheit an war ich immer zu groß, zu schlaksig gewesen. Die Pubertät kam und ging, und ich wurde lediglich größer. Meine Brust schien nicht wachsen zu wollen, dafür schien sich mein Rumpf endlos in die Länge zu ziehen. Meine Arme und Beine waren wie junge Bäume. Nichts, was man im Laden kaufen konnte, würde mir jemals richtig passen, deshalb wäre ich immer besser dran, wenn ich mir meine eigenen Kleider nähte. Und Großmutter Morris – Gott hab sie selig – brachte mir bei, mich so zu kleiden, dass es meiner Größe schmeichelte, statt mich wie eine Stelzenläuferin aussehen zu lassen.
Falls es sich so anhört, als würde ich meinem Äußeren mit Selbstironie begegnen, so führt das in die Irre. Ich schildere lediglich die Tatsachen: Ich war groß, das ist alles. Und falls es sich so anhört, als wollte ich die Geschichte vom hässlichen Entlein erzählen, das in die Stadt kommt und schließlich herausfindet, dass es doch hübsch ist – keine Sorge, diese Geschichte wird es nicht.
Ich war immer hübsch, Angela.
Und ich war mir dessen immer bewusst.
Zweifellos lag es an meinem hübschen Äußeren, dass ein attraktiver Mann im Speisewagen des Empire State Express zu mir herüberstarrte, während ich an meiner Malzmilch nippte und meine Birnen in Sirup vertilgte.
Schließlich kam er zu mir und fragte, ob er mir Feuer geben dürfe. Ich bejahte, er nahm Platz und begann zu flirten. Ich war begeistert von der Aufmerksamkeit, wusste aber nicht, wie ich den Flirt erwidern sollte. Also reagierte ich auf seine Annäherungsversuche, indem ich aus dem Fenster starrte und vorgab, in Gedanken versunken zu sein. Ich runzelte leicht die Stirn, in der Hoffnung, dass es mich seriös und dramatisch wirken ließ, obwohl ich vermutlich nur kurzsichtig und verwirrt aussah.
Diese Szene wäre noch peinlicher gewesen, als sie klingt, wäre ich nicht irgendwann von meinem eigenen Spiegelbild im Zugfenster abgelenkt worden, was mich eine ganze Weile beschäftigte. (Verzeih mir, Angela, aber von seinem eigenen Aussehen bezaubert zu sein ist das Privileg junger, hübscher Mädchen.) Wie sich herausstellte, war selbst dieser attraktive Fremde nicht annähernd so interessant wie der Schwung meiner Augenbrauen. Dabei interessierte mich nicht nur, wie gut ich sie in Form gebracht hatte – obwohl ich vollkommen fasziniert von dem Thema war –, sondern es war zufällig auch so, dass ich in jenem Sommer zu lernen versuchte, eine Augenbraue hochzuziehen wie Vivien Leigh in Vom Winde verweht. Das zu üben erforderte Konzentration, wie du dir sicher vorstellen kannst. Also verstehst du bestimmt, wie die Zeit verflog, während ich mich in meinem Spiegelbild verlor.
Als ich das nächste Mal aufblickte, fuhren wir schon in die Grand Central Station ein, mein neues Leben würde gleich anbrechen, und der attraktive Mann war lange fort.
Aber keine Sorge, Angela – es würde noch viele attraktive Männer geben.
Oh! Ich sollte dir auch erzählen – falls du dich gefragt hast, was aus ihr geworden ist –, dass meine Großmutter Morris etwa ein Jahr, bevor der Zug mich in New York City absetzte, gestorben war. Sie verschied im August 1939, nur wenige Wochen, bevor ich am Vassar anfangen sollte. Ihr Tod kam nicht überraschend – sie hatte seit Jahren abgebaut –, aber der Verlust (meiner besten Freundin, meiner Mentorin, meiner Vertrauten) erschütterte mich bis ins Mark.
Weißt du was, Angela? Diese Erschütterung könnte etwas damit zu tun haben, dass ich in meinem ersten Jahr am College so schlecht war. Vielleicht war ich gar keine so schreckliche Studentin gewesen. Vielleicht war ich einfach nur traurig.
Erst jetzt, da ich dir schreibe, wird mir diese Möglichkeit bewusst.
Oje.
Manchmal dauert es wirklich sehr lang, bis wir etwas begreifen.
2
Jedenfalls kam ich sicher in New York City an – ein so frisch geschlüpftes Mädchen, dass es praktisch noch Eigelb im Haar hatte.
Tante Peg sollte mich an der Grand Central Station in Empfang nehmen. Meine Eltern hatten mich darüber informiert, als ich morgens in Utica den Zug bestieg, aber niemand hatte mir konkret gesagt, wo genau ich auf sie warten sollte. Man hatte mir auch keine Telefonnummer gegeben, die ich im Notfall hätte anrufen können, und keine Adresse, die ich hätte ansteuern können, sollte ich auf mich gestellt sein. Ich sollte einfach »Tante Peg an der Grand Central treffen«, und das war’s.
Tja, die Grand Central Station war grandios, wie der Name schon sagt, aber sie war auch ein großartiger Ort, um jemanden nicht zu finden, insofern dürfte es nicht überraschen, dass ich Tante Peg bei meiner Ankunft nicht entdecken konnte. Eine halbe Ewigkeit stand ich mit meinem Gepäckstapel auf dem Bahnsteig und beobachtete das Gewusel um mich herum, aber niemand ähnelte Tante Peg.
Dabei war es nicht so, dass ich nicht wusste, wie Peg aussah. Ich war meiner Tante schon ein paar Mal begegnet, auch wenn sie und mein Vater sich nicht nahestanden. (Das ist vielleicht eine Untertreibung. Mein Vater war mit seiner Schwester genauso wenig einverstanden wie mit ihrer beider Mutter. Wann immer beim Abendessen Pegs Name fiel, schnaubte mein Vater und sagte: »Muss schön sein – durch die Lande zu ziehen, in einer Traumwelt zu leben und das Geld zum Fenster hinauszuwerfen!« Und ich dachte mir: Klingt wirklich schön …)
Als ich klein war, war Peg zu einigen Weihnachtsfesten im Kreis der Familie gekommen – aber viele waren es nicht gewesen, weil sie immer mit ihrer Theaterkompanie tourte. Meine stärkste Erinnerung an Peg stammte von einem Tagesausflug nach New York City, als ich elf Jahre alt war und meinen Vater bei einer geschäftlichen Unternehmung begleitete. Peg war mit mir im Central Park Schlittschuhlaufen gegangen. Sie hatte mit mir den Weihnachtsmann besucht. (Obwohl wir uns einig waren, dass ich viel zu alt war für den Weihnachtsmann, war ich insgeheim begeistert, ihn zu treffen.) Mittag hatten wir in einem Restaurant mit Lunchbuffet gegessen. Eindeutig einer der erfreulicheren Tage meines Lebens. Mein Vater und ich waren nicht über Nacht in der Stadt geblieben, denn Dad hasste und misstraute New York, aber es war ein herrlicher Ausflug, das kann ich dir sagen. Ich fand meine Tante phantastisch. Ihre Aufmerksamkeit hatte mir als Person gegolten, nicht mir als Kind, und einem elfjährigen Kind, das nicht als Kind gesehen werden wollte, bedeutete das alles.
Vor nicht allzu langer Zeit war Tante Peg in meine Heimatstadt Clinton zurückgekehrt, um an der Beerdigung von Großmutter Morris, ihrer Mutter, teilzunehmen. Während des Gottesdienstes hatte sie neben mir gesessen und meine Hand in ihrer großen, tüchtigen Pranke gehalten. Diese Geste tröstete und überraschte mich (meine Familie neigte nicht zum Händchenhalten). Nach der Beerdigung umarmte Peg mich mit der Kraft eines Holzfällers, und in ihren Armen verlor ich die Fassung und vergoss Niagarafälle an Tränen. Sie roch nach Lavendelseife, Zigaretten und Gin. Ich klammerte mich an sie wie ein trauriger kleiner Koala. Nach der Beerdigung blieb mir allerdings nicht viel Zeit mit ihr. Sie musste sofort in die Stadt zurück, weil dort eine Show auf sie wartete, die produziert werden wollte. Ich hatte das Gefühl, mich mit dem Zusammenbruch in ihren Armen lächerlich gemacht zu haben, auch wenn sie mir ein Trost gewesen war.
Ich kannte sie schließlich kaum.
Tatsächlich folgt hier die Zusammenfassung all dessen, was ich über meine Tante Peg wusste, als ich mit neunzehn Jahren in New York City ankam:
Ich wusste, dass Peg ein Theater mit dem Namen Lily Playhouse gehörte, das sich irgendwo in Midtown Manhattan befand.
Ich wusste, dass sie keine Theaterkarriere angestrebt hatte, sondern eher zufällig zu ihrem Beruf gekommen war.
Ich wusste, dass Peg eigenartigerweise eine Ausbildung zur Rotkreuzschwester absolviert hatte und während des Ersten Weltkriegs in Frankreich stationiert war.
Ich wusste, dass Peg irgendwann bemerkt hatte, dass ihre Begabung eher darin lag, für die verwundeten Soldaten ein Unterhaltungsprogramm zu organisieren, als ihre Wunden zu versorgen. Sie hatte ein Händchen dafür, in Feldlazaretten und Baracken Shows umzusetzen, die billig, schnell, knallbunt und komisch waren. Der Krieg ist ein schreckliches Geschäft, aber er lehrt jeden etwas; dieser spezielle Krieg lehrte meine Tante Peg, wie man eine Show auf die Beine stellte.
Ich wusste, dass Peg nach dem Krieg eine ganze Weile in London geblieben war und dort am Theater gearbeitet hatte. Sie produzierte gerade eine Revue im West End, als sie ihren zukünftigen Ehemann kennenlernte, Billy Buell – ein attraktiver und schneidiger amerikanischer Offizier, der ebenfalls beschlossen hatte, nach dem Krieg in London zu bleiben, um eine Theaterkarriere zu verfolgen. Wie bei Peg war man in seiner Familie wer. Großmutter Morris beschrieb die Buells immer als »abscheulich vermögend«. (Jahrelang habe ich mich gefragt, was genau sie damit meinte. Meine Großmutter huldigte dem Mammon; an welchem Punkt wurde er »abscheulich«? Eines Tages hatte ich sie das schließlich gefragt, und sie antwortete, als wäre damit alles gesagt: »Sie sind aus Newport, Schätzchen.«) Aber Billy Buell, wie viel Newport er auch in sich tragen mochte, ähnelte Peg darin, dass er die kultivierte Klasse mied, in die er hineingeboren worden war. Er zog den Wagemut und den Glanz der Theaterwelt der geschliffenen Verdrängungskunst der feinen Leute vor. Außerdem war er ein Playboy. Er hatte gern »Spaß«, wie Großmutter Morris sagte, ihre höfliche Umschreibung für »Zechen, Prassen und Schürzenjagen«.
Nach ihrer Hochzeit kehrten Billy und Peg Buell nach Amerika zurück. Zusammen gründeten sie eine fahrende Theatertruppe. Den Großteil der zwanziger Jahre verbrachten sie mit einem festen kleinen Ensemble auf Tour und gastierten in Städten überall im Land. Billy verfasste die Revuen und trat darin auf, Peg produzierte sie und führte Regie. Große Ambitionen hegten sie nie. Sie hatten einfach Spaß und gingen den üblichen Verpflichtungen des Erwachsenenlebens aus dem Weg. Aber so sehr sie sich auch bemühten, keinen Erfolg zu haben, holte der Erfolg sie doch irgendwann ein.
1930 – als sich die Wirtschaftskrise verstärkte und die Nation in Angst und Schrecken versetzte – landeten meine Tante und ihr Mann versehentlich einen Hit. Billy schrieb ein Stück mit dem Titel Ihre fröhliche Affäre, das so lustig war, dass die Leute ihnen die Bude einrannten. Ihre fröhliche Affäre war eine musikalisch untermalte Farce über eine adelige britische Erbin, die sich in einen amerikanischen Playboy verliebt (selbstverständlich dargestellt von Billy Buell). Es war leichte Unterhaltung, so wie alles, was sie je auf die Bühne gebracht hatten, aber es wurde ein überwältigender Erfolg. Im ganzen Land kratzten nach Vergnügen hungernde Bergarbeiter und Farmer ihr letztes Kleingeld zusammen, um Ihre fröhliche Affäre zu sehen, und verwandelten das schlichte, geistlose Stück in einen lukrativen Triumph. Das Stück wurde in den Lokalzeitungen derart gefeiert, dass Billy und Peg es 1931 sogar nach New York brachten, wo es ein Jahr lang an einem renommierten Broadway-Theater lief.
1932 machte MGM einen Film daraus – für den Billy das Drehbuch verfasste, in dem er aber nicht mitspielte. (William Powell übernahm die Rolle. Billy war mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass es sich als Autor leichter lebte denn als Schauspieler. Autoren schreiben, wann sie wollen, hängen nicht von der Gnade des Publikums ab und müssen sich nicht von einem Regisseur sagen lassen, was sie zu tun haben.) Der Erfolg von Ihre fröhliche Affäre gebar eine Reihe einträglicher Fortsetzungen (Ihre fröhliche Scheidung, Ihr fröhliches Baby, Ihre fröhliche Safari), die Hollywood ein paar Jahre lang ausspuckte wie eine Füllmaschine Würstchen. Das ganze Fröhlich-Unterfangen bescherte Billy und Peg einen beträchtlichen Batzen Geld, aber es markierte auch das Ende ihrer Ehe. Billy hatte sich in Hollywood verliebt und kehrte nie zurück. Peg wiederum beschloss, die Wandertruppe aufzugeben und sich mit ihrer Hälfte des Fröhlich-Honorars ein großes heruntergekommenes Theater in New York City zu kaufen: das Lily Playhouse.
All das ereignete sich circa 1935.
Billy und Peg ließen sich nie scheiden. Doch auch wenn zwischen ihnen kein böses Blut zu herrschen schien, konnte man sie nach 1935 nicht mehr als »verheiratet« bezeichnen. Sie teilten weder Heim noch Beruf, und auf Pegs Drängen hin hielten sie auch ihre Finanzen getrennt – was bedeutete, dass all das glänzende Newporter Geld für meine Tante nun außer Reichweite war. (Großmutter Morris konnte nicht begreifen, warum Peg sich von Billys Vermögen abwandte; mit unverhohlener Enttäuschung befand sie über ihre Tochter: »Ich fürchte, Geld hat Peg nie etwas bedeutet.«) Meine Großmutter vermutete, dass Peg und Billy sich nie offiziell scheiden ließen, weil sie »zu unkonventionell« waren, um sich mit solchen Angelegenheiten zu befassen. Vielleicht liebten sie einander auch noch. Nur war ihre Liebe dann von der Sorte, die am besten gedeiht, wenn ein ganzer Kontinent zwischen den Eheleuten liegt. (»Lach nicht«, sagte meine Großmutter. »Zahllose Ehen würden so viel besser funktionieren.«)
Ich weiß nur, dass Onkel Billy meine gesamte Jugend über nicht präsent war – zuerst, weil er tourte, und später, weil er sich in Kalifornien niedergelassen hatte. Tatsächlich war er so wenig präsent, dass ich ihm nie begegnete. Billy Buell war ein Mythos für mich, geschaffen aus Geschichten und Fotos. Und wie glamourös diese Geschichten und Fotos waren! Häufig stießen Großmutter Morris und ich in Hollywood-Boulevardblättern auf Bilder von Billy oder lasen in Klatschkolumnen von Walter Winchell und Louella Parsons über ihn. Wir waren zum Beispiel völlig aus dem Häuschen, als wir entdeckten, dass er bei der Hochzeit von Jeanette MacDonald und Gene Raymond zu Gast gewesen war! Ein Bild von ihm bei der Hochzeitsfeier fand sich in der Variety vor unserer Nase, er stand gleich hinter der strahlenden Jeanette MacDonald in ihrem puderrosa Hochzeitskleid. Das Foto zeigte Billy im Gespräch mit Ginger Rogers und ihrem damaligen Ehemann, Lew Ayres. Meine Großmutter wies mich auf Billy hin und sagte: »Da ist er, auf Eroberungstour durchs ganze Land, wie üblich. Sieh nur, wie Ginger ihn angrinst! Wenn ich Lew Ayres wäre, würde ich meine Frau aber gut im Auge behalten.«
Mit Großmutters strassverzierter Lupe betrachtete ich das Foto genauer. Ich sah einen attraktiven blonden Mann im Smoking, dessen Hand auf Ginger Rogers’ Unterarm ruhte, während sie ihn tatsächlich freudig anstrahlte. Er hatte mehr von einem Filmstar als die tatsächlichen Filmstars, die ihn umgaben.
Es schien mir unglaublich, dass dieser Mann mit meiner Tante Peg verheiratet sein sollte.
Peg war zweifellos wunderbar, aber sie war so unattraktiv.
Was in aller Welt hatte er nur in ihr gesehen?
Ich konnte Peg nirgends entdecken.
Mittlerweile war so viel Zeit vergangen, dass ich die Hoffnung, auf dem Bahnsteig in Empfang genommen zu werden, begrub. Ich gab mein Gepäck in die Obhut eines Trägers und wanderte durch die dahinhastenden Menschen, die Grand Central ausmachten, und versuchte, im Gedränge meine Tante zu finden. Man hätte meinen können, dass mich der Gedanke beunruhigte, ganz allein, ohne Plan und Anstandsdame, in New York City zu stranden, aber aus irgendeinem Grund tat er das nicht. Ich war mir sicher, dass alles gutgehen würde. (Vielleicht ist das eins der Merkmale von Privilegiertheit: Gewisse junge Damen aus gutem Hause können sich gar nicht vorstellen, dass nicht bald jemand zu ihrer Rettung herbeieilt.)
Schließlich gab ich meine Wanderschaft auf und setzte mich auf eine gut sichtbare Bank nahe der Haupteingangshalle, um auf Erlösung zu warten.
Und siehe da, irgendwann wurde ich gefunden.
Die Rettung nahte in Gestalt einer kleinen, silberhaarigen Frau in bescheidenem grauem Kostüm, die auf mich zusteuerte wie ein Bernhardiner auf einen verschollenen Skifahrer – mit entschlossener Konzentration und der ernsten Absicht, Leben zu retten.
»Bescheiden« ist eigentlich ein zu schwaches Wort für das Kostüm, das diese Frau trug. Es war ein zweireihiger kleiner Ziegel – die Art von Kleidungsstück, die geschaffen wurde, um der Welt vorzugaukeln, dass Frauen weder Brüste noch Taillen oder Hüften besitzen. Auf mich wirkte es wie britische Importware. Es sah zum Fürchten aus. Die Frau trug außerdem klobige, flache schwarze Schnürschuhe und einen altmodischen grünen Filzhut, wie er bevorzugt von Waisenhausleiterinnen getragen wird. Ich kannte diesen Typ Frau aus dem Internat; sie wirkte wie eine Jungfer, die Ovomaltine zum Abendessen trank und für mehr Lebenskraft mit Salzwasser gurgelte.
Sie war von Kopf bis Fuß unscheinbar, und vor allen Dingen war sie es mit Absicht.
Dieser Backstein von einer Oberin trat mit eindeutiger Mission und gerunzelter Stirn an mich heran, in den Händen ein beunruhigend großes Bild in einem verschnörkelten Silberrahmen. Sie starrte auf das Bild und dann auf mich.
»Sind Sie Vivian Morris?«, fragte sie. Ihr klarer Akzent offenbarte, dass das zweireihige Kostüm nicht der einzige zutiefst britische Import in der Stadt war.
Ich bekannte, dass dem so war.
»Sie sind groß geworden«, sagte sie.
Ich war verwirrt: Kannte ich diese Frau? War ich ihr in jüngeren Jahren schon einmal begegnet?
Angesichts meiner Verwirrung zeigte mir die Fremde das gerahmte Bild in ihren Händen. Verblüffenderweise entpuppte es sich als Porträt meiner Familie, das etwa vier Jahre alt war. Wir hatten es in einem richtigen Fotostudio machen lassen, nachdem meine Mutter zu dem Schluss gekommen war, dass es von uns, wie sie es ausdrückte, »wenigstens ein offizielles Dokument« geben sollte. Da waren meine Eltern, die die Zumutung ertrugen, von einem Kaufmann abgelichtet zu werden. Da war mein nachdenklich wirkender Bruder Walter, dessen Hand auf Mutters Schulter ruhte. Da war eine schlaksigere und jüngere Version meiner selbst, in einem Matrosenkleidchen, das für mein Alter viel zu mädchenhaft war.
»Ich bin Olive Thompson«, verkündete die Frau in einem Ton, der erkennen ließ, dass sie Verkündungen gewohnt war. »Ich bin die Sekretärin Ihrer Tante. Sie konnte nicht kommen. Es gab einen Notfall im Theater. Ein kleiner Brand. Sie hat mich geschickt, um Sie zu finden. Bitte entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Ich bin schon seit mehreren Stunden hier, aber da mir lediglich dieses Foto zur Verfügung stand, um Sie zu identifizieren, hat es gedauert, bis ich Sie lokalisieren konnte. Wie Sie ja gemerkt haben.«
Ich hätte am liebsten gelacht und würde es auch jetzt am liebsten tun. Die Vorstellung, wie diese strenge ältere Frau mit einer riesigen Fotografie in einem Silberrahmen durch die Grand Central Station wanderte – einem Silberrahmen, der aussah, als wäre er hastig von der Wand eines reichen Menschen gerissen worden (was er ja auch war) – und in jedes Gesicht starrte, um eine Übereinstimmung zwischen der Person vor ihr und einem Mädchen festzustellen, das vier Jahre zuvor porträtiert worden war – diese Vorstellung erschien mir rasend komisch. Wie hatte ich die Frau nur verpassen können?
Olive Thompson schien das Ganze allerdings nicht komisch zu finden.
Ich sollte bald feststellen, dass das typisch für sie war.
»Ihr Gepäck«, sagte sie. »Holen Sie es. Dann nehmen wir ein Taxi zum Lily. Die Spätvorstellung hat schon begonnen. Beeilen Sie sich. Keine Sperenzchen bitte.«
Folgsam schloss ich mich ihr an – ein Entenküken hinter seiner Entenmama.
Ich machte keine Sperenzchen.
Ich dachte: »Ein kleiner Brand?« – wagte aber nicht nachzufragen.
3
Man kann nur einmal im Leben zum ersten Mal nach New York City ziehen, Angela, und das ist ein ziemliches Ereignis.
Vielleicht birgt der Gedanke keine Faszination für dich, da du in New York zur Welt gekommen bist. Vielleicht ist unsere vortreffliche Stadt für dich eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht liebst du sie aber auch mehr als ich, auf eine dir eigene, unvorstellbar intime Weise. Zweifellos kannst du dich glücklich schätzen, hier aufgewachsen zu sein. Aber du durftest nie hierher umziehen – und dafür bedaure ich dich. Eine der großen Erfahrungen des Lebens blieb dir versagt.
New York City 1940!
So ein New York wird es nie wieder geben. Damit will ich weder all die New Yorks schmähen, die es vor 1940 gab, noch die, die danach kamen. Sie sind alle von Bedeutung. Aber dies ist eine Stadt, die durch den frischen Blick eines jeden jungen Menschen, der zum ersten Mal hier ankommt, neu ersteht. Diese Stadt, dieser Ort – nur für meine Augen geschaffen – wird nie wieder existieren. In meiner Erinnerung ist sie auf ewig konserviert, wie eine Orchidee in einem Briefbeschwerer. Diese Stadt wird immer mein perfektes New York bleiben.
Du kannst dein perfektes New York haben und andere Leute ihres – aber dieses wird immer meins sein.
Die Fahrt von Grand Central zum Lily Playhouse dauerte nicht lang – einmal auf direktem Weg von Ost nach West –, aber wir querten dabei das Herz von Manhattan, und das ist für einen Neuankömmling schon immer der beste Weg gewesen, um die Macht New Yorks zu spüren. Ich stand vollkommen unter Strom und hätte am liebsten alles auf einmal in mich aufgesogen. Aber dann erinnerte ich mich an meine Manieren und unternahm den Versuch, Konversation mit Olive zu machen. Olive schien allerdings nicht der Meinung zu sein, dass die Luft ständig mit Worten gefüllt werden müsse, und ihre seltsamen Antworten warfen nur weitere Fragen auf – Fragen, von denen ich ahnte, dass sie sie nicht vertiefen wollte.
»Wie lange arbeiten Sie schon für meine Tante?«, fragte ich sie.
»Seit Moses Windeln getragen hat.«
Das gab mir einen Moment zu denken. »Und welche Aufgaben haben Sie im Theater?«
»Dinge, die sich im freien Fall befinden, aufzufangen, kurz bevor alles zu Bruch geht.«
Wir fuhren eine Weile schweigend weiter, und ich ließ auch das erst mal sacken.
Ich versuchte es ein letztes Mal: »Was wird denn heute Abend im Theater gegeben?«
»Ein Musical. Es heißt Unser Leben mit Mutter.«
»Oh! Davon habe ich schon gehört.«
»Nein, haben Sie nicht. Sie meinen Unser Leben mit Vater. Das lief letztes Jahr am Broadway. Unser Stück heißt Unser Leben mit Mutter. Und es ist ein Musical.«
Ich fragte mich: Ist das legal? Darf man sich einfach den Titel eines Riesen-Broadway-Renners schnappen, ein Wort austauschen und das Stück zu seinem eigenen machen? (Die Antwort auf diese Frage – zumindest 1940 am Lily Playhouse – lautete: Klar doch.)
Ich fragte: »Aber was, wenn Leute in dem Glauben, sie würden Unser Leben mit Vater sehen, versehentlich Karten für Ihr Stück kaufen?«
Olive, tonlos: »Ja. Wäre das nicht bedauerlich.«
Allmählich kam ich mir jung, dumm und nervtötend vor, deshalb hörte ich auf zu reden. Während der restlichen Taxifahrt konnte ich endlich aus dem Fenster schauen. Es war sehr unterhaltsam, die Stadt vorbeiziehen zu sehen. Herrlichkeiten, wohin man auch blickte. Ein später schöner Sommerabend in Midtown Manhattan ist durch nichts zu übertreffen. Kurz zuvor hatte es geregnet. Der Himmel war lila und dramatisch. Ich erhaschte einen Blick auf verspiegelte Wolkenkratzer, Neonschilder und glänzende, nasse Straßen. Menschen hasteten, stürzten, schlenderten und stolperten die Gehwege entlang. Als wir am Times Square vorbeikamen, spuckten Kunstlichtgebirge Lava aus weißglühenden Nachrichten und Werbeslogans aus. Spielhöllen, Tanzhallen, Filmpaläste, Cafeterien und Theater flogen vorbei und entzückten meine Augen.
Wir bogen in die Forty-first Street ein, zwischen Eighth und Ninth Avenue. Das war damals keine schöne Straße, und sie ist es auch heute noch nicht. Früher war sie vor allem ein Wirrwarr aus Feuerleitern der wichtigeren Gebäude, die zur Fortieth und Forty-second Street hinausgingen. Aber dort mitten in dem unansehnlichen Block befand sich das Lily Playhouse, das Theater meiner Tante Peg – es war grell erleuchtet, und das große Schild verkündete Unser Leben mit Mutter.
Ich sehe es heute noch vor mir. Das Lily war ein großer, schwerer Kasten, dessen Stil ich mittlerweile als Jugendstil erkenne, aber der mir damals einfach überladen vorkam. Und mein lieber Herr Gesangsverein, was gab sich das Foyer Mühe, zu zeigen, dass man an einer wichtigen Adresse angelangt war. Es war ganz Gravitas und Düsternis – üppige Holzarbeiten, Deckenpaneele mit Schnitzereien, blutrote Keramikfliesen und beachtliche alte Tiffanyleuchten. Die Wände bedeckten nikotinvergilbte Gemälde von barbusigen Nymphen, die mit Satyrbanden herumtollten – und eine der Nymphen wirkte doch glatt so, als drohten ihr andere Umstände, wenn sie nicht aufpasste. Andere Wandbilder zeigten muskulöse Männer mit heroischen Waden, die in einer Weise mit Seeungeheuern rangen, die eher erotisch denn brutal wirkte. (Man bekam den Eindruck, dass die Muskelmänner den Kampf nicht gewinnen wollten, wenn du verstehst, was ich meine.) Wieder andere Wandgemälde zeigten Dryaden, die mit gereckten Brüsten aus Bäumen hervorbrachen, während in einem nahen Fluss Najaden plantschten und sich gegenseitig die nackten Oberkörper nassspritzten – man hörte förmlich das Jippie! Kräftig geschnitzte Weinranken, Glyzinien (und natürlich Lilien!) wanden sich jede Säule hinauf. Es war wie in einem Bordell. Ich war völlig verzückt.
»Ich bringe dich direkt in die Vorstellung«, sagte Olive mit Blick auf ihre Armbanduhr. »Sie ist fast vorbei, Gott sei Dank.«
Sie stieß die große Flügeltür auf, die in den eigentlichen Theatersaal führte. Ich muss leider sagen, dass Olive Thompson ihren Arbeitsplatz mit einer Attitüde betrat, als würde sie dort lieber nichts anfassen, aber ich selbst war überwältigt. Das Innere des Theaters war wirklich ziemlich atemberaubend – ein großer, in goldenes Licht getauchter verblichener alter Schmuckkasten. Ich ließ alles auf mich wirken – die durchhängende Bühne, die schlechten Blickachsen, den schweren purpurroten Vorhang, den beengten Orchestergraben, die vergoldete Decke, den bedrohlich glitzernden Kronleuchter, den man nicht ansehen konnte, ohne sich zu fragen: »Was, wenn das Ding abstürzt …?«
Es war alles grandios, es war alles in Auflösung begriffen. Das Lily erinnerte mich an Großmutter Morris – nicht nur, weil meine Großmutter kitschige alte Theater wie dieses geliebt hatte, sondern auch, weil meine Großmutter selbst einmal so aussah: alt, aufgetakelt und stolz – und bis obenhin in altmodischen Samt gehüllt.
Wir stellten uns an die Rückwand, obwohl es noch viele freie Plätze gab. Tatsächlich schienen kaum mehr Zuschauer als Darsteller da zu sein. Ich war nicht die Einzige, der das auffiel. Olive zählte kurz durch, notierte die Zahl in einem kleinen Notizbuch, das sie aus der Tasche gezogen hatte, und seufzte.
Was das Geschehen auf der Bühne anging, so konnte einem schwindelig werden. Es musste tatsächlich das Ende der Vorstellung sein, denn es passierte jede Menge auf einmal. Im Hintergrund der Bühne befand sich eine Reihe aus etwa einem Dutzend Tänzern – Mädchen und Jungen –, die manisch grinsten, während sie die Beine zum staubigen Theaterhimmel emporwarfen. In der Bühnenmitte vollführten ein gutaussehender junger Mann und eine temperamentvolle junge Frau einen Stepptanz, als ginge es um ihr Leben, und dabei sangen sie aus vollem Hals davon, wie nun alles gut werden würde, Baby, denn wir beide sind verliebt! Auf der linken Bühnenseite befand sich eine Phalanx aus Revuegirls, deren Kostüme und Bewegungen noch gerade so moralisch akzeptabel waren, aber deren Beitrag zur Geschichte – wenn es denn eine gab – unklar blieb. Ihre Aufgabe schien es zu sein, mit ausgestreckten Armen dazustehen und sich langsam zu drehen, so dass man ihre amazonenhaften Figuren bequem aus jedem Winkel auf sich wirken lassen konnte. Auf der anderen Seite der Bühne jonglierte ein als Vagabund gekleideter Mann mit Bowlingkegeln.
Selbst für das große Finale zog es sich schrecklich hin. Das Orchester gab alles, die Tänzerreihe hüpfte unermüdlich, das glückliche und atemlose Paar konnte gar nicht glauben, wie phantastisch das Leben werden würde, die Revuegirls präsentierten bedächtig ihre Figuren, der Jongleur schwitzte und schleuderte – bis auf einmal, mit großem Getöse aller Instrumente, Scheinwerferwirbel und gleichzeitigem In-die-Luft-werfen sämtlicher Arme endlich Schluss war!
Applaus.
Kein donnernder Applaus. Eher ein leichtes Tröpfeln von Applaus.
Olive klatschte nicht. Ich klatschte höflich, wobei mein Klatschen dort hinten im Saal ziemlich einsam klang. Der Applaus währte nicht lang. Die Darsteller mussten die Bühne beinahe in Stille verlassen, was nie gut ist. Die Zuschauer schoben sich brav an uns vorbei, wie Arbeiter, die Feierabend hatten – und das waren sie ja auch.
»Meinst du, es hat ihnen gefallen?«, fragte ich Olive.
»Wem?«
»Den Zuschauern.«
»Den Zuschauern?« Olive blinzelte, als wäre sie nie auf den Gedanken gekommen, sich zu fragen, was die Zuschauer von einer Aufführung hielten. Nach einiger Überlegung sagte sie: »Du musst verstehen, Vivian, dass unsere Zuschauer weder voller Vorfreude im Lily ankommen noch von Hochgefühl überwältigt wieder gehen.«
So wie sie es sagte, klang es so, als wäre sie ganz einverstanden mit dem Arrangement oder hätte es zumindest akzeptiert.
»Komm«, sagte sie. »Deine Tante wird hinter der Bühne sein.«
Also ging es backstage – mitten hinein in den geschäftigen, übermütigen Trubel, der immer am Ende einer Vorstellung in den Seitenbühnen ausbricht. Alle sind in Bewegung, alle schreien, alle rauchen, alle ziehen sich um. Die Tänzer zündeten einander Zigaretten an, und die Revuegirls nahmen ihren Kopfschmuck ab. Ein paar Männer in Overalls schoben Kulissen herum, aber nicht so, dass sie ins Schwitzen kamen. Es wurde laut und übertrieben gelacht, wenngleich nicht, weil irgendetwas besonders witzig gewesen wäre; es waren einfach Menschen aus dem Showbiz, die sind so.
Und da war auch meine Tante Peg, so groß und stämmig, das Klemmbrett in der Hand. Ihr kastanienbraunes, mit Grau durchwirktes Haar war unvorteilhaft kurz geschnitten, was ihr eine gewisse Ähnlichkeit mit Eleanor Roosevelt verlieh, nur mit schönerem Kinn. Peg trug einen langen, lachsfarbenen Rock aus Twill und etwas, das aussah wie ein Herrenoberhemd. Außerdem trug sie blaue Kniestrümpfe und beigefarbene Mokassins. Das klingt nicht nur nach einer unmodischen Kombination, es war auch eine. Sie war damals unmodisch, sie wäre heute unmodisch, und sie wird unmodisch bleiben, bis die Sonne explodiert. In einem lachsfarbenen Twill-Rock, einem blauen Oberhemd, Kniestrümpfen und Mokassins hat noch niemand eine gute Figur gemacht.
Ihr nachlässiger Look trat umso stärker hervor, als sie gerade mit zweien der bildschönen Revuegirls redete. Deren Bühnen-Make-up verlieh ihnen einen Glamour, der nicht von dieser Welt zu sein schien, und ihr Haar türmte sich in glänzenden Locken oben auf dem Kopf. Sie trugen rosa Seidenmäntel über ihren Kostümen und zeigten mir das Frausein in der am unverhohlensten sexuellen Variante, die mir bisher begegnet war. Die eine der beiden war blond – platinblond, genaugenommen – und hatte eine Figur, bei der Jean Harlow in neidischer Verzweiflung um sich geschlagen hätte. Die andere war eine sinnliche Brünette, deren außergewöhnliche Schönheit mir schon vom Ende des Saals aus aufgefallen war. (Wobei man mir das nicht zu hoch anrechnen sollte; ein Marsmensch hätte sie bemerken können … vom Mars aus.)
»Vivvie!«, schrie Peg, und ihr Strahlen erhellte meine Welt. »Du hast es geschafft, Kiddo!«
Kiddo!
Niemand hatte mich je Kiddo genannt, und aus irgendeinem Grund wäre ich am liebsten in ihre Arme gestürzt und hätte geheult. Es war außerdem ermutigend, dass mir jemand sagte, ich hätte es geschafft – als wenn ich eine besondere Leistung vollbracht hätte! In Wahrheit hatte ich nichts Beeindruckenderes geschafft, als von der Schule zu fliegen, zu Hause rausgeworfen zu werden und schließlich an der Grand Central Station verloren zu gehen. Aber ihre Freude bei meinem Anblick war Balsam für meine Seele. Ich fühlte mich so willkommen. Nicht nur willkommen, sondern erwünscht.
»Olive hast du ja schon kennengelernt, unsere hauseigene Zoowärterin«, sagte Peg. »Und das ist Gladys, unsere Vortänzerin –«
Das platinblonde Mädchen grinste, ließ ihr Kaugummi knallen und sagte: »Wie geht’s?«
»– und das ist Celia Ray, eins unserer Revuegirls.«
Celia streckte mir ihren grazilen Arm entgegen und sagte mit tiefer Stimme: »Freut mich. Reizend, dich kennenzulernen.«
Celias Stimme war unglaublich. Das lag nicht nur am starken New Yorker Akzent, sondern auch am dunklen, rauen Timbre. Ein Revuegirl mit der Stimme von Lucky Luciano.
»Hast du schon gegessen?«, fragte Peg mich. »Bist du am Verhungern?«
»Nein«, sagte ich. »Am Verhungern nicht gerade. Aber ich habe noch nicht richtig zu Abend gegessen.«
»Na, dann gehen wir aus. Lass uns ein paar große Drinks kippen und über alles reden.«
Olive schritt ein: »Vivians Gepäck ist noch nicht nach oben gebracht worden, Peg. Ihre Koffer stehen noch im Foyer. Sie hatte einen langen Tag, und sie wird sich frisch machen wollen. Außerdem sollten wir dem Ensemble Rückmeldung geben.«
»Die Jungs können ihre Sachen nach oben bringen«, sagte Peg. »Sie sieht frisch genug aus. Und das Ensemble braucht keine Rückmeldung.«
»Das Ensemble braucht immer Rückmeldung.«
»Das lässt sich morgen regeln«, war Pegs ausweichende Antwort, die Olive nicht zufriedenzustellen schien. »Ich möchte jetzt nicht übers Geschäft reden. Ich habe einen Mordshunger und vor allem einen mächtigen Durst. Können wir nicht einfach ausgehen?«
Mittlerweile klang es so, als würde Peg Olive um Erlaubnis anflehen.
»Heute nicht, Peg«, sagte Olive standhaft. »Der Tag war zu lang. Das Mädchen muss sich ausruhen und erst mal ankommen. Bernadette hat einen Hackbraten dagelassen. Ich kann Sandwichs machen.«
Peg wirkte ein bisschen ernüchtert, aber im nächsten Moment strahlte sie schon wieder.
»Dann ab nach oben!«, sagte sie. »Komm, Vivvie! Los geht’s!«
Das war etwas, was ich mit der Zeit über meine Tante lernte: Wann immer sie sagte: »Los geht’s!«, meinte sie damit alle, die in Hörweite waren; jeder war eingeladen. Peg bewegte sich immer in Gruppen, und sie war nicht wählerisch, wer zur Gruppe gehörte.
Deshalb beinhaltete unsere Zusammenkunft an diesem Abend – die oben, im Wohntrakt des Lily Playhouse stattfand – nicht nur mich, Tante Peg und Olive, die Sekretärin, sondern auch Gladys und Celia, die Revuegirls. In letzter Minute wurde noch ein femininer junger Mann rekrutiert, den Peg sich krallte, als er gerade den Bühneneingang ansteuerte. Ich erkannte in ihm einen der Tänzer wieder. Aus der Nähe stellte ich fest, dass er aussah wie vierzehn und auch eine Mahlzeit nötig zu haben schien.
»Roland, komm mit nach oben und iss mit uns«, sagte Peg.
Er zögerte. »Ach, schon gut, Peg.«
»Keine Sorge, Schätzchen, wir haben reichlich zu essen. Bernadette hat einen Riesenberg Hackbraten gemacht. Es gibt für alle genug.«
Als Olive Anstalten machte zu protestieren, brachte Peg sie zum Schweigen: »Oh, Olive, nun gib nicht die Gouvernante. Ich kann mein Essen mit Roland teilen. Er muss etwas zulegen, und ich muss etwas abnehmen, es geht also auf. Außerdem sind wir gerade halbwegs solvent. Wir können es uns leisten, noch ein paar mehr Mäuler zu stopfen.«
Wir gingen in den hinteren Bereich des Theaters, wo eine breite Treppe in die oberen Etagen des Lily führte. Als wir sie hinaufstiegen, konnte ich nicht aufhören, die beiden Revuegirls, Celia und Gladys, anzustarren. Solche Schönheiten hatte ich noch nie gesehen. Theatermädchen waren mir schon im Internat begegnet, aber das hier war etwas anderes. Die Theatermädchen der Emma Willard neigten dazu, sich nicht die Haare zu waschen und blickdichte schwarze Trikotanzüge zu tragen; sie hielten sich allesamt und jederzeit für Medea. Ich konnte sie nicht ertragen. Aber Gladys und Celia – die waren eine andere Kategorie. Sie waren eine andere Spezies. Ich war fasziniert von ihrem Glamour, ihren Akzenten, ihrem Make-up, dem Schwung ihrer seidenumhüllten Hinterteile. Roland bewegte sich übrigens ganz genauso. Er war auch so ein fließendes, schwingendes Wesen. Wie schnell sie alle redeten! Und wie verlockend sie mit Klatsch-und-Tratsch-Schnipseln um sich warfen, als wäre es leuchtend buntes Konfetti.
»Sie kommt doch nur mit ihrem Aussehen durch!«, sagte Gladys über irgendein Mädchen.
»Nicht mal mit ihrem Aussehen!«, ergänzte Roland. »Nur mit ihren Beinen!«
»Tja, das reicht aber nicht!«, sagte Gladys.
»Noch eine Spielzeit«, sagte Celia. »Vielleicht.«
»Ihr Auserwählter ist auch keine Hilfe.«
»Dieser Einfaltspinsel!«
»Den Champagner schlürft er aber gern.«
»Sie sollte es ihm einfach sagen!«
»Er bettelt aber auch nicht gerade darum!«
»Wie lange kann sich ein Mädchen schon als Platzanweiserin im Filmtheater durchschlagen?«
»Aber sie läuft mit diesem hübschen Diamanten rum.«
»Sie sollte es wirklich vernünftiger angehen.«
»Sie sollte sich einen Sugar-Daddy zulegen.«
Wer waren diese Leute, von denen da die Rede war? Was war das für ein Leben, das sich da andeutete? Und wer war das arme Mädchen, das Thema auf der Treppe war? Wie sollte sie ihr Platzanweiserinnen-Dasein je hinter sich lassen, wenn sie es nicht vernünftiger anging? Wer hatte ihr den Diamanten geschenkt? Und wer zahlte für den Champagner, der geschlürft wurde? Diese Dinge waren mir wichtig! Diese Dinge spielten eine Rolle! Und was in aller Welt war ein Sugar-Daddy?
Nie wollte ich dringender wissen, wie eine Geschichte ausging, und dabei hatte diese Geschichte noch nicht mal eine Handlung – es gab nur namenlose Figuren, die Andeutung wilden Treibens und das Gefühl einer drohenden Krise. Mein Herz raste vor Aufregung – so hättest du dich auch gefühlt, wenn du ein frivoles neunzehnjähriges Mädchen gewesen wärst, das in seinem Leben noch keinen ernsten Gedanken gehegt hatte.
Wir erreichten einen spärlich erleuchteten Treppenabsatz, Peg sperrte eine Tür auf und ließ uns alle herein.
»Willkommen zu Hause, Kiddo«, sagte Peg.
Das »Zuhause« meiner Tante Peg umfasste die zweite und dritte Etage des Lily Playhouse. Das war der Wohnbereich. Die erste Etage des Gebäudes beherbergte – wie ich später herausfinden sollte – die Büroräume. Im Erdgeschoss befand sich natürlich das eigentliche Theater, das ich dir ja schon beschrieben habe. Aber die zweite und dritte Etage waren das Zuhause, und da waren wir jetzt angekommen.
Peg hatte kein Händchen für Inneneinrichtung, das erkannte ich sofort. Ihr Geschmack (wenn man es so nennen wollte) tendierte zu schweren, aus der Mode gekommenen Antiquitäten, einem Sammelsurium an Stühlen und einer allgemeinen Unsicherheit darüber, was wo hingehörte. An Pegs Wänden sah ich die gleichen düsteren, trostlosen Bilder wie bei meinen Eltern (zweifellos von denselben Verwandten geerbt). Verblichene Druckgraphiken von Pferden und Porträts mürrischer alter Quäker. Auch eine erhebliche Menge vertraut wirkendes Silberzeug und Porzellan war in der Wohnung verteilt – Kerzenständer, Teegeschirr und dergleichen mehr –, und manches davon sah wertvoll aus, aber wer weiß? Nichts davon schien benutzt oder geliebt zu werden. (Die Aschenbecher, die überall herumstanden, wurden dagegen eindeutig benutzt und geliebt.)
Ich will damit nicht sagen, dass die Wohnung heruntergekommen war. Sie war nicht schmutzig, sie war nur nicht hergerichtet. Mein Blick fiel auf das offizielle Speisezimmer – oder vielmehr das, was bei jedem anderen das Speisezimmer gewesen wäre, wenn in der Mitte des Raums keine Tischtennisplatte gestanden hätte. Welche seltsamerweise auch noch direkt unter einem tiefhängenden Kronleuchter platziert worden war, was es erschwert haben dürfte, eine Runde zu spielen.
Wir gelangten in ein großzügig bemessenes Wohnzimmer – es bot reichlich Platz, um es mit Möbeln vollzustopfen und auch noch einen Flügel hineinzuquetschen, der einfach an die Wand geschoben worden war.
»Wer braucht etwas aus der Abteilung Flaschen und Karaffen?«, fragte Peg und steuerte die Hausbar in der Ecke an. »Martinis? Irgendwer? Alle?«
Die Antwort, die zurückschallte, klang wie: Ja! Alle!
Na ja, fast alle. Olive lehnte ab und runzelte die Stirn, während Peg die Martinis einschenkte. Es sah so aus, als würde Olive den Preis eines jeden Cocktails bis auf einen halben Penny berechnen – was sie wahrscheinlich auch tat.
Meine Tante reichte mir so beiläufig einen Martini, als tränken sie und ich schon seit Ewigkeiten miteinander. Wie erfreulich. Ich kam mir ziemlich erwachsen vor. Meine Eltern tranken (natürlich tranken sie, sie waren WASPs), aber sie tranken nie mit mir. Ich hatte mich meinem Trinken immer heimlich widmen müssen. Das schien vorbei zu sein.
Cheers!
»Ich werde Ihnen Ihre Zimmer zeigen«, sagte Olive.
Pegs Sekretärin führte mich in einen Korridor und öffnete eine der Türen. Sie sagte: »Das ist das Apartment Ihres Onkels. Peg möchte, dass Sie einstweilen hier wohnen.«
Ich war überrascht. »Onkel Billy hat hier ein Apartment?«
Olive seufzte. »Es ist Ausdruck der anhaltenden Zuneigung Ihrer Tante für ihren Ehemann, dass sie diese Zimmer für ihn bereithält, sollte er auf der Durchreise eine Unterkunft benötigen.«
Es war sicher keine Einbildung, dass Olive die Worte »anhaltende Zuneigung« aussprach wie jemand anderes »hartnäckiger Ausschlag« sagen würde.
Nun, vielen Dank, Tante Peg, denn Billys Apartment war wunderbar. Kein Durcheinander wie in den anderen Räumen – nicht die Spur davon. Nein, diese Wohnung hatte Stil. Es gab ein kleines Wohnzimmer mit Kamin und einem schönen, schwarz lackierten Schreibtisch, auf dem eine Schreibmaschine stand. Dann gab es ein Schlafzimmer mit Fenstern, die auf die Forty-first Street hinausgingen, und einem schönen Doppelbett aus Chrom und dunklem Holz. Auf dem Boden lag ein jungfräulich weißer Teppich. Ich hatte noch nie auf einem weißen Teppich gestanden. Vom Schlafzimmer ging ein geräumiges Ankleidezimmer ab, mit einem großen Chromspiegel an einer Wand und einem glänzenden Kleiderschrank, in dem sich nicht ein einziges Kleidungsstück befand. In der Ecke des Ankleidezimmers gab es ein kleines Waschbecken. Alles war makellos.
»Sie haben leider kein eigenes Bad«, sagte Olive, während die Männer in Overalls meine Koffer und die Nähmaschine im Ankleidezimmer abluden. »Über den Flur gibt es ein Gemeinschaftsbad. Sie werden es sich mit Celia teilen, da sie vorläufig im Lily wohnt. Mr Herbert und Benjamin bewohnen den anderen Flügel. Sie haben ihr eigenes Bad.«
Ich wusste nicht, wer Mr Herbert und Benjamin waren, aber ich vermutete, dass ich es bald herausfinden würde.
»Billy wird das Apartment nicht benötigen, Olive?«
»Das bezweifle ich stark.«
»Sind Sie sich da sicher? Sollte er diese Räume je brauchen, kann ich natürlich woanders unterkommen. Ich will nur sagen, ich brauche so etwas Schönes wie das hier eigentlich gar nicht …«
Das war gelogen. Ich brauchte und wollte dieses kleine Apartment von ganzem Herzen und hatte es in meiner Phantasie schon in Besitz genommen. Hier würde ich es zu etwas bringen, beschloss ich.
»Ihr Onkel war seit über vier Jahren nicht in New York City, Vivian«, sagte Olive und sah mich auf ihre typische Art an – diese beunruhigende Weise, bei der man das Gefühl hatte, sie sähe deine Gedanken wie eine Wochenschau vorbeiziehen. »Ich glaube, dass Sie sich hier mit einiger Gewissheit einquartieren können.«
Ach, welch ein Glück!
Ich packte ein paar wesentliche Dinge aus, spritzte mir etwas Wasser ins Gesicht, puderte meine Nase und kämmte mir das Haar. Dann kehrte ich in das Gerümpel und Geplapper des großen, übervollen Wohnzimmers zurück. Wieder in Pegs Welt, mit all ihrem Krimskrams und Krach.
Olive ging in die Küche und brachte einen kleinen Hackbraten auf einem trostlosen Salatbett mit. Wie sie schon befürchtet hatte, war das keine ausreichende Mahlzeit für die Anwesenden. Doch nur kurze Zeit später kehrte sie mit kaltem Aufschnitt und Brot zurück. Außerdem trieb sie ein halbes Hähnchen, einen Teller Cornichons und einige Kartons mit kaltem chinesischem Essen auf. Ich bemerkte, dass jemand ein Fenster geöffnet und einen kleinen Ventilator angestellt hatte, was die stickige Sommerhitze allerdings nicht vertrieb.
»Esst, Kinder«, sagte Peg. »Nehmt, so viel ihr wollt.«