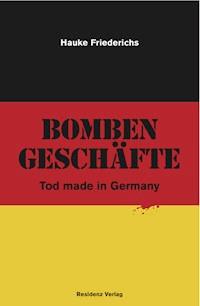16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Hauke Friederichs erzählt die dramatischen Ereignisse des Sommers 1940, als die Schrecken des Krieges den Westen erreichen: Anne Frank, vor den Nationalsozialisten geflohen, wird in den Niederlanden von ihren Verfolgern eingeholt, NS-Gegner Lion Feuchtwanger kommt in ein südfranzösisches Lager, Anna Seghers fürchtet in Paris die vorrückende Wehrmacht – und abertausende Soldaten ziehen sich nach Dünkirchen zurück, wo sie von den deutschen Truppen eingeschlossen werden. Erst im allerletzten Moment werden Briten und Franzosen von der Marine evakuiert. Durch Winston Churchills Erfolg schöpft Großbritannien neuen Mut und setzt den Kampf gegen die Nationalsozialisten fort – entschiedener denn je. Das „Wunder von Dünkirchen“ verändert den Krieg. „Es gelingt Friederichs, Weltgeschichte über das Schicksal einzelner Menschen greifbar und erfahrbar zu machen.“ dpa über „Funkenflug“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Bestsellerautor Hauke Friederichs erzählt die dramatischen Ereignisse des Sommers 1940, als die Schrecken des Krieges den Westen erreichen: Anne Frank, vor den Nationalsozialisten geflohen, wird in den Niederlanden von ihren Verfolgern eingeholt, NS-Gegner Lion Feuchtwanger kommt in ein südfranzösisches Lager, Anna Seghers fürchtet in Paris die vorrückende Wehrmacht – und abertausende Soldaten ziehen sich nach Dünkirchen zurück, wo sie von den deutschen Truppen eingeschlossen werden. Erst im allerletzten Moment werden Briten und Franzosen von der Marine evakuiert. Durch Winston Churchills Erfolg schöpft Großbritannien neuen Mut und setzt den Kampf gegen die Nationalsozialisten fort – entschiedener denn je. Das »Wunder von Dünkirchen« verändert den Krieg.
»Es gelingt Friederichs, Weltgeschichte über das Schicksal einzelner Menschen greifbar und erfahrbar zu machen.« dpa über »Funkenflug«
Über Hauke Friederichs
Hauke Friederichs, geboren 1980 in Hamburg, hat in Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Hamburg promoviert und arbeitet als Journalist und Autor. Er schreibt u. a. für die ZEIT und SPIEGEL Geschichte. Von ihm erschienen zuletzt »Die Totengräber: Der letzte Winter der Weimarer Republik« sowie bei Aufbau der SPIEGEL-Bestseller »Funkenflug. August 1939: Der Sommer, bevor der Krieg begann« (2019).
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Hauke Friederichs
Das Wunder von Dünkirchen
Wie sich im Sommer 1940 das Schicksal der Welt entschied
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog – 80 Jahre später
Vorgeschichte
Fall Gelb 9. Mai–10. Mai
Rollende Panzer 11. Mai–14. Mai
Auf zum Ärmelkanal 15. Mai–19. Mai
Kollaps im Westen 20. Mai–23. Mai
Befehl mit Folgen 24. Mai–25. Mai
Operation Dynamo 26. Mai–29. Mai
Rettung über See 30. Mai–2. Juni
Anfang vom Ende 3. Juni–5. Juni
Epilog
Bildteil
Danksagung
Abkürzungen
Glossar
Literatur
Bildnachweis
Impressum
Prolog – 80 Jahre später
Der Wind bläst Sand über den Strand, wirft kunstvolle Wirbel aus hellen Körnern in die Luft, schäumt Wellen auf, rüttelt an Werbebannern von Hotels und Cafés, pfeift durch Ritzen in Zäunen und Wänden hindurch. Der Quai von Bray-Dunes, einer französischen Küstenstadt nahe Belgien, wirkt im März 2020 wie leergefegt. Nur wenige Spaziergänger, die meisten mit Hunden, und alle dick verpackt, trotzen den Böen und dem diesigen Wetter. Wer von der Strandpromenade auf das Meer schaut, kann in der Ferne das Wrack der »Dévonia« ausmachen. Ein Schaufelrad-Dampfer, der vor etwas mehr als achtzig Jahren britische, französische und belgische Soldaten vom Strand vor Bray-Dunes retten wollte. Eingeschlossen von der Wehrmacht, bedroht von vorrückenden Panzern und permanenten Luftangriffen, saßen die Männer 1940 in den Dünen und hofften, auf ein Schiff zu kommen. Auf ein Schiff, das sie retten und über den Ärmelkanal nach England bringen würde.
Der »Dévonia« gelang das nicht: Ein deutscher Sturzkampfbomber beschädigte den Dampfer so, dass er vom Kapitän an Land gesetzt wurde. Andere Schiffe waren erfolgreicher: Zerstörer, Fähren, schwimmende Lazarette, Feuerwehrboote, Frachter, Minensucher, Truppentransporter holten hunderttausende Soldaten aus dem Hafen von Dünkirchen sowie von den weiter östlich gelegenen Stränden in Malo-Les-Baines und Bray-Dunes an der Kanalküste. »Operation Dynamo« hat die britische Kriegsmarine die wohl größte Rettungsmission aller Zeiten getauft.
Ein Denkmal an der Promenade in Bray-Dunes erinnert an den Frühling 1940, an die Kämpfe in der Region und an die Evakuierung von den Stränden. Und auch in der Touristeninformation der Kleinstadt nimmt die »Operation Dynamo« viel Raum ein. In einem Regal liegen und stehen dort einige Devotionalien aus dem Zweiten Weltkrieg: ein abgestoßenes Fernglas, ein alter Kompass und eine Feldflasche. Als Souvenirs bieten die Mitarbeiter T-Shirts mit dem Aufdruck »Dunkerque. Mai. Juin. 1940« an sowie Kaffeebecher, Parfumflakons und Kugelschreiber mit dem Schriftzug »Operation Dynamo«, Postkarten mit historischen Motiven, kleine Soldatenfiguren und Schirmmützen.
Draußen, an der Fassade des Backsteingebäudes hängen zwei große Transparente, die Fotos eines französischen und eines britischen Soldaten zeigen. Junge Männer, die entschlossen und optimistisch wirken. Ihre freundlichen, offenen und vor allem jungen Gesichter stehen für den Kampf, das Leid und den Tod der anonymen Masse der Soldaten. Tausende kamen bei den Kämpfen um Dünkirchen ums Leben, Bewohner des Départements Nord, Flüchtlinge aus Belgien, Seemänner aus England, Infanteristen aus Algerien, Panzerfahrer aus Frankreich, Piloten aus Deutschland – und viele andere.
Ihre dramatische Geschichte reizte auch Hollywood. In Malo-les-Bains, einst ein eigenständiger Badeort, gut zehn Kilometer von Bray-Dunes entfernt, der heute zu Dünkirchen gehört, zeigen Plakate direkt an der Strandpromenade mehrere Szenen aus dem Kriegsfilm »Dunkirk« von Christopher Nolan. Dreharbeiten zu dem Streifen fanden 2016 in der Umgebung statt. Modellflugzeuge stiegen über den Stränden auf, Sandsackbarrieren stapelten sich in historischen Straßenzügen, Statisten in Uniformen aus dem Weltkrieg liefen umher. Solcher Trubel herrscht hier sonst nur beim Karneval – und bei den Jahrestagen zur »Operation Dynamo«, wenn die letzten lebenden Veteranen zurückkehren und die in die Jahre gekommenen Schiffe erneut über den Kanal fahren.
Auch Dünkirchen wirbt mit den Ereignissen vom Mai und Juni 1940 um Besucher. Ein Rundgang führt zu den historischen Orten, die beim Kampf um die Stadt eine Rolle spielten. Und davon gibt es viele: Die Spuren des Kriegs sind immer noch allgegenwärtig.
Dünkirchen hat für die Tapferkeit seiner Verteidiger teuer bezahlt. An einigen Plätzen der Stadt zeigen Tafeln mit aufgedruckten Fotografien, wie Dünkirchen früher aussah, vor der deutschen Westoffensive. Viele Gebäude, die damals in der Hafenstadt standen, wurden von Bomben und Granaten regelrecht pulverisiert. Ganze Straßenzüge sprengten die Deutschen aus dem Stadtbild. Aber auf dem Platz Jean Bart, der nach dem bekannten Korsaren benannt ist, blieb eine imposante Statue des Freibeuters stehen – überdauerte Luftangriffe und Beschuss der Artillerie. Trotzig streckte er noch seinen Säbel in die Luft, als die Besatzer kamen. Und schaute dabei auf Mauerreste, die aus Trümmern ragten, auf einen Schornstein, der aus Ruinen wuchs und Lücken in den Häuserreihen, die es Anfang Mai 1940 noch nicht gegeben hatte.
An den Kais lagen damals Wracks, auch die Fahrrinne blockierten gesunkene Schiffe. Und die Stadt war tagelang in dicken, schwarzen Rauch gehüllt, der aus den brennenden Ölraffinerien und den in Flammen stehenden Lagerhäusern aufstieg. Ein apokalyptisches Bild bot sich den britischen Soldaten, die in Dünkirchen eintrafen und nur eines wollten: so schnell es ging, weg kommen, heimwärts, über den Ärmelkanal.
Überall sind Hinweise auf die Rettungsaktion zu entdecken: ein alter Raddampfer liegt im Hafen, die »Princess Elizabeth«. Während der »Operation Dynamo« hat sie auf vier Fahrten 1673 Soldaten in Sicherheit gebracht. Die Mauern der Hallenkirche Saint-Éloi in der Innenstadt zieren immer noch Einschusslöcher. Und am Rand des Hafens erinnern ein Denkmal und das Kunstwerk »Le Sablier« von Séverine Hubard in der Form eines Stundenglases, durch das die Zeit rinnt, sowie ein Kriegsmuseum an die wenigen Tage im Mai und Juni 1940, als die Augen der Welt auf Dünkirchen gerichtet waren, als an der Kanalküste Geschichte geschrieben wurde.
Das »Musée Dunkerque 1940« zeigt Uniformen, Waffen, Fahrzeuge der Militärs in jenen Tagen und es berichtet von den Schicksalen der Flüchtlinge, der Einwohner Dünkirchens und so manches Soldaten. Die Ausstellung ist in der 1874 errichteten Bastion 32 untergebracht. Von dieser Festung aus organisierten die Alliierten den Kampf um die Stadt und den Abzug der Truppen.
Ein Kriegsmuseum gibt es auch in Leffrinckoucke, fünf Kilometer von Dünkirchen entfernt, eingerichtet wurde es in einem alten Dünenfort. In der Nähe der Festung, neben einem Schulzentrum, liegt ein Militärfriedhof, mit schlichten hellen Steinkreuzen, die auf Gräbern gefallener Soldaten der Alliierten stehen. Jedes Kreuz verweist auf ein Schicksal.
Und eine Holzhütte bei Esquelbecq zeigt das Grauen des Krieges in besonderer Weise: Dort ermordeten SS-Männer am 28.Mai 1940 britische Gefangene. Hier stehen auf matschigem Grund weiße Steinstelen mit den Namen der Toten, unter ihnen Gilbert Aldridge, ein einfacher Soldat des Gloucestershire Regiments und Bert Evans vom Royal Warwickshire Regiment. Junge Männer, die Opfer eines Kriegsverbrechens wurden. Sie und ihre in der Hütte eingesperrten Kameraden hatten keine Chance. Die Deutschen warfen fünf Handgranaten in den Raum und beschossen sie mit Maschinengewehren. 80 Kriegsgefangene starben. An sie erinnern 80 Bäume aus der Heimat der Ermordeten. Die Männer hatten die Straße nach Dünkirchen tagelang zäh und entschlossen gehalten, um den Hafen und ihre in Dünkirchen eingeschlossenen Kameraden zu verteidigen. Sie sorgten so dafür, dass die Schiffe und Boote der »Operation Dynamo« genügend Zeit erhielten, die Hafenstadt und die Strände anzulaufen.
In der Region um Dünkirchen sind die Ereignisse aus dem Frühjahr 1940 immer noch sehr präsent. In Deutschland hingegen geriet das Ringen um die Hafenstadt weitgehend in Vergessenheit.
In England steht Dünkirchen für einen ersten großen Erfolg, gar für den Anfang vom Ende des »Dritten Reiches«. 330000 Soldaten aus Großbritannien, Frankreich und Belgien holte die Royal Navy aus Dünkirchen und den Stränden in der Region ab, während die Deutschen angriffen und die Alliierten die Küste verteidigten. Der Kampf um die Stadt war nicht die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs, aber sicherlich eine der dramatischsten. Noch immer gibt dessen Ausgang Rätsel auf. Weshalb ließen die Deutschen so viele Gegner entkommen, warum griffen sie nicht entschiedener an und eroberten die Hafenstadt, als noch abertausende Feinde dort auf ihre Rettung hofften? Dünkirchen bleibt ein Mysterium.
Nach dem Kampf um die Stadt dauerte es noch fünf Jahre, bis Adolf Hitler am 30.April 1945 in Berlin Selbstmord beging und Deutschland am 8. Mai kapitulierte. Aber der Verlauf des Krieges wäre sicherlich ein anderer gewesen, wenn der »Führer und Oberbefehlshaber« nicht im Mai 1940 eine rätselhafte Entscheidung getroffen hätte, über deren Gründe Historiker heute noch uneins sind, eine Entscheidung, ohne die es die Invasion der Allierten in der Normandie vier Jahre später wohl nicht gegeben hätte: Hitlers »Haltebefehl«, der mehrere Tage Angriffe der Panzer verhinderte, verschaffte den Briten die nötige Zeit, Hunderttausende zu retten.
So unerklärlich erschien den Menschen in England und in vielen anderen Ländern das Geschehen in der nordfranzösischen Hafenstadt, Malo-les-Bains, Bray-Dunes und Zuydcoote, dass sie ein Wunder bemühen mussten, um den Ablauf der »Operation Dynamo« und die Kämpfe während des Westfeldzuges um die Stadt zu erklären. »Das Wunder von Dünkirchen«, es stellte die Weichen für den Sieg der Allierten, entschied das Schicksal der Welt.
Vorgeschichte
Anfang Mai 1940 herrschte an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich noch Ruhe. Seit dem 3.September 1939 befanden sich beide Länder im Krieg, aber die Waffen schwiegen seitdem weitgehend.
Die Regierungen in Paris und London hatten Adolf Hitler am 1. September ein Ultimatum gestellt: Wenn dieser nicht binnen zwei Tagen seine Soldaten aus Polen abzöge, griffen sie in den Konflikt ein. An diesem Tag war die Wehrmacht in das Nachbarland eingefallen. In Schweden notierte eine Sekretärin: »Oh! Heute hat der Krieg begonnen. Niemand wollte es glauben.« Am Vortag hatte sie noch mit einer Freundin im Stockholmer Vasapark gesessen, die Kinder liefen um sie herum, die Mütter schimpften auf Hitler und waren sich einig, dass die Waffen schweigen würden. Und nun das. Astrid Lindgren heißt die Schwedin, die oft fassungslos über die Eskalation der Gewalt die Seiten ihres Tagebuchs füllte. Am 3. September schrieb sie: »Die Sonne scheint, es ist warm und schön, die Erde könnte so ein herrlicher Ort zum Leben sein. Heute um 11 Uhr hat England Deutschland den Krieg erklärt, Frankreich desgleichen.«
Denn die Deutschen hatten die Frist verstreichen lassen. Ein Abzug aus Polen kam für Hitler überhaupt nicht infrage. Sein Sieg im Osten stand für den deutschen Oberbefehlshaber schon fest, als ihn die Kriegserklärungen aus Paris und London erreichten.
Im Westen passierte dennoch erst mal nichts. Die Franzosen zogen in den Kampf, ohne zu kämpfen. Sie blieben in ihren Festungen. Und auch die Verbündeten aus Großbritannien, die ihr Expeditionskorps über den Ärmelkanal geschickt hatten, verharrten in ihren Stellungen in Frankreich.
Während deutsche Panzer durch Polen rollten, die Luftwaffe dort ganze Dörfer einebnete und die Soldaten der Wehrmacht unerbittlich vorrückten, warteten die Alliierten ab. Zwar hatten sie der Regierung in Warschau Hilfe zugesagt, aber im Osten ging alles viel zu schnell. Der Entlastungsangriff auf den Westen Deutschlands, den die französische Regierung ihren polnischen Verbündeten vor dem deutschen Einmarsch versprochen hatte, fiel aus. Dabei hatte die Wehrmacht kaum kampffähige Truppen im Westen gelassen, keine Panzer und wenige Abfangjäger. Am Boden standen Flugzeugattrappen aus Holz, mit denen die Alliierten getäuscht werden sollten.
Die Franzosen zögerten, den Polen zu Hilfe zu kommen, weil sie sich selbst von Deutschland bedroht fühlten – und das seit Langem. Konflikte zwischen beiden Nationen waren in den vergangenen Jahrhunderten keine Seltenheit gewesen. Das deutsche Kaiserreich entstand 1871 nach dem Sieg gegen Frankreich – Wilhelm I. ließ sich im Spiegelsaal von Versailles zum Herrscher proklamieren – ein nationales Trauma für die Franzosen. Sein Enkel Wilhelm II. befahl 1914 seinen Armeen den Angriff auf Frankreich. Und Adolf Hitlers aggressive Außenpolitik bestärkte die Grande Nation in ihrer Sorge vor einer weiteren Attacke der Nachbarn.
Hitler hatte zwar immer wieder vom Frieden gesprochen, sein Land aber ließ er 1933 aus dem Völkerbund austreten, er rüstete auf und führte 1935 die Wehrpflicht ein. Im März 1936 marschierten die Deutschen dann in das entmilitarisierte Rheinland ein, ein weiterer klarer Bruch des Versailler Vertrages. Aber ahnden wollte das damals niemand. Auch nicht, als die Wehrmacht 1938 in Österreich und in das »Sudetenland« einrückte sowie im März des folgenden Jahres die Tschechoslowakei zerschlug. Erst der Angriff auf Polen führte zur Kriegserklärung der Westmächte.
Noch bevor der Krieg gegen Polen beendet war, drängte Hitler seine Generäle zum nächsten Großangriff. Er wollte die gute Stimmung in der Truppe ausnutzen, einfache Soldaten und hochrangige Offiziere befanden sich in einem Siegestaumel. Dem »Blitzsieg« über Polen, wie die Propaganda den Feldzug in den Osten nannte, sollte ein weiterer Triumph folgen. Außerdem war Hitler überzeugt, mit der Wehrmacht, vor allem mit der Panzertruppe und der Luftwaffe, über die modernste Armee in Europa zu verfügen.
Bei der schweren Artillerie war Frankreich den Deutschen überlegen, aber bei der Kriegsführung, die der Oberbefehlshaber sich vorstellte, spielte das keine große Rolle. Der Feind im Westen sollte im Bewegungskrieg vernichtet – also komplett besiegt werden. Allerdings hielten unabhängige Experten Frankreich für eine der führenden Militärnationen Europas, die Deutschland mindestens ebenbürtig sein müsste.
Das französische Heer mit seinen 101 Divisionen unterschied sich kaum von dem des Jahres 1914. Die Soldaten trugen 1940 die gleichen Stiefel wie ihre Vorgänger, feuerten mit denselben Geschützen und marschierten zu den gleichen Klängen der Militärmusiker. Noch immer zogen häufig Pferde die Kanonen und Wagen – vor allem aber rückte die Grande Armée zu Fuß vor. Komplett motorisierte Verbände gab es nur wenige. Auch in der Wehrmacht blieben Pferde unverzichtbar für die 120 Infanteriedivisionen. Aber die zehn Panzerdivisionen und die motorisierten Infanteristen ermöglichten schnelle Vorstöße auch durch schwieriges Gelände, und aus der Luft wurden sie von Fliegerstaffeln gedeckt.
Im Bürgerkrieg in Spanien und beim Angriff auf Polen hatten die Bodentruppen der Wehrmacht viel gelernt. Galt das auch für die französischen und britischen Generäle, die mit Faszination und Schrecken den deutschen Vormarsch verfolgten?
Hitler wollte das herausfinden. Am 27.September 1939, Warschau hatte gerade vor den deutschen Truppen kapituliert, überraschte Hitler die Befehlshaber der Wehrmacht mit der Forderung, »an der Westfront noch in diesem Jahre, und zwar so bald wie möglich, zum Angriff zu schreiten«. Das Oberkommando des Heeres plante, den Westmächten die Initiative zu überlassen. Wenn die Franzosen und Briten das deutsche Ruhrgebiet angreifen wollten, müssten sie wegen der starken deutschen Verteidigungsstellungen durch Belgien kommen. Dann wäre die Regierung in Brüssel nicht mehr neutral und die Wehrmacht könnte dort einmarschieren.
Aber davon wollte Hitler nichts wissen. Er verlangte, dass seine Truppen durch Belgien, Luxemburg und die Niederlande vorrücken sollten, um Frankreich zu attackieren. Auf Neutralitätserklärungen könne nichts gegeben werden, hatte er schon im Mai 1939 erklärt. Er erteilte am 9. Oktober die »Weisung Nr.6 für die Kriegsführung«. Darin befahl Hitler dem Generalstab, mit der Vorbereitung zur Offensive im Westen zu beginnen – zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Für einen Krieg gegen Frankreich und damit auch gegen England konnten sich die hochrangigen Militärs nicht begeistern, trotz des schnellen Sieges über Polen nach knapp drei Wochen. Von einem »Wahnsinnsangriff« sprachen einige Generäle hinter Hitlers Rücken. Gerade weltkriegserfahrene Offiziere fürchteten einen neuen Stellungskrieg – und bei der Missachtung der Neutralität angegriffener Staaten abermals die internationale Ächtung.
Bereits Anfang 1938 hatte Ludwig Beck versucht, Hitler von einem Konflikt mit den Westmächten abzuhalten. Der Generalstabschef des Heeres hatte eine Denkschrift verfasst, in der er für diesen Fall eine Niederlage Deutschlands prophezeite. Im Spätsommer 1938 ging Beck in den Ruhestand – und das nicht freiwillig. Zuvor ergänzte er seine Denkschrift mit einer handschriftlichen Notiz: »Um unsere Stellung den Historikern gegenüber in der Zukunft klarzustellen und den Ruf des Oberkommandos sauber zu halten, wünsche ich als Chef des Generalstabes zu Protokoll zu geben, daß ich mich geweigert habe, irgendwelche nationalsozialistischen Abenteuer zu billigen. Ein endgültiger Sieg ist eine Unmöglichkeit.«
Mit seiner Haltung stand Beck nicht alleine da. Im deutschen Generalstab gab es eine »Friedenspartei«, die auch nach der Kriegserklärung Frankreichs und Englands dazu riet, im Westen die Alliierten nicht zu provozieren. Der Erste Weltkrieg war in den Köpfen noch gegenwärtig. Von 1914 bis 1918 hatte das Reichsheer fast 1,8 Millionen Mann verloren. Vor allem die Kämpfe an der Front in Frankreich und Belgien hatten den Kriegsparteien große Opfer abverlangt. Materialschlachten, permanente gegenseitige Angriffe auf Schützengräben und Bunkeranlagen und schreckliche Attacken mit Giftgas zermürbten die Heere. Das sollte sich auf keinen Fall wiederholen.
Die Bedenken seiner Generäle wischte Hitler beiseite und befahl, den Krieg im Westen schon im November zu eröffnen. Doch den Beginn der Offensive musste Hitler verschieben. In den kommenden Wochen und Monaten legte er immer wieder neue Angriffstermine fest, die dann wieder aufgehoben wurden; 29 Mal insgesamt. Mehrfach lag es am Wetter, langandauernder Nebel behinderte etwa die Luftwaffe, mehrmals verzögerte die Generalität auch den Beginn der Kampfhandlungen, weil ihr der Angriff zu früh kam, sie Materialprobleme meldete oder Truppen nicht einsatzbereit schienen.
Ihrem »Führer« entging das nicht. Am 23.November 1939 empfing Hitler die Verantwortlichen von Heer, Marine und Luftwaffe in der Reichskanzlei in Berlin. Die Zeit arbeite gegen Deutschland, erklärte er den Generälen und Admirälen. »Wir haben eine Achillesferse: das Ruhrgebiet.« Und weiter: »Wenn England und Frankreich durch Belgien und Holland in das Ruhrgebiet vorstoßen, sind wir in höchster Gefahr.« Unverhohlen zeigte er sein Misstrauen gegenüber den Spitzenmilitärs. Er erneuerte seinen »unabänderlichen Entschluss« zum Angriff auf den Westen. Und er setzte sich durch. Hitler legte den nächsten Angriffstermin für den 17.Januar 1940 fest. Seine Generäle entwarfen dafür eine Aufmarschidee, die an das Vorgehen von 1914 erinnerte, den Schlieffen-Plan: Mit einem Vorstoß durch Belgien sollten die französischen Verteidigungslinien an der Grenze zu Deutschland weitgehend umgangen werden.
Und dann geschah aus deutscher Sicht im Januar 1940 eine Katastrophe. Beim belgischen Ort Mechelen musste ein deutsches Flugzeug notlanden, das sich bei eisigem Wetter und starkem Nebel verirrt hatte. Gut 80 Kilometer von Köln entfernt ging die Me 108 runter. An Bord waren zwei Offiziere mit geheimen Unterlagen über die geplante West-Offensive. Sie verbrannten einen Teil der Dokumente, bevor belgische Soldaten sie festnahmen. Wie viele Informationen die Gegner dennoch gewonnen hatten, wussten die Deutschen nicht. Sie entwickelten nun aber einen neuen Ansatz, mit dem sie die Alliierten überraschen wollten. Hitler verschob die Offensive im Westen auf das Frühjahr 1940.
Tatsächlich hatten die Belgier die nach der Notlandung gefundenen deutschen Schriftstücke an Franzosen und Engländer weitergeleitet. Doch die Alliierten fürchteten, dass ihnen gefälschte Angriffspläne zugespielt werden sollten. Sie hatten lange darüber diskutiert, wie sie im Falle einer Offensive den Feind zurückschlagen könnten. Lehren aus dem raschen deutschen Vormarsch in Polen zogen sie nicht. Der »Plan D«, auf den sie sich im November 1939 einigten, sah vor, dass ein verstärkter linker Flügel der alliierten Armee mit den besten und schnellsten Einheiten nach Belgien hineinstoßen sollte, sobald die Wehrmacht zur Attacke übergegangen war. Genau damit rechneten die Deutschen.
Ein fähiger Stratege, General Erich von Manstein, hatte einen Plan für eine Attacke auf Frankreich entwickelt, der radikal von anderen Vorschlägen abwich. Manstein sah einen überfallartigen Vorstoß durch die Ardennen vor, durch bergiges, bewaldetes Terrain; also schwieriges Gelände für Panzer und andere Fahrzeuge. Die Franzosen hielten das Gebirge für undurchdringlich.
Die deutschen Truppen sollten dennoch die engen Täler durchbrechen, bis zur Maas. Einen 80 Kilometer breiten Abschnitt des Flusses zwischen Dinant und Sedan hatte Manstein als Angriffsschwerpunkt ausgemacht. Er vergewisserte sich bei General Heinz Guderian, einem Experten für mobile Kriegsführung, ob schwere Fahrzeuge rasch durch die Ardennen vordringen könnten. Der Fachmann kannte das Terrain aus dem Ersten Weltkrieg. Er hielt es für machbar, mit Panzern über die Gebirgsstraßen bis nach Sedan durchzustoßen. Guderian empfahl sogar, gleich ein Vorrücken mit der motorisierten Truppe bis zum Ärmelkanal zu planen.
Manstein diente als Stabschef der Heeresgruppe A unter Generaloberst Gerd von Rundstedt. Sein Vorgesetzter leitete die Idee weiter. Das Oberkommando des Heeres lehnte den Vorschlag kategorisch als viel zu riskant ab. Aber ein Adjutant des »Führers« trug den Plan an Hitler heran. Am 17.Februar 1940 sprach Erich von Manstein in der Reichskanzlei vor. Er erläuterte Hitler seine Strategie. Und der oberste Befehlshaber stimmte dem Gast zu. Er hatte selbst schon darüber nachgedacht, wie er schnelle Truppen in den Rücken des Gegners bringen könnte.
Wer im Westen angreifen will, muss über die Maas kommen. Der Fluss, auf Französisch Meuse, auf Wallonisch Moûze, fließt auf 874 Kilometern durch die Niederlande, Belgien und Frankreich. Er entspringt in Le Châtelet-sur-Meuse, durchquert die Ardennen, und läuft als Nebenfluss des Rheins zum Meer. Die Maas mündet in den »Holland Diep«, einen Arm des Rheins, der in eine Bucht der Nordsee übergeht. Die Brücken über die Maas spielten in den Plänen der Angreifer – und in denen der Verteidiger – eine zentrale Rolle. Auch in Mansteins und in Hitlers Überlegungen war es entscheidend, wo und mit welchen Einheiten der Fluss überquert wird.
Kurz nach Mansteins Vortrag erteilte Hitler dem Militär neue Weisungen für den »Fall Gelb«. So lautete der Tarnname für die Offensive im Westen. Sie soll, so legte es der »Führer« fest, mit einem Vorstoß durch die Ardennen entschieden werden. Der Generalstab des Oberkommandos des Heeres arbeitete nun detaillierte Pläne aus.
Anfang Mai verschanzte sich die Grande Armée hinter der Maginot-Linie, dem mächtigen Befestigungsgürtel, der sich entlang der französischen Grenze von Belgien über Luxemburg und Deutschland bis zur Schweiz und nach Italien zieht. Auf ihrer Seite des Rheins hatten die Franzosen ein Bollwerk gegen den Nachbarn im Osten errichtet. Die Stellungen sind nach dem Kriegsminister André Maginot benannt, der den Bau von Bunkern und Forts entschieden vorangetrieben hatte. Er starb lange, bevor das Werk vollbracht war. Erst 1939, nach elfjähriger Bauzeit, wurde die gut 1000 Kilometer lange Linie eröffnet. Ein beeindruckender Grenzschutz – auch wenn zahlreiche Gebäude noch nicht fertig waren, Panzerglocken, Gasschutzsysteme und manchmal sogar Stahltüren fehlten.
Für die Forts und Bunker hatte die Republik mehr als sieben Milliarden Gold-Francs ausgegeben. Der Verteidigungsriegel, von der französischen Regierung als unbezwingbar bezeichnet, war aber nicht überall gleich stark. Und an der Grenze zu Belgien blieb ein 400 Kilometer langer Streifen gänzlich unbefestigt. Die Gefahr drohe schließlich von den »Boches«, den Deutschen.
Gegenüber, auf der anderen Seite des Rheins, hatten die Nachbarn in den vergangenen Jahren ebenfalls viel Beton verbaut. Das deutsche Pendant zur Maginot-Linie hieß »Westwall« – von den Alliierten als »Siegfried-Linie« verspottet. Für die NS-Propaganda hingegen handelte es sich um »das gewaltige Bollwerk von Stahl und Beton«. Auf 400 Kilometern Länge erstreckte sich der Westwall von Aachen bis zur Grenze bei Basel. Fast 15000 Bunkeranlagen sollten einen Vorstoß der Franzosen verhindern. Acht Millionen Tonnen Zement, drei Millionen Rollen Draht und 1,2 Millionen Tonnen Eisen stecken darin. »Täglich waren 8000 Güterwaggons mit Baustoffen nach dem Westen unterwegs, außerdem waren die Binnenschifffahrt und 15000 Lastkraftwagen für den Transport sowie Feld- und Förderbahnen eingesetzt«, verkündete die deutsche Propaganda. Das Konzept des »Blitzkrieges« passte zu der sperrigen Verteidigungsanlage allerdings nicht.
In Frankreich hatten sich die meisten Soldaten mit dem »Sitzkrieg« arrangiert. So führten die 390000 Mann des Britischen Expeditionskorps (BEF) unter dem Kommando von Generalleutnant John Vereker, Sixth Viscount Gort, meist nur Lord Gort genannt, ein angenehmes Leben. Die ersten seiner Einheiten waren im Sommer 1939 in Frankreich angekommen. Ihre besten fünf Divisionen hatten die Engländer geschickt und dazu noch zehn weitere, deren Kampfkraft als zweifelhaft galt. Einige Einheiten waren weder vernünftig ausgebildet noch ausgerüstet. Und auch die 1.Panzerdivision der Briten war noch nicht einsatzbereit. Mehr Soldaten können die Engländer nicht aufbringen.
Die Briten fühlten sich sicher hinter der Maginot-Linie. Sie hatten zudem weitere Bollwerke gebaut, allein mehr als 400 neue Bunker angelegt und Schützenstellungen wie im Ersten Weltkrieg ausgehoben. Sie waren sich sicher, dass die Deutschen an den Stahl- und Betonbarrieren zerschellen würden, sollten sie einen Angriff wagen.
Im Ersten Weltkrieg waren mehr als 800000 Briten gefallen. Und zwei Millionen kehrten verwundet an Körper und Seele heim. Von diesem Horror schienen die Soldaten des BEF im Jahr 1940 weit entfernt zu sein. Sie verbrachten ihre freien Abende in Lokalen und Cafés, feierten und sangen. So mancher von ihnen ahnte aber, dass der Frieden nicht von Dauer sein würde.
Tatsächlich war die Ruhe in Europa seit April vorbei. Im Frühjahr 1940 griff die Wehrmacht weitere Länder an. Adolf Hitler ließ seine Truppen am 9. April in Dänemark und Norwegen einmarschieren. Die Regierung in Kopenhagen entschied, keinen Widerstand zu leisten. Norwegen wehrte sich gegen die Invasoren – unterstützt von Briten und Franzosen, die gut 25000 Mann geschickt hatten, um die deutsche Invasion zu schlagen. Im Oberkommando der Wehrmacht machten sich einige Herren große Sorgen, nachdem die Briten in Norwegen gelandet waren und dort gegen die Wehrmacht vorgingen.
Wenigstens in Dänemark gab es aus Sicht der Generäle keine Probleme: Die Besatzung lief wie geplant. Dorthin waren in den Jahren nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten bis zu 30000 deutsche Exilanten geflohen. Die meisten der Flüchtlinge reisten bald in andere Staaten weiter, nur wenige Tausend von ihnen blieben in dem skandinavischen Land. Wer im April 1940 noch dort war, musste aufpassen, nicht in die Hände der Geheimen Staatspolizei zu fallen.
Der Dramatiker Bertolt Brecht und seine Frau, die Schauspielerin Helene Weigel, hatten in Dänemark mit ihren beiden Kindern bis 1939 gelebt und ihre Zuflucht rechtzeitig in Richtung Schweden verlassen. Für Menschen, die vor den Nationalsozialisten auf der Flucht waren, gab es immer weniger sichere Orte: Österreich und die Tschechoslowakei waren 1938 und 1939 als Exilstaaten weggefallen, in Skandinavien war nur noch Schweden geblieben und im Westen konnte der Krieg bald losgehen.
Deutschland stand im Frühjahr strategisch gut da. Polen war besetzt und von den Regierungen in Berlin und Moskau aufgeteilt worden. Seit dem deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffs-Pakt vom 23.August 1939 war das Verhältnis zwischen Adolf Hitler und Josef Stalin offiziell ausgezeichnet. Der »Führer« der NSDAP hatte dem »Führer« der KPdSU im Dezember 1939 herzlich zum Geburtstag gratuliert.
Das Bündnis der Diktatoren hatte die Welt aufgeschreckt. Geheim blieb ein Zusatzabkommen zum Hitler-Stalin-Pakt, mit dem die Machthaber Osteuropa unter sich aufgeteilt hatten. Solange dieser Pakt bestünde, wollte Hitler im Westen Fakten schaffen, und sich dann dem Osten zuwenden. Stalin hoffte, dass sich die Deutschen an den »kapitalistischen« Ländern im Westen die Zähne ausbeißen und dann keine Gefahr mehr für sein Land sein würden – oder besser noch, eine leichte Beute für seine Rote Armee.
Während im Osten eine unheilvolle Ruhe eingekehrt war und im Norden gekämpft wurde, belauerten sich im Westen die Kriegsparteien. »Drôle de guerre«, komischer oder seltsamer Krieg, nannten die Franzosen diesen nervenaufreibenden Zustand. Vom »Sitzkrieg« sprachen die Deutschen, vom »phoney war« die Briten, vom unechten oder auch vom faulen Krieg.
Als eine »unheilvolle Stille« bezeichnete Winston Churchill, der erste Lord der Admiralität und damit britischer Marineminister, die Situation. Er forderte seit Jahren ein härteres Vorgehen gegen Hitler. Bislang vergeblich.
William L.Shirer, ein amerikanischer Radioreporter, staunte im Oktober 1939, als er von der Grenze berichtete: »Die Deutschen schaffen Geschütze und Nachschub mit der Eisenbahn heran, aber die Franzosen behindern sie nicht. Welch seltsamer Krieg!« Er reiste im Zug am Rhein entlang. Ein einziger Treffer eines schweren Geschützes der Franzosen von der anderen Seite könnte seinen Waggon von den Gleisen pusten, das wusste Shirer. Aber das Bahnpersonal versicherte dem Reisenden, seit Kriegsbeginn sei hier kein einziger Schuss gefallen.
Beide Seiten flogen allerdings Luftangriffe gegeneinander. So attackierten die Engländer Wilhelmshaven. Und im Gegenzug schlugen deutsche Bomber im September 1939 gegen die britische »Home Fleet« zu, die Flotte, die der Verteidigung der britischen Hoheitsgewässer diente. Die deutsche Propaganda bejubelte das Versenken des Flugzeugträgers »Ark Royal« – eine Falschmeldung. Nicht ganz einen Monat später beschädigten deutsche Flugzeuge dann tatsächlich einen Kreuzer und zwei Zerstörer. Auf dem Rückflug verloren die Angreifer zwei Maschinen, als sie in der Luft von britischen Jägern attackiert wurden.
Beide Armeen bekämpften sich aber vor allem mit ihren Propagandakompanien. In Köln heulten am 5.September 1939 die Sirenen, es gab Flugalarm. Doch statt Bomben fielen tausende Flugblätter vom Himmel: »Warnung – Großbritannien an das deutsche Volk« lautete der Titel.
Ein Gegenschlag mit Papier erfolgte nur eine Woche später: die deutsche Luftwaffe warf zwei Millionen Flugschriften über Frankreich ab. Auf ihnen stand, dass die Regierungen Englands und Frankreichs »immer neue Vorwände«, suchten, um »den Krieg mit Deutschland fortzusetzen«. Auf anderen Flugblättern wandten die Deutschen sich an die »Kameraden von da drüben« und versicherten, dass der »Führer« keinen Krieg wolle.
Außerdem betrieb das deutsche Propagandaministerium zwei Geheimsender, die Voix de la Paix, die Stimme des Friedens, und Radio Humanité, mit denen französische Hörer davon überzeugt werden sollten, wie falsch ein Krieg gegen Deutschland sei.
Die einzigen, die marschierten, waren die Deutschen. Diesmal innerhalb des eigenen Landes, von Ost nach West. Die Friedhofsruhe an der Grenze zu Frankreich sollte schon bald vorbei sein.
Fall Gelb 9. Mai–10. Mai
9. Mai 1940, Donnerstag
»Englands Aggressionspläne klar bestätigt.«
Berliner Börsen-Zeitung
»Aus den Vorbereitungen geht hervor, daß Holland fest entschlossen ist, sich mit allen Kräften gegen einen Angriff zu wehren.«
Kriegstagebuch der Seekriegsleitung
Durch Berlin geistern in diesen Tagen immer neue Gerüchte über eine weitere Offensive der Wehrmacht. William Shirer kennt sie alle. Das gehört schließlich zu seinem Job. Er arbeitet als Korrespondent für den US-Rundfunksender Columbia Broadcasting Systems (CBS). Gerade hat Shirer erfahren, dass Holländer und Belgier sehr nervös seien. »Das hoffe ich«, notiert der Journalist in seinem Tagebuch. »Sie sollten es sein.«
Die CBS-Chefs in New York City haben gerade entschieden, seinen Kollegen in Amsterdam abzuziehen und ihn nach Skandinavien zu schicken, wo Norweger und Briten gegen deutsche Invasoren kämpfen. Aber Shirer protestiert gegen diesen Schritt. In Norwegen ist der Krieg schon fast vorbei, denkt er. Im Westen hingegen dürfte es bald losgehen. Der Reporter hat erfahren, dass die »Wilhelmstraße«, also die Reichsregierung, sehr verstimmt gewesen ist über eine Meldung der amerikanischen Nachrichtenagentur AP. Diese hatte berichtet, dass zwei deutsche Armeen sich von Bremen und Düsseldorf aus auf die holländische Grenze zubewegen. Für Shirer mehren sich die Zeichen, dass Adolf Hitler weitere Nachbarstaaten angreifen will.
Am Vortag hatte Shirer bereits in einem Radiobeitrag, der in die Vereinigten Staaten übertragen wurde, davon berichtet, dass der nächste deutsche Schlag in Kürze zu erwarten sei – Holland, Belgien, Frankreich und die Schweiz fühlten sich bedroht. Shirer wunderte sich über die Milde der deutschen Zensoren, die ihn in aller Breite ausführen ließen, dass es im Westen bald brenzlig werden dürfte.
Shirer arbeitet seit 1937 für CBS. Seine Reportagen für den Rundfunk waren aufgefallen, weil er stets gut informiert ist, einen feinen Stil besitzt und klug analysiert. Seit August 1939 arbeitet er als Korrespondent in Berlin, ohne seine Frau Tess und die Tochter. Als Quartier wählte er das Hotel »Adlon« am Pariser Platz aus. Vier- bis fünfmal am Tag geht er in diesem hitzigen Sommermonat auf Sendung. Von ihm erfahren die Hörer in den Vereinigten Staaten, wie Europa auf den Krieg zusteuert.
Shirer bleibt trotz seines gewissen Ruhmes bescheiden. »This is Berlin«, der Spruch am Beginn seiner Sendung, entwickelt sich zu einem Markenzeichen, das abertausende Hörer kennen. Auf seine Erfolge angesprochen, sagt Shirer, er sei einfach nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen. Das ist er nun wieder, in diesem Mai 1940.
Englands Premierminister Neville Chamberlain bittet um neun Uhr morgens den Parteirebellen Leo Amery zu sich. Der Parlamentarier hat ihn gestern im Unterhaus vorgeführt: »Sie sitzen hier schon länger, als ihr Handeln es rechtfertigt«, hatte ihm Amery in einer Debatte zur Lage in Norwegen zugerufen. »Ich sage Ihnen, gehen Sie, wir sind mit Ihnen fertig. In Gottes Namen, gehen Sie.« Die Opposition innerhalb der Konservativen greift den Regierungschef immer härter an. Bis vor neun Monaten hatte auch Winston Churchill zu Chamberlains Gegnern gehört. Dann holte der Premier ihn in sein Kabinett. Nun versucht er Amery mit demselben Schachzug matt zu setzen. Dieser könne sich jeden Ministerposten aussuchen, auch andere Unzufriedene würde er mit Ämtern versorgen, verspricht Chamberlain. Man müsse verhindern, dass die linke Labour-Partei mitregiere. Amery lehnt das Angebot ab und erklärt, er halte es für undenkbar, dass sein Gastgeber Premierminister bleibe.
Chamberlain steht also weiterhin unter Druck. Und eine große Hilfe sind seine Kollegen im Kabinett in dieser kritischen Lage nicht. Gestern hat ebenfalls Churchill zu den Abgeordneten gesprochen – als Verteidiger der Regierung, versteht sich. Er hatte verkündet, dass die britische Marine Tag und Nacht gegen deutsche Schiffe kämpfe. Der erfahrene Politiker, Jahrgang 1874, ist als Rhetorikgenie bekannt. Aber auch ihm gelingt es nicht, die Stimmung im »House of Commons« zu heben. Er habe eine interessante Rede gehalten, brillant gesprochen, aber nicht überzeugt, stellt ein Zuhörer fest. Vielleicht wollte Churchill das Parlament aber auch gar nicht davon überzeugen, dass Chamberlain alles im Griff habe?
200 Parlamentsmitglieder stimmten am 8. Mai gegen die Regierung, darunter 100 Konservative – und nur 281 für sie. Ein Verhältnis, das rasch kippen kann. Und daran könnte Churchill durchaus gelegen sein, auch wenn er stets seine Loyalität gegenüber Chamberlain betont. Einige Politiker und Spitzenbeamte, die ihn seit Jahren kennen, vermuten, dass der umtriebige Marineminister hinter einer Kampagne gegen den Premier steckt.
Vielleicht gibt es aber auch gar keine Verschwörung, vielleicht wartet Churchill einfach ab, bis seine Stunde gekommen ist. Chamberlain hat selber viel getan, um sich zu schaden. Am 30. September 1938 hatte er seinen Landsleuten noch versprochen, mit dem Münchner Abkommen den »Frieden für unsere Zeit gesichert« zu haben. Der Preis, den er dafür zahlte, war die Tschechoslowakei. Zunächst musste die Regierung in Prag das »Sudetenland« an Hitler abtreten. Kurz darauf zerschlug dieser dann den Nachbarstaat, besetzte auch »Böhmen und Mähren«. Gut elf Monate später begann der Zweite Weltkrieg. Und Chamberlain stand da wie ein Narr.
Im selben Jahr wie Churchill, 1874, kam Friedrich Stampfer zur Welt. Der Sohn eines jüdischen Rechtsanwalts ist ebenfalls ein erfahrener Politiker. Seit Jahrzehnten dient er der deutschen Sozialdemokratie. An diesem 9. Mai 1940 kehrt Stampfer aus Amerika zurück zu seiner Familie in Paris. In den Vereinigten Staaten hat er versucht, Geld für die Sopade aufzutreiben, für den Vorstand der SPD im Exil.
Der Journalist, der viele Jahre die SPD-Zeitung Vorwärts als Chefredakteur führte und als Abgeordneter im Reichstag saß, lebt mit seiner Familie in der französischen Hauptstadt. Er zählt zu den führenden Sozialdemokraten im Exil. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten hatte er mit anderen Genossen dafür plädiert, vom Ausland aus den Kampf gegen Hitler fortzusetzen. Das Parteiverbot am 22. Juni 1933 zwang die Sozialdemokraten in Deutschland dann in die Illegalität. Stampfer war bereits mit seiner Frau und mit seiner Tochter Marianne nach Prag geflohen. Dort gründeten er und andere SPD-Sympathisanten die Sopade. Otto Wels wurde ihr Vorsitzender und Stampfer in den Vorstand berufen. Am 23. März 1933 hatte Wels eine der mutigsten Reden gehalten, die bis dahin in einem deutschen Parlament zu hören gewesen waren. »Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht«, rief er den Nationalsozialisten entgegen. »Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird billigerweise niemand von ihr erwarten können, daß sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt.« Und weiter: »Kein Ermächtigungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, die ewig und unzerstörbar sind, zu vernichten.«
Im August 1933 stand Stampfers Name auf der ersten Ausbürgerungsliste des NS-Regimes. Er war damit staatenlos geworden. Viel tun für die Genossen in der Heimat konnte die Sopade von Prag aus nicht. Ihre Anhänger schmuggelten verbotene Publikationen wie den Neuen Vorwärts, den Stampfer herausgab, über die Grenze nach Deutschland. Zudem sammelte der Exil-Vorstand Informationen über die Lage der Genossen im NS-Staat, über den Ausbau der Diktatur. In Deutschland erging es den Sozialdemokraten schlecht. Führende SPD-Kader, die nicht geflohen waren, wurden festgenommen, oft misshandelt, kamen in Haft und in Konzentrationslager. Bevor Hitlers Truppen im März 1939 in die »Resttschechei« einmarschierten und Prag besetzten, flohen Friedrich Stampfer und seine Familie nach Frankreich. Erneut waren sie den Verfolgern entwischt. Wie lange würden sie in Paris noch sicher sein?
Marianne Stampfer, 16 Jahre alt, freut sich, ihren Vater wiederzusehen. Im Weltkrieg sind Reisen über den Ozean alles andere als sicher. Deutsche U-Boote und Hilfskreuzer lauern auf den Meeren.
Um zwölf Uhr mittags erteilt der »Führer und Oberste Befehlshaber«, Adolf Hitler, die Weisung zur »Durchführung Operation ›Gelb‹«. Festgehalten sind darin:
A-Tag: 10. 05.
X-Zeit: 05:35 Uhr.
Wenn das Stichwort »Danzig« an die Truppe ausgegeben wird, soll der nächste Krieg beginnen. Danzig scheint dafür das richtige Codewort zu sein. Schließlich war die Stadt einer der Orte, an dem die Wehrmacht den Zweiten Weltkrieg entfesselte.
Die Funkaufklärung des deutschen Marinenachrichtendienstes ortet östlich von Dünkirchen einzelne französische Zerstörer, die vor der Küste kreuzen. Sie empfängt deren Signale und versucht, die Funksprüche abzufangen. Was im Raum von Dünkirchen passiert, interessiert die Lauscher. Schließlich liegt in der Stadt einer der wichtigsten Häfen Frankreichs, deren Kaianlagen gerade noch weiter ausgebaut werden. Es gibt dort zudem große Erdölraffinerien. Am bedeutendsten aber ist Dünkirchen wegen seiner strategischen Lage in der Nähe der belgischen Grenze und gegenüber der englischen Küste. Die Seekriegsleitung ist gut informiert darüber, was in Frankreich und England passiert. Ein V-Mann meldet, dass der Flugzeugträger »Béarn« spätestens bis zum 14. Mai nach Gibraltar auslaufen soll und dass die Depots in den Stützpunkten auf Korsika voll mit Proviant sind.
In der Nordsee versenkt das Schnellboot »S31« mit einem Torpedo einen feindlichen Zerstörer. »Der erste herrliche Erfolg unserer Schnellbootwaffe, der in seiner abschreckenden Wirkung auf den Gegner besonders hoch zu bewerten ist«, notiert ein Offizier im »Kriegstagebuch« der Seekriegsleitung. »Feindstreitkräfte sind nach Westen abgelaufen.«
Und auch unter Wasser geht der Krieg weiter. Das Unterseeboot U9 teilt den Abschuss eines feindlichen U-Bootes in den Hoofden mit, einem Seegebiet zwischen Dover im Westen und Dünkirchen im Osten. Es handelt sich dabei vermutlich um das englische U-Boot »Triad« – so ganz genau wissen die Deutschen das nicht.
Um kurz nach drei Uhr am Nachmittag schickt die deutsche Botschaft in Brüssel eine geheime Nachricht an das Auswärtige Amt in Berlin. Die belgische Regierung habe die momentane Lage geprüft, aber es nicht für notwendig gehalten, »besondere Anordnungen« zu treffen. Die Presse habe an diesem Donnerstag berichtet, dass ihr Land auf alle Möglichkeiten vorbereitet sei: Die aktuelle Situation werde vom Kabinett mit Ruhe und Kaltblütigkeit beurteilt.
Auf dem Plateau, das über der belgischen Festung Eben-Emael liegt, spielen Soldaten gegeneinander Fußball. Zwei Tore haben sie zwischen den gewaltigen Gefechtstürmen aufgebaut. Für die Männer, die sieben Tage am Stück in der Bunkerwelt unter der Anhöhe Dienst verrichten, ist es ein Geschenk, die Sonne zu sehen und den Wind zu spüren. Die Luft im Fort riecht oft nach dem Diesel der Generatoren, nach dem Öl, mit dem die Waffen gefettet werden und nach dem Schweiß der vielen Männer, die unter Tage ihren Dienst verrichten. Zwar sollen gewaltige Ventilatoren für Durchzug sorgen, aber mit der frischen Luft hier draußen, direkt am Albert-Kanal und in der Nähe der Maas, ist das nicht zu vergleichen. Für gute Laune der gut 1185 Mann Besatzung hat an diesem Donnerstag das Ende der Urlaubssperre gesorgt. Kommandant Jean Fritz Lucien Jottrand hat 100 Mann abreisen lassen, die seit Wochen auf ihre freien Tage gewartet haben.
Während die Belgier um den Ball kämpfen, Stürmer versuchen, Torhüter zu überwinden, vergessen die Männer sicherlich die Kriegsgefahr. Wenn es jedoch zum Konflikt mit Deutschland kommen sollte, werden sie in vorderster Linie stehen. Eben-Emael liegt auf dem St.-Pieter-Berg, sechs Kilometer südlich von Maastricht in den Niederlanden, neunzehn Kilometer von Lüttich und zwanzig Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Schon die Römer hatten hier ein Kastell errichtet. Die Deutschen müssen die Festung ausschalten, um nach Belgien hineinzukommen. Aber wer würde schon Eben-Emael angreifen, mit Wänden, die mehrere Meter dick sind, mit zahlreichen Panzerabwehrkanonen, schweren Maschinengewehren und Geschützen?
Fußball spielen auch französische und englische Soldaten in den Parks der Pariser Vorstädte. Zwölf Prozent aller Angehörigen der französischen Armee befinden sich gerade im Urlaub. Die Männer, die im Dienst sind, versuchen diesen sonnigen Donnerstag ebenfalls mit möglichst viel Amüsement zu verbringen. Der Louvre lockt mit seinen Ausstellungen, in den Parks und an der Seine flanieren tausende Menschen, und in Auteuil können Soldaten ihren Sold beim Pferderennen setzen. Der gesamte Stab der 2. Armee, die Sedan bei einem deutschen Angriff verteidigen soll, fährt geschlossen nach Vouziers, um ein launiges Theaterstück zu besuchen. Erst nachts um zwei Uhr werden sie zurückerwartet. Weniger entspannt geht es bei der 1. Armee zu, die im Kriegsfall Belgien zu Hilfe kommen muss. Ihre Soldaten stecken in einem anstrengenden Manöver, trainieren gut 100 Kilometer von der belgischen Grenze entfernt für den Ernstfall.
Erika Mann schreibt vom »Bedford« aus, ihrem Hotel in New York City, an Eva Herrmann, eine deutsch-amerikanische Karikaturistin und Malerin. »Mädel, verzeih! Die Maulfaulheit – das garstige, undankbare, unzuverlässige, – auch einfach beunruhigende Stillschweigen. Denn wer sagt Dir denn, ob alle Deine freundlichen Botschaften ihr mieses Ziel erreicht haben, – oder nicht vielmehr in den Abgrund vorangerollt sind, der uns wähnt?« Eva Herrmann hatte Erika Mann geholfen, Flüchtlinge in die USA zu holen. Für eine Freundin von Erika Mann stellte sie eine Bürgschaft, die damals gebraucht wird, wenn jemand in die Vereinigten Staaten einreisen will.
Mann hat Beunruhigendes gehört über die Aufrüstung der USA. Das Heer, so berichtet sie an Herrmann, sei in keinem guten Zustand. »Es ist nicht nur an sich lästig, – es ist ganz einfach albern – wenn sie immerzu fragen, ob sie denn nun wirklich ihre ›boys‹ hinüberschicken sollen, damit diese sich für England schlagen! Sie haben gar keine Boys (im Ernst: keine ausgebildeten, equippten!), – auch sonst haben sie nichts!« Im Kriegsfall ist also keine schnelle Hilfe der Amerikaner zu erwarten.
Das Hotel »Bedford« schätzt Erika Mann sehr. Dessen Zimmer bieten behaglichen Komfort. Dort wohnt nicht nur Erika gern, auch ihr Bruder Klaus lebt hier, wenn er in New York ist, und Thomas und Katia kehren meist ebenso in dem Haus in Midtown Manhattan ein, wenn sie die Stadt besuchen. Das »Bedford« liegt in der recht stillen Vierzigsten Straße, zwischen Lexington Avenue und der berühmten Park Avenue. Als Klaus Mann vom Portier einmal aufgefordert wird, seine Heimatadresse anzugeben, fällt ihm keine ein. Das »Bedford« ist längst zu einer Art Heimat geworden.
Marianne Feuersenger, die beim Oberkommando der Wehrmacht als Sekretärin arbeitet, erfährt, dass sie morgen in aller Frühe mit einem Dienstwagen abgeholt und zur Bahn gebracht wird. Sie weiß, dass wieder eine Offensive ansteht. Aber was ist das Ziel? Ihr Vorgesetzter informiert sie nur, dass sie an Bord des Sonderzugs »Atlas« soll. Von ihrem Büro im Neubau des OKW in der Bendlerstraße 11–13 fährt sie nach Hause. Dort packt sie zum fünften Mal innerhalb weniger Wochen den Koffer – bislang stets vergeblich, die Reisen fielen immer wieder aus. »Dumm, daß nicht klar ist, wohin es wirklich geht«, schreibt Feuersenger im Tagebuch. »Ziemlich aufgeregt, weil so viel auf dem Spiel steht – allgemein!«
Auf den Kölner Flughäfen Ostheim und Butzweilerhof herrscht heute reger Betrieb. Ab viertel vor sechs Uhr am Abend landen 42 Flugzeuge vom Typ Junkers Ju 52 mit Soldaten der »Sturmabteilung Koch«. Sie gehören zu verschiedenen Sonderkommandos, die Codenamen erhalten haben: »Eisen«, »Stahl« und »Beton«. Nur die 85 Fallschirmjäger-Pioniere der Sturmgruppe »Granit« reisen nicht standesgemäß im Flugzeug an, sondern per Lastwagen auf der Straße. Ihr Auftrag, für den sie seit Monaten trainieren, ist streng geheim. Die Männer stehen vor einer Mission, die ihr »Führer« mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.
Über 4500 Fallschirmjäger verfügt die Wehrmacht. Sie sind ein neues Instrument der Militärs für Überrumpelungsattacken. Schon sehr bald sollen die Elitesoldaten von Köln aus zu einer solchen aufbrechen – zu einer entscheidenden und mehr als riskanten Operation.
Intensiv haben sich deutsche Strategen mit dem Einsatz von Fallschirmjägern hinter den Linien des Feindes beschäftigt. »Es kommt in solchen Lagen gar nicht auf besondere Stärke der im Rücken des Gegners abgesetzten Luftinfanterie an«, heißt es in einer Militärstudie von 1939. »Auch schwache, energisch geführte Abteilungen werden die Panikstimmung beim Feinde erhöhen«. Bereits beim Angriff auf Dänemark und Norwegen spielten diese Spezialisten eine Rolle: Fallschirmspringer hatten einige bedeutende Brücken, aber auch den Flugplatz von Stavanger besetzt. Bei den Ländern im Westen haben diese Überraschungsattacken nicht zu neuen Abwehrmaßnahmen geführt. Sie unterschätzen die Gefahr von oben.
In Amsterdam freuen sich die Menschen seit Monatsbeginn über einen sonnig warmen Frühling. Auch an diesem Donnerstag verführt ein wolkenloser, blauer Himmel viele Amsterdamer dazu, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren und früh Feierabend zu machen, um sich auf eine der Restaurant-Terrassen zu setzen, auf dem heimischen Balkon Platz zu nehmen, an den Grachten entlangzuspazieren oder im Café ein »kopje koffie« zu genießen.
Es soll eine klare Sternennacht geben, ohne Niederschlag. Auch die Deutschen frohlocken über das gute Wetter in den Niederlanden. Mehrfach hatte die Wehrmachtsspitze wegen schlechter Witterung geplante Offensiven absagen müssen. Nun besteht dazu keinerlei Anlass.
Um fünf Uhr am Nachmittag steigen Adolf Hitler und hochrangige Generäle in den »Führerzug«. Von Finkenkrug aus, westlich von Berlin, fahren sie zunächst nach Norden. Mit einigen Umwegen wollen sie mögliche Beobachter täuschen. Es sieht so aus, als solle der Zug nach Norwegen fahren, wo die Wehrmacht gegen Briten und Franzosen kämpft. Hitler aber hat bereits ein neues Ziel. Er hat entschieden, dass morgen die Wehrmacht zur nächsten Offensive antreten soll. In einer »Führeranweisung« regelt er »die Verwaltung der besetzten Gebiete«, dabei sind seine Gegner noch gar nicht geschlagen.
Der gepanzerte »Führerzug« besteht aus zwei Lokomotiven, die zehn dunkelgrün lackierte Wagen ziehen. Dazu gehören auch ein rollender Salon, ein Speisewaggon und eine Funkzentrale. Den Luxus an Bord wird Adolf Hitler in diesen Tagen nicht richtig genießen können. Auf einige Vertraute in seinem Umfeld wirkt er so nervös wie noch nie. Aber beim Abendessen im Speisewagen lässt sich Hitler nichts anmerken. Er plaudert mit seinem Gefolge und sagt, er hoffe, dass einige Aktionen, die er persönlich mit vorbereitet habe, an den Grenzen gut gelingen mögen.
Um acht Uhr am Abend trifft Hauptmann Walter Koch, der Anführer der Sturmgruppen »Beton«, »Eisen«, »Granit« und »Stahl«, in Köln ein. Gemeinsam mit dem Verantwortlichen für das Lastenseglerkommando inspiziert er die Maschinen, die von der Betriebskompanie aus den Hallen geschoben und auf den Flugfeldern aufgestellt werden.
Seit Januar befinden sich die Lastensegler vom Typ DFS 230 in Köln. Sie wurden von der Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug entwickelt. Sie wiegen nur 860 Kilogramm, können bis zu neun Personen transportieren und erreichen im Sturzflug eine Geschwindigkeit von 290 Kilometern in der Stunde. Die Gleiter sind eine neue Methode, Soldaten fast lautlos an ein Ziel heranzubringen. Segelflugzeuge sind seit Langem bekannt, aber den Deutschen ist es gelungen, einen gleitenden Militärtransporter zu entwickeln. Adolf Hitler selbst hat ihren Einsatz forciert. Koch und seine Offiziere konnten sich stets auf den »Führer« berufen und erhielten alles Material und alle Spezialisten, die sie brauchten. Nun, so stellt Koch zufrieden fest, ist alles bereit für den Beginn der morgigen Mission.
Im Grenzgebiet zu Deutschland präparieren niederländische Sprengmeister wichtige Brücken. Sie bereiten die Flussübergänge so vor, dass sie in die Luft gejagt werden können, wenn die Deutschen kommen. Zum Verteidigen der Brücken in Maastricht stehen 750 Soldaten bereit. Sie werden im Lauf der Nacht in höchste Alarmbereitschaft versetzt.
Anna Seghers schreibt in Paris einen Brief an Wieland Herzfelde, den Begründer des Malik-Verlages. Wie die Schriftstellerin hat sich auch Herzfelde in der Weimarer Republik für den Kommunismus eingesetzt. Sein Verlag war eine Institution im literarischen, avantgardistischen Berlin. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten versteckte Herzfelde sich und floh aus Deutschland. Längst wollte Seghers das Schreiben an den Freund abgeschickt haben. Er war wie so viele Emigranten zunächst nach Prag gegangen – aber rechtzeitig weitergezogen. Als die Deutschen im März 1939 die »Resttschechei« besetzten, war er bereits über London nach Amerika ausgewandert. Seghers ging mit ihrer Familie nach Frankreich. »Wie Du weißt, gibt es bei uns immer viel Neues, und nur die Hälfte alles Durcheinanders pfleg ich durch schreiben zu erleichtern, die andre Hälfte behalt ich für mich, um unsre Freunde nicht zu äußerstem Wahnsinn zu bringen«, schreibt Seghers. »Z. B. kam neulich die Kleinigkeit an mich, dass man meine Mutter nach dem Tod meines Vaters zwingen wollte, von dort, wo sie ist, nach Shanghai zu fahren, nur darum, weil zufällig dort eine Quote frei war – an dieser seltsamen Nuss knack ich noch immer. Von meinem Mann weißt Du.«
Ihr Mann László Radványi wurde von den französischen Behörden im Januar 1940 festgenommen. Er kam in das Lager Le Vernet, Quartier C, Baracke 35. Dort bleibt er als Gefangener.
Im Exil hatte Seghers für Herzfeldes Exilzeitschrift Neue deutsche Blätter gearbeitet. Sie schreibt dem ehemaligen Partner nicht ohne Grund. Sie fragt ihn, ob er ein Buch von ihr verlegen würde. Es heißt »Das siebte Kreuz«. Die Schriftstellerin hat es Querido angeboten, dem großen Exil-Verlag in Amsterdam. Dort liegt das Manuskript nun schon eine Weile, man habe ihr beinahe zu- und auch noch nicht abgesagt, berichtet Seghers. »Doch hab ich die Hoffnung ziemlich verloren.« Sie bedauert sehr, dass der Roman immer noch nicht erschienen ist. Sie möchte mit diesem Buch »einen bestimmten Grad meines Könnens zeigen«, will »dass eine bestimmte Phase unserer Geschichte darin gezeigt« wird. Sie schließt ihren Brief mit wenig optimistischen Worten: »Nun gut, ich bin übergeschnappt und der Zeitpunkt ist unsinnig. Ich weiß nicht, ob Du noch lebst. Ich weiß nicht, ob Du, falls lebend, zu Donquichotterien geneigt bist.«
Am Abend steigt Alexander Kirk, der Geschäftsträger der amerikanischen Botschaft in Berlin, in einen Zug. Ihren Botschafter haben die Vereinigten Staaten nach den Pogromen gegen Juden im November 1938 aus Protest abgezogen. Kirk ist deswegen der ranghöchste Vertreter seiner Nation in Deutschland. Seit einem Jahr arbeitet er in der deutschen Hauptstadt. Ein harter Posten in diesen Zeiten. Die US-Diplomaten in den zehn Konsulaten von Köln bis Dresden und Hamburg bis Wien haben einen schweren Stand im sogenannten »Dritten Reich«. Seit dem deutschen Angriff auf Polen, den Sympathiebekundungen von Präsident Franklin Delano Roosevelt für die Alliierten und Gerüchte über eine anstehende Lieferung von amerikanischen Zerstörern an die Briten, meiden die Nationalsozialisten Kirk und seine Kollegen noch mehr.
Zu stören scheint ihn das allerdings nicht wirklich. Nach dem deutschen Einmarsch in Polen hatte Kirk seinen Präsidenten gedrängt, die Kontakte zu den Deutschen völlig einzustellen. Er hasst die Nationalsozialisten geradezu. Das hat er mit seinem Präsidenten gemeinsam: Roosevelt widert der Militarismus der Deutschen an, er lehnt ihren Antisemitismus ab und hält von ihrem »Führer« gar nichts. Er lässt keinen Zweifel daran, auf welcher Seite er steht.
Das Personal der Botschaft hat gut zu tun in diesen Tagen. Sie helfen seit Kriegsbeginn auch Engländern und Franzosen in Deutschland. Und viele Juden, die Hitlers Staat verlassen wollen, bitten dort um Unterstützung.
Kirk will von Berlin über München nach Italien fahren. Von dort aus möchte er per Schiff nach Amerika reisen. In Washington soll er der Regierung einen persönlichen Bericht über die Lage in Deutschland und Europa liefern. Wie wird es weitergehen in diesem Krieg?
In Washington residiert auch kein deutscher Botschafter mehr. Die deutsche Regierung hat ihn ebenfalls abberufen, als Reaktion auf den amerikanischen Schritt zuvor. Diplomaten sind aber in den USA geblieben. So berichtet der deutsche Militärattaché weiterhin nach Berlin: über die unzulängliche amerikanische Rüstung und ihre nur sehr langsam anlaufende Verstärkung der US-Streitkräfte. Die diplomatischen Kontakte zwischen beiden Staaten sind heruntergefahren – wenn auch noch nicht völlig abgebrochen.
Kirks Kollege in Paris, William Christian Bullitt, gibt heute Abend ein festliches Dinner in der US-Botschaft. In der französischen Hauptstadt ist der amerikanische Diplomat als Weinkenner und Gourmet von Rang bekannt. Sein Koch zählt zu den besten Vertretern seiner Zunft. Und so gehören zu Bullitts Gästen heute Abend einige Prominente, auch Mitglieder des französischen Kabinetts, sogar Ministerpräsident Paul Reynaud gibt sich die Ehre. Ein unbeschwerter Abend in diesen angespannten Tagen. Zwar plaudern die Gäste darüber, ob, und wenn, wann die Deutschen wohl angreifen, aber der Ausbruch echter Feindseligkeiten scheint noch weit entfernt zu sein.
Ein Patriot und Offizier begeht an diesem 9. Mai Landesverrat. Am späten Abend informiert der deutsche Oberst Hans Oster einen Kontaktmann über den unmittelbar bevorstehenden Beginn der deutschen Offensive. Sein Gesprächspartner ist der niederländische Militärattaché in Berlin, Gijsbertus Sas, beide sind befreundet. »Das Schwein ist abgefahren zur Westfront«, sagt Oster zu Sas und meint natürlich Hitler. »Jetzt ist es endgültig aus. Hoffentlich sehen wir uns nach dem Krieg wieder.«
Sas berichtet noch in der Nacht an das Kriegsministerium in Den Haag, was er von seinem Kontaktmann erfahren hat – verschlüsselt, mit einem Code, versteht sich. Aber seine Meldung wird nicht ernst genommen. Zu oft haben Oster und andere Mitglieder des deutschen Widerstandes in der Wehrmacht in den vergangenen Monaten konkrete Angriffstermine weitergegeben. Da die Offensive im Westen jedoch oft verschoben wurde, wirkten ihre Warnungen wie Fehlalarme.
Osters Dienststelle, das Amt Abwehr, ist der militärische Geheimdienst der Wehrmacht. Ihn gab es schon zur Zeit der Reichswehr. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wuchs die Abwehr immer weiter, Aufgaben wie Spionage und Sabotage im Ausland wurden wichtiger. Seit 1934 steht Vize-Admiral Wilhelm Canaris an ihrer Spitze. Er hatte 1923 am Kapp-Putsch gegen die Republik teilgenommen, stand rechtsextremen Wehrverbänden nah und half als Militärrichter dabei, den Mord an Rosa Luxemburg zu vertuschen. Obwohl Canaris dem NS-Staat gegenüber zunächst loyal war, duldete er, dass in seinem Umfeld ein Widerstandskreis entstand. Hans Oster, Leiter der Zentralabteilung, entwickelte sich zur treibenden Kraft der Hitler-Gegner in Abwehr und Wehrmacht. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges nimmt Osters Bedeutung für den Widerstand weiter zu und auch Canaris verliert zunehmend seine Sympathien für die Nationalsozialisten.
Der Vize-Admiral allerdings ist in die Offensive eingebunden, vor der Oster heute die Niederländer warnt. Seine Agenten und Elitesoldaten sollen in der Nacht aktiv werden. Alles ist für ihren Einsatz vorbereitet. Mehrere Kommandos rücken im Lauf der Nacht vor. Sieben Mann in Zivilkleidung haben den Auftrag, die Zünder von Sprengladungen an den Brücken über die Maas zu entschärfen. Zwei weitere Teams sollen verhindern, dass die Niederländer weitere Flussübergänge in die Luft jagen. So hat eine Angriffseinheit der Abwehr, gut 80 Mann stark, den Auftrag bekommen, in niederländischen Uniformen die Brücken in Maastricht zu besetzen. Für solche Kommandos stehen die »Brandenburger« bereit, vom Btl. z. b. V. 100, dem »Bataillon zur besonderen Verwendung«, das auch den Tarnnamen »Bau- und Lehrkompanie Brandenburg« trägt.
20 Männer gehen bei Herzogenrath in die Niederlande hinüber. In Voerendal erhalten sie falsche Pässe, Fahrräder, Handfeuerwaffen und Totschläger. Einige der Deutschen und ihrer Handlanger bekommen von V-Leuten die Uniformen niederländischer Eisenbahner ausgehändigt. Die Agenten teilen sich in Gruppen auf. Sechs Männer fahren nach Wijk. Dort werden sie von Wachtposten angehalten und kontrolliert. Zwei Deutsche fliegen auf, vier andere fliehen auf ihren Rädern. Auch eine zweite Gruppe stößt auf Beamte, die sie überprüfen. Es kommt zu einer weiteren Festnahme eines Mannes und zu einer wilden Flucht seiner Kameraden. Die dritte Gruppe, die aus sechs Niederländern in deutschen Diensten und einem Unteroffizier besteht, gelangt abends ohne Kontrolle nach Maastricht. In einer Wohnung in der Nähe des Bahnhofes verbergen sie sich. Die Männer stoßen auf das Gelingen ihrer Geheimmission an. Dem ersten Glas folgt ein weiteres, dann trinken sie immer mehr und beginnen ein wildes Gelage.
In Berlin feiert heute Abend ein Theaterstück Premiere. Es heißt »Cavour« und handelt von einem berühmten italienischen Staatsmann. Bemerkenswert ist diese Uraufführung im Staatstheater, weil der CoAutor in Deutschland sehr bekannt ist. Er heißt Benito Mussolini und war einst das große Vorbild Adolf Hitlers. Er hat in Italien die Faschisten und sich selbst zur Macht geführt. Sein erfolgreicher »Marcia su Roma« war eine Inspiration für Hitlers dilettantischen Marsch auf die Feldherrenhalle 1923. Doch aus dem Schüler ist längst der Lehrmeister geworden. Hitler gibt den Takt an. Mussolini hat er kurz vor dem Angriff auf Polen informiert, dass Deutschland in den Krieg zieht. Der »Duce« sollte mitmachen. Bislang beteiligt sich Italien zwar nicht an Hitlers Offensiven, aber Mussolini schwankt bereits. Er will von den Siegen der Nationalsozialisten profitieren, ohne ein zu großes Risiko einzugehen.
Das Theaterstück in Berlin könnte ein Erfolg werden. Die Premiere zumindest ist ausverkauft. Hermann Göring und Joseph Goebbels, zwei der einflussreichsten Männer des NS-Staates, gehören zu den Gästen. Besonderen Eindruck macht das Stück auf Goebbels nicht: »Der Duce kann offenbar besser Geschichte machen als Geschichte dramatisieren«, stellt der Propagandaminister in seinem Tagebuch fest.