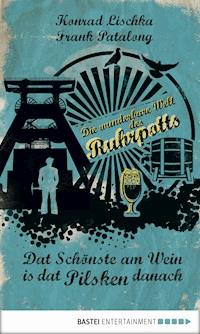
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Konrad Lischka und Frank Patalong sind im Ruhrgebiet groß geworden. Jetzt kehren sie zurück, kramen in Erinnerungen und entdecken ihre Heimat neu. Sentimental, melancholisch, aber auch mit viel Sinn für Ironie und Deftigkeit - eben typisch Ruhrpott - zeigen sie die Einzigartigkeit des Reviers und seiner wunderbaren Bewohner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
KONRAD LISCHKA
FRANK PATALONG
Dat Schönste
am Wein
is dat Pilsken
danach
Die wunderbare Welt des Ruhrpotts
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieses Werk wurde vermittelt durch Aenne Glienke,
Agentur für Autoren und Verlage, www.AenneGlienkeAgentur.de.
Copyright © 2011 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © shutterstock/abrakadabra, © shutterstock/Camilo,
© shutterstock/Cyril Hou, © shutterstock/daseaford, © shutterstock/
Lora liu, © shutterstock/kornilov007, © shutterstock/valeriya_gold,
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel GmbH, Köln
ISBN 978-3-838-71024-2
Sie finden uns im Internet unter www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Inhalt
VORWORT
Mein Todesstern
Feckeln wir los!
1. MENSCH – MENTALITÄT – MILIEU
Ruhr ist ein Redefluss
Wieder da
Kiezkinder
Hollywood gleich hinter Kuhberg
Pssssst, ich hab da was für dich!
Die da oben – der Malochermythos
Unsere roten, grünen, braunen Socken
2. MIGRATION – HERKUNFT – WURZELN
Heimweh rückwärts
Paul, Paweł und Omas Hanfsuppe – die Einwanderer
Gekappte Wurzeln
Heimat ist, wo der Kaiser hängt
Wo sind denn hier die Berge?
3. KULTUR – KNEIPEN – HOBBY
Die Sache mit der Sprache
Anne Bude
Kickern in Mekka
Hinterm Opel-Werk rechts – Underground im Ruhrgebiet, eine Liebeserklärung
Blut zum Abendbrot – Ruhrküche
Homo morbus columba
Kicken mit dem Küster
Tanz in den Meister-Mai
4. UMWELT – STADTLANDSCHAFT
Auf Halde
Zuhause im Pantoffelgrün
Kohle und Wackelboden
Schrankstadt – der erste Eindruck stählt
In die Stadt nach Horten – Landschaftskunde
Ausblenden, bitte!
SCHLUSSWORT
Dat Schönste am Wein is dat Pilsken danach
Ausflugs- und Freizeittipps
Dank
Literatur / Film / Hörspiele
Über die Autoren
Konrad Lischka ist Referent Digitale Gesellschaft in der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen und arbeitete vorher als Redakteur bei SPIEGELONLINE. Er wuchs in Essen auf und schrieb als Schüler für die Lokalseiten von WAZ, TAZ und BILD.
Frank Patalong, Autor bei SPIEGELONLINE. Zuvor arbeitete er als Journalist, Pauschalist und Lokalreporter in Essen und Duisburg. Als Spross einer Bergarbeiterfamilie hat er den Strukturwandel hautnah erlebt.
Vorwort
MEIN TODESSTERN Ich wuchs mit der ersten Generation im Pott auf, für die Schwerindustrie vor allem Geschichte war. Im Süden von Essen hatte die letzte Zeche vor Jahrzehnten dichtgemacht, die Kokerei im Norden schloss, als ich in der Grundschule war. Wir sind nie auf Halden geklettert, nur auf stillgelegte Bahngleise von alten Kohlestrecken. Gestunken haben in meinem Ruhrgebiet nur die Autobahn, die Gülle auf den Feldern in Richtung Ruhr und ab und zu die Köttelbecke, in die wir Stöcke (wir nannten sie Stöcker) warfen. Als Teenager gingen wir in die frühere Schlosserei der Krupp-Zeche Sälzer & Neuack, weil da Drum ’n’ Bass aufgelegt wurde. Da war es ein bisschen rostiger und verfallener als anderswo und draußen unglaublich still, weil das gesamte Krupp-Gelände drumherum noch Niemandsland war.
Schwerindustrie hab ich nie gerochen, aber ihre Folgen habe ich als sehr lebendig erlebt. Jede Woche fuhr der oberschlesische Metzger durch unsere Hochhaussiedlung, und meine Mutter kaufte bröckelige Sahnebonbons (Krówki, also Kühchen) und Krupnioki – Graupenwurst, deren Füllung beim Anbraten eine wunderbare Kruste ergibt. Den Einwanderern verdankt der Ruhrpott neben den oberschlesischen Metzgern auch Schalke 04 und das wunderbare Wort Motek. Das heißt Hammer, aber wenn jemand zeigen will, wo »der Motek hängt«, klingt das viel besser.
Als 1920 ein paar Städte in der Region den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk gründeten (der umfasste die Gegend, die man heute als Ruhrgebiet kennt), war alles auf Zeit gebaut wie eine Goldgräberstadt. Die Gebäude der heute als Weltkulturerbe mühsam erhaltenen Zeche Zollverein wurden in den Zwanzigern als Wegwerfarchitektur errichtet: Sechzig Jahre sollten die elf Zentimeter dicken Ziegelsteinwände zwischen Eisenträgern halten, länger nicht, schließlich waren dann die Kohlevorkommen erschöpft.
Gerade deshalb gibt es im Ruhrgebiet den unbändigen Drang, die Region als fertig zu deklarieren, ihr eine Tradition und Identität zu attestieren und diese Behauptungen zu feiern. Die Vorfahren der meisten Einwohner sind erst vor ein paar Generationen hier gestrandet (Frank Patalongs vor dem Zweiten Weltkrieg, meine erst während des Kalten Kriegs). Geblieben ist aus der Goldgräberzeit die Irrsinnslandschaft. Vor sich hin brennende Halden, verfallene Fabrikhallen, leere Hochhäuser, dazwischen ein paar neue Parks auf Industriebrachen – es sieht an vielen Stellen so aus, als würde das Ruhrgebiet gerade noch gebaut. Die Region ist jünger, unfertiger und entwurzelter als jede andere Millionengegend Deutschlands. Das ist sehr sympathisch und prägt die Gegend heute noch.
DJ Kay Shanghai, der in Essen einen Club betreibt, hat ein großartiges Bild für dieses Ruhrgebiet gefunden: »Das sieht hier aus wie der Todesstern.«
Das ist ein Kompliment. Denn das Ruhrgebiet war ein ähnlich größenwahnsinniges Projekt wie der künstliche Mond in den »Star Wars«-Filmen. Der Todesstern wie die Region entstanden zu einem einzigen Zweck: Jener sollte Planeten zerstören, der Pott sollte Stahl und Waffen produzieren. Man muss sich nun einmal vorstellen, die Besatzung des Todessterns erhält plötzlich das Kommando: Wir brauchen keine Planetenzerstörer mehr. Ihr könnt ruhig hierbleiben, aber macht mal etwas anderes. Schwer vorstellbar. Und dennoch ergeht es dem Ruhrgebiet genau so.
FECKELN WIR LOS! Manchmal, sehr selten, landen wir spät nach der Arbeit in kleiner Gruppe noch auf einen Absacker in einer Hamburger Kneipe. Die Redaktion, in der wir als Journalisten arbeiten, ist typisch für ein bundesweit publizierendes Angebot: Die Kollegen kommen aus allen Ecken des Landes. Einige wenige sind aus dem Ruhrgebiet.
Wenn wir also in kleiner Gruppe nach zwei, drei, vier Bier beieinandersitzen, kommt es in überraschend häufiger Zahl der Fälle vor, dass die Ruhrgebietler von zuhause erzählen. Wir Pöttler schwelgen dann in Vergangenheiten, die mit unserem jetzigen Leben nur noch wenig gemein haben.
Interessanterweise hören aber auch die anderen zu. Für sie klingt das manchmal wie Geschichten aus einer Parallelwelt. Denn – man begreift das erst, wenn man das Revier verlässt – der Pott ist tatsächlich ein gutes Stück anders als jede andere Region in diesem Land. Konrad Lischka und ich sind dort aufgewachsen, in zwei unterschiedlichen Teilen des Potts, zu zwei unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlichen Hintergründen. Wir teilen eine Menge, aber wir unterscheiden uns auch in vielem, nicht zuletzt in unserer Wahrnehmung des Ruhrgebiets. Denn die ist auf völlig anderen Erfahrungen gewachsen.
Ich habe meine Jugend in den siebziger und frühen achtziger Jahren erlebt, für Konrad waren es die Neunziger. Uns trennen siebzehn Jahre, die das Ruhrgebiet von Grund auf veränderten.
Ich wuchs auf in einer Malocherschlafstadt mit erbärmlicher Infrastruktur, keinerlei Nachtleben, null Angeboten für Jugendliche, einem mitleiderregenden Nahverkehrsnetz und einer Zukunftsperspektive, die nichts Gutes verhieß: Erwachsen wurde ich kurz vor dem Kollaps der Schwer- und Montanindustrie. Bis dahin wurden Jobs quasi vererbt. In meiner Kindheit waren neunzig Prozent der Männer entweder in der Stahlindustrie oder »auf Zeche«, die anderen waren reich: Ärzte, Bäcker, Metzger, Priester. Standardberufe waren Schlosser (mit oder ohne Auto davor), Schweißer, Dreher, Hauer. In der gymnasialen Oberstufe warb das Arbeitsamt für das neue Berufsbild des Hüttenfacharbeiters, bis dahin eine reine Hilfsarbeit für Angelernte. Wir lachten nur noch darüber.
Denn unsere Perspektiven lösten sich gerade da in Luft auf, als unsere Schulzeit dem Ende zuging. Eineinhalb Jahre nach dem Abitur lebten von meinen langjährigen Freunden noch zwei in der Stadt und insgesamt fünf irgendwo im Ruhrgebiet, der Rest war fort. Ich zog wenig später weg (aber auch noch einmal wieder zurück). Es blieben die, die Arbeit hatten, alt waren oder zu wenig qualifiziert – oder ihr Glück in Handwerk, Dienstleistung oder Selbständigkeit suchten. Von meinen Freunden lebt heute noch einer in Bochum und einer in Oberhausen, das war’s.
Als Konrad Lischka siebzehn Jahre später das Alter erreichte, das ich bei meinem (ersten) Wegzug hatte, erlebte er Ruhrstädte, denen man mittlerweile Kultur nachsagte. Auf die Idee wäre man früher nicht gekommen.
Was für meine Generation verfallene Infrastrukturen waren, die wir für Housepartys nutzten, zehn Jahre, bevor das Wort erfunden wurde, waren nun bestens gepflegte Industriedenkmäler, die man mit Millioneneinsatz teils zu spektakulären Clubs, zu Museen oder Kulturzentren umgebaut hatte.
Konrad schreibt: »Ich wuchs mit der ersten Generation im Pott auf, für die die Schwerindustrie vor allem Geschichte war.«
So ist das wohl.
Zu der gehöre ich nicht.
Interessant finde ich, dass ihm dadurch die Identifikation mit dem Ruhrgebiet leichterzufallen scheint als mir. Vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass meine dort perspektivlose Generation, die vom sogenannten Strukturwandel voll erwischt wurde, das, was man anderswo Heimat nennen würde, als so große Ernüchterung erfahren hat. Sein Pott ist noch da, meiner ist vor allem eine Erinnerung.
Vielleicht gibt mir das die Perspektive eines enttäuschten Liebhabers? Die Frage, ob ich dort bleiben wollte, hatte sich mir nie gestellt. Als ich zwanzig, einundzwanzig Jahre alt war, war klar: Der Pott will dich nicht, er kann dich nicht gebrauchen, er hat dir nichts zu bieten.
Stattdessen nahm ich ihn mit. Erst außerhalb lernte ich, wie viel Ruhrgebiet in mir war. Wie »falsch« ich beispielsweise spreche. Echtes Hochdeutsch spreche ich bis heute nicht, warum auch? Inzwischen ist mein so ruhrtypischer Minderwertigkeitskomplex geschwunden, ich weiß, dass mir die raue Heimat Ruhr ein paar Fähigkeiten mitgegeben hat, die andere nicht haben. »Datten« und »Watten« diskreditiert einen nicht. Und dass sich mir mitunter sogar beim Schreiben was einschleicht und die Chefin vom Dienst anruft und fragt, ob »feckeln« etwas Unanständiges sei, ist okay. Heute weiß ich: Das ist kein Fehler, sondern ein Dialekt.
Ja, wir sind ein ganz eigenes Völkchen, mit eigener Sprache, spezifischen Bräuchen, eigener Denkweise. Ein seltsam unpatriotischer, flachwurzelnder, weltoffener, lauter, mal komplexbeladener, mal großspuriger Haufen. Ein stets nach unten orientierter, bodenständiger, nicht zur Arroganz neigender, pragmatischer, mitunter sogar nervtötend fatalistischer Schlag mit einem selbstironischen, aber gern auch schmutzigen Humor. Am liebsten lachen wir über uns und die Klischees, die man uns nachsagt: primitiv zu sein, ungebildet, prollig. Die Ruhr-Archetypen haben sich verändert – meiner ist Herbert Knebel, Konrads vielleicht Atze Schröder – aber sie sind eng verwandt. Proll sein ist Teil der Kultur.
Das ist nicht immer echt, es ist unsere Form des Understatements. Man ist kein echter Ruhrjunge, wenn man das nicht kann. Wir können lernen und promovieren und Titel ernten und erfolgreich werden, aber wir wissen, dass wir uns eine Fähigkeit erhalten müssen, wenn wir zuhause in der Kneipe »nich auffe Ömme« kriegen wollen: sich im richtigen Moment auch intellektuell fallen und den Proll raushängen lassen. Das erdet übrigens sehr effektiv.
Es gibt eine Duisburger Band, die vor ein paar Jahren eine richtig gelungene Hymne für ihre Stadt schrieb, die noch immer zu den unschönsten in Deutschland zählt. Die Band heißt »Die Bandbreite«, und der Refrain ihres Liedes geht so:
Ja, dat is Duisburg – hier will einfach keiner hin,
dat is Duisburg – und dat macht auch keinen Sinn,
du musst schon hier geboren sein, um dat zu ertragen,
allen Zugezogenen schlägt Duisburg auf ’n Magen.
Das stimmt, die meisten Duisburger nicken da wohl und sagen: »Jau, so is dat!« Bei YouTube hat das Lied bis heute rund 1,1 Millionen Aufrufe gesammelt – ungefähr dreimal so viele wie die erfolgreichste Live-Aufnahme von Herbert Grönemeyers Lobhudelei auf Bochum. Natürlich ist das Lied ironisch gemeint, aber es ist auch wahr: Es ist Ausdruck einer »Trotzdem!«-Mentalität.
Denn ich kenne viele, die wollen trotzdem nie aus Duisburg weg. Der Pöttler ist ein Meister darin, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren, selbst wenn die wirklich bitter sind – und es gibt wahrlich viele finstere Dinge über das Ruhrgebiet zu erzählen.
Wat sollet, kamman da nua saagen: Woanders is auch Scheiße. Außerdem, das hat schon Harald Schmidt sehr richtig erkannt, ist es mit dem Ruhrgebiet doch wie mit Mallorca: »Das Hinterland ist wunderbar!«
Stimmt. Jetzt müssen wir uns nur noch darüber einigen, wo das Hinterland anfängt, denn ein Zentrum hat der Pott nicht.
P.S.: »Feckeln« beschreibt ein schnelles Laufen mit sehr kleinen Schritten, so wie ganz kleine Kinder das tun. Feckeln wir mal los: Die Ruhr wartet.
Lothar Dohr: Der Fanbeauftragte von Rot-Weiß Essen war mit elf das erste Mal im Georg-Melches-Stadion – 1970. © Konrad Lischka
1. Mensch Mentalität Milieu
RUHR IST EIN REDEFLUSS Im Dezember 2009 stand plötzlich überraschend Schibulski vor meiner Tür. »Mensch Patalong«, knarzte er wie immer ein Stück zu laut, »willse mich nich reinlassen? Dat is lausich hia draußn.«
Klar ließ ich ihn rein. Seine Schuhe zog der alte Stoffel natürlich nicht aus, sondern eine feuchte Schneematschspur vom Eingang zur Küche. Dort ließ er sich mit einem genüsslichen »Woaaaahrr!« auf einen Stuhl fallen. Wie üblich brauchte er nicht lange, um sich zu akklimatisieren: Schibulski war nie ein Freund weniger Worte.
»Mensch«, hob er an, »schicke Hütte. Hättse auch nich gedacht, datte ma so wait komms, wa? So mit eignen Häussken und all dat. Hasse ma ’n Kaffee?«
»Fühl dich wie zuhause«, sagte ich und brachte den verlangten Kaffee auf den Weg. Während ich hantierte, beobachtete ich ihn. Schibulski sah sich die Küche gründlich an. Oder wie er selbst wohl sagen würde: Er war sie am Inspizieren. Bissken spinxen. »Schönen Gaaten«, nickte er beifällig, »doll, son bissken eignes Grün, wa?«
»Ham wa zuhause auch gehabt«, antwortete ich und erschrak: Hatte ich da gerade ge-ruhr-deutscht? War Schibulski ansteckend?
Ich hatte ihn seit langer, langer Zeit nicht gesehen und noch länger nicht an ihn gedacht. Er war ein Teil meiner Kindheit, ging schon im Haus meiner Großeltern ein und aus und hatte sich nicht die Bohne verändert. Wie immer war er leicht gebräunt, der faltige, alte Knochen. Wie immer trug er die Kappe auf dem Kopf, wie immer das blau-weiß gestreifte Hauerhemd und die schweren Schuhe. Seine ledrigen Hände sahen aus, als wären sie grob geschnitzt, die Nägel trug er kurz und breit und wie immer ein wenig schmutzig. Im Pott nennt man so was lobend eine »Pranke«.
Als Kind sah ich ihm zu, wie er die fahlblauen Adern, die sich auf seinen knorrigen Händen so prächtig abzeichneten, hin- und herspringen ließ. Er bewegte die Finger, als kraulte er einen seiner Schäferhunde im Nacken, und die Adern rollten über seine gespannten Sehnen. Lustig sah das aus: So was kann man nicht, wenn man jung ist. »Lass gut sein, Köttel«, tröstete der Alte dann, »dat kommt noch früh genuch.«
Wenn meine Mutter nicht hinsah, nahm er manchmal sogar seine Zähne für mich heraus und ließ sie klappern. »Dat sin die Praktischen«, erklärte er dann, »die brauchse nie putzen. Krisse auch ma. Kriegn wa alle.«
»Ach Schibulski, du …«, fuhr meine Mutter dazwischen und bremste kurz vor »Schwein« oder was auch immer sie da gerade gedacht hatte: »Musse den Jung imma so’n Mist zeigen?« Schibulski lachte. Musste er wohl. Immer wieder, tausendmal.
Hager war er schon damals, die Haut spannte über seinen Wangenknochen, und doch zeichneten sich deutlich seine Muskeln überall da ab, wo man Muskeln aufbaut, wenn man wirklich arbeitet.
Arbeit, so sieht das der Ruhrgebietler, ist Kraft mal Weg. Viel Kraft und viel Weg macht viel Arbeit. Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Immobilienmakler, Pfarrer, Musiker, Politiker, Lottobudenbesitzer, vor allem aber Beamte tun dieser Definition folgend nichts für ihr Geld. Sie leben quasi parasitär. Bäcker, Fleischer und andere Reiche müssen zumindest früh raus aus den Federn, wie sich das gehört, machen »ansonnest abba viel Schönwetta«, wie Schibulski so etwas erklärt, »weil die ham welche, wo wat die wirklich aabeiten müssen, un zwaa füa die.«
Deshalb gibt es ja auch relativ wenige davon. Der ganze große Rest der Menschheit muss derweil wirklich arbeiten für sein Geld. Unter Tage. »Die Schisser«, so Schibulskis weitere Erklärung der Härten dieser Welt, »die dat nich abkönn unter Tage, gehn auffe Hütte.«
Zu Deutsch: in die Stahlindustrie. So sieht sie aus, die alte Rangordnung der werktätigen Menschen: Ganz oben steht der Bergmann, der Hauer. Eigentlich drüber noch der Steiger, aber der ist meist ein Arsch. Dann kommt der Vorarbeiter, der so heißt, weil er vorher mal gearbeitet hat, jetzt aber daran arbeitet, sich charakterlich dem Steiger anzunähern, »un am liebsten von hinten«.
Es folgen Meister und Vorarbeiter »auf Hütte«, dann der Stahlkocher, Schlosser, Schweißer, Dreher. Und dann irgendwann die anderen, die vom Geld der Arbeiter leben.
Ach ja, dann gibt es ja noch diese Studierten, meist Ärzte, denen man schon ehrfürchtig, aber absolut nicht unterwürfig begegnet – weil Ahnung vom richtigen Leben haben die ja auch nicht. Normale Menschen verstehen ja meist noch nicht mal, worüber die reden. Weißkittel und alles mit einem Doktor, selbst wenn sie keine Erste Hilfe können, sind Fremdkörper. Der Ruhrpöttler sieht sie meist so, wie indigene Völker einst Missionare und westliche Mediziner wahrnahmen, die in den Dschungel einfielen: Immer wissen sie alles besser, haben aber letztlich keine Ahnung, würden in freier Wildbahn keine fünfzehn Minuten machen.
Sagen Sachen wie »Mit dem Rauchen, Herr Subjanek, sollten Sie mal aufhören!«. Und Subjanek sitzt da und sagt: »Jau. Schon klaa.« Und denkt an Kohlenstaub und Abgase, an den Gestank der Petrochemie bei Ostwind, den Asbest in seinen Nachtspeicheröfen, die er nicht loswird, und dass da, wo er heute seinen Schrebergarten hat, früher mal eine Müllkippe war. Is halt so. Woanders is auch Scheiße.
Aber woher sollen diese Studierten all das wissen? Sind zugezogen oder kommen aus Familien, wo nie einer unter Tage war, nie einer einen Anstich erlebt hat, nie einer Nachtschicht fuhr und sich die Hände am Verladebahnhof über der brennenden Öltonne wärmte. Oder noch schlimmer: Vielleicht wussten sie einst mal Bescheid und ließen sich dann im Studium in Heidelberg, Bonn oder ähnlichen Urlaubsorten Flausen in den Kopp setzen. Ne, Ahnung haben nur die, die noch wissen, wie der Dreck schmeckt. Die mit ihrem Körper, ihrer Gesundheit, ihrem Leben zahlen für den Wohlstand ihrer Familien. Sie sind die Helden der Arbeit. Das ist normal.
Man muss nicht weiter erklären, wo das beste Geld verdient wurde. Schibulski hustet übrigens oft und sehr, sehr trocken, aber hat »ne Rente wi’en Könich«. »Ich bin mit viazehn unter Tage«, hat er mir mal gesagt, »un hab da gut Geld vadient. Denk ma drüba nach. Ich weiß wiaklich nich, wat dea Scheiß soll mit dat Abitua.« Irgendwie hat er nie verdaut, was aus mir geworden ist. Einer mit sauberen Fingernägeln, einer ohne Schwielen, ein Studierter. So einer, für den Arbeit nur eine weit zurückliegende Erinnerung ist.
Schämen muss man sich nicht unbedingt dafür, aber ein bisschen peinlich ist das schon. Die Frage »Ach, den Patalongs ihr’n Frank?« beantwortet so ein Schibulski möglicherweise mit: »Dat is jezz son Studierten.«
Will sagen: Für die wahre Welt leider verloren.
So sieht er das, er ist eben einer der alten Fürsten. Auf seinen Unterarmen prangen als Insignien seines Standes leicht verblasst blaugraue Tätowierungen: Rechts die zwei Hämmer, gekreuzt, einer stumpf, einer spitz. Links ein Herz mit Pfeil und »Mia«.
»Dat Heaz«, hatte mir Schibulski einmal erklärt, als ich noch ein Kind war, »schläächt links. Imma links. Daafse nich vergessn.«
Damals fuhr er noch ein. Ich sah ihn manchmal bei Schichtwechsel, immer auf dem Fahrrad, am Lenker hing eine braune, ausgebeulte Lederaktenmappe, als sei er auf dem Weg zum Büro. Irgendwann fuhr er Zündapp, fünfzig Kubik, frisiert bis zum Anschlag. Am Wochenende kam dann wieder das alte Hollandrad heraus, und rechts neben ihm trabte dann Stinnes, der langhaarige Preisträger: Zwei Mal deutscher Meister, fast täglich trainiert auf dem Hundeplatz, wenn die Schicht passte. Ein Pfiff, und der Hund ging ab wie Lutzi. Hörte aufs Wort. »Voa Hunde«, belehrte uns Schibulski, »musse imma Respekt ham.« Auch vor Stinnes: Krumm angucken durfte man den nicht, wenn Schibulski nicht da war.
Angst hatten wir trotzdem keine. Irgendwie war da keine Angst vor etwas, was uns hätte drohen können, damals. Zwar veränderte sich die Welt in den Siebzigern rapide, und mit ihr veränderten sich die Städte und die Wohnungen erst recht. Anfang des Jahrzehnts kamen die Fernseher, und die Wohnzimmermöbel richteten sich mit einem Mal nicht mehr kommunikativ zueinander aus, sondern dem elektronischen Herdfeuer zu. Zugleich mutierten sie von Gebrauchsräumen zu familiären Museen, in denen man zeigte, was man hatte: Rein durften wir Kinder plötzlich nur noch sonn- und feiertags oder unter Aufsicht, dreckig Machen war verboten.
Die Autos wurden mit jedem Jahrgang größer, schicker, besser. Ende der Siebziger – satt über hundert Jahre nach ihrer Erfindung – zogen die ersten Telefone in die Arbeiterwelt ein. Noch waren die ein Grund für einen steten Besucherstrom: »Hömma, kann ich ma eben telefonieren?«
Neben dem Telefon stand ein Sparschwein, ein Ortsgespräch kostete zehn, später zwanzig Pfennig, Ferngespräche gab’s nicht. Als irgendwann alle ein Telefon hatten, versiegte der Besucherstrom in jeder Hinsicht. Die Überfälle aus Freundeskreis und Nachbarschaft verebbten, stattdessen rief man vorher an und traf Verabredungen: »Ne, Fine, am Donnastach passdat nich so gut. Wie isset mit Freitach?« Und anders als früher wurde dann vor dem Besuch »ersma die Bude auf Vordamann gebracht«. Wachsender Wohlstand und bessere Ausstattung gingen auch im Ruhrgebiet mit einer Verarmung des Soziallebens einher, wie überall, wenn auch langsamer als im Rest der Republik. Und wie überall ist es auch uns erst mal nicht aufgefallen. Wir sahen: Uns geht es immer besser. Unaufhaltsam.
Als 1973 die Entscheidung anstand, auf was für eine Schule ich wechseln sollte, war das Gymnasium eine Option, über die man fünf Jahre früher wohl nicht einmal nachgedacht hätte, inzwischen aber schon. Dass wir Arbeiterkinder dann wirklich »auffe höhere Schule« gingen, war Teil des Wandels – und schmeckte einigen unserer Lehrer absolut nicht. Selbst im Pott blieben wir ersten Arbeiter-Gymnasiasten-Jahrgänge Exoten, aber uns wurde klar, dass diese Nicht-Arbeiter viel häufiger vorkommen mussten, als bis dahin gedacht. Ein Trugschluss, natürlich: Wir drangen nur in ihr Revier vor. Einen Mittelstand gab es im Ruhrgebiet traditionell so gut wie nicht, das kam später. Man war entweder was, oder man war nichts. Und Sein war untrennbar verbunden mit Haben.
Auf meinem ersten Gymnasium packten sie die Proletariatsbrut in eine Klasse und steckten uns in eine als Behelfsklassenraum hochgezogene Asbestbaracke (»Nur für das erste Jahr!«), die wir für die folgenden Jahre natürlich nicht mehr verlassen sollten. Ich habe das damals nicht wahrgenommen, erst in der Rückschau erkannt, aber es stimmt wohl: Die machten uns von Anfang an klar, dass wir zweite Klasse waren. »Frank«, sagte mir vor wenigen Jahren ein alter Schulfreund, dessen Vater Hauer unter Tage und der wie ich am elitären Dünkel dieser Schule gescheitert war, »die wollten uns nicht. Die wollten uns einfach nicht.«
So ist das wohl, aber die Dinge veränderten sich. Mein oben zitierter Kumpel durfte schulisch seinen Hut nehmen, packte es auf anderem Wege und gehört heute (wie damals) zu der bestens vernetzten künstlerischen Avantgarde des Reviers. Viele von uns, die wir den vermeintlichen sozialen Aufstieg im Visier hatten, erwiesen sich als unaufhaltsam. Der aufstrebende »Unterstand« schuf sich seine Räume im Revier effektiver als irgendwo anders.
Natürlich. Wo auch sonst? Nur dort waren wir die Masse, nun auf der Suche nach Klasse. Andere urbane Räume leisten sich »Brennpunkte«. Die wahren Ghettos des alten Reviers hingegen waren die dünn gesäten gutsituierten Viertel – sozusagen die Nicht-Brennpunkte. Wir wuchsen in einer verkehrten Welt auf, der die bürgerliche Selbstgewissheit der alten BRD sehr fernlag. Der bessergestellte »Mittelstand« lebte (und lebt) in den Speckgürteln leicht außerhalb des Reviers und pendelte hinein in den Arbeits-, aber bitte nicht Lebensraum. Wir lebten da, als wäre der Pott eine Insel. »Draußen« war anfangs richtig exotisch.
Ich wechselte für die letzten drei Schuljahre aufs Clauberg, ein »Modellgymnasium« in Duisburg-Hamborn, das sich die »Integration« (!) von Arbeiterkindern ins Stammbuch geschrieben hatte. Da waren wir unter uns, Deutsche, Türken, Italiener, Polen, echte Pöttler. Leute aus dem Mittelstand waren Exoten, und der Anteil türkischer Schüler lag bei vielleicht dreißig Prozent, was damals etwa dem Ausländeranteil im Einzugsbereich der Schule entsprach. Heute soll der im engeren Umkreis (Marxloh und der nordwestliche Teil Hamborns) bei über siebzig Prozent der Bevölkerung liegen. Auch darum hatte sich das Clauberg kurz vor seinem Ende zur »Schule ohne Rassismus« gewandelt, in der Deutsche längst eine Minderheit waren, was dort aber über Jahrzehnte weitgehend problemlos funktionierte. Zuletzt kamen rund sechzig Prozent der Schüler aus rund zwanzig Nationen. Im Frühjahr 2010 wurde dieses prächtige, emanzipatorische Projekt als erstes Gymnasium im Duisburger Norden dichtgemacht. Für mich ist die Schließung ausgerechnet im so hochgejazzten Kulturhauptstadtjahr Ruhr2010 ein weiteres Zeichen für den fortdauernden Verfall des Ruhrgebietsnordens. Mit dem Clauberg wurde eine große Chance auf sozialen Aufstieg für eine Bevölkerungsgruppe, die es an anderen Gymnasien schwer haben wird, abgeschrieben. Auch das ist leider Revier.
Ernstlich begonnen hat der Verfall, dem sich der Pott heute entgegenstemmt, Ende der Siebziger. Vor der großen Industrieschmelze, der Krise im Ruhrgebiet, die wirklich alles verändern sollte, ahnten wir nicht, dass es so etwas wie Schließung, Rückbau, Abbau und Aufgabe geben könnte. Die Ölkrise war ein kurzer Schock und zeigte, dass da was im Fluss war, das eventuell das Leben aller betreffen könnte. Dem Ruhrgebietler aber ging das noch »am Aaasch vobei«: Wir hatten unseren Spaß daran, an autofreien Sonntagen auf der Autobahn mit dem Fahrrad »’n Stechen zu faan« oder die Tischtennisplatte aufzubauen. Ansonsten schien alles auf ewiges Wachstum gebürstet: Die Schlote rauchen, denn die Feuer verlöschen nie!
Die Männer fuhren ein oder ins Stahlwerk, die Frauen versorgten das Haus, gingen bei den parasitären Nicht-Arbeitern putzen oder saßen hinter der Supermarktkasse. Die Jungs hatten eine gesicherte Perspektive: Schlosser werden, Schweißer, Sprengmeister. Jobs mit vermeintlich lebenslanger Garantie, quasi geerbt vom Vater, Großvater, Urgroßvater. Was braucht eine Stadt mehr als ein, zwei Arbeitgeber, wenn die so mächtig und groß erscheinen, als gehörte ihnen die Welt? Und umgekehrt: »Mein Thyssen« sagten die Hüttenarbeiter, »unsa Schacht« die Hauer. Lebens- und Arbeitswelt waren aufs Engste verschmolzen. Man lebte in Werkswohnungen, deren Mieten bis weit in die Achtziger hinein billiger waren als jeder Sozialbau und sich auf einem Preisniveau bewegten, das dem Rest der Republik dreißig Jahre hinterherhinkte. Als mein Großvater 1993 starb, lag die Miete für sein Zechenhaus mit kleinen Stallgebäuden und dem Garten, der meine Großeltern jahrzehntelang zu fast autarken Gemüseselbstversorgern gemacht hatte, irgendwo knapp unter 200 Euro.
Klar also, dass die meisten Arbeiterfamilien zumindest ihr Auskommen hatten: Man wurde nicht reich »auf Hütte«, aber die Lebenshaltungskosten waren niedrig. Man hatte nicht genug für große Sprünge, blieb abhängig »vonne Maloche«, aber man hatte, was man brauchte. In Opas Garten gab es ein Stück Rasen und dahinter ein kleines Feld. Kartoffeln zog er, Kohl und Mohrrüben, Kirschbäume und Pflaumen, Johannis- und Stachelbeeren. Die Taubenschläge waren massiv gezimmert aus Platten, handgeklaut vom Industrieabbruchgelände. »Besoacht«, tadelt Schibulski in solchen Fällen, »heißt dat: Wia klauen nich. Nie. Wia finden wech. Wir besoagen nua.«
Denn auch das war wichtig, damals: eine ehrliche Haut sein. Hart, aber gerecht. Wenn dir oder der Familie einer krummkommt, kriegt er auffe Fresse, aber sonst war man friedlich. Ehrensache. Nicht so wie heute. Eine Welt voller harter Ehrenmänner, denen das Herz links schlägt. Die auf Asche Fußball spielen. Die auf Tauben wetten. Die man Sonntagmittag aus der Kneipe holen muss, wenn das Essen fertig ist. Die miteinander nie redeten, sondern immer brüllten. Als liefe selbst am Tresen noch die schwere Maschine, gegen die man anschreien musste, um gehört zu werden. Kneipen waren so laute Orte, dass man die Jukebox nur hören konnte, wenn man in der Ecke saß, wo das Ding stand.
Und doch sind es die stillsten Momente, die hängen bleiben, auf ewig im Gedächtnis. Die Augenblicke, in denen kaum Worte fielen.
Das ist eine meiner allerersten Erinnerungen: Im Garten des Zechenhäuschens lagen wir Kinder im Zelt. »Sitz«, sagte Schibulski ganz ruhig, fast beiläufig zu Stinnes. Und dann saß der da wie hingemauert, sein Profil im Mondlicht scharf umrissen vor dem nie wirklich dunklen Himmel. Im Westen blies Schacht Walsum schlagende Wetter ab, der Boden grollte, es fauchte dumpf und mächtig, die Flamme färbte den Himmel rötlich, als ginge nachts um drei im Westen die Sonne wieder auf, und Stinnes saß und wachte. Als am Morgen der Tau fiel, die Kälte in den Schlafsack kroch und uns weckte, saß er immer noch da. Stinnes, eine warme Statue.
»Dat iss vielleicht ’n bekoppten Hund«, hörte ich meinen Vater einmal sagen, aber er meinte natürlich nicht Stinnes, sondern dessen Herrchen. »Nix im Kopp außa Taubn und sein Köter, abba heazensgut. Un ’n echter Sausack.«
Sausack ist so ein Wort, bei dem man ganz wehmütig wird, wenn man weit weg ist vom Pott. Kein nettes Wort, außer man sagt es richtig.
»Eyh, bisse am Träumen?«, fragt Schibulski jetzt und reißt mich aus meinen Gedanken. »Wann bisse eigentlich wech von Walsum? Müssn mea als zwanzich Jahre sein, oda?« Wartet die Antwort nicht ab. »Musse ma ankucken gehen, dat glaubse nich. Wat sich dat allet verändat hat. Du glauuuubset nich. Un jezz der ganze Scheiss mit de Ruar zwanzich-zehn, waiß ich auch nich, wat dat soll. Mit uns hattat allet doch nix zu tun.«
»Ach Schibulski«, sage ich, »die Welt bleibt doch nicht stehen. Ist heute eben alles anders. War das nicht immer so? Das Ruhrgebiet von früher, das gibt’s nicht mehr.«
Da ist er für einen kurzen Augenblick ruhig, der Schibulski. Denkt nach, sieht mich an. »Ach wat«, bellt er dann, »wat haißt schon imma? Ewich gibbet nich. Wat bleibt is, wie die Leute sind.«
So wie du, Schibulski? Ich habe da meine Zweifel. Der ewige Ruhrgebietler, der ewige Schibulski, das ist doch ein Klischee. Der Pott ist nicht mehr so, wie er zu meiner Kindheit war. Die Männer fahren nicht mehr ein, trainieren keine Hunde, keine Tauben mehr. Die älteren Frauen liegen nicht mehr auf Kissen in den Fenstern. Kittel und Jogginghose als Straßentracht: lang ausgedient. Auch die Menschen verändern sich, sag ich, alles verändert sich.
»Acht wat, eahlich, meinse?«, hämt der Schibulski. »Du waas ja imma eina, wo wat dea alles ganz genau wusste. Da frach mal deinen jungen Kumpel da, den Lischka. Dea is da noch näha dran. Dea sieht dat andas.«
Vielleicht ist das so. Ich frag ihn mal, den Lischka. Der ist gerade sowieso im Pott unterwegs, recherchieren. Auch eine Art Freizeit, wenn man Schibulski fragen würde. Zwar viel Weg, aber keine Kraft. Un dat gildet nich.
WIEDER DA »Also ich käm mit dem Scheißdingen nich klar«, ruft der Tankwart von der Kasse rüber, und es ist passiert: Ich fühle mich zuhause. Den Typen mit der roten Latzhose hinter den Schokoriegeln und dem Bild-Stapel kenne ich nicht. Achtzehn ist er vielleicht, kassiert hier wahrscheinlich im Nebenjob. In dieser Tanke bin ich noch nie gewesen, ich muss Zeit totschlagen am Nordrand von Essen-Holsterhausen, denn der Kollege, bei dem ich übernachte, steht gerade im Stau auf der A40.
Wenn ich heute ins Ruhrgebiet komme, bin ich erstmal ein Besucher. Neunzehn Jahre habe ich hier gelebt, zwei Mal bin ich weggezogen, zuletzt vor drei Jahren. Da braucht es jedes Mal diesen bestimmten Moment, der mich schlagartig zurückholt, mir das Gefühl gibt, nicht mehr Besucher, sondern daheim zu sein. In dem Fall ist es der Tankwart, der über das Scheißdingen schimpft. Er meint mein iPhone, auf dessen Bildschirm ich gerade E-Mails lese. »Warum kommse denn nicht klar mit sowat?«, frage ich zurück.
Der Tankwart kommt herüber an den Plastikstehtisch neben dem Kaffeeautomaten und erzählt von seinem Telefon, seiner neuen Freundin und den Klassenunterschieden in der Berufsschule. Das hängt alles zusammen, und zwar so: Der Tankwart braucht ein Telefon mit vielen Tasten, damit er schnell Kurznachrichten tippen kann. Eintausendvierhundert Nachrichten hat er in den vergangenen sechs Tagen geschrieben, so lange ist er mit seiner neuen Freundin zusammen. Er kann auf Bildschirmtastaturen schlecht tippen und überhaupt, die Tarife sind scheiße bei der Telekom, und die Ayse ist bei Ay Yildiz, und da sind die SMS von E-Plus kostenlos.
Weil ich mehr Webseiten und E-Mails lese und weniger schreibe mit meinem Telefon, ja, da versteht er schon, dass so ein großer Bildschirm eine feine Sache ist. Aber sonst, neee, das ist überteuert, dieses Apple-Zeug, der Sohn vom Autohändler in der Berufsschule hat das alles, aber der kommt damit auch nicht klar. »Aber is ja schick so wat«, sagt der Tankwart, der schon eintausendvierhundert SMS lang etwas laufen hat, das Soziologen interkulturelle Partnerschaft nennen würden.
So direkt drauflos hat mich in Hamburg oder München noch nie jemand in ein Pläuschchen verwickelt. Das passiert Zugereisten im Ruhrgebiet an der Tanke, an der Bude, in der S-Bahn. Und wer hierherzieht, merkt es ohnehin daheim. So gut wie in meiner letzten Wohnung im Ruhrgebiet habe ich nirgends die Nachbarn kennengelernt. Es begann mit einem Bier bei den Anwälten nebenan, die mir etwas von der Dame in der unteren Etage erzählten. Die hatte mal etwas mit Herrn B. aus dem obersten Stock gehabt. Das wusste das ganze Haus, weil Herr B. sonntagmittags dann oft nach unten durchs Treppenhaus rief, dass er nun gerne bald mal etwas Warmes zu essen hätte.
Leider hatte ein Sondereinsatzkommando Herrn B. abgeholt, bevor ich eingezogen bin. Von der Verhaftung hatte mir auch die Frau aus dem Erdgeschoss erzählt, der die Ex-Freundin des Herrn B. ein Alkoholproblem anhängen wollte. Das hatte die Dame vielleicht wirklich, aber der gerade besiegte Krebs setzte ihr mehr zu, wie sie mir einmal bei etwas Likör an einem traurigen Abend erzählte, nachdem ich ihren penetrant piepsenden Rauchmelder mit einem neuen Akku zum Schweigen gebracht hatte.
Die einzige Bewohnerin des Hauses, mit der weder ich noch sonst jemand je gesprochen hatte, wohnte direkt neben mir. Sie hatte wahrscheinlich ihre Gründe zur Zurückhaltung, irgendwann durchsuchte die Polizei die Wohnung. Der Kommissar, der mich über meine einzige mir völlig unbekannte Nachbarin ausfragte, kam aus Oberschlesien. Wir haben dann noch über Wurst gequatscht, und er empfahl mir einen Metzger in Recklinghausen, bei dem die Krupnioki fantastisch sein sollen.
Das ist kein Klischee: Im Ruhrgebiet kommt man mit Fremden schneller als anderswo ins Quatschen. Was die Menschen dann an der Theke, vor der Bude oder in der S-Bahn erzählen, klingt oft sehr privat, und da beginnt das Klischee: Das sollte man nicht mit Offenheit verwechseln. Ein Hamburger, der in der S-Bahn nie die Zähne auseinander kriegt und im Ruhrgebiet plötzlich all die quatschenden Fremden für seine Freunde hält, irrt: Das ist nicht persönlich gemeint. Denn so unkompliziert und direkt es bei solchen Pläuschchen unter Fremden auch werden kann – es ist egal, wer dabei ist. Solange jemand nicht allzu sehr aus dem Rahmen fällt, wird halt gequatscht.
So wie der schluffige Typ, der immer in den Regionalexpress stieg, mit dem ich zu Schulzeiten jede Donnerstagnacht von der Arbeit in Bochum nach Essen zurückfuhr. Den immer leicht angetrunkenen Parka-Typen hatte ich ein paar Mal gesehen, einmal erzählte er einfach so vor sich hin von seiner »Scheißarbeit«. Als er beim nächsten Mal zustieg, habe ich in falsch verstandener Verbrüderung der nachts Bahnfahrenden gefragt, wie es nun läuft. Der Typ schaute mich nur entgeistert an und schlurfte weiter. Und das war wohl das Beste, was mir in dieser Situation passieren konnte.
KIEZKINDER Die erste tiefe, für mich schwer zu ertragende Ungerechtigkeit erlebte ich, als ich etwa fünf Jahre alt war. Mein Leben spielte sich damals in einem Dreieck ab, das weniger als hundert Meter Schenkellänge maß: Da war unsere Wohnung, ein vielleicht fünfzig Quadratmeter messender Sozialwohnungsschuhkarton in Hamborn, in Laufentfernung nach Marxloh. Direkt nebenan lag mein Kindergarten. Wenn der schloss, dackelte ich hinüber zur Bäckerei Prinz, wo meine Mutter als Auslieferungsfahrerin arbeitete.
Manchmal nahm sie mich mit, sie fuhr einen T1-VW-Bus mit nur einer Sitzbank, hinten gab es Gestelle für Backbleche. Wenn sie gerade auf Tour war, saß ich in der Backstube und beschäftigte mich selbst. Ab fünf bekam ich dann den Schlüssel; wenn ich Langeweile hatte, konnte ich mich also auch allein ins (natürlich geteilte) Kinderzimmer zurückziehen: Meine Mutter hatte mit meiner drei Jahre jüngeren Schwester eh alle Hände voll zu tun. Nach heutigen Maßstäben war das Maß an scheinbarer Nicht-Beaufsichtigung kaum zu glauben.
Der Eindruck täuscht jedoch. Es gab genügend Erwachsene, die ein Auge auf mich hielten: Da waren die Eigner der Bäckerei, die anderen Verkäuferinnen. Da waren vor allem aber auch die Nachbarn: Wir Kinder gingen in vielen Wohnungen ein und aus.
Im gleichen Haus wohnte mein Freund Rolf. Wir beide waren echte TV-Junkies: Jede Woche mussten wir die zwanzig Minuten Fernsehen sehen, die man Kindern programmtechnisch damals gönnte. Das fand in der Wohnung über uns statt, bei einem alten Ehepaar, die sozusagen Early Adopters waren: Sie besaßen bereits Ende der Sechziger einen Schwarzweißfernseher, über den freitags ab 18:40 Uhr Pat und Patachon oder Die kleinen Strolche liefen.
Die Sendungen waren Vorläufer der Väter der Klamotte, die Anfang der Siebziger (und auch da wieder freitags, dann ab 18:25 Uhr) folgen sollten, und genau so gemacht – ein Mischmaschformat von mit ironischen Sprechertexten unterlegten Stummfilm-Clips. Sprecher all dieser Serien war der begnadete niederrheinische Kabarettist Hanns Dieter Hüsch, der später auch Laurel und Hardy (damals natürlich Dick und Doof geheißen), Buster Keaton oder den kleinen Strolchen seine Stimme lieh.
Fast noch prägender wurde bei den Vätern die Musik von Quirin Amper und Fred Strittmacher, der später als Filmkomponist noch einige deutsche Softsexfilmchen vertonen sollte: Der beherzte Einsatz von Instrumenten wie Mundorgel (»Ptoiiiiing!«) und Pauke (»Bummmms!«) mag diese ganz spezifischen Karrieren befeuert haben. Ptoing, Bums und Hanns Dieter Hüsch wurden jedenfalls zur TV-Grundversorgung einer ganzen Generation, deren Konsum sich zunächst auf zwanzig Minuten pro Woche beschränkte. Sie brannten den Freitagstermin in unsere Hirne – wer den verpasste, erlebte eine Woche Fernsehentzug. Genau der wurde bald zu einer beliebten, wenn auch nicht der einzig üblichen Disziplinierungsmaßnahme.
Wie auch immer. Die alten Leutchen, sehr kultivierte, von irgendwo aus dem Süddeutschen zugewanderte Menschen, freuten sich jede Woche auf uns Kinder. Das klingt nach einem Stückchen heiler Welt, und das war es auch mehr oder minder: Es war eine kleine Blase der Geborgenheit in äußerst rauem Umfeld. Denn die Ecke, in der wir damals lebten, war ein ganz schön heißes Pflaster. Vor allem meine Mutter, die ursprünglich aus dem besitzenden Mittelstand kam, also vermeintlich »schlecht« geheiratet hatte, litt darunter. Häusliche Gewalt gehörte ringsum zum Alltag, auch Gewalt auf der Straße unter Kindern wie unter Erwachsenen: Wir lebten in einer sogenannten »Siedlung« – in anderen Städten würde man von einem Kiez reden.
Der Kiez ist eine stachelige Heimstatt. Im Kleinen hat er oft fast dörflichen Charakter: Es bilden sich anhand unausgesprochener Regeln definierte Untereinheiten, Nachbarschaften, in denen die Leute zusammenhalten wie Pech und Schwefel, in der jeder alles vom anderen weiß. Zugleich ist es möglich, dass man keinerlei Verkehr hat mit dem Gesocks, den Paselacken vom Block nebenan oder gegenüber. Dass eine Mutter ihren Fünfjährigen warnt, nie weiter als »bis anne Ecke, wo die Bude is« zu gehen, aber »bloß nich inne Siedlung«. Zur anderen Seite raus durfte man unter Umständen laufen, solange die kleinen Füße trugen – Hauptsache, man lief nicht in diese kriminelle Siedlung hinein.
Die Siedlungen des Ruhrgebiets waren einst als Schlafstätten für Arbeiter konzipiert worden, und so sah das auch aus. Eine ernstzunehmende Infrastruktur gab es nicht. Die hat sich in den Siedlungen heute eher noch verschlechtert als verbessert: Wie überall sieht man auch im Pott einen Trend zur Konzentration, zum großen Supermarkt, zum Einkaufszentrum. Es entstehen urbane Landschaften, in denen man zum Einkauf pendelt, als lebe man auf dem Lande.
Wir wohnten am Ende der Straße, einem Zug von vielleicht zehn Häusern, wo es damals immerhin einen Bäcker, einen Kindergarten, eine Reinigung, eine Bude und einen winzigen Schrottplatz gab. In die andere Richtung gab es nichts außer großen, grauen Siedlungsblöcken mit ihren riesigen, mit slumartigen Bretterverschlags-Schrebergärten zugebauten Innenhöfen. Hier und dort wird eine Bude eine Art Notfallrundumversorgung geboten haben. Doch die Tiefe der Siedlungen war nicht nur Terra inkognita, sondern sogar gefährliches Gelände – für uns Kinder.





























