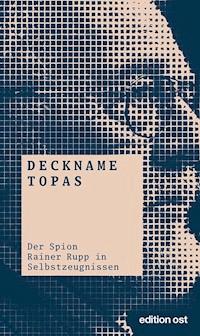
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition ost
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rainer Rupp arbeitete in der NATO-Zentrale in Brüssel. Dort war er der wichtigste Mann der DDR-Aufklärung und damit auch Moskaus. Seine Informationen waren von existenzieller Bedeutung. Zu Beginn der 80er Jahre, auf dem Höhepunkt der Raketenkrise, gab er Entwarnung: Die NATO plane keinen Überfall auf den Osten. Der Atomkrieg fiel aus. Klaus Eichner und Rupps damaliger Führungsoffizier Karl Rehbaum haben unveröffentlichte Briefe, Selbstzeugnisse und Texte zusammengetragen, die das Bild eines überzeugten Friedenskämpfers zeigen und spannende Einblicke in die Arbeit eines militärischen Aufklärers geben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Rainer Rupp alias »Topas« hat noch keine Memoiren vorgelegt. Das Interesse an der wichtigsten Quelle im Hauptquartier der NATO, die die Aufklärung der DDR in Brüssel hatte, ist aber ungebrochen. So haben denn zwei Freunde von ihm aus Selbstzeugnissen von Rainer Rupp, aus Korrespondenzen und Interviews, die er während und nach seiner Haft gab, das Leben einer ungewöhnlichen Persönlichkeit zu rekonstruieren versucht.
Rainer Rupp war ein Überzeugungstäter, und er ist es auch noch heute. Als Marxist glaubt er an die Veränderbarkeit der Welt – und an die Notwendigkeit, sie zu verändern, wenn denn Frieden und soziale Gerechtigkeit herrschen sollen.
Als Analytiker und Publizist setzt er sich unverändert mit zentralen Menschheitsfragen auseinander. Er war und er ist ein Aufklärer in des Wortes doppelter Bedeutung.
Das Buch ist das erste in einer Porträt-Reihe, die wichtigen Spionen der DDR, die damals mit Recht »Kundschafter des Friedens« hießen, gewidmet ist.
Die Herausgeber
Klaus Eichner, Jahrgang 1939, von 1957 bis 1990 Mitarbeiter des MfS, letzter Dienstgrad Oberst. Von 1957 bis 1968 in der Spionageabwehr, danach in der Aufklärung des MfS; leitender Analytiker auf dem Gebiet der US-Geheimdienste; zuletzt Leiter des Bereiches IX/C (Auswertung/Analyse der Abteilung IX der HV A – Gegenspionage).
Karl Rehbaum, Jahrgang 1937, von 1955 bis 1990 Mitarbeiter des MfS, letzter Dienstgrad Oberst. Bis 1965 in der Abwehr (Schutz der Volkswirtschaft), danach in der HV A, spezialisiert auf NATO und EG. Zuletzt Leiter der Abt. XII. Führungsoffizier von Rainer Rupp.
Wegen Landesverrats zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.
Impressum
ISBN eBook 978-3-360-51014-3
ISBN Print 978-3-360-01846-5
© 2013 edition ost im Verlag Das Neue Berlin, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
unter Verwendung eines Fotos von Robert Allertz
Fotos: Robert Allertz
Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH
Neue Grünstr. 18, 10179 Berlin
Die Bücher der edition ost und des Verlags Das Neue Berlin erscheinen in der Eulenspiegelverlagsgruppe
www.edition-ost.de
Klaus Eichner/Karl Rehbaum
(Herausgeber)
Deckname Topas
Der Spion Rainer Rupp
in Selbstzeugnissen
Inhalt
Jörg Hafkemeyer ind der ARD
Werner Großmann: Auftakt einer neuen Reihe
Die Jagd auf »Topas«
Rainer W. Rupp: Herkunft und Entwicklung
Mit der HV A in das Herz des Nordatlantikpaktes
Mittendrin in der NATO
Krisenjahr 1983. Steht die Welt vor einem atomaren Inferno?
Der Prozess
Gegen Haftschikanen – für ein baldiges Haftende
Marxistischer Analytiker und Publizist
Anlagen
Auszüge aus dem psychologischen Gutachten über Rainer Rupp für den Prozess vorm Oberlandesgericht Düsseldorf, erstellt von Prof. Dr. Steinmeyer von der TH Aachen
»Zwischen Gulaschsuppe und Kartoffelschalen«
»Sie nannten ihn Topas«
»Damals war ich Aufklärer, heute kläre ich auf«.
Lebensdaten
Topas war nicht der klassische Verräter,
der aus Geldgier handelte, sondern ein Überzeugungstäter.
»Ich steh zu dem, was ich getan habe. In dem Moment, wo ich es getan habe, habe ich geglaubt,
dass es meine moralische Pflicht war, es zu tun.«
»Der Mann, der die NATO verriet – Topspion Topas«,
ARD-Dokumentation von Jörg Hafkemeyer,
Erstausstrahlung 2001
Auftakt einer neuen Reihe
Mit dem vorliegenden Buch beginnen ehemals verantwortliche Mitarbeiter der Hauptverwaltung A eine Porträt-Reihe, in der bedeutsame Kundschafter und Kundschafterinnen der DDR möglichst detailliert dargestellt werden. Dabei greifen sie auf Texte und Aufzeichnungen der Porträtierten, vorliegende Publikationen und andere Berichte zurück.
Mit dieser Porträt-Reihe soll auch an Kundschafter der DDR erinnert werden, über die in der Vergangenheit wenige – und oft auch falsche – Informationen in die Öffentlichkeit gelangten. Damit werden Mitarbeiter der HV A und die noch lebenden Kundschafter erneut ihrer oft von offizieller Seite verleugneten Rolle als Zeitzeugen des Kalten Krieges gerecht. Zudem soll ihnen auf diese Weise ein publizistisches Denkmal gesetzt werden – in einer Zeit, da Erinnerungen an den Sozialismus geschleift werden.
Nicht ohne Grund wird diese Serie mit einem Porträt über den Kundschafter Rainer Rupp begonnen. Er war eine der bedeutendsten Quellen der HV A, der mit seinem Zugang zu NATO-Dokumenten der höchsten Geheimhaltungsstufen und seinem kreativen Agieren, selbst besonders geschützte Geheimdokumente für die HV A zu beschaffen, entscheidende Beiträge für die militärstrategische Aufklärung des sozialistischen Lagers geleistet hatte.
Gleichzeitig war und ist Rainer Rupp auch heute noch unermüdlich als marxistischer Publizist und Analytiker in linken Medien erfolgreich tätig. Die Vielzahl seiner Publikationen zwang die Autoren, eine strenge Auswahl zu treffen. Leser der Tageszeitung junge Welt finden ihn fast täglich in dieser Zeitung.
Die Herausgeber konnten auf Rupps umfangreiche Korrespondenz zurückgreifen, die er in der Untersuchungshaft und in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken führte. Darin fixierte Rainer Rupp eine Vielzahl Überlegungen zu politischen Problemen, die unverändert Anregungen für Diskussionen auf marxistischer Grundlage geben. Besonders beeindruckten mich seine Gedanken über die Ursachen unserer Niederlage, die Defizite des Realsozialismus in der Sowjetunion und der DDR sowie seine Überlegungen zu Elementen einer Strategie für die Schaffung einer Alternative zur kapitalistischen Gegenwart.
Ich danke den Autoren dieser Serie für ihre Bemühungen und wünsche der Porträt-Reihe eine weite Verbreitung – auch und nicht zuletzt in den uns nachfolgenden Generationen.
Generaloberst a. D. Werner Großmann, letzter Leiter der Hauptverwaltung A des MfS der DDR
Werner Großmann und Rainer Rupp bei der Vorstellung des Buches »Militärspionage« im Gebäude des Neuen Deutschland, 8. September 2011
Die Jagd auf »Topas«
Am 15. Januar 1990 beging Dr. Heinz Busch Fahnenflucht. Der Oberst des MfS war stellvertretender Leiter der Abteilung VII der HV A (»Politische Auswertung«). Den Verantwortlichen in der Aufklärung war bewusst, dass er sein Wissen über Quellenpositionen des Dienstes dem Gegner offenbaren würde.
Busch war verantwortlich für alle militärpolitischen Analysen der HV A und erhielt zu diesem Zweck alle relevanten Informationen.
Nach den Quellenschutz-Regeln der HV A kannte er weder die Klarpersonalien der Quellen noch ihre konkreten Positionen in den Zielobjekten. Die Auswerter wussten nur die Decknamen und Registriernummern des Vorganges. Sie erhielten die Informationen aus dem Objekt in entsprechender Neutralisierung. Jedoch ließ es sich nicht vermeiden, dass bei einem langjährigen, dichten Informationsfluss ein erfahrener Auswerter mit guten Kenntnissen über das Zielobjekt ungefähre Vorstellungen über die Zugangsmöglichkeiten der Quelle und damit über deren mögliche Position im Objekt gewann.
Darum war Busch in der Lage, bundesdeutschen Behörden mitzuteilen, dass die Abteilung XII der HV A eine Quelle im Herzen der NATO führte, die den Decknamen »Topas« trug. Diese Tatsache war folglich seit Mitte Januar 1990 den Sicherheitsbehörden der BRD und der USA bekannt.
In dieser Zeit wurde eine Sonder-Arbeitsgruppe unter Leitung von Regierungsdirektor Stüben, Abteilung IV (»Spionageabwehr«) des Bundesamtes für Verfassungsschutz, aktiv, um »Topas« zu identifizieren. Ihr gehörten Mitarbeiter des MAD und des BND an, es gab entsprechende Arbeitsverbindungen zu den Sicherheitsinstitutionen der NATO. Besonders enge Beziehungen unterhielt die Sonder-Arbeitsgruppe zu den Geheimdiensten der USA, ihren Vertretern in der BRD und in der NATO.
Die Bundesanwaltschaft unter Leitung des nachmaligen Bundesanwalts von Langsdorff leitete ein Ermittlungsverfahren ein und beauftragte das Bundeskriminalamt mit intensiven Recherchen, die vor und auch nach der Enttarnung von »Topas« mit hohem Aufwand betrieben wurden.
Erst im ersten Halbjahr 1992 tauchten darüber Informationen in Medien der BRD auf. Die Journalisten beriefen sich auf eine »regelmäßig geheim tagende Expertengruppe aus allen deutschen Sicherheitsbehörden einschließlich der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe«. (Die Welt vom 13. Mai 1992)
Gleichzeitig kamen spezielle Legenden auf. Sehr schnell wurde ein ganzes Agentennetz der HV A in der NATO ausgemacht, bestehend aus Informanten unterschiedlicher Nationalität auf mittlerer und hoher Ebene des Bündnisses.
Die Schwierigkeiten bei der Enttarnung von »Topas« führte man darauf zurück, dass dieser angeblich zu einem nachrichtendienstlichen Doppelspiel der amerikanischen Geheimdienste gehörte, in das die westlichen Verbündeten und die Führungskräfte der NATO keinen Einblick hätten.
Nicht zuletzt wurde die Behauptung kolportiert, die HV A habe die Quelle rechtzeitig an den sowjetischen Geheimdienst übergeben und die bisherigen Führungsoffiziere von »Topas« unterlägen damit einer besonderen Schweigepflicht.
Diese und weitere Spekulationen beherrschten bis Mitte 1993 die Medien in dieser Sache, bis schließlich die Quelle der HV A enttarnt und diese bei einem Besuch der Eltern in Saarburg festgenommen worden war.
Jedoch war, wie sich bald zeigte, der Fahndungserfolg nicht den hochbezahlten deutschen Spürnasen zuzuschreiben – die Identität der Quelle »Topas« lieferte ihnen die CIA mit Hilfe jener Akten, die in der Öffentlichkeit unter der Bezeichnung »Rosenholz« bekannt wurden. Dazu hieß es im Spiegel 32/1993 (»Auf den Knien zur CIA«): »Um die US-Connection zu verheimlichen, haben Verfassungsschützer und das Bonner Kanzleramt seit Wochen falsche Spuren gelegt. Sie ließen den Spekulationen, die sommerliche Agentenjagd sei auf große Aktenlieferungen vom Moskauer KGB zurückzuführen, freien Lauf – und heizten die Gerüchteküche durch doppeldeutige Interpretationen weiter an. Dabei, so zeigt sich jetzt, hat es eine Aktenübergabe in großem Stil von Moskau an Bonn nicht gegeben.«
Zum Komplex »Rosenholz« eine kurze Erinnerung: Die CIA erhielt auf bisher unbekannten Wegen eine Kopie von Registrierungsunterlagen der HV A – das waren mikroverfilmte Karteikarten und Statistikunterlagen, keine Akten von Quellen.
Die Karteikarten widerspiegelten den Stand der Personenerfassungen der HVA bis Ende 1988. Das betraf alle Personenhinweise, die für die HVA relevant waren – und auch die Klarpersonalien von Quellen, Kontaktpersonen und anderen in den registrierten Vorgängen bedeutsamen Personen.
Zur Ergänzung existierte eine sogenannte Vorgangskartei. Durch Vergleich beider Karteikomplexe war die Identifizierung der Quellen möglich.
Die CIA informierte erst nach Abschluss ihrer Untersuchungen die BRD und andere NATO-Partner über den Besitz der HV A-Unterlagen. Das war etwa Anfang 1993. Eine Gruppe von Mitarbeitern des Bundesamtes für Verfassungsschutz wurde nach Washington entsandt, um dort Kopien der Karteikarten einzusehen und Angaben über HV A-Kontakte mit Bundesbürgern abschreiben. Diese Aktion erhielt im Verfassungsschutz intern die Deckbezeichnung »Rosenholz«.
Erst nach langwierigen Verhandlungen erhielt die Bundesregierung Jahre später von der CIA einen Satz elektronischer Datenträger mit Abschriften der Unterlagen. Über die Vollzähligkeit der Angaben kann man nur spekulieren.
Nachdem Rainer Rupp als »Topas« identifiziert worden war, mussten sich die Sicherheitsbehörden der BRD gedulden. Rupp lebte damals mit seiner Familie in Belgien und konnte dort nicht von deutschen Beamten festgenommen werden. Erst als Rainer Rupp zu einer Familienfeier nach Saarburg kam, konnten sie zuschlagen.
In seinem Beitrag »Mittendrin in der NATO« im Band 6 der Geschichte der HV A (»Militärspionage. Die DDR-Aufklärung in NATO und Bundeswehr«) beschrieb Rainer Rupp, wie er und seine Ehefrau die Fahndung nach der Quelle »Topas« erlebten. Darin nahm er auch Bezug auf den Verräter Heinz Busch: »Am 15. Januar 1990 war der Leiter der militärpolitischen Auswertung der Abteilung VII in der HV A, Oberst Dr. Heinz Busch, zum Bundesnachrichtendienst übergelaufen und hatte als Morgengabe sein Wissen über ›Topas‹ mitgebracht. Zuerst glaubt man im BND-Hauptquartier in München, es handelte sich bei Busch um einen Angeber, als er seinen Verhörspezialisten versicherte, dass ›die NATO so durchlässig‹ sei ›wie ein Sieb‹. Überläufer übertreiben gerne, um sich wichtig zu machen und so ihre Verhandlungsbasis zu stärken bzw. ihren Preis in die Höhe zu treiben. Zudem hatte Busch aus Angst vor seiner Entdeckung beim Grenzübertritt kein einziges von ›Topas‹ an die HV A geliefertes Dokument mit in den Westen gebracht, sondern lediglich die Vorgangsnummer und den besagten Decknamen.
Als Oberst Dr. Busch dann jedoch zu erzählen begann und seine auf Grundlage der ›Topas‹-Dokumente über viele Jahre erworbenen, intimen und umfangreichen Kenntnisse über die militärische Planung der NATO und ihrer Mitgliedsstaaten zum Besten gab, gingen den BND-Zuhörern die Augen über. Schleunigst wurde Anfang 1990 eine hochrangige Arbeitsgruppe zusammen gestellt, die sich aus Vertretern des BND, der Staatsschutzabteilung des BKA, des Bundesverfassungsschutzes, des Militärischen Abschirmdienstes und der Bundesanwaltschaft zusammensetzte und die die Suche nach ›Topas‹ mit einer ebenfalls zu diesem Zweck neu gegründeten Gruppe im NATO-Hauptquartier in Brüssel koordinierte. Im April/ Mai 1990 lief die Operation nach dem meistgesuchten Mann der BRD, die – so die Bundesanwaltschaft später – ›zur größten Suchaktion‹ der Geheimdienste der BRD werden sollte, bereits auf Hochtouren. Aber die Dienste wussten nicht genau, wo sie mit der Suche beginnen sollten.
Die Informationen von Bush entsprachen nicht unbedingt den aus den Vernehmungen von Übersetzern, Sekretärinnen, Technikern und anderem Personal der HV A gewonnen Erkenntnissen über ›Topas‹. Zugleich wurde für die westdeutschen Spürhunde langsam klar, dass das NATO-Material, das Oberst Busch zur Analyse bekommen hatte, nur die Spitze eines Eisberges war. Nach über einem Jahr akribischer Untersuchungen und Verhöre ehemaliger HV A-Mitarbeiter und anderer DDR-Bürger war klar, dass neben den militärischen und militärpolitischen Dokumenten aus der NATO-Abteilung für ›Verteidigungsplanung und -politik‹ (Defence Planning und Policy Division), mit denen sich Oberst Dr. Busch hauptsächlich beschäftigt hatte, ganz offensichtlich auch andere Auswerter der HVA Material von ›Topas‹ bekommen hatten, das aus den anderen vier Hauptabteilungen des NATO-Hauptquartiers stammte.
Auf Grund der Fülle des von ›Topas‹ aus allen NATO-Abteilungen gelieferten Materials schlossen die Verfolger schließlich, dass sich hinter dem Decknamen nur ein ›Spionagering‹ verbergen konnte. Aber auch diese Annahme half nicht weiter, und die Suche nach den Mitgliedern des ›Rings‹ blieb ohne Erfolg.
Dank in früheren, aktiven Zeiten getroffener, sorgfältiger Vorbereitung und glücklicher Umstände, deren Hintergründe das Thema dieses Beitrages sprengen würde, konnte ich die Suche nach ›Topas‹ in der NATO von Anbeginn im Detail mitverfolgen. Hinzu kam, dass ich seit vielen Jahren ständigen und freundschaftlichen Umgang mit den führenden Mitarbeitern der NATO-Sicherheitsabteilung hatte, der Leiter der Gruppe, die ›Topas‹ fassen sollte, mit eingeschlossen.
Während der dreieinhalb Jahre dauernden Suche stand ich bis zuletzt nicht in Verdacht. Erst nachdem es der CIA nach jahrelangen Bemühungen im Frühling 1993 gelungen war, die zwei im Rahmen der sogenannten ›Operation Rosenholz‹ für angeblich eine Million Dollar aus bisher ungeklärten Quellen beschafften Personaldateien der HV A gegenseitig abzugleichen, konnte man in Washington schließlich im Juni 1993 die Identität von ›Topas‹ zweifelsfrei bestätigen.
Am 31. Juli 1993, als ich mit meiner Ehefrau und unseren drei kleinen Kindern von Brüssel zum Geburtstag meiner Mutter in meinen Heimatort in der Nähe von Trier kam, schlug die Falle zu. Über 70 Mitarbeiter des BKA-Staatsschutzes und der Polizei waren im Einsatz und hatten die Umgebung rund um das Elternhaus weiträumig gesichert. Meine Ehefrau und ich wurden verhaftet.«
Rainer Rupp bei der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e.V. (GBM) in Berlin, 5. November 2011.
Rechts Prof. Gerhard Fischer, 1. Sprecher des Berliner Alternativen Geschichtsforums
Rainer W. Rupp:
Herkunft und Entwicklung
Biografische Angaben aus dem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf von 1994
»Der heute 49-jährige, bisher nicht vorbestrafte Angeklagte Rainer Rupp wurde in Saarlouis als nichteheliches Kind von Margarete Rupp geboren.
[…]
1958 – nach der Eheschließung seiner Mutter – zog Rainer Rupp zu ihr und seinem Stiefvater Rudolf Jacoby nach Saarburg und besuchte von nun an ein neusprachliches Gymnasium in Trier, nachdem er zuvor nach vierjähriger Grundschulzeit in Schwalbach auf das Humanistische Gymnasium in Saarlouis gewechselt war. Zu seinem Stiefvater hatte er ein gutes Verhältnis ebenso wie zu seinen drei Halbbrüdern.
Mit 16 Jahren – veranlasst durch die vermeintlich spießbürgerliche Enge einer Kleinstadt – riss der Angeklagte Rainer Rupp für ca. 6 bis 8 Wochen nach Paris aus; zuvor hatte er bereits einen Sommerurlaub an der Nordsee »überzogen« und war per Autostopp für einige Wochen nach Schweden gereist.
[…]
Nach bestandenem Abitur studierte er ab 1964/65 Volkswirtschaft an den Universitäten in Mainz (bis etwa 1969), Brüssel (bis 1970) und Bonn, wo er im Frühjahr 1974 sein Studium erfolgreich mit der Note 2+ abschloss.
Im Anschluss fand er zunächst an der Universität in Brüssel eine Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter für ein Forschungsprojekt über internationale kurzfristige Kapitalbewegungen. Bereits 1975 arbeitete er gleichzeitig – zunächst nur halbtags – bei einer Firma IRELCO in Brüssel, die Industrieinteressen bei den politischen Gremien wahrnahm, als rechte Hand des Geschäftsführers. Anfang 1976 wechselte er zur Brüsseler Industriebank CEDIF und fungierte dort ein Jahr als Leiter der Abteilung für INDUSTRIAL ECONOMIC RESEARCH.
Seit dem 15. Januar 1977 war er bis zu seiner Festnahme am 31. Juli 1993 als Country Rapporteur im Wirtschaftsdirektorat der NATO tätig, wo er zuletzt umgerechnet etwa 16.000 DM netto monatlich verdiente.«
Politische Entwicklung
Mit Beginn des inoffiziellen Kontaktes zur HV A wurde Rainer Rupp gebeten, seine öffentlichen politischen Äußerungen und Aktivitäten weitgehend einzustellen bzw. zu neutralisieren. In einer späteren Phase der Zusammenarbeit mit der HV A erfolgte seine Aufnahme als Mitglied der SED. Nach 1989/90 bzw. nach seiner Inhaftierung war er Mitglied der PDS und nahm unmittelbar nach seiner Freilassung aktiv und öffentlich an Parteitagen und zentralen Veranstaltungen der Partei teil.
Entwicklungen in der PDS, die seiner politischen Überzeugung zuwiderliefen, veranlassten Rainer Rupp, aus dieser Partei auszutreten. Rainer Rupp: »Ich bin Marxist, weil ich mit Marx konform gehe, dass die Geschichte der Menschheit eine Geschichte der Klassenkämpfe ist«. (Tagesspiegel vom 2. Januar 1999)
»Für Rupp war diese Zeit, abgesehen von hoher psychischer Belastung, nicht frei von Konflikten. Er war sich seiner Verantwortung für die Erhaltung des militärischen Gleichgewichts von NATO und Warschauer Pakt bewusst. Zugleich erkannte er mit wachsender Beunruhigung, dass der Sozialismusversuch in der DDR womöglich scheitert, wenn nicht notwendige wirtschaftliche und politische Reformen durchgeführt würden«, schrieb das Neue Deutschland über ihn in der Haft am 30. Juli 1998.
Am 27. Dezember 1995 reflektierte Rupp in einem Brief seine innere Haltung in dieser Frage: »An manchen Tagen überkommt mich eine innere Leere und Resignation, wenn ich daran denke, welche historische Chance wir verspielt haben, die Idee des Sozialismus in einer wirklich humanen Gesellschaft zu verwirklichen. Hierfür hatte ich mit jeder Faser meines Herzens gekämpft und auch die Sicherheit meiner kostbaren Familie aufs Spiel gesetzt. […]
Da ich aber auch ein politischer Mensch bin, sehe ich mich auch als Teil der Gesellschaft und ihrer Entwicklung. Und hier gibt es wenig Positives. Andererseits versuche ich mich in die Rolle jener Genossen zu versetzen, die unter ungleich schwierigeren politischen und physischen Bedingungen im Knast und im Konzentrationslager saßen und lasse deren Widerstandskraft mir Vorbild sein. Allerdings hatten jene Genossen trotz ihrer ungleich viel schwierigeren Lage doch einen großen Vorteil: die Solidarität der Partei, und die Partei wusste, wofür sie stand.«
Rainer Rupp und seine Familie
In seinen Briefen an Freunde und Genossen äußerte sich Rainer Rupp ab und zu auch über seine Sorgen, welche Auswirkungen seine Verhaftung, der Prozess und die lange Haftzeit auf seine Ehefrau Ann und die Kinder haben könnten. Letzten Endes siegt immer wieder der Optimismus. Aus allen Zeilen ist seine tiefe Zuneigung zur Familie spürbar.
Am 4. September 1994 notierte er in der UHA Koblenz:
»Dies irae, dies ulla« (Der Tag des Zornes naht) – hier: der Tag des Prozessbeginns naht mit Riesenschritten. […]
Quälend langsam vergeht die Zeit, wenn ich an meine Familie denke; an Ann, die ich heute genauso liebe wie am ersten Tag – wenn nicht noch mehr – und der gegenüber ich trotzdem große Schuld auf mich geladen habe.
Und dann sind noch die Kinder da. Ich hatte mich immer so bemüht, ein guter Vater zu sein, Freund und Erzieher und liebender Vater, der immer da war für sie, wenn sie etwas bedrückte. Und es hat mir soviel Freude gemacht, in jeder ihrer Entwicklungsphasen dabeisein zu können. Ich vermisse sie sehr – und noch mehr, wenn ich sehe, wie sehr ich ihnen fehle, wenn sie mich nach einem Besuch hier wieder verlassen müssen. Das macht mir sehr zu schaffen. Auch jetzt, wo ich darüber schreibe, werde ich ganz nervös. Da ist nichts, aber auch gar nichts, was man machen kann. Zu dem Gefühl der absoluten Hilflosigkeit kommt dann auch noch das alles überlagernde Bewusstsein der eigenen Schuld. Das kann ich auf niemand anderes abwälzen oder mich sonst wie herausreden.
[…]
Gerade jetzt, vor der bevorstehenden Prüfung (gemeint ist der Prozess – d. Hrsg.) ist die Gesundheit besonders wichtig. Das ist auch das Thema, das mich hier im Knast besonders beschäftigt: die Angst, dass Ann oder die Kinder krank werden könnten. Auch die Gewissheit, daß ich für eine sehr lange Zeit das Leben und die Entwicklung meiner Familie nur noch passiv aus der Ferne beobachten kann, belastet mich sehr. […] Ich muss da ganz alleine durch. Und solange es Frau und Kindern gut geht, schaffe ich das auch.«
Aus einem Brief zum Jahresende 1995:
»Das ist aber alles zu ertragen, da trotz aller Widrigkeiten meine Familie intakt geblieben ist; die Beziehungen zu meiner Frau und den Kindern sind fest wie eh und je. Und auch meine Eltern und Brüder – obwohl sie meine nachrichtendienstliche Tätigkeit, und wie es dazu kam, nicht verstehen und viel weniger gutheißen – stehen weiter hinter mir. So lässt sich selbst die härteste Haftzeit ertragen.«
Am 27. Februar 1996 schrieb er:
»Zum Glück hat sich die Generalbundesanwaltschaft an unseren Deal gehalten, und meine Frau ist draußen geblieben. So haben unsere Kinder wenigstens einen Elternteil.
Meine Frau Ann und die Kinder wohnen jetzt in einem kleinen Dorf unweit von Trier, das ja jedem Marxisten bekannt ist, und in der Nähe (5 km) von meinen Eltern und Brüdern.
Weder meine Frau noch die Kinder werden wegen meiner ›Tat‹ stigmatisiert, sondern sie sind mittlerweile in der dörflichen Gemeinschaft recht gut integriert. Und ich bin auch froh, dass jetzt, da meine beiden Söhne (14 und 16) in die Pubertät kommen, die Familie in einer ländlichen Gegend wohnt, wo ›die Welt noch in Ordnung‹ ist und nicht in einer Großstadt, zumal ich als Vater bei der Erziehung ausfalle.
Und gerade die Erziehung unserer drei Kinder (es gibt noch ein Mädchen von 9 Jahren ) zu offenen, kritisch-selbstbewussten Menschen mit dem aufrechten Gang hat mir so sehr am Herzen gelegen. Trotz aller Schwierigkeiten scheint meine Frau aber auch dieser Aufgabe recht gut gewachsen. Ann steht fest zu mir und sie ist eine großartige Kameradin, liebe Frau und gute Mutter; und leider z. Z. der einzige Brotverdiener. Sie hat zur Zeit eine Dreiviertel-Stelle an der Uni in Trier, wo sie für einen recht bekannten Politikwissenschaftler arbeitet. Der hat aber nun einen Ruf nach Potsdam bekommen und will sie mitnehmen. Sie aber möchte die Kinder nicht schon wieder aus ihrem Umfeld reißen, in das sie gerade erst richtig hineingewachsen sind und in dem sie sich wohlfühlen. Da Ann jedoch allseits geschätzt wird, braucht sie sich um ihren Arbeitsplatz vorerst keine Sorge zu machen.
Und da ist auch immer noch die Großfamilie. Meine Eltern (Mutter und Stiefvater) und meine drei jüngeren Stiefbrüder unterstützen uns, wo sie nur können. Auch stehen sie weiter fest hinter mir, wenn sie auch meinen Einsatz für das ›marode DDR-System‹ nicht verstehen können. Mit 20 kam Vater für vier Jahre in russische Kriegsgefangenschaft und hat sich dort sein Bild über Russland und den Kommunismus gemacht. Dabei war sein Bild von den Russen nie negativ; er betonte stets, dass er fair behandelt wurde; zwar gab es für die Kriegsgefangenen kaum etwas zu essen – zumindest vor und einige Zeit nach Kriegsende –, aber die Russen hatten ja selbst nichts zu essen. Und wer arbeitet, soll auch essen; so oder ähnlich zitierte er Stalin. Und zu arbeiten verstand Vater und wusste sich als Techniker und Mechaniker in den verschiedenen Lagern und Betrieben ›unentbehrlich‹ zu machen.
Aber der Kommunismus kann nie bestehen, weil die Eigensucht des Menschen stärker ist; so versuchte er mich schon als Jugendlichen zu belehren, wenn ich mich für marxistische Ideen begeisterte. Er hat die größten Schwierigkeiten, meine ›Tat‹ zu verstehen. Und trotzdem behandelt er mich weiter wie seinen Sohn und nicht wie ein Stiefkind.
In meinem Elternhaus bekam ich eine humanistische Erziehung, und es war Mutter, die alles zusammenhielt und uns schon als Kinder lehrte, dass Meinungsverschiedenheiten kein Grund waren, sich einander böse zu sein. Und dieser Zusammenhalt innerhalb der Familie hat auch nun während meiner Einkerkerung Bestand.
Mehr Verständnis für mein Handeln finde ich bei meiner Mutter; so sind Mütter halt eben. Seit meiner Verhaftung hat sie viel über den Kommunismus gelesen; und zwar nicht die vorgekauten Meinungen, die dazu in der gängigen BRD-Literatur zu finden sind. Von großem Einfluss war dabei auch ein Zusammentreffen meiner Mutter mit dem (Schriftsteller-)Ehepaar Schuder-Hirsch aus Ostberlin. Rudolf und Rosemarie haben mich quasi ›adoptiert‹, wir schreiben uns regelmäßig, und sie haben mich hier im Knast in Saarbrücken sogar besucht. Sie schicken meinen Kinder zu jeder Gelegenheit Bücher und setzen sich auch sonst wo immer möglich für mich/uns ein.«
Eintrag am 24. März 1996:
»Die Jungs tragen Sonntagmorgens Zeitungen aus und verdienen sich so ein Taschengeld, und deshalb konnten sie nicht mitkommen. Leider bekamen beide eine Deutscharbeit mit der Note 5 zurück. Die lange Zeit auf einer englischsprachigen Schule macht sich leider immer noch negativ bemerkbar und addiert zu unseren Sorgen.«
Brief am 3. Juli 1997:
»Meiner Frau und unseren Kindern geht’s den Umständen entsprechend gut. In ihrer neuen Umgebung in dörflicher Atmosphäre sind sie integriert und respektiert. Es gibt keinerlei Diskriminierungen. Desgleichen gilt für den Arbeitsplatz meiner Frau. Sie hat nun einen Dreiviertel-Job an der Universität und kann so die Familie materiell über Wasser halten. Du kannst Dir ja vorstellen, dass sie alle Hände voll zu tun hat; Erziehung, Haushalt, Anlaufstelle für Auskünfte über ihren Mann etc. Leider kann ich ihr von hier aus nichts abnehmen. Aber sie beklagt sich nie, und wenn ich nachhake, untertreibt sie stets in ihrer sehr britischen Art, um mir das Herz nicht schwer zu machen.
Ann und die Kinder kommen mich regelmäßig besuchen. Und immer wieder muss ich erstaunt feststellen, wie sehr die Kinder gewachsen sind; ein Zeichen dafür, wie schnell die Zeit vergeht. Die dreieinhalb Stunden Besuchszeit im Monat reichen jedoch bei weitem nicht aus, um auch nur halbwegs alles besprechen zu können, zumal jedes unserer drei Kinder seine eigenen Probleme und Erlebnisse hat, die es dem Vater mitteilen möchte. Und hinzu kommt, dass wir manchmal noch einen Teil der Zeit an andere Besucher abtreten, wenn z. B. meine alten Genossen und Freunde aus der HV A, mit denen ich lange Jahre zusammengearbeitet habe, die lange Reise hierher antreten; oder wenn ein Journalist zu einem Interview hierher kommt.«
Aus einem Brief vom 27. September 1997:
»Herzlichen Dank für die Geburtstagsgrüße und Eure Solidarität. Besonders hat mich gefreut, dass Ihr auch an meine Familie gedacht habt. Der geht es zwar den Umständen entsprechend gut, aber trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass meine Frau – obwohl in Freiheit – härter bestraft ist als ich, denn an ihr allein bleiben alle Sorgen des Alltags hängen – materielle Existenz der Familie, Arbeit, Erziehung der Kinder, Haushalt, und der Mann im Gefängnis –, während ich hier hinter Gittern meine Zeit so sinnvoll wie möglich mit meiner Lektüre und Schreibarbeit verbringe und von Alltagssorgen nicht geplagt werde, denn hier drinnen ist alles geregelt, und man muss nur den Anweisungen folgen.
Allerdings hat mich meine Frau ihre Bürde nie spüren lassen. Beim Besuch – im Monat dreieinhalb Stunden – höre ich nie eine Klage, alles ist in Ordnung; wir werden das schon schaffen, bekomme ich zu hören, und ich weiß, dass sie es schafft. Aber zu gern würde ich ihr zur Seite stehen. Aber das wird noch was dauern, denn in den Köpfen der maßgeblichen Politiker geht der Kalte Krieg weiter, solange sich noch auf deutschem Boden sozialistisches Gedankengut regt.«
Aus einem Brief vom 26. September 1997:
»Eine Woche vorher waren Karl Rehbaum und mein ehemaliger Instrukteur, Heinz Sacher, zu Besuch. Ann hatte ihnen die restlichen anderthalb Stunden der monatlichen Besuchszeit abgetreten, weil sie weiß, welch enge Freundschaft uns drei verbindet. Sie kommen mich regelmäßig einmal im Jahr um diese Zeit besuchen. Anschließend verbringen sie ein paar Tage in der Nähe von Ann, sprechen viel mit ihr und unseren Kindern, aber auch mit meinen Eltern.
In den vergangenen Jahren hatte sich allerdings mein Vater diesen Treffen stets entzogen. Obwohl er sich nie von mir abgewendet hatte, hatte ihm meine Verhaftung doch am meisten zu schaffen gemacht. Da er als angesehener Geschäftsmann sein Leben lang immer viel Wert auf das Ansehen bei den ›Leuten‹ seines Umfeldes gelegt hatte, was ich ihm als junger Mann immer als Spießertum vorgeworfen hatte, was aber sicherlich notwendig ist, wenn man als Geschäftsmann in einem kleinen Städtchen der Provinz bestehen will, also da er immer viel Wert auf den guten Ruf der Familie gelegt hatte, hatte ihn meine Verurteilung als Hochverräter im Rampenlicht der Öffentlichkeit besonders stark mitgenommen.
Hinzu kommt, dass er zwar nie antikommunistisch eingestellt war, sondern das System im Osten als gut gemeint, aber für die menschliche Natur als absolut untauglich ansah; eine Meinung, die, versetzt mit den üblichen, westlichen Propagandasprüchen, ich mir als junger Mann immer wieder anhören musste. Und nun stellte sich heraus, dass ausgerechnet ich, auf dessen berufliches Fortkommen er doch so stolz war, für eben dieses ›untaugliche System‹ gearbeitet hatte und mit Schimpf und Schande ins Gefängnis gesteckt wurde.
Soweit der Vorspann.
So ist es schon irgendwie verständlich, dass er die Leute, mit denen ich dieses schändliche Tun betrieben hatte, nicht kennenlernen wollte.
Meine Mutter war von jeher geistig viel aufgeschlossener und seit meiner Verhaftung beschäftigte sie sich intensiv mit der deutschen linken Geschichte und begann mit der Zeit meine Motivation zu verstehen. Sie hatte denn auch bezüglich Karl und Heinz keine Berührungsängste. Und nachdem sie das erste Mal mit ihnen gesprochen hatte, lud sie die beiden für das folgende Jahr zu sich nach Hause ein.
Beim nächsten Mal hatte Vater noch das Weite gesucht, aber dieses Jahr blieb er da, und wie ich von allen Seiten gehört habe, gab es einen sehr langen Abend mit viel Diskussion und Saarwein, und man ist sich allseits viel näher gekommen, sogar soweit, dass Vater persönlich die Einladung fürs nächste Jahr ausgesprochen hat. Dann soll bei meinen Eltern ein Ostabend steigen, wozu die beiden die entsprechenden ›DDR-Produkte‹ mitbringen.
Wenn ich so lange darüber schreibe, dann nur weil ich mich über diese Entwicklung sehr freue.«
Aus einem Brief vom 8. November 1997:
»Vorgestern war meine Frau Ann zu einem einstündigen Sonderbesuch bei mir, der durch Mithilfe des Anstaltspfarrers alle drei Monate ermöglicht wird. Bei diesen Gelegenheiten sind die Kinder nicht dabei, so dass wir uns, ohne auf sie Rücksicht nehmen zu müssen, auch über politische Dinge unterhalten können. Und ich kann Dir gar nicht beschreiben, welche große moralische Hilfe mir meine Ann ist, abgesehen davon, mit welcher Bravour sie alle anderen Probleme meistert. Das dickste und das längste Stück haben wir sowieso schon hinter uns.
Wir haben es bis hierhin geschafft, ohne uns verbiegen zu lassen, dann werden wir den Rest erst recht schaffen!«
Aus einem Rundbrief von 1998:
»Vieles hat sich also zum Guten entwickelt, trotz alledem. Und die ganze Familie ist gesund und guten Mutes. Auch von ihr soll ich grüßen. Kürzlich haben wir sogar eine neue, bessere, größere und hellere Wohnung gefunden, zum selben Preis wie die alte. Dadurch, dass ich nun doch öfters nach Hause komme und auch wieder meine Sachen brauche, diese also nicht länger in Kisten verwahrt auf dem Speicher gestapelt sind, ist die alte Wohnung doch sehr eng geworden.
Anfang Juli werden wir umziehen. Allerdings nur 1,5 km von unserer jetzigen Wohnung entfernt, und so werden unsere Kinder auch nicht ihre sozialen Kontakte verlieren. Sie sind vollkommen akzeptiert und integriert. Thomas, der älteste Sohn, nun schon 19 Jahre alt, ist ein guter Musiker und spielt u. a. in einer Gruppe, die regelmäßig auch bei den lokalen Faschings- und anderen Veranstaltungen auftritt. Richard, 18 Jahre alt, ist ein erfolgreicher Fußballspieler. Er spielt in der A-Jugend der Regional-Liga. Und unsere Alexandra, 12 Jahre, spielt Klarinette in der Musikgruppe des Dorfes, die bei allen möglichen Veranstaltungen in der Region auftritt. Auch sie ist sportlich, hat viele Interessen und einen netten Freundeskreis. Durch unseren Umzug wird dies und all die anderen gesellschaftlichen Bindungen unserer Kinder nicht beeinträchtigt.«
Rainer Rupp arbeitete während der Haft an einem Buch für seine Kinder. Darüber berichtete er in einem Brief am 18. Januar 1994 aus der Untersuchungshaft in Koblenz. Er schrieb es in Fortsetzungen, damit sie sich auf das nächste Lebenszeichen von ihrem Papa freuten.
»Es handelt sich um eine Abenteuergeschichte, in der drei Kinder in einer Situation wie die meine ihre Eltern durch einen schweren Unfall für eine gewisse Zeit verlieren. Die Kinder, die im Ausland in einer großen Stadt aufgewachsen sind, müssen nach Deutschland zu ihren Großeltern in ein kleines Dorf ziehen. Erst einmal ein großer Schock, aber nicht für lange, denn sie machen schnell neue Freunde und erleben eine wundervolle Zeit auf dem Lande, in der unberührten Natur eines Waldsees, wo sie auch ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen können, nämlich Fischen.
Aber die Idylle des Waldsees ist einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt. Aus der unterirdischen Quelle, in der Nähe des Ufers, wo das Wasser immer besonders kalt ist – auch an heißen Sommertagen –, quillt bald ein gelblicher Stoff hervor, der in immer größerem Umkreis alle Lebewesen tötet. Die Kinder versuchen die Behörden zu alarmieren, aber in der Ferienzeit interessiert sich niemand für ihre Belange.
Durch Zufall stoßen sie dann selbst auf eine verdächtige Fährte, die sie zu einem ausgedienten und geheimnisvollen Steinbruch führt, in dessen unterirdischen Galerien gefährlicher Sondermüll in Fässern deponiert wird. Einige skrupellose Unternehmer wollen auf die Schnelle reich werden und nehmen dabei auf nichts Rücksicht.
Der Fall wird nach und nach von den Kindern und unter manchen Gefahren, aber auch lustigen Begebenheiten aufgeklärt. Dabei spielen meine Kinder die Hauptrollen, und die Beschreibungen passen genau auf sie.
Auch habe ich alte Geschichten, die uns oder ihnen in der Vergangenheit passiert sind, eingebaut. Insgesamt gibt es viele Streiche, Abenteuer, Entdeckungen und Lehrreiches aus Wissenschaft und Forschung, das flott in die Geschichte eingebaut ist.
Soweit ich das bisher von meinen Kindern gehört habe, sind sie ganz begeistert und wollen dauernd wissen, was sie nun als nächstes in ihrem Abenteuer machen werden. Bis jetzt bin ich auf Seite 60 angekommen. Also liegt noch viel Arbeit vor mir, obwohl das Gesamtkonzept schon fertig ist. Aber wie immer liegt der Teufel im Detail, und wenn man will, dass es wirklich spannend und trotzdem für Kinder einfach geschrieben ist, ist das gar nicht so leicht.«
In einem Brief am 5. März 1997 ergänzte Rupp:
»Außerdem hat mein Töchterchen kürzlich beanstandet, dass ihre Abenteuergeschichte seit einiger Zeit nicht weitergegangen ist. Also habe ich in den letzten Tagen die Fortsetzung geschrieben, von Seite 143 bis Seite 155. Und so einfach mal runtertippen kann ich das nicht. Schließlich soll die Spannung erhalten bleiben, die Geschichte soll lehrreich sein und zugleich Liebe und Interesse für Tiere und die Natur erwecken, die durch ein Umweltverbrechen konkret bedroht ist, das meine Kinder in der Geschichte nach allerlei Verwicklungen aufdecken.«
Am 10./11. August 1996 erschien im Neuen Deutschland nach einem Besuch in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken, in welcher Rupp bereits länger als ein Jahr einsaß, nachfolgender Beitrag:
»An diesem Sonntagmorgen versteckt sich die Sonne gelegentlich hinter den Wolken, aber auch das verwandelt die Haftanstalt Lerchesflur hinter den meterhohen fahlgrauen, fleckigen Wänden nicht in ein düsteres Château d’If. Hinter dem Schlagbaum und der Eisentür mit dem Sicherheitsglas regieren Sachlichkeit und Routine. Christine Ann Rupp (48) und Tochter Alexandra (9) werden mit einem halben Dutzend anderer Menschen in den Besuchstrakt geführt, ›durchleuchtet‹ und dürfen dann in einem der vielleicht zweimal zwei Meter großen Räume Platz nehmen. Rainer Rupp ist von seiner Frau durch eine 30 Zentimeter hohe Glasscheibe getrennt: Anweisung des Anstaltsleiters für akustische Überwachung, wenn ein Nicht-Familienmitglied wie der ND-Journalist beim Besuch dabei ist. Christine Ann protestiert, aber sie weiß, dass es vergeblich ist.
Oktober 1993 soll im fensterlosen Saal A 01 des Düsseldorfer Oberlandessgerichtes ein unscheinbar wirkender ›Bart- und Brillenträger‹ mit ›müder Stimme‹ seine Zeugenaussage im Prozess gegen Markus Wolf, den langjährigen HV A-Chef, gemacht haben, wie dpa berichtete. An diesen Zeugen erinnern im Besucherraum der JVA Saarbrücken lediglich der Bart, der zu ergrauen beginnt, und die Metallbrille. Rainer Rupp – 1,78 Meter groß und 85 Kilogramm schwer, mit muskulösem Oberkörper und festem Händedruck, hält sich sehr gerade. Er spricht klar und schnell, gestikuliert kaum, überlegt kurz, bevor er bündig antwortet. Rupp ist der Mann, dem das ›Testpsychologische Gutachten‹ von Prof. Dr. Steimeyer, Medizinische Fakultät der TH Aachen, ›weit überdurchschnittliche Gesamtintelligenz‹ bescheinigt. ›Organisationsfähigkeit, Kreativität und Originalität‹ wiesen auf ›hohe soziale Intelligenz‹. Es keimt eine Ahnung, warum im ›größten Verratsfall der NATO-Geschichte‹ die HV A ihrem Mann den Decknamen ›Topas‹ gab.
Um den tatsächlichen Wert des Brüsseler Edelsteins herauszufinden, wird man nicht Politiker, Juristen oder Geheimdienstler, sondern Historiker bemühen müssen. Werner Großmann, Wolfs Nachfolger und letzter HV A-Chef, erinnert jedenfalls daran, dass in der ersten Hälfte der 80er Jahre maßgebliche Kräfte in Moskau von der Theorie ausgingen, dass ein dritter Weltkrieg unmittelbar bevorstünde, die NATO einen atomaren Erstschlag gegen sozialistische Länder plane. Bei einem Arbeitstreffen mit seinem sowjetischen ›Partner‹, dem Spionageschef des Komitees für Staatssicherheit und späteren KGB-Chef, Generaloberst Wladimir A. Krjutschkow, hatte er den Eindruck, dass seine – gerade auf den ›Topas‹-Berichten fußende – gegensätzliche Einschätzung ihre Wirkung nicht verfehlte. Diesem Gedanken mochte sich auch das Düsseldorfer Gericht nicht verweigern, als es im Urteil feststellte, es sei Rupp darum gegangen, ›zum Abbau von Vorurteilen und Besorgnissen des Warschauer Paktes die Absichten der NATO transparent zu machen und damit zum Frieden beizutragen‹. Gleichwohl schickte es den ›Top-Spion‹ ein Dutzend Jahre hinter Gitter.
Wir reden über den Knast-Alltag. Im Frühjahr wurde Rupp zum Vorsitzenden der fünfköpfigen ›Gefangenen-Mitverantwortung‹ gewählt. Er kümmert sich. Um Wäscheprobleme, Hofverschmutzung, das von Gefangenen bemängelte, offenbar minderwertige, aber überteuerte Warenangebot, das mieseste im Vergleich von zehn Knast-Verkaufsstellen.
Auf einen wenig schmeichelhaften Knast-Report in der Saarbrücker Zeitung hat Anstaltsleiter Ernst-Peter Hirschmann mit einem empörten Leserbrief reagiert. Er vermutet, dass die Gefangenen im Beitrag ›ihr mehr oder weniger langfristiges Lebensumfeld … nicht wiedererkennen‹. Mit Hirschmann hat Rupp seine Erfahrungen. Der Leiter lehnte z. B. ein ungebührliches Ansinnen Rupps – die Teilnahme am jährlichen JVA-Sportfest – ab. Begründung: Die frühere nachrichtendienstliche Tätigkeit versetze ihn in die Lage, die ›Sicherheit einer Vollzugsanstalt zu gefährden‹.
Und wir reden über die Ungleichbehandlung der West- und Ost-Spione. Professor Helmut Ridder (Gießen) schreibt in einer völker- und staatsrechtlichen Analyse: Das vereinte Deutschland sei durch völkerrechtliche Akte (Einigungsvertrag und ›Zwei-plus-Vier‹-Vertrag) ein Neustaat. Mit dem Untergang der Alt-BRD und der DDR sind auch ihre strafrechtlichen Schutz- und Verfolgungsansprüche untergegangen.
Es spricht wenig dafür, dass es künftig ridderlich zugeht.
Allein seit 1992 wurden in der Bundesrepublik 2.400 Ermittlungsverfahren wegen ›geheimdienstlicher Agententätigkeit‹ zugunsten der DDR eingeleitet. 72 oder mehr Verurteilungen erfolgten. 17 Menschen sind in Haft. Rupp erhielt die höchste Strafe. Nach den Gesetzen der alten BRD sei er zu Recht verurteilt worden, andererseits will ihm nicht in den Kopf, dass nach der deutsch-deutschen Vereinigung ein Mehr-Klassen-Strafrecht angewandt wird. In schroffem Gegensatz auch zum Artikel 3 des Grundgesetzes.
Christine Ann rutscht unruhig auf dem Stuhl hin und her, runzelt die Stirn. Sie hat Angst, dass sich ihr Mann um Kopf und Kragen, zumindest aber um eine vorzeitige Haftentlassung redet. Und sie will ihn raushaben. Lieber vorgestern als übermorgen.
Sie hat Glück gehabt, obwohl an der Seite ihres Mannes als ›Türkis‹ zu Bewährung verurteilt, ist sie wieder in Lohn und Brot. Nein, kein Bild von ihr in die Zeitung! Sie möchte ihren Arbeitsgeber nicht in Verlegenheit bringen.
Über die Familie brauchen wir nicht zu reden. Es gibt beredte Blicke und eine allgegenwärtige Zärtlichkeit. Immer wieder sucht Rupp die Augen seiner Frau.
Die lebhafte Christine Ann Rupp mit dem kurzgeschnittenen Haar, dem schmalen Gesicht und energischen Mund lacht gern. Und sie verfügt über eine gehörige Portion Selbstironie, wenn sie ulkige Geschichten über ihre Koch›kunst‹ erzählt, die offenbar alles in den Schatten stellt, was schon Gruseliges über die englische Küche bekannt ist.
Womöglich möchte sie ihrem Mann nur bedeuten, dass er sich keine Sorgen zu machen braucht, dass sie mit den Kindern klarkommt. Dass die beiden Großen die Hausaufgaben schaffen und schon allein fischen gehen. Das mag alles stimmen – die Wahrheit ist es nicht.
Immerhin erlaubt der fleißig mitschreibende junge Aufsichtsbeamte der neunjährigen Alexandra, sich auf den Schoß ihres Vaters zu setzen. Sie legt die Arme um Papas Hals, den Kopf an seine Brust – und da sitzt sie nun, auf dem ihr wohl liebsten Platz.«





























