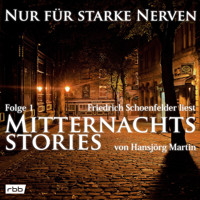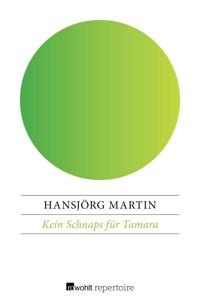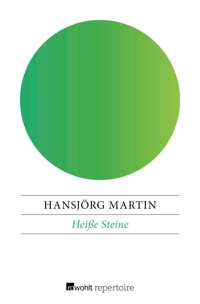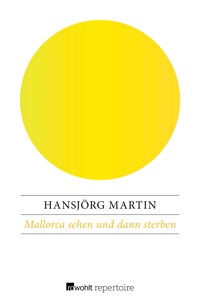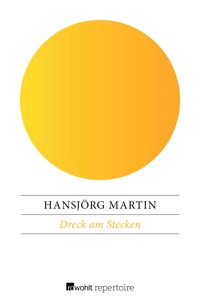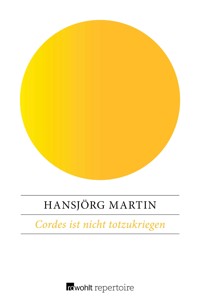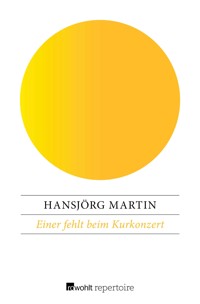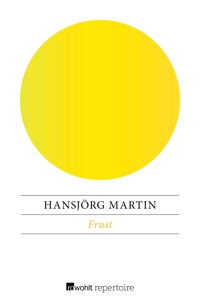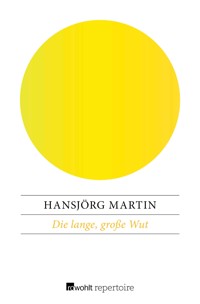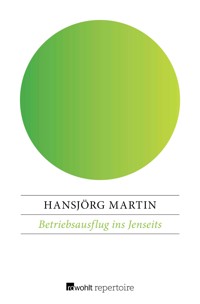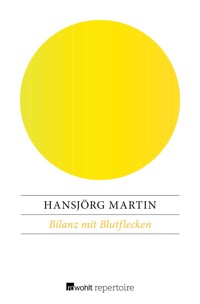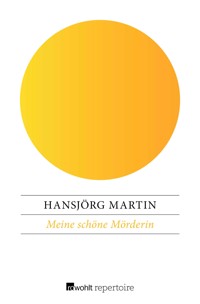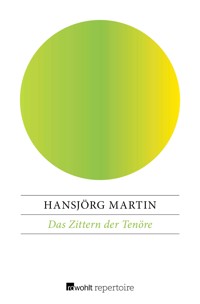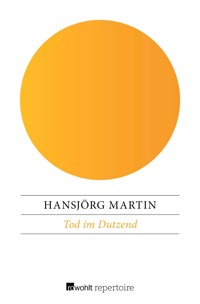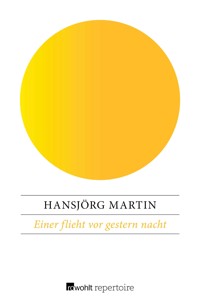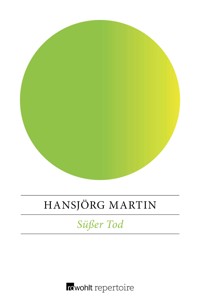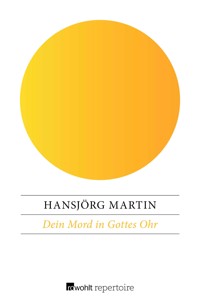
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Philipp Gohlis muß Ideen haben, denn er ist Kriminalschriftsteller von Beruf. Die Idee aber, den nächsten Mord nicht nur auf dem Papier zu planen, sondern ihn auch selbst auszuführen, wäre ihm nie gekommen, wenn er nicht zufällig beim Friseur in einer Illustrierten das Foto von Arno Kutsch entdeckt hätte. Gohlis kennt den ebenso erfolgreichen wie skrupellosen Bauunternehmer nicht; aber er hat Arno Kutsch, den opportunistischen Sanitäts-Hauptfeldwebel, während des Krieges in Rußland gekannt und unter seinen Schikanen gelitten. Schlagartig war sie da, die Erinnerung an die Zeit vor 36 Jahren. Es war Krieg gewesen, und er hatte mit seiner Einheit in der Ukraine gelegen. Und dort hatte er Tanja getroffen, ein Mädchen so heiter und zart wie der Frühling in jenem Jahr. Auch Kutsch hatte ein Auge auf Tanja geworfen gehabt, aber Tanja hatte ihn, Gohlis, geliebt. Kutsch hatte ihr die Niederlage heimgezahlt. Auf eine teuflische Art. Der alte Haß wacht wieder auf. In all den Jahren hat er nichts von seiner brennenden Schärfe verloren. Gohlis weiß, daß er keine Ruhe finden wird, bevor er nicht mit Kutsch abgerechnet hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Dein Mord in Gottes Ohr
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Philipp Gohlis muß Ideen haben, denn er ist Kriminalschriftsteller von Beruf. Die Idee aber, den nächsten Mord nicht nur auf dem Papier zu planen, sondern ihn auch selbst auszuführen, wäre ihm nie gekommen, wenn er nicht zufällig beim Friseur in einer Illustrierten das Foto von Arno Kutsch entdeckt hätte. Gohlis kennt den ebenso erfolgreichen wie skrupellosen Bauunternehmer nicht; aber er hat Arno Kutsch, den opportunistischen Sanitäts-Hauptfeldwebel, während des Krieges in Rußland gekannt und unter seinen Schikanen gelitten.
Schlagartig war sie da, die Erinnerung an die Zeit vor 36 Jahren. Es war Krieg gewesen, und er hatte mit seiner Einheit in der Ukraine gelegen. Und dort hatte er Tanja getroffen, ein Mädchen so heiter und zart wie der Frühling in jenem Jahr. Auch Kutsch hatte ein Auge auf Tanja geworfen gehabt, aber Tanja hatte ihn, Gohlis, geliebt. Kutsch hatte ihr die Niederlage heimgezahlt. Auf eine teuflische Art.
Der alte Haß wacht wieder auf. In all den Jahren hat er nichts von seiner brennenden Schärfe verloren. Gohlis weiß, daß er keine Ruhe finden wird, bevor er nicht mit Kutsch abgerechnet hat.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
Philipp Gohlis
ist Kriminalschriftsteller und plant einen Mord nicht nur auf dem Papier.
Charlotte
weiß nicht, daß sie alles weiß.
Arno Kutsch
hat Haß gesät und glaubt nicht an die Ernte.
Stephan Schnurbusch
wechselt als Musiklehrer vom Jubilate! zum Dies irae.
Dorothea
singt fröhlich, obwohl man ein Miserere von ihr erwartet.
Stock
will sich einen Jux machen.
Dr. Nußbaum
findet das gar nicht komisch.
Duster
singt als Tenor die falschen Lieder.
Matka Mirjam
ist Zigeunerin und hat schon alles im voraus gewußt.
Tanja
wird von allem nichts mehr erfahren.
Haß muß produktiv machen.
Sonst ist es gescheiter,gleich zu lieben.
Karl Kraus
Ich gestehe, es hat mir Vergnügen bereitet, die Tat zu planen.
Nein, Vergnügen ist vielleicht doch nicht das richtige Wort. Das richtige Wort wäre Reiz. Ein Reiz, wie man ihn vor dem Schachbrett empfinden kann oder am Roulettetisch oder auf einer unbekannten Straße, wenn man ein paar Gashebelmillimeter zu schnell fährt.
Aber auch das stimmt nicht so ganz. Wenn ich den Hergang schon analysiere, dann muß ich auch im Detail, in der Formulierung genau sein. Es stimmt nicht, daß ich Vergnügen empfunden habe, als ich Kutsch tot vor mir liegen sah. Aber die Planung, die Vorbereitung, die nötigen Recherchen – das war alles reizvoll und aufregend.
Ich bin sonst durchaus kein Perfektionist – im Gegenteil.
Manche Leser meiner Geschichten und Romane oder Hörer meiner Hörspiele kritisieren, daß ich Probleme nur anreiße und oberflächlich bleibe, wo sie Tiefgang für notwendig halten.
Daran ist was.
Ich gestehe es nicht gern, allenfalls Freunden, wie schwer es mir fällt, wie es mich langweilt, ja quält, manchen Dingen auf den Grund zu gehen. Ich verlasse mich lieber auf meine Intuition, auf den spontanen Eindruck, den ich von einer Figur, einem Vorgang habe, und ich flüchte mich in die Beschreibung von Farben, Gerüchen, Geräuschen, in der Hoffnung, mir dadurch die mühsame Beschäftigung mit so spröden Dingen wie empirischen Untersuchungen von Motivationen der psychologischen Hintergründe zu ersparen.
Weil ich gelernt habe, ein guter Beobachter zu sein, gehen meine Leser und gelegentlich sogar meine Rezensenten mir auf den Leim.
Aber hier, im Fall Kutsch, war es mit atmosphärischen Details und amüsanten Schlaglichtern nicht getan. Hier ging es um Leben und Tod – und zwar nicht nur für Kutsch, sondern auch für mich. Im Falle einer Entdeckung der Tat, einer Festnahme und Verurteilung auf Grund der Indizien hätte ich eine langjährige Freiheitsstrafe mit Sicherheit nicht überlebt.
Gegen meine Gewohnheit und Neigung mußte ich also präzis und gründlich arbeiten, mußte alle Eventualitäten bedenken – und gerade das hatte für mich, so sonderbar es klingt, den prickelnden Reiz des Neuen.
Das schmeckt alles ein bißchen nach Schutzbehauptung und Rechtfertigung, nicht wahr? Aber ich schreibe diesen Bericht ja nicht als Angeklagter. Ich schreibe ihn als freier, unbescholtener und unverdächtiger Mann.
Für wen?
Nun, in erster Linie für mich selbst.
Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß Schriftsteller für irgendwen schreiben. Letztlich schreiben sie immer für sich selbst. Sie sind geradezu Ungeheuer an Egoismus, nein, genauer: an Egozentrik. Das liegt daran, daß ihr Beruf zu den einsamsten Berufen gehört, die es gibt. Viel einsamer als Leuchtturmwärter, Almbauer oder Nachtwächter. Nur weiß ich auch hier wie in manchen anderen Fällen nicht, was eher war: Das Huhn oder das Ei.
Sind Schriftsteller so egozentrisch, weil sie einen einsamen Beruf haben – oder macht ihr Beruf so einsam, weil sie egozentrisch sind … sein müssen?
Aber ich weiche aus. Kein Wunder: sonst schreibe ich immer Geschichten, die konstruiert sind, Geschichten mit erfundenen Handlungen, Leuten, Orten, von denen nicht viel einer Nachprüfung standhalten würde, falls mal einer auf den Gedanken käme, nachzuprüfen.
Diese Geschichte hier aber – oder richtiger: Dieser Bericht hier über den Mord an Arno Kutsch –, das ist wirkliches, «gelebtes, volles Leben». Da brauche ich nur reinzugreifen und zu formulieren, da brauche ich mir nichts auszudenken – nicht mal Dialoge, Gesichter, Zimmer, Gerüche … Das hab ich alles parat, abrufbereit, vor Augen und im Ohr.
Ja … also dann!
1
Mein Friseur heißt Müller.
Tut mir leid, er heißt wirklich Müller. Ich habe mir ja vorgenommen, in allen Punkten bei der Wahrheit zu bleiben. Wenn ich mir den Friseur für eine erfundene Geschichte ausdenken müßte, dann würde ich jetzt das Telefonbuch aufschlagen und einen zum Typ und Charakter dieses Mannes passenden Namen suchen. Das ist immer ein Spiel im Spiel. Oft erliege ich dabei der Versuchung, den Namen der Figur so zu wählen, daß er etwas Symbolisches hat. Dunkle Gestalten in meinen Geschichten fangen oft mit K an und haben ein U im Namen. Daß dies hier im Bericht auch so ist, daß also der negative Typ Kutsch heißt, ist reiner Zufall, aber die Wahrheit. Und mein Friseur heißt eben in Wahrheit Müller.
Er ist Mitte Dreißig und mehr als nur ein Haareschneider. Aber eigentlich sind ja fast alle Friseure mehr. Sie haben fast alle einen Schuß Bohemien, halb Verführer, halb Quacksalber, sind neugierig – Neugier ist was Gutes! – und meistens sehr geschickt im Umgang mit Menschen.
Mein Müller hatte bis vor acht oder zehn Jahren einen kleinen, engen Laden in der holperigen Straße, die zur Kirche führt. Ich bin schon damals immer zu ihm gegangen, denn ich bin in manchen Dingen sehr konservativ und von Gewohnheiten abhängig. Müller schnitt mir immer die Haare so, wie ich es wollte, ließ an den Seiten und über den Ohren genau die richtige Länge stehen, machte nie dusselige Bemerkungen über meine von Jahr zu Jahr größer werdende Glatze und versuchte nur ein einziges Mal, mir ein Toupet zu empfehlen. Das machte er dann allerdings auch so geschickt, daß ich es ihm nicht nachtragen konnte.
Damals, in dem kleinen Laden an der Kirchstraße, hieß er noch Wilhelm Müller und hatte einfach HERRENFRISEUR über der Ladentür stehen. Heute, seit ihn eine Erbschaft und zunehmend große Kundschaft ermutigt haben, sich den großen Laden in der Bahnhofstraße zu mieten, zu renovieren und als COIFFEUR-SALON für die DAME – für den HERRN zu eröffnen, nennt er sich Will Müller und an der linken Fensterscheibe steht:
«Hier bedient und pflegt Sie das Will-Müller-Team.»
Ich habe diese Karriere vergnügt beobachtet und bin ihm als Kunde treu geblieben, lasse mich jedoch nie von einem der Gänschen oder von dem langlockigen Gesellen aus dem «Team» bedienen und pflegen, sondern nur von Müller selbst, eben weil ich da so meine konservativen Gewohnheiten habe … Und außerdem kann ich es mir nicht leisten, große Experimente mit meinem spärlichen Haarwuchs veranstalten zu lassen.
An jenem Dienstag also war ich für 10 Uhr 30 angemeldet. Es war ein sehr schöner Tag im ersten Drittel Mai. Ich ließ mein Auto in der Garage, zog den Trenchcoat an und ging zu Fuß die anderthalbtausend Schritte von meinem Haus zwischen den tulpenblütenbestückten Vorgärten und den gelbflammenden Forsythiensträuchern entlang, die am Rande der öffentlichen Grünanlagen wachsen, tippte grüßend an die Baskenmütze, als ich die hübsche Frau des Studienrats Oeler am offenen Fenster stehen und Kopfkissen ausschütteln sah. Ich lächelte ihr zu, als sie mein Fingertippen mit Lächeln erwiderte, sagte dreißig Schritt weiter «Hallo!» zu dem pensionierten Postbeamten Hamann, der in seinem Garten ein neues Blumenbeet abzirkelte, und war rundum guter Dinge.
Ich hatte schon zweieinhalb Stunden Arbeit hinter mir, einen guten Morgen am Schreibtisch mit fünf Seiten Text, den ich gelungen fand, hatte mit meiner Frau beim Frühstück vergnügt über die Spanien-Reise geredet, die wir uns vorgenommen hatten, und wir waren uns einig geworden, nicht mit Flugzeug oder Bahn, sondern gemütlich mit dem Auto zu fahren, wenn es auch ein paar Tage länger dauern würde. Darauf freute ich mich, denn ich fahre sehr gern Auto – vor allem dann, wenn mich kein Termin treibt.
Es war kühl trotz des Sonnenscheins, also ging ich schneller und war deshalb zu früh in der Bahnhofstraße. So früh war es aber auch nicht, daß es zu einem Besuch oder wenigstens zu einer Stipvisite beim einzigen Buchhändler des Städtchens gereicht hätte. Das brauchte ich jedoch nicht zu bedauern, denn viel ist mit der Buchhandlung sowieso nicht los. Der Besitzer ist ein alter Nazi und verkauft nur sehr ungern Bücher, die literarisch – oder gar politisch – jenseits der Grenzlinie angesiedelt sind, die für ihn bei Dichternamen liegt wie Hans Friedrich Blunck, Hans Grimm und Rudolf Herzog (wer immer das auch gewesen sein mag).
Meine Bücher führt er nur deshalb, weil ich der einzige Schriftsteller im Städtchen bin. Er stellt sie jedoch nie ins Schaufenster. Dort stehen meist Bildbände von wilden oder zahmen Tieren, von der majestätischen Bergwelt, von den deutschen Gartenblumen, von Wald und Feld … und Werbeplakate für das Lexikon, in dem Karl Marx mit fünfunddreißig Zeilen erwähnt wird, im Gegensatz zu anderen Nachschlagewerken, wo dem gefährlichen Philosophen zweihundert und mehr Zeilen eingeräumt werden.
Aber Schulbücher hat unser Buchhändler auch, die kann er gut mit seiner Weltanschauung vereinbaren, so, wie die heutzutage und in diesem Bundesland sind.
Am Kiosk gegenüber dem Friseurladen, pardon, Coiffeursalon, kaufte ich mir eine Tageszeitung und eine neue Illustrierte und warf noch einen Blick in die Schaufenster des Kunstgewerbelädchens neben dem Supermarkt.
Wenn ich ehrlich sein will – und das will ich ja unbedingt in diesem Bericht, ich kann es mir nicht oft genug selbst wiederholen –, wenn ich also ehrlich sein will, warf ich den Blick nicht in, sondern durch das Schaufenster des Kunstgewerbelädchens, denn da hatte ich neulich eine wahrhaft entzückende Verkäuferin entdeckt … Und ich wollte mich nur vergewissern, ob ich sie heute auch noch so entzückend fand.
Das gelang mir nicht, denn es klopfte mir jemand auf die Schulter. Ich wandte mich um. Der immer fröhliche Kantor der Kleinstadt stand vor mir und lachte mich an: «Na, Schreibtischmörder, wie geht’s dir?»
«Danke, Stadtpfeifer, gestern ging’s noch!» sagte ich.
«Lust auf’n Schnaps?»
«Lust schon», sagte ich. «Wenn du mir erst ’ne halbe Stunde beim Haareschneidenlassen zuguckst – dann ja!»
«Soviel Zeit hab ich nicht für die Literatur übrig», sagte er. «Schade!»
«Schade!» bestätigte ich.
«Was schreibst du?» wollte er wissen.
«Ein Drehbuch!» sagte ich. «Fürs Fernsehen.»
«Kannst du nicht mal ’n paar Choräle schreiben? Ich hätte gern mal was Neues – die aus dem Gesangbuch kann ich langsam alle auswendig. Manche sogar von vor- und rückwärts!»
«So einer bist du!» sagte ich. «Laß das bloß deine Kirchenältesten nicht hören. Die lassen dich nie wieder mit den Damen vom Madrigalkreis allein auf der Empore!»
Er lachte. Er lachte hell und gackernd, richtig wie ein Huhn. Seine strapsigen Haare wippten dabei wie Federn um den runden Schädel mit den lustigen Augen.
«Nix wie Schweinkram im Kopf, die deutschen Dichter!» sagte er kichernd.
«Wer hat denn angefangen?» konterte ich. «Du, Berufsorgler!»
Wir schüttelten uns vergnügt die Hände. Ich überquerte die Straße und ging auf Müllers Salon zu.
An der rechten Schaufensterscheibe hatte er ein neues Schild angebracht: Keralogie stand darauf – das sah nach wissenschaftlich verbrämtem Haarschnitt aus.
Ich würde mich aber nicht darauf einlassen.
Im Salon war es warm, roch nach Parfum, Shampoo und ein wenig wie in einer alten Hufschmiede nach verbranntem Horn. Das älteste der drei in fliederfarbene Kunstseidenkittel gehüllten Mädchen aus dem Will-Müller-Team kam auf mich zu, als ich blinzelnd an der Tür stehenblieb und meine beschlagene Brille abnahm.
«Guten Tag, Herr Gohlis!» sagte das Mädchen. «Sind Sie für jetzt angemeldet?»
«Ja», sagte ich. «Halb elf!»
Das Mädchen guckte nach der schmiedeeisernen Uhr, die an der Wand über der Kasse angebracht war, und nickte anerkennend, weil der kupfern glänzende große Zeiger genau auf halb stand.
«Darf ich Sie bitten, abzulegen und eine Minute Platz zu nehmen, der Meister kämmt noch. Aber er ist gleich fertig!»
Das sagte sie fließend und ohne abzusetzen, wie ein Anrufbeantworter.
«Ja», sagte ich, zog den Trenchcoat aus, hängte ihn mit der Mütze an den verschnörkelten Garderobenständer und setzte mich auf einen der spinnebeinigen Stahlrohrstühle, die rechts von der Tür aufgereiht standen.
Ich hatte meine Illustrierte und die Zeitung in die Manteltasche gesteckt und war zu bequem, noch mal aufzustehen, um sie zu holen. Deshalb griff ich mir eine der Lesezirkelmappen, die auf der Glasplatte des runden Tischs lagen, der vor der Stuhlreihe die Beine spreizte.
Wenn ich das jetzt alles erinnernd rekonstruiere, kommt es mir unheimlich vor.
Wäre ich statt am Dienstag erst am Mittwoch zum Haareschneiden gegangen, dann hätten auf dem Glastisch andere Lesezirkelmappen gelegen, weil sie jeden Dienstag abend ausgetauscht werden. Hätte die Dame, die Müller kämmte, sich eine weniger schwierige Frisur machen lassen, wäre ich sofort bedient worden und gar nicht erst dazu gekommen, die Lesezirkelmappe aufzuschlagen. Hätte statt dieser Mappe eine andere – irgendeine andere – obenauf gelegen, dann würde ich möglicherweise niemals erfahren haben, daß Kutsch noch lebte und wie er lebte. Und dann – wenn das alles nicht zufällig so abgelaufen wäre – dann hätte der Mord an Kutsch wahrscheinlich nicht stattgefunden.
Aber im Moment, als ich das Foto sah und – noch verwirrt, betroffen – erschrocken zwinkernd den Text las, in diesem Moment war alles Weitere unabwendbar.
2
Arno Kutsch.
Ich erkannte ihn sofort. Ohne die Bildunterschrift gelesen zu haben, wußte ich, daß er es war. Unverändert. Nach 38 Jahren: Der gleiche Gesichtsausdruck. Der gleiche Blick aus den farblos wirkenden Augen. Die gleiche Kopfschräge, leicht in den Nacken geneigt, so daß die Miene etwas Abwartendes, Lauerndes hatte. Die gleiche angehobene linke Augenbraue. Der gleiche gesenkte rechte Mundwinkel bei vorgeschobener Unterlippe.
Ich las, schon schneller atmend vor Erregung, was mit dem Mann los war, dessen Porträt eine halbe Illustriertenseite füllte: Unter der Titelzeile Ein gewisser Herr K. mit dem Untertitel: Wie man ohne Gewissen Multimillionär wird fand ich eine Reportage über den Bauunternehmer Arno Kutsch, der sich mit ein paar Grundstücken am Stadtrand von Olders, die er in der Schwarzmarktzeit mit Kaffee und Zigaretten erworben hatte, zum Besitzer von Mietshäusern, Wohnblocks, ja ganzen Siedlungen hochspekuliert und -geboxt hatte.
Der Reporter hatte trotz aller Mühe nur einen ungefähren Einblick in die Geschäfte des Immobilienimperiums Kutsch erhalten. Er schätzte vorsichtig, daß Kutsch der Besitzer von mindestens siebzehntausend Wohnungen sei – meist kleine Wohnungen für kleine Leute.
Die Blocks standen fast alle an der Peripherie von Großstädten und immer nahe bei großen Industrieanlagen, Chemiewerken, Maschinenfabriken oder Unternehmen der Bergbaubranche. Ein paar Fotos zeigten graue, einfallslos in die Landschaft geklotzte Menschensilos, noch häßlicher als preußische Kasernen, soweit das möglich ist, ohne die Weite der Exerzierplätze zwischen den Blocks, und doppelt bis dreifach so hoch.
In einem Punkt unterschieden sich die Mietskasernen wesentlich von den Kasernen der Kaiserzeit: Sie waren so schlecht und billig gebaut, daß – so die Zeitschrift – allein in den letzten zehn Jahren durch herabfallende Ziegel, eingestürzte Zwischenwände, lose Geländer, unsichere Treppen nachweisbar zwei Dutzend Bewohner – darunter neun Kinder – zu Tode gekommen waren. Und niemand hatte den Besitzer Kutsch zur Verantwortung gezogen. In der Mehrzahl der Unfälle war nicht mal Anzeige erstattet worden, weil die Hinterbliebenen Angst davor hatten, rigoros auf die Straße gesetzt zu werden.
Aus dem Damensalon kam Müller vom Kämmen.
Das stereotype Lächeln auf seinem runden Gesicht steigerte sich zu einem richtig freundlichen Lachen, wobei er die Oberlippe lüpfte und den goldenen Schneidezahn blitzen ließ. Sogar seine Augen lachten mit. Er mochte mich.
«Guten Tag, hochverehrter Herr Gohlis!» flötete er mit seiner Kleinstadt-Gesangvereins-Tenorstimme. «Bitte entschuldigen Sie die kleine Verzögerung!» und leiser, vertraulich, nahezu verschwörerisch: «Ich hatte Frau Papenfuß unter dem Kamm, wissen Sie! Da gibt’s immer Probleme!»
«Jaja», sagte ich und stieg in die Vertraulichkeitsgondel. «Wie der Herre, so’s Gescherre …»
«Genau!» kicherte Müller mit heftiger Betonung der zweiten Silbe.
Papenfuß war der Vorsitzende unserer Rechtspartei und galt als schwieriger Mann.
Wir waren uns einig, mein Friseur und ich. Auch politisch, wie es den Anschein hatte. Ich ließ mich davon nicht übermäßig beeindrucken, denn ich wußte – oder hielt es jedenfalls für mehr als wahrscheinlich –, daß Müller auch mit Papenfuß kumpelhaft kichern würde, wenn es die Geschäftslage erforderlich machen sollte. Man kann von Angehörigen des Dienstleistungsgewerbes neben Sachverstand und Handfertigkeit nicht auch noch Charakter erwarten.
Wohin sollte das denn auch führen.
Dann müßte es ja sowohl sozialdemokratische wie auch christdemokratische Friseure, Schlachter, Schuster, Klempner und sonstwas geben. Und wo sollten dann die Linksliberalen oder die Rechtskonservativen ihr Kotelett kaufen, sich die Haare schneiden, ihre Stiefel besohlen, ihre verstopften Klosetts reparieren lassen? Von den Kommunisten ganz zu schweigen …
«Darf ich bitten?» sagte Müller mit einer einladenden Handbewegung, die mich an einen Menuett-Tänzer erinnerte. «Im rechten Sessel, bitte!»
Ich stand auf, ging durch den Holzperlenvorhang in die Herrenabteilung und setzte mich vor den rechten der drei Spiegel in den gefährlich bequemen Sessel – gefährlich, weil man sich in dem grüngepolsterten Sitzmöbel so wohlig entspannen kann, daß jeder Widerstand gegen die Anträge des Friseurs schmilzt und der Wunsch, sitzen bleiben zu können, einen allzu leicht dazu bringt, sich den Kopf waschen, ölen, massieren, föhnen … und wer weiß was alles zu lassen.
Ich hatte mir einmal sogar eine Wasserwelle andrehen lassen, war aber beim Heimkommen vom schallenden Gelächter meiner Frau so ernüchtert worden, daß ich mir geschworen hatte, in Zukunft sämtlichen Versuchungen des verführerischen Friseurs und seines sanften Sessels zu widerstehen.
Müller hüllte mich in einen fliederfarbenen Umhang.
«Wie immer, Herr Gohlis?» fragte er.
«Wie immer, Meister, bitte!» sagte ich und merkte, daß ich das Lesezirkelheft noch in der Hand hielt. Ich schob es auf den breiten Rand des ebenfalls fliederfarbenen Beckens, denn an Lesen war nicht zu denken, da ich für die Prozedur meine Brille absetzen mußte.
Ich versuchte den Schock zu verdrängen, den die unerwartete Begegnung mit der bösesten Epoche meiner Vergangenheit ausgelöst hatte, und überließ mich Müllers Manipulationen.
Während der fliederfarbenbekittelte Friseur meine Haare durch den Kamm zog und mit klappernder Schere stutzte, immer mal einen Schritt zurücktrat und sein Kunstwerk begutachtete, indem er den Kopf schief legte und die Augen zusammenkniff, während er von der Großwetterlage und seiner bevorstehenden Sommerreise nach Teneriffa oder Ibiza oder ich weiß nicht mehr wohin plauderte – wozu ich immerzu nur «Ja» sagte, denn nicken durfte ich nicht –, während das alles mit mir und an mir und um mich herum geschah, dachte ich an die Begegnung mit Arno Kutsch im Sommer des Jahres 1942.
Der Ort lag in der Ukraine und hieß Sumy. Es war ein kleines Städtchen, ich habe keine Ahnung, mit wie vielen Einwohnern, vielleicht sechs- oder acht- oder auch zwanzigtausend, die fast alle in einstöckigen, buntgestrichenen Holzhäusern an ungepflasterten Straßen wohnten. Birken wuchsen in den Lücken zwischen den Häusern und auf den Höfen dahinter. Heruntergelassene Papierrollos, manchmal ein Kerzenleuchter hinter den Fensterscheiben. Hier und da bereits Zeichen von kriegsbedingter Verwahrlosung an den Tür- und Fensterrahmen und Fassaden, fehlende Farbe, zersprungenes Glas …
Eine gepflasterte Hauptstraße, die einen staubigen Platz streifte. An Geschäfte erinnere ich mich nicht, denn ich habe nie irgendwas gekauft oder kaufen können, als ich dort war. Um den staubigen Platz standen staubige Linden. Mitten auf ihm gab es einen geborstenen Sockel. Darauf hatte ein gußeiserner Lenin gestanden, den Arm mit dem ausgestreckten Zeigefinger nach Westen gehoben. Das Standbild war gestürzt worden. Lenin hatte man abtransportiert, irgendwohin, vielleicht war er inzwischen zu Gewehrläufen, Kanonenrohren oder Helmen geworden. Niedergerissen hatten ihn übrigens diejenigen Einwohner von Sumy, die glaubten, Hitler bringe ihnen Freiheit und Autonomie. Und abtransportiert hatten ihn die Deutschen. Vielleicht war der eiserne Lenin von Sumy mit anderen Denkmälern der Gegend im gleichen Güterzug weggeschafft worden, in dem auch die ersten Frauen und Männer des Landes in die reichsdeutschen Rüstungsfabriken gebracht worden waren; darunter wahrscheinlich etliche, die sich Freiheit und Autonomie anders gedacht hatten.
Ich erinnere mich an eine hellgrau gestrichene Kirche mit dem Stumpf eines Andreaskreuzes auf der barock wirkenden Kuppel. Sie wurde von den Kolchosen als Lager für Getreide genutzt. Der Pope war schon zwanzig Jahre vor dem gußeisernen Lenin abtransportiert worden. Allerdings in entgegengesetzter Himmelsrichtung.
Sumy war ein hübscher Ort. Er hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit der sächsischen Kleinstadt, in der ich vier Jahre Internatsschüler gewesen war. Vor allem der westliche Stadtteil mit dem Fluß glich dem Städtchen meiner Schulzeit. Der Fluß hieß Psjol, glaube ich. Er war nicht reguliert, sondern schlängelte sich malerisch zwischen weidenbewachsenen Ufern durch Sonnenblumenfelder und bunte Wiesen. Dort habe ich, an einem heißen Sommersonntagnachmittag, Tanja zum erstenmal geküßt, das weiß ich noch ganz genau. Aber das war bereits in der sechsten Woche meines Aufenthalts in Sumy, in der sechsten von insgesamt dreizehn Wochen.
Zum Zeitpunkt jenes ersten Kusses kannte ich Tanja schon fast vier Wochen. Verliebt in sie war ich von der ersten Sekunde an, in der ich sie gesehen hatte.
Kutsch hatte ich schon eine Woche früher zu Gesicht bekommen. Das war der Morgen des ersten Tages nach der Nacht gewesen, in der ich in das Lazarett von Sumy eingeliefert worden war.
Sie hatten uns – die Neuzugänge – auf dem Gang untergebracht, der das Hauptgebäude der ehemaligen Schule mit dem villenartigen Anbau verband, in dem früher wahrscheinlich der Schuldirektor gewohnt und das nun die Lazarettverwaltung bezogen hatte. Ich habe keine sehr deutliche Erinnerung an die Szenerie. Da ich hohes Fieber hatte, war alles, was um mich herum vorging, wie in warme Watte gewickelt. Ich weiß nur noch, daß wir ein Bild des Jammers geboten haben, eine Inkarnation des Infernos, dem wir – krank oder verwundet, sterbend oder verstümmelt – gerade entronnen waren. Ich weiß noch, daß neben mir einer lag, der seinen Kopf auf der grauen Wolldecke hin- und herwarf, in Abständen mit den zuckenden, blutleeren Lippen flüsternd nach seiner Mutter rief und sonst in einem hellen, nervtötenden Ton wimmerte wie ein verirrtes Kind. Die Form der Decke über seinem Körper verriet, daß er keine Beine mehr hatte. Dort, wo der Rumpf endete, war die Decke blutgetränkt. Wahrscheinlich waren seine Verbände durchgeblutet.
Ich weiß noch, daß auf der anderen Seite einer lag, der an die Wand starrte, ohne eine Bewegung, mit weit aufgerissenen Augen, stumm, fast ohne Lidschlag und Lippenzucken. Er reagierte auch nicht, als die Ärzte, Krankenträger und der Lazaretthauptfeldwebel von Lager zu Lager gingen, die Zettel an den Bahren entzifferten, mit einer Liste verglichen und uns einteilten, verteilten, kategorisierten – wie eine frisch gelieferte Stückgutsendung.
Sie redeten leise miteinander, kühl und sachlich, kein Zeichen von Mitleid, Ergriffenheit oder gar Entsetzen war ihnen anzusehen, und ich kam mir ausgeliefert vor wie Ware, wie ein Gegenstand.
Später ist mir klargeworden, daß die Ärzte und Pfleger sich gar nicht anders verhalten konnten als kühl, sachlich und distanziert. Wenn sie ihren Gefühlen nur im mindesten nachgegeben hätten, wären sie verrückt geworden, angesichts des Elends, des Irrsinns, mit dem sie immer wieder bei der Ankunft jedes neuen Lazarettzuges von der Front konfrontiert wurden. Auch die sensibelste Seele setzt Hornhaut an, wenn Schmerz, Blut, Tod und Tränen zum Alltagsgeschäft werden.
Zunächst aber, fiebrig, wie gesagt, und erschüttert von dem gerade Überstandenen, empfand ich die Kühle und Sachlichkeit der Aufnahme im Lazarett als abstoßend und demütigend. Dazu kam, daß der Hauptfeldwebel des Lazaretts einen zynisch-brutalen Schnauzton anschlug.
«Können Sie aufstehen?» herrschte er mich an, als die in weiße Kittel gekleideten Ärzte vor meiner Bahre standen. Es war wie ein Peitschenhieb.
«Das weiß ich nicht», erwiderte ich.
«Das wissen Sie nicht?» Er sah auf das Papier, das er in der Hand hielt, und dann mit vorgeschobener Unterlippe wieder auf mich. «Sie müßten das wissen, Mann – gehen Sie selber pissen – oder wollen Sie sich lieber trockenlegen lassen? Von zarter Schwesternhand … Wie?»
«Was hat er denn?» fragte der eine Arzt, ein weißhaariger mit rotblauem Gesicht.
«Malaria tertiana, Herr Oberstabsarzt!» rapportierte der Hauptfeldwebel.
«Letzte Temperatur?» fragte der Arzt.
«Neun Komma neun, gestern abend auf dem Truppenverbandsplatz», sagte der Hauptfeldwebel.
«Dann kann er natürlich nicht aufstehen, das ist ja wohl klar!» rügte der Arzt den Hauptfeldwebel.
Der kniff die Lippen zusammen und sah mich an. Ich grinste. Er runzelte die Brauen, als er das bemerkte.
Damit war unsere Feindschaft besiegelt.
«Legen Sie den Mann auf die Zwo», sagte der Arzt.
«Da sind nur noch drei Betten», sagte der Hauptfeldwebel.
«Na und?» fragte der Arzt unwirsch. «Er braucht ja wohl bloß eins! Also auf die Zwo, klar!»
Er sprach einen sehr jungen, schmalen Arzt an, der bis jetzt schweigsam neben ihm gestanden hatte.
«Ihr Fall, Kollege!»
«Jawoll», sagte der junge Arzt.
Dann gab der Oberstabsarzt noch ein paar lateinische Sprüche von sich, die ich nicht verstehen konnte, und wandte sich dem Kameraden zu, der links von mir wimmerte.
Der Hauptfeldwebel rapportierte wieder. Der Arzt hob die durchgeblutete Decke und sagte: «Turnhalle!»
«Jawoll!» schnarrte der Hauptfeldwebel.
«Aber behutsam, wenn ich bitten darf, Herr Kutsch!» sagte der Arzt und ging zur nächsten Bahre.
3
«Trocken lassen?» fragte Müller. «Oder darf ich Ihnen heute mal unsere neue keralogische Kopfwäsche empfehlen, Herr Gohlis?»
«Wenn Sie mir garantieren, daß ich dann wieder einen dichten Haarschopf kriege», sagte ich.
«Das kann man nicht garantieren», wich Müller aus. «Die keralogische Behandlungsmethode verhindert weiteren Haarausfall – aber was einmal kahl ist, das bleibt kahl. Leider. Wenn ich da was Sicheres wüßte! – Aber dann stünde ich auch nicht hier, Herr Gohlis! Dann säße ich auf der Terrasse meines Traumbungalows am Mittelmeer und würde vielleicht ein Buch von Ihnen lesen!»
«Schade, daß Sie dazu erst Millionär werden müssen», sagte ich. «Dabei habe ich unter meinen Lesern auch Hausfrauen, Angestellte und Lehrer …»
«Na ja, Lehrer», sagte er. «Die haben nun wirklich mehr Zeit als unsereins …»
Er band mir den fliederfarbenen Umhang ab, pinselte mir den Nacken sauber und griff noch einmal zum Rasiermesser, um ein paar dort stehengebliebene Haare zu entfernen. Das Rasiermesser war schön scharf. Es glitt ohne Kratzen über meine Haut.
Ich erhob mich ungern aus dem verführerisch bequemen Sessel. Müller bürstete mir den Rockkragen ab.
«Danke, Meister!» sagte ich.
«Und Sie überlegen sich die Sache mit dem Ferienhaus noch mal in Ruhe, Herr Gohlis, nicht wahr?» sagte er.
«Ja … Gewiß …» erwiderte ich verblüfft. Er mußte mir irgendwas von irgendeinem Ferienhaus irgendwo erzählt haben. Und ich hatte nicht zugehört. Aber es gelang mir, meine Verblüffung zu verbergen.
«Ich rede mit meiner Frau mal drüber!» sagte ich.
Wir gingen zur Kasse. In dem modern auf altmodisch eingerichteten Frisiersalon war natürlich auch die Kasse einer alten Ladenkasse nachgebildet, CASSA stand da in verschnörkelten Buchstaben auf dem von Jugendstilblumen aus Chrom verzierten Rücken des Monstrums.
«Neunfünfzig», sagte Will Müller. «Wie immer …»
«Stimmt nicht, Meister», sagte ich lächelnd und gab ihm einen Zehnmarkschein. «Vor gar nicht langer Zeit haben Sie mir noch für drei Mark die Haare geschnitten!»
«Alles ist teurer geworden», sagte er ungerührt und gab mir fünfzig Pfennig zurück. «Vor gar nicht langer Zeit hat ein Brief zwanzig Pfennig Porto gekostet. Und heute ist er dreimal so teuer!»
«Nur meine Honorare sind nicht dreimal so hoch wie damals», sagte ich.
«Da müssen Sie eben mal streiken», riet er.
«Das hilft nichts», sagte ich. «Streik wäre nur sinnvoll, wenn alle Autoren mitmachten – und auch dann kann das Fernsehen, der Funk, können die Verlage noch lange weiter produzieren. Dann graben sie eben die alten Dichter aus, die toten, die sich gegen Mißbrauch und Ausbeutung nicht mehr wehren können. Ein toter Metallarbeiter ist kein Streikbrecher. Mit dem kann man keine Autos herstellen. Aber mit toten Dichtern können sie noch jahrelang Bücher und Programme machen.»
«Da sind die Schriftsteller aber schlecht dran, heutzutage …» sagte Müller.
«Heutzutage …? Wie immer!» sagte ich. «Schönen Dank, Meister, in zwei – drei Wochen wieder!»
«Soll mir ein Vergnügen sein, Herr Gohlis!» flötete er, half mir in den Trenchcoat, reichte mir die Mütze, hielt mir die Tür auf und machte eine – nein, deutete eine Verbeugung an.