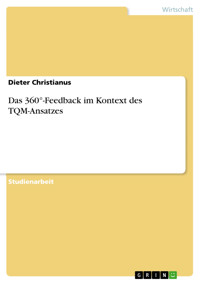19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rund 25 Millionen Tageszeitungen werden in Deutschland jeden Morgen gelesen. Mit ca. 350 Titeln ist die Vielfalt scheinbar groß, doch dahinter verbargen sich nur knapp 150 Redaktionen. Und viele Verlage stehen seit Jahren mit dem Rücken zur Wand: Sinkende Abonnentenzahlen drücken die Auflagen. Damit und mit der Wirtschaftskrise brachen die Anzeigenpreise und -buchungen ein. Für viele Verlage ist die anhaltende Krise inzwischen existenziell. Erfolgreiche Kundenbindung wird - wenn sie es nicht schon immer war - zur ökonomischen Notwendigkeit. Wie sich dieser Erfolgsfaktor durch einen hohen Grad an Kundenorientierung beeinflussen lässt, welche Qualitätsaspekte dabei eine Rolle spielen und wie der Zusammenhang zwischen Kundenzufriedenheit und Kundenbindung ist, wurde in drei Forschungsstudien untersucht. Im vorliegenden Buch werden die Ergebnisse des mehrstufigen Untersuchungsansatzes ausführlich vorgestellt und Umsetzungsempfehlungen erarbeitet. Das Buch wird damit zum wissenschaftlich fundierten Plädoyer für die Qualitätszeitung, denn nur ein gutes Produkt lässt sich auch dauerhaft vermarkten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Dieter Christianus
Dem Zeitungsleser auf der Spur. Qualitäts- und Zufriedenheitsmanagement in Zeitungsverlagen
© Tectum Verlag Marburg, 2011
ISBN 978-3-8288-5638-7
Bildnachweis Cover: Umschlagabbildung: © mal / www.photocase.de / newspaper Foto ID 50230
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-2539-0 im Tectum Verlag erschienen.)
Besuchen Sie uns im Internet unter www.tectum-verlag.de
www.facebook.com/Tectum.Verlag
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Vorwort
Teil A: Theoretische Grundlagen
1 Vom allgemeinen Qualitätsbegriff zur Unternehmensqualität
1.1 Der Qualitätsbegriff
1.2 Qualität als Schlüssel zum Unternehmenserfolg
1.2.1 Das PIMS-Programm – oder: warum Qualität entscheidend für den Unternehmenserfolg ist
1.2.2 Die Beziehungen zwischen relativer Qualität und Rentabilität
1.3 Der umfassende Qualitätsansatz: Unternehmensqualität im Zeitungsverlag
2 Qualitäts- und Zufriedenheitsmanagement im Zeitungsverlag
2.1 Der Zeitungsverlag im Spannungsfeld der Verbundproduktion
2.1.1 Die Verbundproduktion: Zeitungsvertriebs-und Anzeigengeschäft
2.1.2 Betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen in der Praxis
2.1.2.1 Kosten- und Umsatzrelationen
2.1.2.2 Primäre Orientierung an den Anzeigenkunden?
2.2 Qualitätsmanagement im Zeitungsverlag
2.2.1 Was ist publizistische Qualität?
2.2.1.1 Journalistische Qualität – gestern und heute
2.2.1.2 Von der Komplexität der Qualitätsdiskussion
2.2.1.3 Redaktionelle Qualitätssicherung mit dem TQM-Modell
2.2.2 Modelle zur Messung der publizistischen Qualität
2.2.2.1 Das Expertenurteil
2.2.2.2 Qualitätsbewertung anhand von messbaren Qualitätsindikatoren
2.2.2.3 Qualitätsbewertung durch Zeitungsleser – der kundenorientierte Ansatz
2.3 Der Zeitungsleser im Fokus – Zufriedenheitsmanagement im Zeitungsverlag
2.3.1 Theorie der Kundenzufriedenheitsforschung
2.3.1.1 Grundlagen
2.3.1.2 Modelle zur Messung der Kundenzufriedenheit
2.3.2 Erkenntnisse der Leserzufriedenheits- und Leserbindungsforschung
2.3.2.1 Die mediale Bedeutung der Tageszeitung im historischen Vergleich
2.3.2.2 Management der Leserzufriedenheit als Schlüssel zur Kundenbindung?
Teil B: Analytischer Teil
1. Empirische Untersuchung des Ursache-Wirkungszusammenhangs zwischen der Leserzufriedenheit und wirtschaftlichen Entwicklungen im Zeitungsmarkt
1.1 Der Mikro-Marketing-Ansatz: Der Zusammenhang zwischen der Globalzufriedenheit und der prospektiven Kundenbindung
1.1.1 Konzept der empirischen Untersuchung
1.1.2 Beschreibung der Datenerhebung und -erfassung
1.1.3 Beschreibung der Analysemethodik
1.1.4 Darstellung der Ergebnisse
1.1.4.1 Häufigkeitsverteilungen und Kreuztabelle
1.1.4.2 Korrelations- und Signifikanzanalyse
1.1.5 Kritische Diskussion der Ergebnisse
1.2 Der Makro-Marketing-Ansatz: Der Zusammenhang zwischen der Globalzufriedenheit und der Entwicklung des Abonnenten- und Auflagenwachstums
1.2.1 Konzept der empirischen Untersuchung
1.2.2 Beschreibung der Datenerhebung und -erfassung
1.2.3 Beschreibung der Analysemethodik
1.2.4 Darstellung der Ergebnisse
1.2.4.1 Vom Zusammenhang zwischen der Leserzufriedenheit und dem Auflagen-Wachstum
1.2.4.2 Vom Zusammenhang zwischen der Leserzufriedenheit und dem Abonnenten-Wachstum
1.2.5 Kritische Diskussion der Ergebnisse
2 Empirische Untersuchung des Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs zwischen Qualitätsindikatoren und der Leserzufriedenheit
2.1 Erläuterungen zum Forschungsansatz
2.1.1 Konzept der empirischen Untersuchung
2.1.2 Beschreibung der Datenerhebung und -erfassung
2.1.3 Beschreibung der Analysemethodik
2.2 Thesen zu den Qualitätsindikatoren nach Lacy/Fico
2.2.1 Thesen zu Qualitätstreibern nach Fico/Lacy
2.2.2 Thesen zu Hygienefaktoren nach Fico/Lacy
2.3 Thesen zu einem erweiterten Qualitätsindikatoren-Katalog
2.3.1 Thesen zu Qualitätstreibern
2.3.2 Thesen zu Hygienefaktoren
Teil C: Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
1 Zur Bedeutung der Leserzufriedenheit
1.1 Zusammenfassung und Interpretation der Studienergebnisse
1.2 Möglichkeiten und Grenzen der Steigerung der Kundennähe im Massenmedium Tageszeitung
1.3 Fazit und Ausblick
2 Der Katalog der Prüfmerkmale nach Lacy/Fico – Ein sinnvolles Kennzahlensystem zur Ermittlung der Zeitungsqualität?
2.1 Anforderungen an ein Qualitätsindikatorensystem
2.2 Optimierung des Qualitätsindikatorensystems
2.3 Nutzen des Qualitätsindikatorensystems
Teil D: Anhang
Das EFQM-Modell im Detail
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Vorwort
Qualität ist ein Dauerbrenner in der Medienforschung. Seit circa fünfzehn Jahren hält die aktuelle Qualitätsdebatte an. In dieser Zeit wurden zahlreiche Publikationen zum Thema Zeitungsqualität veröffentlicht. Ziel dieser Veröffentlichungen war es, den Begriff der journalistischen Qualität zu definieren sowie darüber hinaus objektive Bewertungsmaßstäbe für journalistische Qualität zu finden. Trotz intensiver Diskussion konnte jedoch kein allgemeingültiger Qualitätsmaßstab gefunden werden. Zeitungsqualität bleibt daher ein schwieriges und komplexes Thema.
Dennoch sollten auch die Fortschritte in der Qualitätsforschung nicht verleugnet werden. Näherte sich die wissenschaftliche Diskussion anfangs dem Qualitätsbegriff ausschließlich anhand ethischer und gesellschaftspolitischer Gesichtspunkte, so setzte sich vereinzelt die Erkenntnis durch, dass ohne die Berücksichtigung der Zeitungsleser die Zeitungsqualität nicht abschließend bewertet werden kann. Dennoch muss konstatiert werden, dass die Wünsche und Interessen der Zeitungsleser auch heute noch nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt werden – weder in der aktuellen Kommunikationsforschung noch in der täglichen Praxis der Zeitungsverlage. Auch blieben die ökonomischen Aspekte eines erfolgreichen Qualitätsmanagements bisher weitgehend unerforscht.
Aktuell kämpfen sehr viele Zeitungsverlage mit einem Rückgang des Zeitungsvertriebsgeschäfts (sinkende Anzahl an Abonnenten, sinkende Auflagen) sowie mit signifikanten Einbrüchen im Anzeigengeschäft. Für nicht wenige Verlage ist diese Krise existenziell. Kundenbindung wird – wenn sie es nicht schon immer war – zu einem der wichtigsten ökonomischen Erfolgsfaktoren. Inwiefern dieser Erfolgsfaktor durch einen hohen Grad an Kundenorientierung positiv beeinflusst werden kann, war Untersuchungsgegenstand einer Forschungsstudie, die vom Autor im Rahmen eines Promotionsstudiums durchgeführt wurde. Betrachtet man die einschlägige Literatur zur Kundenzufriedenheitsforschung, dann wird darin häufig unterstellt, dass eine Steigerung der Kundenzufriedenheit zu einem höheren Unternehmenserfolg führt. Der wissenschaftliche Nachweis dieser These wurde jedoch nur in wenigen Fällen erbracht. Im vorliegenden Buch werden die Forschungsergebnisse des mehrstufigen Untersuchungsansatzes ausführlich dargestellt.
Ein weiterer Analyseschwerpunkt basiert auf den Forschungsarbeiten von Lacy/Fico. Die beiden amerikanischen Kommunikationswissenschaftler stellten einen Katalog von Qualitätsindikatoren zur Messung der Zeitungsqualität zusammen. Im Rahmen der erwähnten Forschungsarbeit wurde analysiert, ob
ein positiver Zusammenhang zwischen den Qualitätsindikatoren und der Leserzufriedenheit besteht ,
ob weitere Qualitätsindikatoren identifiziert werden können
und ob ein Qualitäts-Scoring-System zur Qualitätsmessung entwickelt werden kann.
Die intensive Bearbeitung dieser Fragestellungen auf der Grundlage einer eigenständigen Untersuchung wäre ohne die Mitwirkung einer Reihe von Personen und Institutionen nicht möglich gewesen, denen ich deshalb zu großem Dank verpflichtet bin.
Deizisau, Oktober 2010
Teil A: Theoretische Grundlagen
1 Vom allgemeinen Qualitätsbegriff zur Unternehmensqualität
1.1 Der Qualitätsbegriff
Die Versuche Qualität zu definieren sind vielfältig. Ebenso ist die gemeinsprachliche Verwendung des Begriffs Qualität vielseitig und umfasst ein ganzes Bündel von Vorstellungen. Beispielsweise werden Begriffsinhalte wie „Service am Kunden“, „Gute Ware“, „Forderungen“, „Standards“, „Kundenwünsche“ mit der Qualität in Verbindung gebracht. Insbesondere, wenn man noch die Aussagen in der Werbung hinzuzieht, sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Von Imai Masaaki stammt der Satz: „Es gibt so viele Definitionen von Qualität, wie Leute, die sie definieren und es besteht keine Einigkeit darüber, was Qualität ist oder sein sollte“.1
Dennoch ist es hilfreich, sich mit dem Qualitätsbegriff intensiver zu beschäftigen und sich Gedanken über Qualitätsmerkmale zu machen. Zum Einstieg soll auf die folgenden beiden „offiziellen“ Qualitätsdefinitionen hingewiesen werden.
Die Qualitätsdefinition nach dem Deutschen Institut für Normung e.V. gemäß DIN 55 350, Teil 11 lautet: „Qualität ist die Beschaffenheit einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte oder vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen“.2
Dementsprechend könnte Qualität als Erfüllung von geforderten Eigenschaften verstanden werden.
Die Qualitätsdefinition nach der Deutschen Gesellschaft für Qualität e.V. lautet: „Qualität ist die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produktes oder einer Tätigkeit, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung gegebener Erfordernisse bezieht“.
Offen bleibt bei obigen Definitionen, wer diese Erfordernisse im Einzelfall definiert.3 Vereinfacht gesagt ist die Qualität die Relation zwischen realisierter Beschaffenheit und geforderter Beschaffenheit. Folglich müssen beide Seiten mit gleicher Aufmerksamkeit stets betrachtet werden.4
Griffiger und weniger formal ist die Definition von Haist und Fromm: „Übereinstimmung mit den Anforderungen des Kunden– Anforderungen bezüglich Funktion, Preis, Lieferzeit, Umweltverträglichkeit, ...“.
Als „gute Qualität“ wird demnach bezeichnet, wenn das Produkt bzw. die Dienstleistung die Anforderungen der Kunden erfüllt. D.h., das Kundenurteil steht im Vordergrund der Betrachtung. Andererseits folgt daraus zwingend, dass es ohne eine Spezifizierung der Anforderungen keine Qualität geben kann. Daher muss vor jeder Entscheidung hinsichtlich des Produktes bzw. der Dienstleistung sehr viel Mühe aufgewendet werden, die wirklichen Kundenanforderungen, z.B. in Form von Marktstudien, herauszufinden.5 Da jedoch die Erfüllung von Kundenanforderungen noch nichts über die „Qualität dieser Erfüllung“ aussagt, muss als Qualitätsindikator zusätzlich die Kundenzufriedenheit analysiert werden. Zink6 formuliert hierzu folgendermaßen:
„Qualität ist die Erfüllung von (vereinbarten) Anforderungen zur dauerhaften Kundenzufriedenheit.“
1.2 Qualität als Schlüssel zum Unternehmenserfolg
1.2.1 Das PIMS-Programm – oder: warum Qualität entscheidend für den Unternehmenserfolg ist
PIMS geht auf ein Forschungsprojekt von General Electric und der Harvard University in den 60er und 70er Jahren zurück. Dabei werden mit Hilfe von empirischen Untersuchungen diejenigen Kernfaktoren ermittelt werden, die über den Erfolg einer strategischen Geschäftseinheit effektiv entscheiden. PIMS soll daher die Frage beantworten, welches die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die Gesundheit und Fitness einer Unternehmung sind. PIMS gilt als das weltweit erste empirische Forschungsprojekt zur Ursachenanalyse von Profitabilität eines Geschäftes.8
Seit nahezu 40 Jahren werden die Erfolgsfaktoren für die Leistungsfähigkeit von Unternehmen laufend wissenschaftlich untersucht. Viele beteiligte Unternehmen (aktuell circa 4.000 strategische Geschäftseinheiten) aus den USA und Europa stellten hierfür und stellen immer noch Geld und Daten zur Verfügung. Der Nutzen für die beteiligten Unternehmen ergibt sich daraus, dass diese von den Erfahrungen der anderen beteiligten Unternehmen profitieren können. Der PIMS-Grundsatz lautet demnach: Lernen aus den Erfahrungen anderer, um eigene Fehler zu vermeiden.9
Das PIMS-Programm selbst basiert auf einer Reihe ökonomischer Grundannahmen:
Die empirischen Erkenntnisse über den Einfluss bestimmter strategischer Schlüsselfaktoren auf den Unternehmenserfolg am Markt wurden euphorisch aufgenommen.10 Im folgenden Kapitel werden diese Erkenntnisse speziell zum Erfolgsfaktor „Qualität“ zusammengefasst.
1.2.2 Die Beziehungen zwischen relativer Qualität und Rentabilität
„Auf lange Sicht ist der wichtigste Einzelfaktor, der den Erfolg einer Geschäftseinheit bestimmt, die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen im Vergleich zu ihren Konkurrenten“11. Dies ist eine der wichtigsten Botschaften aus der PIMS-Studie.
Das Maß für die Qualität der Produkte und Dienstleistungen im Vergleich zum Wettbewerb ist die relative Qualität. Der in der PIMS-Datenbank geführte Index der relativen Qualität einer jeden Geschäftseinheit wird durch Expertenurteile und Kundenbefragungen ermittelt.
Die folgende Graphik zeigt, wie nach Buzell/Bradley die relative Qualität das Wachstum und die Rentabilität steigert:
Abbildung 1: Wie Qualität Rentabilität und Wachstum steigert12
Nach Schaldach eröffnet überlegene Qualität dem Unternehmen drei positive Optionen:
Erstens kann für das höherwertige Angebot ein höherer Preis erzielt werden,
zweitens kann der erzielte Mehrbetrag reinvestiert werden, damit der Qualitätsvorsprung gehalten bzw. ausgebaut werden kann und
drittens kann den Kunden ein interessanteres Preis/ Leistungsverhältnis angeboten werden.
13
Die Anbieter von überlegenen qualitativen Produkten und Dienstleistungen erzielen in der Praxis eine höhere Umsatzrentabilität (ROS=Return on Sales) und eine höhere Gesamtkapitalrentabilität (ROI=Return on Investment). Der folgenden Abbildung 2 kann man die quantitativen Zusammenhänge entnehmen.
Abbildung 2: Überlegene Qualität bringt hohe Erträge14
Neben der Qualität fördert auch der relative Marktanteil die Rentabilität, da die Marktführer Kostenvorteile durch Größen- und Erfahrungseffekte realisieren können. Die folgende Abbildung 3 zeigt den entsprechenden quantitativen Zusammenhang.
Abbildung 3: Sowohl Qualität als auch Marktanteil fördern die Rentabilität15
Einer weiter differenzierenden McKinsey-Langzeitstudie zum Qualitätsmanagement „Excellence in Quality Management“ kann man ferner entnehmen, dass
Prozessqualität insbesondere die Rendite und
Designqualität insbesondere das Wachstum und damit den Marktanteil positiv beeinflusst.
16
Unter Designqualität wird die Fähigkeit eines Unternehmens verstanden, Produkte zu entwickeln, die möglichst genau die Anforderungen der Kunden erfüllen.17
Die PIMS-Daten wiederum zeigen, dass die relative Qualität den relativen Preis beeinflusst. Der Marktanteil hat nur geringen Einfluss auf die Preise (vgl. Abbildung 4). Daher können höhere Preise, zum Vorteil des Anbieters, am Markt durchgesetzt werden.
Abbildung 4: Qualität beeinflusst den Preis; der Marktanteil hat nur einen geringen Einfluss auf den Preis18
Viele der beeindruckenden Ergebnisse werden in der Literatur weitgehend kritiklos akzeptiert und finden sich heute in aktuellen Lehrbüchern als Quasi-Gesetzmäßigkeiten wieder. Doch gibt es auch kritische Stimmen zur PIMS-Studie. So kritisieren Barzen/Wahle zu Recht die verwendete Operationalisierung des Erfolgsfaktors „relative Qualität“.19 Hierzu wurde ein von PIMS entwickeltes Instrument eingesetzt, um die Qualität der eigenen Produkt- und Dienstleistungspalette im Vergleich zum Wettbewerb zu messen. Das Messinstrument basiert auf einer multiattributiven Selbstbewertung durch ein Team von Experten und Managern der Geschäftseinheit.20
Des Öfteren wurden die Ergebnisse durch Kundenzufriedenheitsbefragungen verifiziert und gegebenenfalls modifiziert.21 Einerseits besticht die verwendete Methode durch ihre einfache Anwendbarkeit.22 Andererseits existiert eine Diskrepanz zwischen Selbsteinschätzungen durch die Unternehmen (Eigenbild) und den tatsächlichen Kundenurteilen (Fremdbild).23 Insofern müssen die PIMS-Ergebnisse hinsichtlich des Erfolgsfaktors „relative Qualität“ leider mit Zurückhaltung aufgenommen werden, da die Operationalisierung des Faktors „relative Qualität“ Schwächen aufweist.
1.3 Der umfassende Qualitätsansatz: Unternehmensqualität im Zeitungsverlag
Der Weg des Total Quality Managements ist beschwerlich. Empirische Untersuchungen zeigen, dass 60% der Unternehmungen bei der Umsetzung dieses ganzheitlichen Qualitätsansatzes scheitern.24 Beispiele für ein erfolgreiches, kundenorientiertes Qualitätsmanagement liefern die Preisträger des European Quality Awards (EQA).
Die European Foundation for Quality Management (EFQM) wurde im September 1988 gegründet. Die wichtigste Aktivität war von Anfang an die Schaffung eines Europäischen Qualitätspreises, dessen Basis ein umfassend verstandener Qualitätsgedanke sein sollte. Vorbild war der sehr erfolgreiche amerikanische Qualitätspreis, der „Malcolm Baldridge National Quality Award“, sowie der ebenso erfolgreiche japanische Qualitätspreis „Deming Prize“. Ziel des Preises war es, auf diese Weise Paradebeispiele für Spitzenleistungen zu identifizieren und auf breiter Front die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu steigern.25
Der EQA arbeitet mit einem sehr modernen und umfassenden Qualitätsverständnis:
„Quality is what the customer says it is. “26
Analog hierzu wird auch beim Malcolm Baldridge National Quality Award die Qualität vom Kunden definiert. Der Ausgangspunkt eines Qualitätsmanagements müssen demnach die Produkt- und Dienstleistungsmerkmale sein, die einen Beitrag zum Kundennutzen leisten und letztlich zur Zufriedenheit des Kunden führen sollten.27
In den Qualitäts-Score des EQA gehen neben der Kundenzufriedenheit auch die Ziele und Interessen anderer Stakeholder mit ein. Diese Stakeholder sind
die Mitarbeiter („Mitarbeiterzufriedenheit“),
die Eigenkapital- und Fremdkapitalgeber („Geschäftsergebnisse“) sowie
sonstige gesellschaftliche Gruppen („Auswirkungen auf die Gesellschaft“).
28
Qualität wird zudem auch als Führungsaufgabe verstanden, d.h. das oberste Management ist die treibende Kraft in diesem Veränderungsprozess.29
Ein wichtiger Aspekt im EQA ist es, Unternehmensqualität messbar zu machen. Anhand von zahlreichen, gewichteten Einzelfaktoren wird die Unternehmensqualität zu einem Gesamtindex verdichtet.
Die folgende Abbildung 5 zeigt im Überblick die relevanten Einzelfaktoren:
Abbildung 5: Kriterienraster des EQA30
Das am stärksten gewichtete Kriterium ist dabei die Kundenzufriedenheit (200 von insgesamt 1.000 Punkten). Der Prüfer bewertet jeden Teil der Ergebniskriterien, indem er zwei Faktoren miteinander kombiniert:
Inwieweit die Ergebnisse überragend sind und
wie umfänglich die Ergebnisse sind.
Darüber hinaus ist Nachhaltigkeit gefordert. Beispiel Kundenzufriedenheit: Es wird erwartet, dass das Unternehmen in regelmäßigen Abständen (jährlich) die Kundenzufriedenheit misst, sich bei den Ergebnissen positiv vom Wettbewerb abhebt und sich die Ergebnisse von Jahr zu Jahr verbessern (keine einmalige Messung).31
Es werden fünf Hauptkriterien bewertet, die beschreiben WIE die Spitzenleistungen erreicht wurden und in Zukunft weiterhin erreicht werden sollen:
• Kriterium 1: Führung
• Kriterium 2: Strategie und Planung
• Kriterium 3: Mitarbeiterorientierung
• Kriterium 4: Partnerschaften und Ressourcen
• Kriterium 5: Prozesse
Unmittelbar qualitätsmaßgebend, aus Sicht der Kunden, ist die Ausgestaltung der Geschäftsprozesse, da sie unmittelbar auf die Kundenzufriedenheit wirken. Dabei werden die für den Unternehmenserfolg wichtigsten Geschäftsprozesse analysiert. Fünf Teilkriterien sollen zeigen, wie die Unternehmen zur Unterstützung ihrer Strategie und Planung ihre
• Prozesse systematisch gestalten und managen,
• Prozesse bei Bedarf unter gezieltem Einsatz von Innovationen verbessern, um Kunden und andere Interessengruppen voll zufrieden zu stellen und den Nutzen für diese zu steigern,
• Produkte und Dienstleistungen aufgrund der Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden planen und entwickeln,
• Produkte und Dienstleistungen herstellen, liefern und betreuen sowie
• Kundenbeziehungen entsprechend aufbauen, pflegen und vertiefen.32
In vier Ergebniskriterien wird gemessen, WAS bisher an Ergebnissen erreicht wurde:
• Kriterium 6: Kundenzufriedenheit
• Kriterium 7: Mitarbeiterzufriedenheit
• Kriterium 8: Gesellschaftliche Auswirkungen
• Kriterium 9: Geschäftserfolge33
Das von der Bedeutung am höchsten gewichtete Ergebnis-Kriterium, die Zufriedenheit externer Kunden (Kriterium 6), sollte für ein marktwirtschaftliches System eine selbstverständliche Größe sein. Einige wichtige Facetten dieses Kriteriums sind:
• Wie werden die Produkte und Dienstleistungen durch die Kunden aktuell beurteilt?
• Wie sind diese Ergebnisse im Vergleich zu Wettbewerbern?
• Wie hat sich die Kundenzufriedenheit in der Vergangenheit entwickelt?
• Welche zusätzlichen Beurteilungs- und Messgrößen zur Erfassung der Kundenzufriedenheit werden eingesetzt, um möglichst frühzeitig Informationen über die Entwicklung der Kundenzufriedenheit zu erhalten (z.B. Beschwerdemonitoring)?
• Werden den Kunden Qualitätsgarantien eingeräumt?
• Werden bei der Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen Kunden unmittelbar beteiligt?34,35
Das Konstrukt „Kundenzufriedenheit“ ist demnach der zentrale Erfolgsfaktor eines umfassenden Qualitätsgedankens.
1 Imai, Masaaki: Kaizen: Der Schlüssel zum Erfolg der Japaner im Wettbewerb, 3.Auflage, München, 1992
2 Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN), DIN 55350, Teil 11, Seite 3, Nr. 5
3 Vgl. Bruhn, Manfred: Qualitätssicherung im Dienstleistungsmarketing –eine Einführung in die theoretischen und praktischen Probleme. In:Bruhn, Manfred/Stauss, Bernd: Dienstleistungsqualität – Konzepte, Methoden, Erfahrungen, 2. Auflage, Wiesbaden, Gabler, 1995, ISBN 3-409-23655-4, Seite 23
4 Vgl. Geiger, Walter: Qualitätslehre, Einführung – Systematik – Terminologie, 2. Auflage, Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig/ Wiesbaden,1994, Seite 45
5 Vgl. Haist, Fritz/Fromm, Hansjörg: Qualität im Unternehmen/Prinzipien – Methoden – Techniken, 2. Auflage, Carl Hanser Verlag,München/Wien, Seite 5
6 Zink, Klaus J.: TQM als integratives Managementkonzept: das europäische Qualitätsmodell und seine Umsetzung; München, Wien; Hanser, 1995, ISBN 3-446-18246-2, Seite 28
7 Vgl. z.B. Kottmann, Karl: (Hrsg.): Unternehmensqualität/Überblick überdie Erfolgsfaktoren eines Unternehmens, Stuttgart, Teubner, 1993, ISBN3-519-06349-2, Seite 2
8 Vgl. Buzzell, Robert D./Bradley, T. Gale: Das PIMS-Programm: Strategien und Unternehmenserfolg, Gabler, Wiesbaden, 1989, ISBN 3-409-13343-7, Seite 1-26
9 Vgl. Buzzell, Robert D./Bradley, T. Gale: Das PIMS-Programm: Strategien und Unternehmenserfolg, Gabler, Wiesbaden, 1989, ISBN 3-409-13343-7, Seite V-XIII sowie 27-44
10 Vgl. Hildebrandt, Lutz/Strasser, Helge: PIMS in der Praxis – ein Controllingsystem. In: Harvard Manager, Theorie und Praxis des Managements,4. Quartal 1990, Seite 127
11 Buzzell, Robert D./Bradley, T. Gale: Das PIMS-Programm: Strategien und Unternehmenserfolg, Gabler, Wiesbaden, 1989, ISBN 3-409-13343-7,Seite 7
12 Buzzell, Robert D./Bradley, T. Gale: Das PIMS-Programm: Strategien und Unternehmenserfolg, Gabler, Wiesbaden, 1989, ISBN 3-409-13343-7,Seite 92, Abbildung 6-1
13 Vgl. Schaldach, Heinz: Entwicklung einer europaweiten Qualitätsstrategie. In: Zeitschrift für Planung, Jahrgang 1990, Seite 162
14 Buzzell, Robert D./Bradley, T. Gale: Das PIMS-Programm: Strategien und Unternehmenserfolg, Gabler, Wiesbaden, 1989, ISBN 3-409-13343-7, Seite 93, Abbildung 6-2
15 Buzzell, Robert D./Bradley, T. Gale: Das PIMS-Programm: Strategien und Unternehmenserfolg, Gabler, Wiesbaden, 1989, ISBN 3-409-13343-7,Seite 94, Abbildung 6-3
16 McKinsey & Company, Inc., Rommel, Günter/Brück, Felix/Diederichs, Raimund/Kempis, Rolf-Dieter/Kaas, Hans-Werner/Fuhry, Günter: Qualität gewinnt – mit Hochleistungskultur und Kundennutzen an die Weltspitze, Stuttgart, Schäffer-Poeschel, 1995, ISBN 3-7910-0855-2, Seite10
17 ebenda, Seite 31
18 Vgl. Buzzell, Robert D./Bradley, T. Gale: Das PIMS-Programm: Strategien und Unternehmenserfolg, Gabler, Wiesbaden, 1989, ISBN 3-409-13343-7, Seite 95, Abbildung 6-4
19 Vgl. Barzen, Dietmar/Wahle, Peter: Das PIMS-Programm – was es wirklich wert ist. Den Gesetzen des Markterfolgs auf der Spur – „Lernen aus den Erfahrungen anderer“. In: Harvard Manager, Theorie und Praxis des Managements, 1. Quartal 1990, Seite 105 und 109
20 Vertiefende Informationen zur Methode enthält Quartapelle, Alberto Q./ Larsen, Georg: Kundenzufriedenheit; Wie Kundentreue im Dienstleistungsbereich die Rentabilität steigert, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1996, ISBN 3-540-59398-5, Seite 148-152. Auch Schaldach stellt die PIMS-Operationalisierung zur Messgröße „relative Qualität ausführlich da: Vgl. Schaldach, Heinz: Entwicklung einer europaweiten Qualitätsstrategie. In: Zeitschrift für Planung, Jahrgang 1990, Seite 166-172
21 Vgl. Buzzell, Robert D./Bradley, T. Gale: Das PIMS-Programm: Strategien und Unternehmenserfolg, Gabler, Wiesbaden, 1989, ISBN 3-409-13343-7, Seite 91-93
22