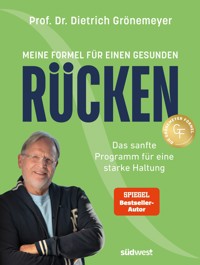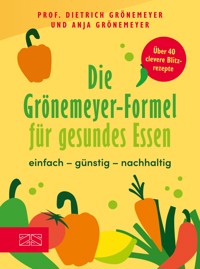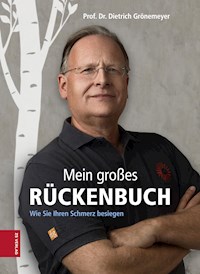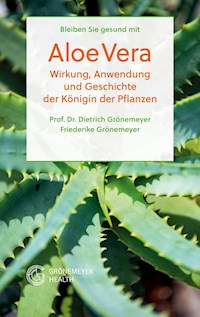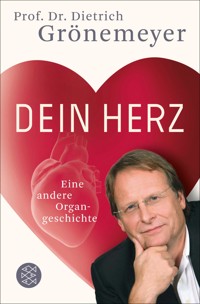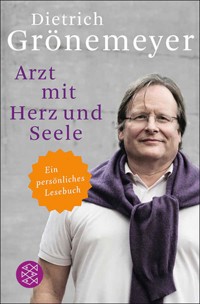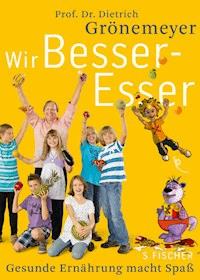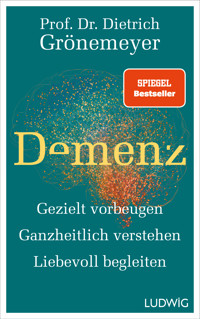
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Dietrich Grönemeyer
- Sprache: Deutsch
Alles, was Sie über Demenz wissen sollten
Das individuelle Demenzrisiko lässt sich senken! Mit kleinen Schritten – von Bewegung, gesunder Ernährung, gemeinsamen Aktivitäten, Entspannung und gutem Schlaf bis zu einer positiven Lebenseinstellung – können wir viel dafür tun, dass Demenz gar nicht erst entsteht. In seinem umfassenden Buch beleuchtet Prof. Dietrich Grönemeyer, neben den wirkungsvollen Präventionsmöglichkeiten, welche Hoffnungen wir in die Forschung setzen können. Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Medizin, Psychologie und Ernährung zeigt er, wie Demenz frühzeitig erkannt und verlangsamt werden kann, und wie wir bestmöglich mit der Erkrankung umgehen. Am besten gemeinsam! In seinem umfassenden Buch spricht er über die Herausforderungen im Alltag mit Demenzkranken und erzählt von seinen persönlichen Erfahrungen in der Familie. Dabei gibt er eine Fülle von Anregungen, die im Umgang mit Betroffenen den Unterschied machen. Ein neuer Blick auf die Krankheit – geprägt von Verständnis, Hoffnung, Empathie und konkreten Maßnahmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Inhalt:
Alles, was Sie über Demenz wissen sollten
Das individuelle Demenzrisiko lässt sich senken! Mit kleinen Schritten – von Bewegung, gesunder Ernährung, gemeinsamen Aktivitäten, Entspannung und gutem Schlaf bis zu einer positiven Lebenseinstellung – können wir viel dafür tun, dass Demenz gar nicht erst entsteht. In seinem umfassenden Buch beleuchtet Prof. Dietrich Grönemeyer neben den wirkungsvollen Präventionsmöglichkeiten, welche Hoffnungen wir in die Forschung setzen können. Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Medizin, Psychologie und Ernährung zeigt er, wie Demenz frühzeitig erkannt und verlangsamt werden kann und wie wir bestmöglich mit der Erkrankung umgehen. Am besten gemeinsam! Er spricht über die Herausforderungen im Alltag mit Demenzkranken und erzählt von seinen persönlichen Erfahrungen in der Familie. Dabei gibt er eine Fülle von Anregungen, die im Umgang mit Betroffenen den Unterschied machen. Ein neuer Blick auf die Krankheit – geprägt von Verständnis, Hoffnung, Empathie, viel Liebe und konkreten Maßnahmen.
Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer
Demenz
Gezielt vorbeugen Ganzheitlich verstehen Liebevoll begleiten
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Ludwig Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
www.ludwig-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Unter der Mitarbeit von Anne Jacoby
Redaktion: Evelyn Boos-Körner
Coverdesign: wilhelm typo grafisch unter Verwendung eines Motivs von Christoph Burgstedt / Shutterstock.com
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31199-5V001
Verstandesherz
Selbst
wenn
der VERSTAND
messerscharf
der
Wortschatz
Allumfassend
Worte
präzise
gewählt
Sätze
brillant
formuliert
und
Geschichten
umfassend
erzählt
Nichts
versteht
so gut
wie
das
HERZ
Dietrich Grönemeyer
Juni 2009
Hella-Carin, Wilhelm, Willa und Wally und den vielen anderen Vergiss-Mich-Nicht gewidmet
Inhalt
Ein Wort zuvor
I Was ist Demenz?
Warum es viele Demenzformen gibt – und wie wir sie erkennen
Wie fühlt sich Demenz für Betroffene an? • Wie fühlt sich Demenz für »die anderen« an? •Demenz – eine weltweit wachsende Herausforderung. Und ein Hoffnungsschimmer. • Alzheimer, Lewy-Body, vaskulär – was ist was? • Wie verläuft Demenz? • Die ersten Anzeichen von Demenz – bei anderen und bei sich selbst
II Forschung
Doch, man kann etwas tun
Lecanemab – Hoffnung mit vielen Fußnoten • Eiweißablagerungen: Nicht jeder wird durch Plaques dement • Stille Entzündung bringt Durcheinander im Kopf • Wenn die Kraftwerke im Kopf streiken • Trauma, Stress und Kopfnüsse • Staub in der Nase, Plastik im Kopf • 14 Stellschrauben gegen das Vergessen
III Prävention
Kleine Schritte, große Wirkung
Bewegung als Schutzschild
Tai-Chi – der Sport der Hundertjährigen
Das richtige Essen für fitte Hirnzellen • Bildung macht den Unterschied? So logisch, wie es klingt, ist es nicht • Hören und Sehen – die unterschätzten Schlüssel zur geistigen Gesundheit • Kreativität als Gehirntraining • Gemeinsam statt einsam • Genuss mit Maß • Entspannung und Schlaf
IV Besser leben mit Demenz
Willkommen in einer anderen Welt
»Mörder! Mörder!« Wenn der Krieg zurückkommt • »Du bist mein Cousin!«: Das Verrückt-Sein so nehmen, wie es kommt • »Alles geklaut!« Wovor sich demenzkranke Menschen fürchten • »Ich will nach Hause«: Demenzkranke auf Wanderschaft • Autofahren mit Demenz? Bitte, bitte nicht. • Nudeln in der Zitruspresse: Wie sich demenziell veränderte Menschen organisieren • »Die Frau heißt blauer Fleck!«: Verstehen, auch wenn die Worte purzeln • »Ich bin so traurig …« Was noch gesagt sein will • »Rätsel sind so doof.« Kognitives Training hat Grenzen • »Und dann gehe ich mit Schwung in die Erde.« Todessehnsucht und Glaube
V Herausforderungen in der Klinik, im Heim und zu Hause
»Herr Doktor, da mache ich nicht mit«
Ist es nun Demenz? Oder noch nicht? • Ist es noch Depression? Oder schon Demenz? Wie beides zusammenhängt • »Schmeiß das weg, das stinkt!« Gesund essen in der Pflege und zu Hause – trotz allem • »Prost!« So motivieren Sie zum Trinken • »Schluck das jetzt runter!« – Wenn Tabletten nehmen so einfach wäre … • Schmerzen erkennen – auch ohne Worte • Bluthochdruck und Rhythmusstörungen – die oft übersehenen Baustellen • Wut statt Fieber: Infektionen erkennen bei Menschen mit Demenz • Stürze: Wenn Verletzungen vergessen werden • Zähne: »Doch, doch, die habe ich geputzt!« • Inkontinenz: »Nein, das brauche ich nicht« • »Ich hau dir gleich eine!« Wenn Demenzkranke aggressiv werden • Alles, was recht ist
Es ist eine heikle Aufgabe – und so wichtig
Und wie geht es Ihnen? Pflege und Selbstfürsorge
VI Eine Frage der Würde
Menschlichkeit, Hoffnung und Liebe
Lebensfreude, jetzt erst recht! • Für eine demenzfreundliche Gesellschaft
Dankeschön
Anhang
Demenz? 5 Fakten zum Weitersagen • 8 Hacks für eine demenzfreundliche Wohnung • 8 Knotenlöser für akute Krisen • Hier gibt es Hilfe per Telefon
Anmerkungen
Ein Wort zuvor
»Dietrich, da ist irgendwas in meinem Kopf!« Das sagte mein Vater oft und klopfte sich dabei zornig auf seinen Schädel. »Dietrich, ich merke da was!« Anfangs nahm ich das nur wenig ernst. »Ja, Vater, du wirst alt, und dann läuft es vielleicht mit der Durchblutung nicht so richtig.« Doch meine ärztlichen Beschwichtigungen ließ mein Vater nicht gelten. »Nein, nein, Dietrich, irgendwas ist wirklich anders in meinem Kopf.« Heute sage ich rückblickend: Er hatte recht. Er hat seine Demenz früh kommen sehen. Viel früher als wir – seine Söhne, seine Frau, seine Freunde.
Es fing langsam an: Zuerst wurde aus seinem stolzen, kräftigen Gang ein Tippeln. Parkinson – ganz typisch im Verlauf einer Demenz. Dann passierte etwas, das für ihn ganz untypisch war: Meine Mutter kam später als erwartet zu einem Familienfest, und er rastete aus. Zorn, blanke Aggression. Von diesem Moment an war keine Verständigung mehr mit ihm möglich. Als hätte die Demenz über Nacht einen Schalter in ihm umgelegt. Er schlug um sich. Wir alle versuchten, ihn zu beruhigen, zu bändigen, zumindest irgendwie zu halten.
Es dauerte nicht lange, bis die Diagnose klar war: eine rasant voranschreitende Lewy-Körper-Demenz. Doch was hilft diese Diagnose, wenn der Vater schreit? Wenn er schlägt? Wenn er auf die Straße läuft und sich und andere in Gefahr bringt? Wenn er in der Dusche sitzt und unsichtbare Soldaten anbrüllt: »Mörder, Mörder, Mörder!«
Das sind Momente, die mir unter die Haut gegangen sind. Ich habe viele davon erlebt: Bei meinem Vater kamen in der Demenz die Stalingrad-Traumata zurück; meine Tante verliebte sich in der Demenz alle drei Minuten neu in das gleiche Hündchen; meine Mutter verstummte; meine Großmama trug in der Demenz aus Sicherheitsgründen immer ein Küchenmesser bei sich. Im BH.
Und doch gibt es bei allen Herausforderungen, die Demenz mit sich bringt, immer auch Schönes, Skurriles, Wunderbares. Auch wenn Menschen mit Demenz in ihrer eigenen Welt leben, die wir nicht immer ganz verstehen, so gibt es doch die Chance, alte Konflikte zu vergessen und sich stattdessen zu versöhnen, miteinander zu leben, zu lachen und das Leben zu feiern. Ich bin total dankbar dafür, dass es Herbert, Anja und mir mit unseren Familien, den Kindern und Enkelkindern trotz allem immer wieder gelungen ist, die demenziell veränderten Menschen in unserer Familie zum Lächeln zu bringen, manchmal zum Lachen oder sogar zum Sprechen.
Wir alle wollen alt werden – aber bitte, ohne alt zu sein. Am liebsten fit und formvollendet bis weit über 90, mit Sportschuhen, Smartphone und einem verschmitzten Lächeln im Gesicht. Und klar, das ist ein schöner Traum, und in der Werbung sieht er wunderbar real aus. Nur besteht das Alter leider nicht aus Fitness plus Fernreisen. Da gibt es immer auch Zipperlein, da gibt es Trauer, Abschied, Verlust. Das schieben wir lieber weg. Besonders, wenn es um Demenz geht.
Weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Weil uns das Angst macht – dieses leise Verschwinden, das man nicht aufhalten kann, nicht wegoperieren, nicht wegerklären. Es passt nicht zum Bild vom durchoptimierten »Best Ager«. Deshalb geraten Menschen mit Demenz oft aus dem Blick. Nicht aus Bosheit. Sondern weil uns die Nähe zu ihnen unangenehm ist, weil wir ihr »Verrückt-Sein« bedrohlich finden und ihr Verhalten inakzeptabel. Dabei wären Nähe und Akzeptanz genau das, was es braucht.
Ende 2023 lebten in Deutschland 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Jedes Jahr kommen viele dazu. Allein 2023 waren es rund 445 000 Menschen über 65 Jahre, bei denen eine Demenz neu festgestellt wurde.
Die Zahlen steigen weiter, weil wir alle älter werden. Das ist an sich eine gute Nachricht – aber sie hat Folgen. Wenn sich bei Prävention oder Behandlung nichts Grundlegendes tut, könnten es im Jahr 2050 schon 2,7 Millionen an Demenz erkrankte Menschen in Deutschland sein. Das ist nicht irgendwer. Das sind Eltern, Großeltern, Nachbarn, Freunde. Und irgendwann vielleicht wir selbst.1
In der Forschung tut sich was – keine Frage. Und doch gibt es bis heute kein sicheres Heilmittel. Noch immer ist nicht vollständig klar, warum Menschen dement werden. Was da im Gehirn genau geschieht. Und ob es bei allen Betroffenen überhaupt dasselbe ist.
Wir wissen: Es kann genetische Ursachen geben. Eine gestörte Energieversorgung im Gehirn. Eine fehlgeleitete Immunreaktion. Und immer deutlicher zeigt sich: Auch seelische Verletzungen können eine Rolle spielen. Traumata, die tief sitzen. In manchen Fällen scheint die Demenz eine Art Rückzugsort zu sein – der Versuch des Gehirns, sich vor Überforderung zu schützen. Ein letzter Raum, in dem sich die erschöpfte Seele verbarrikadiert. Ob bei Ihrem Vater, Ihrer Schwester, Ihrem Freund oder bei Ihnen selbst – oft lässt sich nicht sagen, welcher der genannten Faktoren der entscheidende ist. Vielleicht ist es einer. Vielleicht sind es viele.
Aber eins ist klar: Nur wenn wir bereit sind, all diese Möglichkeiten mitzudenken, verändert sich unser Blick. Dann sehen wir die Demenz nicht mehr als ein schlimmes Schicksal, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben wollen. Sondern als Teil einer vielschichtigen Geschichte des Alterns. Und dann können wir auch menschlicher damit umgehen.
Ganz gleich, ob wir eines Tages verstehen, was bei einer Demenz genau im Gehirn passiert, ob wir sie irgendwann aufhalten oder heilen können – mein größter Wunsch ist ein anderer: dass wir erkennen, wie viel Würde in jedem einzelnen Leben steckt, auch dann, wenn es sich verändert. Auch dann, wenn es nicht mehr so funktioniert, wie wir es gewohnt sind.
Menschen mit Demenz haben ein Recht auf Teilhabe. Auf Zuwendung. Auf Nähe. Sie gehören nicht ausgeschlossen, nicht abgeschoben – sondern mitten hinein ins Leben, zu uns. Zu denen, die das Glück haben, noch klar zu denken.
Das bedeutet: ein liebevoller, geduldiger Umgang zu Hause, in der Familie. Und in den Pflegeeinrichtungen ein Alltag, wie wir ihn uns selbst wünschen würden. Doch genau hier scheitert unser System oft. Menschen mit Demenz werden zu häufig ruhiggestellt, ignoriert, falsch behandelt – nicht aus bösem Willen, sondern weil die Strukturen fehlen, die Zeit, die Schulung. Angehörige sind überfordert – wie sollen sie die Pflege auch schaffen, wenn sie gleichzeitig arbeiten und sich um eigene Kinder kümmern müssen? Viele Pflegekräfte sind auch überfordert. Die Strukturen in den Krankenhäusern lassen weder Zeit noch Raum für demenzkranke Menschen. Dann liegen sie orientierungslos in ihren Betten und rufen, rufen, rufen, und niemand kommt. Weil niemand vorbereitet ist auf das, was Demenz mit einem Menschen machen kann. Und weil es keine Ressourcen gibt, auch nur das Nötigste aufzufangen.
Dabei ist klar: Diese Krankheit wird uns noch viel mehr beschäftigen. Medizinisch, gesellschaftlich, menschlich. Sie ist ein Stresstest für unsere Fähigkeit, das Geschenk eines längeren Lebens wirklich anzunehmen – und auch dann noch hinzusehen, wenn es unbequem wird.
Kein Wunder also, dass die Angst groß ist: Laut einer repräsentativen Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der DAK-Gesundheit, veröffentlicht Ende 2024, fürchten sich 55 Prozent der Deutschen am meisten davor, an Demenz oder Alzheimer zu erkranken. Nur die Angst vor Krebs ist noch größer.2 Die Angst vor Demenz ist so groß, dass viele lieber wegschauen, als sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit, sich trotzdem zu kümmern, immer größer.
Viele Menschen, die mitten im Zweiten Weltkrieg geboren wurden oder kurz danach, werden jetzt dement. Oder sind schon dement. In ihrem langen Leben hat sich viel angesammelt: Sorgen, die nie ausgesprochen wurden. Kränkungen, die tief sitzen. Träume, die sie irgendwann aufgegeben haben. Verluste, Verletzungen, vergrabene Ängste. Auch Schuld, vielleicht. Wenn wir ihnen helfen, all diese losen Enden wiederzufinden – und daraus gemeinsam so etwas wie einen tragfähigen Lebensfaden zu knüpfen –, dann tun wir nicht nur ihnen etwas Gutes. Dann heilt auch in uns selbst etwas.
Deshalb dieses Buch: Es will eine Einladung sein, demenziell veränderte Menschen neu anzuschauen, sich in ihre »ver-rückte« Welt neu einzufühlen und neue Wege zu finden, mit ihnen in Beziehung zu bleiben. Gleichzeitig möchte dieses Buch Sie begleiten – wenn Sie selbst einen demenzkranken Menschen betreuen, vielleicht auch mehrere. Wenn Sie Tag und Nacht mit der Krankheit leben. Wenn Sie müde sind, überfordert, ratlos, wütend oder einfach nur erschöpft. Dieses Buch will an Ihrer Seite sein. Mit Hintergründen, die helfen können, das Verhalten »altersverwirrter« Menschen besser zu verstehen. Und mit Anregungen, die Ihren Alltag hoffentlich ein kleines Stück leichter machen.
Ich habe in meinem Leben viele Menschen mit Demenz begleitet – und immer wieder wurde ich gefragt: »Kann man da eigentlich etwas tun?« Ja, man kann. Dieses Buch zeigt Ihnen, was Sie selbst tun können, damit Ihr Kopf lange klar bleibt: sich bewegen, gut essen, Neues lernen, mit allen Sinnen leben, kreativ bleiben, Freunde treffen, genießen, entspannen, gut schlafen. Kein starres Programm – eher ein bunter Kasten mit vielen, vielen Ideen zur Demenzprävention. Und vielleicht ist ja genau das Richtige für Sie dabei.
Ich bin überzeugt: Auch für unseren eigenen Seelenfrieden brauchen wir neue Formen des Miteinanders – freier, menschlicher, lebendiger. Wir brauchen ein Zusammenleben mit alten und sehr alten Menschen, das nicht von Pflicht, sondern von Beziehung getragen ist. Das wäre für mich ein Teil der »ars vivendi et moriendi«, dieser alten Idee von der Kunst zu sterben – und vor allem: zu leben.
Mir gefällt mein Slogan »Fit bis 100«. Und Ihnen? Ich finde, er bringt etwas Entscheidendes auf den Punkt: Altern ist kein Verfall, gegen den man nichts tun kann. Altern ist ein natürlicher Prozess vom ersten Lebenstag an, den wir mitgestalten können. Auch im Hinblick auf Demenz!
Natürlich gibt es keine Garantie. Aber vieles spricht dafür, dass Bewegung, gute Ernährung, geistige Anregung, soziale Nähe und ausreichend Schlaf unser Gehirn stärken. Es geht um Lebensqualität, gerne auch ohne Bikinifigur, gerne auch mit Lachfalten. Entscheidend sind ganz andere Dinge: Selbstständigkeit, Klarheit, Lebensfreude. Wer heute auf sich achtet, erhöht die Chance, auch morgen noch selbst über sein Leben bestimmen zu können. Fit bis 100! Ist das nicht eine schöne Einladung an uns selbst?
I Was ist Demenz?
Warum es viele Demenzformen gibt – und wie wir sie erkennen
Ich war fünfzehn, als mir die Demenz das erste Mal begegnete. Oder sagen wir: als sie mir zum ersten Mal auffiel. Und zwar bei meiner geliebten Tante – der Schwester meiner Mutter, einer Frau mit großem Herzen und einer Vorliebe für Zwergschnauzer. Der aktuelle hieß Schnuffi. Ein wirklich süßer Hund. So süß, dass meine Tante sich wieder und wieder und wieder in ihn verliebte.
»Wie heißt der liebe Hund?«, fragte sie.
»Schnuffi«, sagten wir.
»Oh, wie süß der ist. So ein lieber Hund!«
Drei Minuten später: »Sag mal, wie heißt denn der süße Hund?«
»Schnuffi, liebe Tante.«
»Ach, der ist ja toll. Komm mal her, du Kleiner.«
Wieder drei Minuten später: »Was ist das denn für ein süßer Hund?! Wie heißt der denn?«
Und so ging das Tag für Tag. Dieselbe Begeisterung, dieselbe Frage, dieselbe Antwort. Schnuffi, Schnuffi, Schnuffi. Wir Jugendlichen fanden das unfassbar. »Bekloppt!« Wir machten uns lustig über die Tante, wir wussten es nicht besser. Was wir als Jugendliche nicht verstanden: Demenz ist eine Krankheit, die einem Menschen Stück für Stück wegnimmt, was er liebt. Seine Erinnerung. Seinen Sinn. Seine ganze Welt.
Was wir auch nicht wussten: Unsere liebe Tante war traumatisiert. Vom Krieg. Vom Verlust ihrer geliebten Heimat Estland. Zusammen mit meiner Mutter und ihren Schwestern hatte sie mitangesehen, wie Fremde in das Haus eindrangen, das sie gerade überstürzt verlassen hatten, und wie sie sich dort breitmachten. Sie musste Todesängste ausstehen, als das Schiff, mit dem sie über die Ostsee fliehen wollten, ohne sie ablegte. Und dann noch einmal, als sie vom Hafen aus zusahen, wie dieses Schiff unter Bombenhagel in der Ostsee versank, zusammen mit allen, denen es gelungen war, einen Platz auf diesem Schiff zu ergattern: Freunde, Nachbarn. Alle kamen sie um; meine Großmama und ihre Töchter kamen davon. Mit einem einfachen Bollerwagen, mit Schiffen, Pferdewagen zogen sie von Tallin nach Danzig, von Danzig nach Goslar. Ich weiß bis heute nicht, wie ihnen das gelungen ist. Was ich aber weiß: Der Horror des Krieges, der Horror dieser Flucht blieb als Trauma. Bei allen vier Frauen.
Vielen Menschen aus dieser »Kriegseltern«- und »Kriegskinder«-Generation ist es gelungen, die Schrecken, das Grauen, die Gewalterfahrungen dieser schlimmen Jahre tief zu vergraben. Mit viel Disziplin. Mit Härte gegen sich selbst und andere. Mit endlosem, unruhigem Beschäftigtsein. Im hohen Alter aber versiegt oft die Kraft, diese Erinnerungen unter dem Deckel zu halten. Dann suchen sich die verdrängten Erlebnisse ein Ventil – manchmal in Form einer Demenz.
Meine Großmama war eine sehr harte Frau. Für uns Kinder war sie wie eine Mischung aus einem gefährlichen Drachen und einem ostpreußischen General – statt in Uniform eben in Schürze. Herzlichkeit war nicht gerade ihre Sache, jedenfalls nicht in den Jahren, in denen sie noch ganz klar war. Als die Demenz sich langsam ankündigte, veränderte sie sich: Plötzlich war sie vergnügt, geradezu fröhlich. Sie erzählte Witze, pfiff manchmal sogar ein Liedchen vor sich hin. Ich war skeptisch.
War sie nicht die gleiche Großmama, die uns beim Mittagessen strammstehen ließ, bis unsere Mutter zu Tisch saß? Die uns nicht aufstehen ließ, bevor die Mutter aufgestanden war? Die mit strafendem Blick in der Küche Patrouille lief, um zu kontrollieren, ob wir drei Brüder den Tisch auch wirklich ordentlich deckten, ob wir auch wirklich ordentlich abräumten, ob wir wirklich richtig abspülten, ob wir die Teller perfekt abtrockneten und alles akribisch an seinen Platz zurückstellten? (Dabei übte einer von uns Brüdern oft dringend lieber Gitarre. Großmama duldete das, vielleicht in weiser Voraussicht.)
Später lachte Großmama über diese Küchenszenen. Doch es dauerte nicht lange, bis sie sich an die Küchengeschichten nicht mehr erinnerte, bis sie nicht mehr wusste, was eine Küche eigentlich ist, und mich dann auch gar nicht mehr erkannte.
»Wer sind Sie denn eigentlich?«, fragte sie und starrte mich an, als sei ich ein Eindringling.
»Großmama, ich bin doch dein Enkel.«
»Ich habe keine Enkel.«
»Doch, Großmama, ich bin’s, Dietrich.«
»Kenne ich nicht.«
Sie setzte sich mir gegenüber, kniff die Augen zusammen und fragte wieder:
»Wer sind Sie? Sie sehen mir sehr gefährlich aus!«
Ich versuchte zu lächeln: »Großmama, ich bin doch dein Enkel.«
»Ich habe keine Enkel. Was wollen Sie von mir? Ich bin bewaffnet, ich kann mich verteidigen!«
Blitzschnell griff sie unter ihre Bluse und zog ein Messer aus dem BH. »Kommen Sie mir bloß nicht zu nah!«
Ich schluckte. Rückte sicherheitshalber ein Stück von ihr weg. Dachte nach. Warum das Messer? Warum im BH? Unter Schock stehend, verstand ich immerhin, dass Verteidigung für sie gerade überlebenswichtig war. Also sagte ich lapidar: »Verteidigen ist immer gut.«
Ich atmete ein paar Mal durch. Dann schien es mir – tatsächlich aus Angst, dass sie wirklich zustechen könnte – am günstigsten, in ihrer ver-rückten Szene mitzuspielen, und ich verzog mich möglichst ruhig aus der Küche: »Ich gehe jetzt, ich habe ja Angst vor Ihnen!«
Als ich später nach ihr sah, hatte sie diese Szene vergessen. Ich nicht. Doch in diesem Augenblick verstand ich: So furchtbar ich die Küchenszenen in der Kindheit auch fand – meine Großmama war keine »harte Frau«. Sie war eine Frau, die sich auf der Flucht so hart gemacht hat, dass sie mit Zähnen, Klauen und Küchenmesser um ihr Leben und das Leben ihrer drei Töchter kämpfen konnte. Sie hat sich hart gemacht, um zu überleben.
Als der kleine Flüchtlingstreck in Goslar angekommen war, dauerte es nicht lange, bis sich meine Eltern kennenlernten. Mein Vater war gerade aus dem Krieg zurückgekehrt. Stalingrad. Er war froh, dass er lebte, wenn auch nun mit nur einem Arm, dem linken; der rechte war in Russland geblieben. Er zwang sich mit äußerster Härte dazu, sich nichts anmerken zu lassen – weder den Stumpf noch den Schmerz.
Wie so viele junge Väter in den 1950er-Jahren war auch mein Vater nicht gerade zimperlich. Als wir älter wurden, wurde es in den politischen Diskussionen mit ihm nicht leichter. Ich war für den Atomausstieg, er für Atomkraft. Ich war für einen freieren Umgang mit Sexualität, er war für Zucht und Ordnung. Und so ging es weiter. Für mich war das oft schwer zu ertragen.
Erst als sein erster Enkelsohn und später seine Enkelinnen geboren wurden, wurde er milder. Er wurde offener, zugewandter – und in unseren politischen Diskussionen beim gemeinsamen Essen klang er fast schon weise. »Bleibt in der Mitte«, sagte er. »Sucht die Mitte. Lasst euch nicht von den Extremen, rechts oder links, überrollen. Und versucht, euch gegenseitig zu verstehen.« Irgendwann habe ich begriffen: Mit Radikalpositionen kommt man nicht weiter. Auch ich nicht. Man muss zwischen den widerstreitenden Polen vermitteln. Man muss aufeinander zugehen, auch wenn es schwer ist. Heute bin ich dankbar, dass ich diesen Moment der Annäherung mit meinem Vater mitgestalten und erleben durfte, bevor er mit 87 Jahren über Nacht in seiner Demenz versank. Auf diese Versöhnung mit ihm hatte ich lange nicht zu hoffen gewagt. Und doch ist es geschehen. Das macht glücklich und trägt bis heute.
Wie fühlt sich Demenz für Betroffene an?
Kein Messgerät, kein Test, keine äußere Beobachtung kann erfassen, wie sich Demenz von innen anfühlt. Was wir immerhin zu wissen glauben: Es gibt nicht die Demenz. Es gibt nur Menschen mit Demenz, und bei jedem verläuft sie anders, jeder erlebt sie anders. Selbst an einem einzelnen Tag kann sich das demenziell veränderte Erleben am Morgen anders darstellen als am Mittag und wieder anders am Abend. Mal war ich für Großmama der Bruder, mal ein Fremder, selten war ich Dietrich. Mal war der Nebel dicht, mal weg.
Manchmal wirkt es, als nehme ein Mensch mit Demenz die Welt wahr wie ein Betrunkener: verwirrt, verzerrt, verzögert. Oder wie ein Kleinkind: orientierungslos, planlos, wortlos. Doch das täuscht. Auch wenn einzelne Reaktionen ähnlich scheinen, ist da eine andere innere Welt. Wer einen demenzkranken Menschen behandelt wie einen Betrunkenen, tut ihm unrecht. Wer mit ihm spricht wie mit einem Kleinkind, tut ihm ebenso unrecht. Menschen mit Demenz sind Erwachsene mit Erfahrungen, mit Emotionen, mit einer Menschenwürde, die nicht antastbar ist. Die zumindest nicht antastbar sein sollte.
Das Wort dement stammt aus dem Lateinischen: »de-« bedeutet weg, ab, herunter. Und »mens« heißt Geist, Verstand. Wörtlich ist ein dementer Mensch also ein Mensch ohne Geist, ein vom Verstand Abgekommener. Dement ist ein Wort, das abwertet. Wie bei so vielen Worten, vor denen die lateinische Silbe »de-« auftaucht – demotiviert, demoliert, deformiert –, geht es um etwas Verlorenes. Doch ein dementer Mensch ist kein demolierter, er ist kein defekter, kein verlorener Mensch. Er ist ein Mensch, den wir nicht verloren geben dürfen.
Wir wissen nicht, was in unserem »dementen« Gegenüber vorgeht, genauso wenig wie wir wissen, was in unserem »gesunden« Gegenüber vorgeht. Und doch hilft es, wenn wir versuchen, uns der inneren Welt eines Demenzkranken anzunähern. Das gelingt der Literatur zuweilen besser als der Medizin. Da ist zum Beispiel Arno Geigers Erzählung Der alte König in seinem Exil.3 Für diesen alten König – es ist Geigers eigener Vater – »gibt es keine Welt außerhalb der Demenz«.4 Also versucht der Sohn, in die Welt des dementen Mannes hineinzuschlüpfen. Es gelingt ihm nie ganz, der Vater bleibt ihm »unergründlich«.5 Und doch treffen sie sich auf einer anderen Ebene neu. Vergessen sind die alten Konflikte. Vergnüglich die Stunden, in denen die beiden gemeinsam am Tisch sitzen. Geiger schreibt, der Vater schaut zu. »Oft ist es, als wisse er nichts und verstehe alles.«6
Oder Jörg Maurers Roman Leergut. »Es ist nicht unangenehm, nichts mehr zu verstehen. Es sind Geräusche wie der Wind oder das Meeresrauschen. Und dann rauscht gar nichts mehr«, lässt Maurer die Neurologin erklären, die die Hauptfigur behandelt, schon mit Mitte 30 ein Alzheimer-Patient. Es sind die anderen, es sind die Gesunden, die diesem Menschen das Leben schwer machen, sobald sie ihn in die »richtige Welt« zurückholen wollen. Seine eigene Traumwelt scheint ihm viel interessanter, zumindest kein bisschen beunruhigend. »Sie schlafen ein, sie dämmern weg«, erklärt die Neurologin. »Das tut nicht weh, mein Lieber. Für die Angehörigen ist es viel schlimmer.«7 Dass eine Demenz auch für die Gesunden ein schlimmes Schicksal sein kann, mindestens so schlimm wie für die Kranken, ist ein wichtiger Punkt.
Wie fühlt sich Demenz für »die anderen« an?
Demenz ist lästig – für die anderen. Weil Demenz Umstände macht. Extraarbeit. Weil Demenz Zeit braucht, die niemand eingeplant hat. Und wer will es schon gern ertragen, so formuliert es Arno Geiger, »dass sich der Vater mittels einer Krankheit in die Abwesenheit zurückzieht und gleichzeitig aus der Abwesenheit heraus mein Leben beeinträchtigt«.8 Demenz ist eine Zumutung. Sie ist für uns »Gesunde« eine Zumutung, weil sie Illusionen zerreißt, die wir uns über das Leben machen, um es vermeintlich besser auszuhalten. Doch eigentlich machen wir es uns (und auch den Demenzkranken) genau mit diesen Illusionen noch viel schwerer. Oder? Ich denke an folgende fast schon fixe Alltagsideen, die wir beim Erleben einer Demenz leider loslassen müssen.
Das Leben »vollendet« sich nicht.Eslöst sich auf. Eine unserer liebsten Illusionen ist die »Vollendungsillusion«, sagt der Philosoph Odo Marquard. Doch das Leben geht nicht so rund und schön zu Ende wie ein Theaterstück, »das ist eine Illusion; denn wir sind alsbald ohne Rücksicht auf Vollendungen am Ende.«9 Die Demenz fragt nicht, ob wir alles abgeschlossen haben, was uns wichtig war. Sie kommt, wann sie will, und macht uns einen Strich durch die Rechnung.
Doch ist das Unvollendete, das Unfertige, das Zerbrochene wirklich weniger wertvoll? Sind wir ein Niemand, wenn es uns nicht gelingt, die Stube besenrein an die Hinterbliebenen zu übergeben? Wenn wir keine glamouröse Heldenreise abgeschlossen haben? Ich habe auf meinen Reisen viel gesehen, auch in Japan. Da erzählen die Menschen Geschichten anders als wir hier. Da muss es nicht immer ein großes Finale geben, nicht immer ein Happy End. Da darf etwas offenbleiben. Man nennt das Kishōtenketsu. Am Ende steht ein Atemholen. Vielleicht ist das der Gedanke, der uns weiterbringt, wenn wir uns mit dem Thema Demenz vertraut machen wollen. Dass nicht alles, damit es Bedeutung hat, »fertig« sein muss.
Unsere »Identität« kann zerfallen. Und wir sind immer noch jemand. Wenn wir uns nicht mehr erinnern – nicht an unsere Herkunft, nicht an das Zuhause von früher, nicht an die Eltern, Geschwister, Kinder, Enkel, nicht an die Abenteuer in der Kindheit, nicht an die Freunde, nicht an den Beruf, nicht an die Entscheidungen, nicht an die Aufgaben, die wir uns selbst gesetzt haben – wer sind wir dann? Hat ein Mensch, der seine Geschichten verloren hat, sich selbst verloren?10 Das ist eine beunruhigende Frage.
Bei meinen Reisen auf der Suche nach einer Weltmedizin ist mir immer wieder aufgefallen: In anderen Kulturen gilt ein Mensch nicht nur dann als wertvoll, wenn er einen Lebenslauf mit einer Liste von Leistungen vorzeigen kann. Er ist ein Mensch, einfach so. Auch wenn er nicht mehr ins Büro gehen kann. Nicht mehr Geschichten erzählen kann. Nicht einmal mehr Kartoffeln schälen kann.
Das fällt uns im Westen oft schwer: Wir verknüpfen unsere Identität mit der Arbeit. Wir schätzen die Arbeit mehr als das Sein. Viele Menschen mit Demenz leben genauso nach diesem Bild, und das ist traurig. Sie meinen, sie hätten kein Lebensrecht mehr, wenn sie nichts mehr »beitragen«. Viele schämen sich dafür, dass sie »zur Last fallen«. Wer sich so fühlt – arbeitslos, identitätslos, wertlos –, verliert seinen Lebensmut und gleitet noch schneller ab in Rückzug und Einsamkeit. Deshalb ist mir so wichtig, dass wir gerade im Umgang mit Demenz immer wieder klarmachen: Ein Mensch ist nicht wertvoll, weil er etwas leistet, sondern weil er da ist. Weil er mit uns ist. Einfach so.
Trotzdem ist das nicht einfach zu ertragen – der an Demenz erkrankte Mensch ist für uns oft ja nicht wirklich da. Katrin Seyfert bringt das in ihrem Buch Lückenleben schmerzhaft klar auf den Punkt: »Alzheimer verlangt mehr Ausdauer von Angehörigen als jede andere Krankheit, weil der Mensch jahrelang und langsam verschwindet, bevor er tot ist.«11
Wir leben nicht in der gleichen »Wahrheit«. Und das ist gar nicht schlimm. Im Umgang mit Demenz ist das einer der schwierigsten, aber auch am meisten befreienden Gedanken: Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Schneekugel. (Kennen Sie diese mit Wasser und künstlichen Schneeflocken gefüllten Halbkugeln, die man schüttelt, und dann schaut man in eine magische Welt?) Die Schneekugeln der Gesunden ähneln sich untereinander, die der Demenzkranken sind ganz anders. Hier gibt es Menschen und Tiere, die wir nicht sehen können. Hier werden vertrocknete Blumenstängel, Plastikblumen und frische Blumen zusammen eingepflanzt (»Was hast du denn, das sind doch alles Blumen!«). Hier legt man sich mit dem guten Anzug ins Bett und schläft friedlich bis zum nächsten Morgen (»Warum soll ich einen anderen Anzug zum Schlafen anziehen, der ist doch gut!«). In Ordnung. Wo keine ernsthafte Gefahr im Verzug ist, sondern nur unsere Vorstellungen auf die Probe gestellt werden, müssen wir Menschen, die in anderen Wirklichkeiten leben, unsere Wirklichkeit nicht aufzwingen. Arno Geiger hat es treffend formuliert: »Einem Demenzkranken eine nach herkömmlichen Regeln sachlich korrekte Antwort zu geben, ohne Rücksicht darauf, wo er sich befindet, heißt, versuchen, ihm eine Welt aufzuzwingen, die nicht die seine ist.«12
Dann lassen wir es doch einfach. Geben wir unsere Wahrheiten auf und besuchen wir die alten Menschen, so gut es geht, in ihren Schneekugeln. Manchmal finden wir erst in diesem fantastischen Land die wahrhaftige, die herzenswarme Verbindung zu den Großeltern, zu den Eltern oder zu alten Freunden, die wir uns als Kinder so bitter ersehnt haben.13
Demenz – eine weltweit wachsende Herausforderung. Und ein Hoffnungsschimmer.
Wir werden immer älter. Und mit der wachsenden Lebenserwartung wächst auch die Zahl der Menschen, die über 80 oder 90 Jahre alt werden. Weil das Risiko einer Demenzerkrankung im hohen Alter deutlich steigt, rechnen Fachleute damit, dass die Zahl demenzkranker Menschen bis 2050 auf 2,3 bis 2,7 Millionen anwachsen wird – allein in Deutschland.
Was viele nicht wissen: Rund sechs Prozent der Erkrankten in Deutschland sind jünger als 65 Jahre. Das sind über 100 000 Menschen, die zum Teil noch mitten im Berufsleben stehen, die Familie und Kinder haben. Was es für eine Familie mit drei Schulkindern, mit Hund und Haus bedeutet, wenn der Papa mit Anfang fünfzig ausfällt, wenn also plötzlich ein Einkommen fehlt, wenn eine Bezugsperson für die Kinder fehlt, wenn es kaum sinnvolle Hilfsangebote gibt und Freunde wie Nachbarn abwechselnd mit viel zu viel Erbsensuppe und Rückzug reagieren, ist eindrücklich nachzulesen in Katrin Seyferts Bestseller Lückenleben. Hier müsste auf allen Ebenen noch sehr viel passieren – in den Familien, in der Nachbarschaftshilfe, in der Politik. Es passiert viel zu wenig.
Doch trotz vieler Lücken in der Demenzforschung, in der Versorgung der Demenzkranken und trotz insgesamt immer mehr Menschen mit Demenz in der ganzen Welt gibt es Hoffnung: In den vergangenen 25 Jahren ist das Risiko, an Demenz zu erkranken, in den USA und Europa gesunken – um ganze 13 Prozent pro Jahrzehnt. Und das nicht, weil sich unsere Gene verändert hätten, sondern weil wir heute besser gebildet sind, weil wir gesünder leben als frühere Generationen. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass es weniger Menschen gibt, die in den Wirren des Zweiten Weltkriegs geboren und aufgewachsen sind und die bis ins hohe Alter unter ihren frühen Traumata leiden. Und ja, nicht nur das: Wie viele Erwachsene, aber auch wie viele Kinder haben alles gegessen, was ihnen irgendwie essbar schien, Wurzeln, Blätter, Erde, auch rohes Fleisch und verdorbene Nahrung (mein Vater erzählte uns davon). Sie haben sich mit Vergiftungen herumgeschlagen, mit Infektionen, haben zwar irgendwie überlebt. Aber der Körper merkt sich das, und die Seele auch.14
Alzheimer, Lewy-Body, vaskulär – was ist was?
In meiner Jugend war die Sache mit der Demenz vermeintlich noch ganz einfach. Verwirrte, orientierungslose alte Menschen wie unsere Tante, die sich nicht einmal einen einfachen Hundenamen merken konnten, nannten wir »verkalkt«. Wir stellten uns vor, dass sich die Blutgefäße in ihrem Gehirn langsam zusetzen wie Wasserrohre in alten Häusern. Ganz falsch war die Idee nicht: Bei der vaskulären Demenz spielen Durchblutungsstörungen eine Rolle. Richtig war die Idee aber auch nicht. Heute wissen wir, dass es sehr viele verschiedene Demenzformen gibt, auch Mischformen.
Wie für fast alles in der Medizin gibt es auch für Demenzerkrankungen offizielle Definitionen. Hier diejenige der Weltgesundheitsorganisation WHO:
»Demenz (F00-F03) ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen. Das Bewusstsein ist nicht getrübt. Die kognitiven Beeinträchtigungen werden gewöhnlich von Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation begleitet, gelegentlich treten diese auch eher auf. Dieses Syndrom kommt bei Alzheimer-Krankheit, bei zerebrovaskulären Störungen und bei anderen Zustandsbildern vor, die primär oder sekundär das Gehirn betreffen.«15
Es ist nicht schlecht, die offiziellen Diagnose-Codes zu kennen – vielleicht hat man eines Tages einen Arztbrief auf dem Tisch, auf dem diese Codes auftauchen. Die Codes der verschiedenen Demenzformen beginnen bei F00 für Demenz bei Alzheimer-Krankheit, gehen weiter mit F01 bei vaskulärer Demenz und F02 für Demenzen, die infolge anderer Krankheiten auftreten. Für jeden Code gibt es weitere Unter-Codes: zum Beispiel F02.1 für die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (besser bekannt als »Rinderwahn«), F02.3 für Demenz bei Parkinson, F02.4 für Demenz bei HIV oder F02.8 bei Demenz infolge von Vitamin-B12-Mangel.
Alzheimer, Lewy und Bruce Willis: Was wir heute über primäre Demenzen wissen
Beginnen wir mit einer grundlegenden Unterscheidung: Es gibt primäre Demenzen – da liegt die Ursache der Krankheit im Gehirn selbst. Aus unterschiedlichen Gründen sterben Nervenzellen ab oder »reden nicht mehr richtig miteinander«. Und es gibt sekundäre Demenzen. Hier taucht die Demenz als Folge anderer Erkrankungen oder Einflüsse auf, die das Gehirn beeinträchtigen: Alkoholismus, Mangelernährung, Tumore. Sekundäre Demenzen sind seltener und für die Betroffenen eine gute Nachricht. Denn, das ist der wichtigste Unterschied: Wenn die Grunderkrankung geheilt werden kann, dann kann auch eine sekundäre Demenz verschwinden.
Alzheimer ist eine primäre Demenz, weitere Beispiele sind die frontotemporale Demenz oder die Lewy-Körper-Demenz (dazu gleich mehr). Diese Demenzformen können wir im Moment noch nicht rückgängig machen. Sie sind nicht heilbar. Allerdings gibt es mittlerweile Medikamente, mit denen sich diese Demenzen bei einigen (leider wenigen) Betroffenen verzögern lassen (wenn auch nur kurz). Schauen wir uns die primären Demenzformen an:
DieAlzheimer-Krankheit ist die häufigste Form der Demenz. Das, was viele sich unter Demenz vorstellen, ist meistens Alzheimer. Es gibt zwei Formen: »Typ 1« beginnt meist erst im höheren Alter, oft erst mit Ende 70. Sie entwickelt sich langsam und fängt meistens mit kleinen Gedächtnislücken an. Mal ein Name, mal ein Termin – Dinge, die uns allen mal entfallen. Nur dass es eben nicht dabei bleibt.
Dann gibt es auch eine frühere Form, die schon vor dem 65. Lebensjahr beginnt, das ist »Typ 2«. Dieser Typ kommt mit Wucht und entwickelt sich rasch weiter. Menschen verlieren plötzlich das Zeitgefühl, wissen nicht mehr, wo sie sind, finden sich im Gespräch nicht mehr zurecht. Bei beiden Formen passiert im Gehirn im Grunde dasselbe: Da lagert sich ein Eiweiß, das sogenannte Beta-Amyloid, als Plaques zwischen den Nervenzellen ab. Innerhalb der Nervenzellen verklumpt ein anderes Eiweiß, das Tau-Protein, zu wirren Faserknäueln. Beides zusammen bringt die Kommunikation der Nervenzellen durcheinander – deshalb fallen immer mehr geistige Funktionen aus, und irgendwann kann das Gehirn auch den Körper nicht mehr steuern.
Dievaskuläre Demenz kommt deutlich seltener vor als Alzheimer. Sie entsteht, wenn die Durchblutung im Gehirn gestört ist – nach einem Schlaganfall zum Beispiel oder vielen kleinen Infarkten, die man oft gar nicht richtig bemerkt. Hier kommt alles nicht so langsam und stetig wie bei Alzheimer, sondern eher ruckartig, weil mit jedem kleinen Durchblutungsproblem ein weiterer Bereich im Gehirn praktisch »ausgeknipst« wird. Gedächtnis, Planen, sogar Gehen – eins nach dem anderen geht verloren.
DieLewy-Körper-Demenz ist benannt nach dem Neurologen Friedrich H. Lewy, der 1912 erstmals runde Eiweißablagerungen (das sind die »Lewy-Körperchen«) in den Nervenzellen beschrieben hat. Von dieser Demenzform war mein Vater betroffen. Das Besondere (und für Angehörige besonders herausfordernd): Diese Form der Demenz verändert sich ständig. Man weiß bei jedem Besuch also nicht, was auf einen zukommt. Mal wirkt der betroffene Mensch fast wie früher, dann ist er plötzlich müde, verwirrt oder plötzlich sehr aggressiv. Vielleicht sieht er Lebewesen oder Dinge, die nicht da sind – große Tiere in der Küche, gefährliche Soldaten in der Dusche. Dazu kommen Schlafstörungen, bei denen laut geredet oder sogar geschlagen wird, weil der Körper das Geträumte »mitmacht«. Häufig, so war es auch bei meinem Vater, kommen Bewegungsprobleme dazu, die ähnlich sind wie bei einer Parkinsonerkrankung: steifer Gang, Zittern, Unsicherheit.
Diefrontotemporale Demenz (kurz FTD) tritt meistens schon früher auf – etwa zwischen Mitte 40 und Mitte 60. Anders als bei Alzheimer ist hier nicht das Gedächtnis das Erste, was sich verändert, sondern die Persönlichkeit. Manche Menschen werden teilnahmslos, deshalb kann FTD