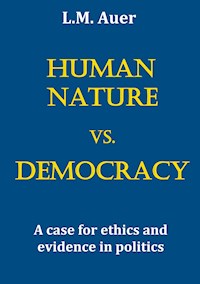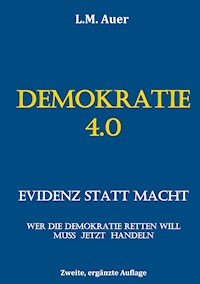
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Demokratie als Methode zur Schaffung einer sozialen Ordnung gerät in einen Notstand: Einerseits ist sie die heute weltweit anerkannteste Regierungsform. Gleichzeitig aber ist sie in weniger als fünf Prozent der Staaten voll entwickelt und in vielen Ländern, kaum etabliert, nur noch Schauplatz weitgehend tatenlosen Parteigezänks und polarisierter Bürgergruppen. Zusätzlich befinden sich demokratische Staaten auf der Weltbühne in einem ideologischen Spannungsfeld und zeigen gegenüber kollektivistischen und autokratischen Systemen existenziell bedrohliche Schwächen: Denn einerseits sieht die westliche Welt der liberalen repräsentativen Demokratien sich selbst und den Rest der Welt heute noch immer mit den Augen ihrer Vorväter, der weltbeherrschenden Kolonialherren, und ihre Vorstellungen von Ethik und Sozialordnung als global gültig. Andererseits aber schwächelt dieser Westen zunehmend ratlos angesichts seiner eigenen sogenannten Werte. Der Autor beschreibt zunächst drei Stufen der Entwicklung von Demokratie der Antike bis zur Gegenwart. Als viertes Thema diskutiert er sodann die sorgenvollen Beobachtungen europäischer und amerikanischer Autoren der rezenten Literatur zur derzeitigen Entwicklung, sowie deren Vorschläge zur Verbesserung. Die vergleichende Analyse weist auf selbstzerstörerische Widersprüchlichkeiten in der demokratischen Ideologie und ihren Strategien. Daraus ergibt sich, dass die Rolle und Funktion des demokratischen Bürgers noch weitgehend durch archaische Formen von Sozialverhalten bestimmt wird und dadurch die Vorstellung von einer Selbstverwaltung des Volkes ad absurdum führt. Als Gründe für den Niedergang liberaler Demokratie identifiziert der Autor u.a. das fast völlige Fehlen jeglicher Erziehung in ein Verantwortungsbewusstsein als Bürger, und die Idee, ja Forderung, nach freier Marktwirtschaft, die letztlich die Zerstörung der sozialen Grundidee durch einen asozialen Raubkapitalismus bedingt; die soziale Schere öffnet sich immer weiter und zerstört den sozialen Zusammenhalt. Schließlich führt diese Untersuchung zu dem Schluss, dass nur der offene Umgang in Erziehung und Politik mit dem "Faktor Mensch" - seinen evolutionsbedingten Neigungen zu egozentrischem, asozialem Handeln - eine stabile demokratische Gesellschaftsform ermöglicht. Damit rücken für den Autor zwei notwendige Reformen in den Fokus: Erziehung zum Verständnis der Funktion von Gemeinschaft, und Etablierung eines Systems evidenzbasierter Politik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1182
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet den Nachkommen meiner Familie
und Allen,
die sich um ein Zusammenleben
in Fairness und Frieden bemühen
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Kapitel I
Was ist Demokratie – und ist es überhaupt eine?
Demokratie im Laufe der Geschichte
Kritik von Anbeginn: das antike Griechenland
Mauern um Athen
Die Römische Republik
Renaissance einer Sozialordnung im Europa der Neuzeit
Die Aufklärung, Kant und die Demokratie
Aufklärung und Absolutismus
Aufgeklärte Politik des 17. und 18. Jahrhunderts
Die Französische Revolution und ihre Folgen
Zur politischen Philosophie des 19. Jahrhunderts
Demokratie im 20. Jahrhundert
Demokratie: ein Zwischenstadium in der Geschichte
Kapitel II
Prolog
Die Schwächen der Demokratie
Demokratie gegen Natur: Der Faktor Mensch
Xenophobie und Territorialität
Aggression und Hass
Die Quelle der Macht – und die Dominanzfalle
Von Seilschaften, Hierarchie und sozialem Zusammenhalt
Brüderlichkeit: Empathie, Sympathie und Altruismus
Zur Gleichheit
Freiheit
Philosophie und Lebenswirklichkeit
Die a priori - Schwächen demokratischer Ideologie
Die Paradoxien der Toleranz in demokratischen Systemen
Fehler in den Wahlsystemen
"Das Volk" regiert sich nicht selbst
Demokratie basiert auf einem virtuellen „Soll-Menschen"
Selbstzerstörung durch Anonymisierung der Macht
Das Kapital, der stille Diktator
Selbstzerstörung durch die eigenen Regeln und Werte
Weitere Schwachstellen der liberalen Demokratie
Mediokratie: Diktatur der Mittelmäßigkeit
Die Illusion von Gemeinwohl
Der kalte Krieg der Parteien
Die Politiker: Führungsqualität und Verantwortlichkeit
Das Volk: Volkswille, Toleranz und Selbstbetrug
Staatsschulden und Ausverkauf
Liberaler Anti-Nationalismus
Multikulturalismus und Religion
Die freie Presse
Die Schwächen moderner Philosophie um Demokratie
Das 21. Jahrhundert in der rezenten Literatur
"Demokratie überlebt nur, weil sie nicht funktioniert"
Endzeitliche Szenarien?
Post-Demokratie
Die Spirale der Polarisierung
Demokratie: die Idee konfrontiert mit der aktuellen Lage
Der Tanz der Populisten
Wirklicher Demokratie entgegen?
Zusammenfassung und Ausblick
Kapitel III
Einleitung
Was Philosophen über die Zukunft der Demokratie sagen
Demokratie heilen?
Demokratie für das 21. Jahrhundert?
Liberalismus-Populismus: Tanz oder Krieg?
Die Bereiche des Wandels
Wandel der generellen sozialen Einstellung
Die Grundstruktur von Sozialmoral
Reziprozität: eine aufrichtige Humanität
Der Umgang mit dem "Faktor Mensch"
Die neue Gleichheit
"Neue Freiheit": Soziale Pflichten vor Rechten
Neue Brüderlichkeit: demokratisches Sozialverhalten
Vertrauen muss Misstrauen überwinden
Wie evidenzbasierte soziale Verantwortung entsteht
Erziehung
Das Ende von Rache im Strafgesetz
Das Ende von Machtmissbrauch
Das Ende des ruchlosen Kapitalismus
Getrennt in Frieden -vereint über gemeinsamen Interessen
Veränderung von politischer Strategie, Praxis und Struktur
Neue sozialer Struktur und Entscheidungsfindung
Die neue Verfassung
Übereinkunft: die Antithese zur Diktatur der Mehrheit
Evidenzbasierte Sachpolitik statt ideologischer Parteipolitik
Staatsbürgerschaft und Wahlrecht
Ein neues Wahlverfahren
Professionalisierung der Politik
Struktur und Funktion der politischen Institutionen
In kleinen Schritten in eine friedliche Zukunft
Die globale Herausforderung der Demokratie
Kulturelle Souveränität
Der Zusammenfluss der Kulturen
Demokratie, Europa und die Welt
Die EU: ein Modell für die Welt
Eine globale Armee
Epilog
Abkürzungen
Verzeichnis der Fremdwörter
Anmerkungen
Anmerkungen zur Einleitung
Anmerkungen zu Kapitel I
Anmerkungen zu Kapitel II
Anmerkungen zu Kapitel III
Weitere Anmerkungen
Liste der im Text zitierten Autoren
Index
Literaturzitate
Anmerkungen zum Text
Mehrere Wiederholungen im Text habe ich auch hier wieder bewusst belassen, manche davon in der Vorstellung, dass ein Text dieses Umfangs auch zum Nachschlagen anhand des umfassenden Stichwortverzeichnisses verwendbar wäre.
Um Ihnen das Nachschlagen in früheren Abschnitten zu ersparen, habe ich für öfter verwendete Fachbegriffe hinten eine Liste mit kurzer Erklärung zusammengestellt.
Mit einem Sternzeichen * markierte Zitate sind vom Autor übersetzt.
Hochgestellte Zahlen, z.B. Autor 35 beziehen sich auf die Literaturliste am Ende des Buches. Eine detaillierte Liste der über 1000 Einzel-Zitate mit allen individuellen Seitenangaben ist beim Autor via e-mail erhältlich: [email protected]
Hochgestellte und unterstrichene Zahlen, z.B. Notiz 36zeigen eine Fußnote an.
Hochgestellte Zahlen mit vorangestelltem "N", z.B. Demokratie N39 stehen für eine Anmerkung im hinteren Teil des Buches.
Verweise auf andere Seiten im Text, z.B. S. →, gelten für mehrere Seiten, wenn hinter der Zahl ein "f" oder "ff" steht, z.B. S. →f.
Vorwort zur zweiten Auflage
Schon anlässlich der englisch-sprachigen Ausgabe hatte ich eingangs erwähnt, dass aktuelle politische Fragen eigentlich kein geeignetes Thema für Bücher mehr sind: weittragende Ereignisse lösen einander nicht mehr im Takt von Jahrzehnten oder Jahren ab sondern von Monaten und Wochen: drohende Kriegsgefahr, Umweltkrise mit bereits deutlich spürbaren Klimaveränderungen, rapider Verfall sozialpolitischer Strukturen, auf denen diese liberalen westlichen Demokratien fußte. Meldungen in den Medien übersteigen an Frequenz nicht mehr nur unser Erinnerungs-, sondern auch das Fassungsvermögen. Einige der global verbreiteten, inzwischen jedoch fast schon wieder ganz aus dem Horizont der Aufmerksamkeit gerückten Ereignisse habe ich als Ergänzungen in dieser Auflage nachgetragen, weil ich sie wegen ihres Beispielcharakters für erinnerungswürdig halte; dazu zählt die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich, auch der globale Medien-Tsunami anlässlich des Auftretens von Greta Thunberg, die nachfolgende Schüler-Bewegung und des x-ten Zerredens der Umweltkrise im Sinne deliberativer Demokratie ohne tatsächlich ernsthafte politische Konsequenzen. Doch eine weitere Veränderung kommt hinzu, die diesem Erdrutsch in eine düstere Zukunft mit zunehmender Intensität entschlossen entgegenzuwirken scheint: In immer mehr Ländern kommt es zu Massendemonstrationen der Zivilgesellschaft – nicht nur der Gelbwesten in Frankreich, sondern auch in USA, Deutschland, Russland, Tschechien, Hongkong, Georgien, Haiti, Kasachstan, Sudan, Algerien ..., zu Aufruhr und Protesten gegen politischen Missbrauch, oder gegen die Untätigkeit der Politik, zu Forderungen nach Maßnahmen, von denen Politiker meinen, sie wegen der Gefahr von Stimmenverlusten in ihrem eigenen Interesse und dem ihrer Partei nicht wagen zu dürfen. Ende einer Ära, oder schon Anfang einer Neuen? Beginnt die in meinem dritten Kapitel bezeichnete Veränderung von unten bereits vor unseren Augen? Leiten schon die ersten verantwortungsvollen Politiker eine Fusion der Parteien ein, die Führung der Zivilgesellschaft guten Willens, die Überleitung zu einer neuen Form von evidenzbasierter Politik?
Außerdem habe ich die Gelegenheit genutzt, die Diskussion zum Thema Massenpsychologie und Psychologie allgemein etwas zu vertiefen, etwa im Sinn von Freud's „Massenpsychologie und Ich-Analyse" sowie Marcuse's Verarbeitung von Freud's Werk in „Triebstruktur und Gesellschaft".
Ludwig M. Auer, im Frühjahr 2019
Vorwort zur ersten Auflage
"Demokraten, die den Unterschied zwischen einer freundlichen und einer feindseligen Kritik nicht erkennen, sind selbst von einem totalitären Geist erfüllt"*1
Karl Popper
Demokratie wird heute in einer zunehmenden Zahl von Ländern weltweit als das einzige akzeptable politische System für eine moderne Gesellschaft angesehen. Die westliche Sphäre liberal demokratischer Länder erklärt ihre Werte über alle anderen Kulturen und Zivilisationen hinweg für die gesamte Welt als universell gültig (eine Erläuterung meines Versuches einer Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen quer durch alle Kulturkreise, die sie voneinander abweichend definieren, findet sich in der Anm.N1).
Die Medien preisen und verteidigen die liberale Demokratie als das Zentrum unseres "Gemeinwohls", das heute von Politikern eher als "unsere gemeinsamen Werte" bezeichnet wird. Damit greifen sie nicht selten die Bürger ihrer eigenen Länder an, indem sie jene rechtsgerichteten Parteien dämonisieren, die demokratisch gewählt wurden: etwa 20% in den Niederlanden (PVV), 34% in Frankreich (FN), 26% in Österreich (FPÖ), je 12,6% in Großbritannien (UKIP) und in Deutschland (AfD). Liberale Politiker der westlichen Welt ignorieren die Ängste ihrer Bürger, werden ihrerseits populistisch und schaffen damit eine neue Welle von Anti-Populismus-Populismus, anstatt die gegenwärtige Entwicklung als dringenden Hinweis darauf zu werten, dass die Demokratie renovierungsbedürftig ist. Sogar vermeintlich politikverdrossene und selbstzufriedene Wähler werden aufmerksam, irritiert und orientierungslos; eine politische Nachkriegs-Ära des „Nichtwissenwollens" 2 scheint zu Ende gekommen zu sein.
Viele politisch interessierte und engagierte Bürger und Gruppen sind zunehmend über die Untätigkeit ihrer Politiker frustriert. Einige wollen sich zu „echter Demokratie" vorwärts bewegen („true democracy"), andere in eine „zukünftige Demokratie", wieder andere wollen das gegenwärtige System besetzen („Occupy"- movement) und Demokratie „wirklich" machen; dementsprechend stehen norwegische und britische Gruppen ein für „Real Democracy" oder haben vor, den Neo-Liberalismus aus der Bahn zu werfen und gegen die Macht wirtschaftlicher Konzerne („Corporatocracy") anzukämpfen.N2 Wir stehen also vor der Tatsache, dass Demokraten gegen ihr eigenes politisches System aufstehen und damit ihre Länder spalten. Damit erhebt sich die Frage: was ist hier schiefgelaufen?
In diesem Buch werde ich begründen, dass die moderne liberale Demokratie wegen vieler ihrer Architektur innewohnender Mängel und Schwachstellen von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Diesbezüglich ist meine Argumentation allerdings nicht neu: Demokratie wird bereits seit ihrem Bestehen und ihrer ersten Beschreibung in der Antike verteufelt und verlacht, beginnend mit Sokrates, der sich allerdings nicht über die Demokratie selbst lustig machte, sondern über deren Führer. In ähnlicher Weise hatte auch Platon keine hohe Meinung von demokratischen Politikern: er wollte sie allesamt durch einen weisen Herrscher als Führer ersetzen.380
Die Idee einer Regierung des Volkes ist von Anfang an ein Widerspruch in sich selbst, weil sie den Konflikt zwischen den Individuen und den sozialen Klassen in der wirklichen Welt außer Acht lässt. Die Demokratie der Neuzeit begann als Republiken, die entschieden keine Demokratien sein wollten, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika in ihrer Anfangszeit, oder sie begann mit Revolutionen und Gemetzel wie in Frankreich, mit der mörderischen Beseitigung alter und neuer Führer, mit dem Rückfall in alte Regierungsformen oder Diktaturen, wie dies in weiteren europäischen Ländern geschah.
In unserer Zeit macht sich über die Demokratie nach einer Nachkriegs-Episode scheinbarer Stabilität in den westlichen Ländern eine zunehmende Unruhe und Unsicherheit breit, die sich in einer Reihe kritischer Veröffentlichungen von Politologen wie A.C. Grayling ausdrückt, wonach dieses politische System reparaturbedürftig oder insgesamt abgesagt sei: so schreibt Grayling in seinem Buch
„Democracy and its Crisis", dass „zwei ihrer führenden Beispiele in der heutigen Welt, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, die repräsentative Demokratie mutwillig verfallen ließen. Beachten Sie diese Worte: Absichtlich verfallen ließen ... durch eine Kombination von Ursachen, allesamt vorsätzlich".*11 J. Brennan nennt Demokratie "ein fehlerhaftes Instrument",* 3 und Y. Mounk4 meint, dass die Wahl von Donald Trump "die signifikanteste Manifestation der Krise der Demokratie" sei. Mehrere weitere Autoren rezenter Publikationen haben ihren Abgesang an die Demokratie in die Titel ihrer Bücher geschrieben – ich habe sie auf S. → zusammengestellt. Wohl als Spiegel dieses Aspekts von Zeitgeist lautet der Untertitel der amerikanischen Zeitschrift „The Washington Post": „Democracy Dies in Darkness" [Die Demokratie stirbt im Dunkel].435
Keiner dieser Autoren hat jedoch zur tiefreichendsten Ursache des Dilemmas Stellung bezogen: nämlich die zunehmende Diskrepanz zwischen den politphilosophischen Ideologien einerseits und den Gegebenheiten der menschlichen Natur andererseits, und zwar sowohl des Individuums an sich wie auch dessen Verhalten in Gruppen und Massen. Dieser „Faktor Mensch" wurde in den letzten 120 Jahren biologischer, human-ethologischer, psychologischer und soziologischer Forschung intensiv untersucht. Die grundlegenden Tatsachen wurden jedoch von der Politik weitgehend ignoriert – außer zum Zweck ihrer Ausnutzung für eigene Interessen. Aus diesem Grund habe ich diese Erkenntnisse zu einem Kernthema in diesem Buch gemacht. Dazu zählen evolutionäre Faktoren unseres individuellen Verhaltens, aber auch Seilschaftsdenken und Massenphänomene ebenso wie deren politischer Missbrauch: „Populismus" ist hierfür ein merkwürdig berührendes Beispiel.
Ich werde zeigen, dass die gegenwärtige Form von Demokratie nachgerade auf widersprüchlichen Regeln und Einrichtungen aufgebaut ist - ich nenne sie „a priori"-Schwächen. Zusammen mit den Paradoxien, auf denen sie basieren, gewährleisten sie den frühen Verfall und das Verschwinden der Demokratie im Chaos, wenn keine Veränderung gelingt.
Die gefährlichste Entwicklung besteht jedoch in der zunehmend verzweifelten und zunehmend populistischen Aggression der Neo-Liberalen gegen ihre abtrünnigen Mitbürger, indem sie selbst zu Populisten werden anstatt nach gemeinsamen Interessen und dem Verständnis der Ängste der Leute zu suchen.
Ich habe keine 10 Jahre mit dem Schreiben dieses Buches verbracht wie John Keane5, und gewiss nicht jene 35 Jahre, die von Nahum Capen berichtet werden6, aber ich habe mich zeitlebens mit der menschlichen Natur, ihrer Physiologie, Pathologie und Psychologie befasst, und ich habe die letzten 3 Jahre mit dem Studium dieser politischen Belange und ihrer Geschichte verbracht.
Ein tieferer Blick in die grundlegenden Ideen, Hypothesen und Ideologien über Demokratie ergab eine alarmierend große Zahl weiterer Schwächen und Widersprüche, mit denen sie geschlagen ist. Da diese die gegenwärtige Unzufriedenheit über die mangelnde Funktionsfähigkeit der westlichen politischen Systeme mit ihren Demokratien erklären, habe ich sie zu einem weiteren Schwerpunkt in der Diskussion der gegenwärtigen Situation gemacht. Außerdem war deren Analyse entscheidend für die Arbeit am dritten Kapitel, welches eine Besprechung der verschiedenen Vorschläge zur Verbesserung der politischen Gegebenheiten beinhaltet, soweit sie sich aus dem Vergleich von wissenschaftlichem und philosophischem Wissen ergibt. Ich hoffe, dass dieser abschließende Teil der interessanteste und herausforderndste geworden ist.
Meine hauptsächliche Motivation für diese Arbeit war jedoch mein Gefühl, immer näher an den Rand eines Strudels zu geraten, der immer mehr Länder mit einbezieht, deren einige ich in ihrer Tagespolitik mitverfolge. Dieses Gefühl hat mich anfänglich gedrängt, meiner Verantwortung gegenüber unseren Nachkommen mit dieser Publikation noch rechtzeitig nachzukommen. Der Takt der Abfolge von Ereignissen wird jedoch in einem Maße beschleunigt, dass die geschriebenen Worte unter der Hand zu Wirklichkeiten werden und immer neue Ergänzungen am Text erfordern, während man zunehmend in einen bedrohlich dunklen Bereich gezogen wird. Die Tagespolitik der letzten Wochen und Monate zeigt, und zwar die Hektik, die Hysterie in manchen Regionen ebenso wie die besorgniserregende Stille in anderen:
Die Zeit drängt.
Bedenke ich Verhalten und Reaktionen der Akteure, der Menschen, die in der Politik und in den Medien tätig sind, dann muss ich mich angesichts meines Textes fragen: wen spreche ich eigentlich an, wenn ich gleichzeitig die Politiker, ihre Parteien und ihre Strategien kritisiere, aber von der dringenden Notwendigkeit spreche, dass die Politik geändert wird? Es ist eine Auflösung der Quadratur des Kreises in den Köpfen von uns Allen, liebe Leserinnen und Leser, die gelingen müsste, wollten wir eine friedliche Veränderung erzielen, entschlossen aber geduldig, bedacht darauf, dass Alle, und ich meine tatsächlich Alle, mitmachen. Es ist ein Aufruf zur Besinnung an unser aller Lage und deren Ursachen. Alle Bürger jedes Landes, dessen demokratisches System zu zerbrechen droht, sind aufgerufen ebenso wie alle in ihren Institutionen Tätigen: es geht um ein Umdenken mit dem Blick auf eine entscheidende Gegebenheit: ein demokratischer Staat existiert nur in dem Maße und Umfang, in welchem seine Bürger etwas dazu beitragen. Nur dieser Beitrag erhält diesen Staat am Leben. Es ist an der Zeit, jetzt mehr an dessen Überleben zu denken als an den eigenen Wohlstand und das eigene Fortkommen. Die heutige Form von Demokratie ist deshalb am Absterben, weil sie ausgehungert und ausgehöhlt wurde, weil zu Viele von uns sich zu viel davon für sich alleine genommen und zu wenig dazu beigetragen haben. Nur ein Umdenken in uns Allen kann die drohende unkontrollierte politische Veränderung unserer Länder verhindern: es besteht darin, nicht vorwiegend oder gar ausschließlich von den eigenen Interessen auszugehen, sondern die der Anderen in gleicher Weise mit zu berücksichtigen.
„Gleiches Recht für Alle" ist eine sehr vereinfachende Abkürzung, die aber in einem zweiten Gedanken zur entscheidenden Verhaltensänderung führen kann: denn „gleiches Recht" bedeutet gleichzeitig „gleiche Pflichten". Nichts in der Welt geordneten gesellschaftlichen Lebens geschieht von selbst, alles muss getan werden. Die erste und wichtigste Tat zur Rettung der Lage ist daher, Rücksicht auf die Anderen im Staat zu nehmen, zu bedenken, dass Alle Interessen haben, und zwar derart viele und einander im Weg stehende Interessen, dass daran unser Aller Lebensraum, der Staat und die Umwelt, in der er steht, kaputt zu gehen drohen, und zwar bald. Die Geschichte zeigt, dass wir einen großen Fehler machen, wenn wir weitermachen wie bisher im einlullenden Gedanken, es sei ja im Großen und Ganzen ohnehin alles wie immer: die ganz gravierenden Veränderungen im Gesellschaftssystem passieren fast immer explosionsartig - uns Allen ist klar, dass jegliche Einsicht zu spät kommt, wenn diese Explosion einsetzt.
Dieser Aufruf gilt selbstverständlich auch den professionellen Akteuren in Politik und Medien, die ja ebenso Bürger sind wie alle anderen. Der Aufruf kann für sie nur bedeuten, Parteieninteressen hintanzustellen und sich auf das Gemeinwohl als erste Pflicht zu konzentrieren, sogar, auf die Verwirklichung von Karrierechancen zu verzichten, zurückzustehen. Der Aufruf bedeutet aber auch, die unwürdigen gegenseitigen Beschuldigungen zu beenden, das gegenseitige Dämonisieren, stattdessen besonnen gemeinsam zu beraten, wie die Lage im Interesse Aller Verbessert werden kann. Nicht gegenseitiges Verteufeln und Ausschließen, Verdächtigen und Inkriminieren schafft Frieden, sondern der Austausch von Vorstellungen und Ideen und deren gemeinsames Einordnen in den Rahmen des Gemeinwohls und der überhaupt bestehenden Möglichkeiten. Dieser Teil des Aufrufs gilt in gleicher Weise für die Medien, die zweifellos durch übersteigertes Deuten auf Ereignisse die Lage aufheizen, anstatt selbst zur Besonnenheit Aller im Interesse des Gemeinwohls zu wirken. Wem von Ihnen meine Worte zu hart klingen und mir den Vorwurf einbringen, ich selbst handelte mit meinen Worten nicht im Sinne jener in der Einleitung, möge bitte das Zitat von François de la Rochefoucauld (s. S. →) auf sich beziehen und mir verzeihen.
Was für den eigenen Staat gilt, trifft in gleicher Weise für die "globalisierte" Welt zu: so wie der Versuch schiefläuft, innerhalb des Staates nur den privaten Interessen zu leben und rücksichtslos alle Möglichkeiten dafür zu nutzen, die sich bieten, so können wir in naher Zukunft auch nicht mehr in Frieden leben, wenn wir uns um die Anderen dort, in den anderen Staaten nicht, in gleicher Weise kümmern, wie es innerhalb des eigenen Landes notfallartig erforderlich geworden ist. Dazu müssen wir Alle unsere privaten Wünsche zurückstecken, uns auf einen vernünftigeren privaten Aufwand reduzieren und zum Aufbau eines lebbaren Lebensraumes in anderen Ländern beitragen, die derzeit in einem katastrophalen Zustand sind und die Menschen von dort weg und in die gemäßigten Zonen treibt. Leider ist aber unsere Geschichte von Ausbeutung und Missachtung in vielen dieser Länder, die früher die Kolonien Europas waren, so lange und derart weit gediehen, dass wir erst Vertrauen aufbauen müssen, bevor wir dort unsere wohlgemeinte Hilfestellung überhaupt anbringen können. An dieser Stelle schließt sich ein Kreis zwischen dem Thema über unsere Pflichten im eigenen Land und denen dem Rest der Welt gegenüber: wir müssen selbst wieder glaubens- und vertrauenswürdig werden und dies durch unser Handeln bezeugen. Damit können wir uns und einander als gleichwertige Menschen der ganzen Welt ein Leben in Würde schaffen.
Die Länge des Textes bestätigt eine Gabe, die mir von wohlmeinenden Kritikern wiederholt vorgehalten worden ist: ich sei kein Meister der knappen klaren Worte und würde meine Kernbotschaften gut im Text zu verstecken wissen. Ich selbst gebe diesmal meinen Anmerkungen die Schuld daran; manches an Kernbotschaften ist in der Tat dort verborgen – damit befände ich mich einerseits in der guten Gesellschaft von Machiavelli; andererseits sind manche Anmerkungen in der Tat ein Versteck für liebgewordene Formulierungen. Vor allem entschuldige ich mich jedoch mit der Komplexität des Themas, und hoffe auf die Nachsicht und Geduld meiner Leser.
Einleitung
"... die beste Einstellung für den Leser wäre es, von Anbeginn an keine der hier präsentierten Maxime direkt auf sich persönlich zu beziehen und anzunehmen, dass er die einzige Ausnahme sei, obwohl sie als allgemein gültig erscheinen. Danach garantiere ich Ihnen, dass er [bzw. sie] unter den ersten sein wird, die ihnen zustimmen und daran glauben, dass sie der Menschheit zur Ehre gereichen werden".*7
François de la Rochefoucauld
Demokratie betrifft Sie, und mich, uns alle auf Erden; für die Mehrzahl der Menschen in der westlichen Welt eine Selbstverständlichkeit, selbstverständlich – oder etwa doch nicht? Nicht mehr? Vielleicht zu selbstverständlich geworden?
Demokratie, diese Idee, die Ideologie von Selbstverwaltung durch uns selbst, das Volk, oder zumindest "die Vielen" – auf den zweiten Blick entpuppt sich Demokratie als ein politisches Unterfangen auf dem mysteriösen Boden von "Gemeinschaftlichkeit" in Menschenmassen, auch dem Konflikt zwischen Gruppen, dem Klassenkampf, also von sozialen Phänomenen, die unabhängig von politischen Systemen den gleichzeitigen Traum von Freiheit und von Zugehörigkeit jedes Einzelnen von uns verkörpern. Ein Reisender zwischen den Welten im 19. Jahrhundert, der Leute in Europa, Afrika und Asien studierte, beschrieb diese Eigentümlichkeiten von Menschentum in Gruppen auf eindrucksvolle Weise: Gustave LeBon. Als Arzt vertraut mit den biologischen Gegebenheiten des Menschen, sog er das allererste Wissen über Evolution, Anthropologie, Psychologie und Soziologie auf, um es sodann mit seiner eigenen Interpretation menschlichen Gruppenverhaltens zu verbinden. Während ihn die akademische Welt weitgehend ignorierte, beeinflussten seine Schlussfolgerungen viele Politiker, welche die Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitgehend bestimmen sollten, wie Lenin, Hitler und Mussolini, aber auch Roosevelt. In seinen späten Jahren erlebte Gustave LeBon, dass Männer wie Henri Bergson und Sigmund Freud auf sein Werk Bezug nahmen, ebenso wie Émile Durkheim, einer der Begründer der Soziologie1: Gustave LeBon beschrieb 1895 in seinem Werk "Psychologie des foules" (Die Psychologie der Massen)2 den Effekt jenes Bildes, den ein Wort in unserem Geist hervorruft, eine Vorstellung, die für die öffentliche Meinung eines jeweiligen Zeitalters eine spezielle Bedeutung hat. Eines jener Worte ist in unseren Tagen zweifellos „Demokratie": ausgesprochen in einem fordernden Ton, entsprechend der gegebenen politischen Korrektheit, versieht die Stimme es aber auch bereits mit einer leicht ängstlichen Schwingung. Dennoch wird eine kritische Bemerkung über Demokratie heute noch immer nahe asozialem, suspektem, wahrscheinlich sehr weit rechts angesiedeltem, wenn nicht sogar gleich rechtsextremem Denken zugeordnet. Kritik an Demokratie ist eben nichts, was die Mehrheit in der westlichen Welt heute hören will. Vertreter des westlichen Universalismus belehren weiterhin den Rest der Welt und hören nicht auf die Anderen – nach meiner Ansicht eine bedenkliche Situation: aber wer ist hier im Recht und wer im Unrecht? Allem voran muss man eingestehen, dass Intoleranz gegenüber Kritik einem der wichtigen Axiome der Demokratie zuwiderläuft. Deshalb meine ich, dass die heutige Form von Demokratie in Gefahr ist, sicher jedoch keineswegs ein sicherer Hort, nicht einmal vollkommen verstanden in seiner eigentlichen Bedeutung, nicht einmal in Europa, wie auch LeBon mit seiner Bemerkung feststellt: "Bei den lateinischen Völkern bedeutet das Wort Demokratie vor allem die Auslöschung des Willens und der Tatkraft des einzelnen vor dem Staat. ... Bei den Angelsachsen, namentlich bei den Amerikanern, bedeutet dasselbe Wort im Gegenteil die angespannteste Entfaltung des Willens und der Persönlichkeit, das möglichste Zurücktreten des Staates, den man mit Ausnahme der Polizei, des Heeres und der diplomatischen Beziehungen nichts leiten läßt".8,N3
Demnach hat es den Anschein, dass die jeweilige Form von Demokratie auch ein Ausdruck des Charakters und Temperaments eines Volkes ist. Jedoch: erzeugt Demokratie selbst schon einen besseren Menschen, eine bessere Gesellschaft, ein besseres Leben, oder leitet sie lediglich die Völker durch ihren Liberalismus über Libertinismus und Hedonismus in Dekadenz und Verfall? Wenn das erstere zutrifft, wie manche Politologen meinen, warum haben wir dann mit einer derartigen Vielzahl von Systemmängeln zu schaffen?
In diesem Buch werde ich anhand einer Vielzahl von Beispielen zeigen, dass Demokratie in mehrfacher Weise einem Widerspruch in sich selbst gleichkommt und ganze Länder zu spalten beginnt, wie dies in unseren Tagen in Ländern vorgeführt wird wie Spanien, Tschechien, Polen, auch in allen anderen europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien, Holland, Österreich, in der Türkei, aber auch in USA und Großbritannien.
Daraus resultiert die Frage: sind die heutigen Einrichtungen der Demokratie ausreichend, um diese Herausforderungen zu bewältigen? Viele vergessen bei der Erörterung der Verlässlichkeit und Zukunftsfähigkeit N4 von Demokratie, dass dieses System aus der Sicht unseres heutigen Verständnisses davon erst seit wenigen Jahrzehnten besteht. Ungeachtet dessen entwickeln politische Parteien in den westlichen Ländern schon jetzt einerseits eine zunehmende Abgrenzung voneinander, andererseits aber auch eine undefinierte Unsicherheit über das derzeitige politische Konstrukt. Im Gegensatz dazu sagt man, dass immer mehr Länder weltweit zur Demokratie tendieren. Werden die Einen ihrer Freiheit müde, desinteressiert und selbstzufrieden, während die Anderen nach diesem Traum von Freiheit streben?
Was genau erwarten denn die heutigen Menschen von der Demokratie?
Demokratische Systeme brüsten sich mit der „Gewaltenteilung", sind sich jedoch ihres fehlenden Gewahrseins von deren tatsächlichem Wert gar nicht bewusst, oder jedenfalls nicht mutig genug, sich die ursprüngliche Zielsetzung einzugestehen: es gibt nämlich keinen Grund stolz zu sein auf die Tatsache, dass Menschen dazu neigen, einander derart auszubeuten, dass es zwingend vorbeugender Maßnahmen wie der „Gewaltenteilung" bedarf; andererseits gibt es auch keinen Grund, sich des Erbes unserer Verhaltenseigenschaften aus der Evolution zu schämen, für das wir von vornherein nicht verantwortlich sind. Ist diese „Gewaltenteilung" überhaupt ausreichend effektiv?
Politische Ideologien zielen vorwiegend darauf, einige menschliche Eigenschaften zu verdammen und dafür einen idealisierten, durch Regeln zurechtgehämmerten Menschen zu schaffen. Aber schufen sie tatsächlich einen besseren Menschen, ein besseres Leben? Keine Ideologie der Welt, nicht einmal die Demokratie – und ich werde zeigen - vor allem nicht die Demokratie – verbesserte die menschlichen Lebensbedingungen, heute nicht und auch nicht im Griechenland der Antike. Denn der heutige Wohlstand basiert auf Errungenschaften von Wissenschaft und Technologie, nicht der Politik - ausgenommen vielleicht den Umstand, dass Staatsverschuldung, die Quelle eines künstlichen Wohlstands, ein Ergebnis von Politik ist. Demokratie ist demnach abhängig von einem gewissen Wohlstandsniveau, das sie nicht selbst geschaffen hat. Während absolutistische Regierungen den Gehorsamen Sicherheit bieten, läuft die Demokratie Gefahr, Chaos zu verursachen, dem lediglich die archaische Sozialordnung entgegenarbeitet, jedenfalls so lange die Demokratie überlebt.N5
Nicht-staatliche Organisationen (Non-Governmental Organizations - NGOs) sind eines der charakteristischen Beispiele für die chaotische missionarische Tätigkeit demokratischer Systeme: NGOs, geschaffen in gutem Willen, werden in einem System tätig, das für sich beansprucht, von den Menschen für die Menschen eingeführt worden zu sein: wäre ein solches System erfolgreich, wozu bedürfte es dann weiterer, ergänzender und manchmal sogar konkurrierender und gegeneinander arbeitender Einrichtungen? Zwar wissen wir alle, dass es politisch korrekt ist, Wohltätigkeitseinrichtungen zu lobpreisen, nicht aber zu kritisieren – aber hier richtet sich die Kritik gar nicht gegen NGOs sondern gegen die Demokratie, die eingesteht, dass es zusätzlicher Einrichtungen bedarf, um die Insuffizienzen der „Regierung durch das Volk für das Volk" zu kompensieren. Politiker demokratischer Länder wie Großbritannien verkünden stolz und lauthals, dass kein einziger Bürger alleingelassen werde, nur um sodann weiter wie bisher 5-10% ihrer Bevölkerung in absoluter und weitere 10% in relativer Armut und Elend zurückzulassen.9, 10
Eine beunruhigende Brise lässt die Menschen in ihrer schützenden Dunstglocke des Wohlstands erschauern. Die Leute beginnen sich zum Schutz um neue Rufer zu scharen, die ihnen bestätigen, was sie schon aus ihren Träumen, Tagträumen und Gemütszuständen wissen. Ist das ein Erwachen, oder ist es nur ein dumpfes Zusammenrotten der Verlorenen?
Als Kind des unmittelbaren Nachkriegs-Europa, aufgewachsen in österreichischer, französischer und englischer Erziehung,N6 nahm ich wenig Notiz von dem Phänomen „Demokratie", oder den Vereinten Nationen. Sie erschienen vielmehr als die selbstverständliche Basis des alltäglichen Lebens, immer schon dagewesene Bühne für die aufregenden politischen Ereignisse, dargestellt von einzelnen, herausragenden Persönlichkeiten wie dem Schah von Persien, der Königin des Britischen Empire, dem würdig einherschreitenden und sprechenden Präsidenten de Gaulle, einem aufbrausenden Nikita Chruschtschow oder einem beflügelnd-begeisternden John F. Kennedy. Es gab zwar immer irgendwo Krieg, jedoch nur in fernen Traumländern. Die Wiederauferstehung Europas war nur kurz unterbrochen von Jugendprotesten, die in den Ereignissen der 68er gipfelten – einige berichten, dass unsere juvenile Begeisterung für soziale Gerechtigkeit wahrscheinlich durch sowjet-kommunistische undercover-Aktivität verstärkt wurde, die bereits in den 1950ern begann. Der Kalte Krieg mit seiner atomaren Bedrohung, und erste ökologische Bedenken, hielten sich im Hintergrund der Aufmerksamkeit im Alltag der rasch voranschreitenden Technokratie. Kritik beschränkte sich auf Machenschaften der politischen Mittelklasse, betraf nie die Helden der Ära. Aber das politische System selbst, die Demokratie, wurde niemals in Frage gestellt. Vielmehr schien sie, kaum jemals direkt erwähnt, derart selbstverständlich unersetzlich, dass die Leute nicht einmal an ihre Existenz dachten.
Die Lage hat sich nun innerhalb weniger Jahre verändert.
Das Wort „Erneuerung" trat in vielen Wahlkampf-Reden in den USA, in Großbritannien und in Ländern des europäischen Kontinents in den Mittelpunkt. Politiker einiger Parteien der Mitte wurden auf die Unzufriedenheit der Menschen aufmerksam, auf ihre Sorgen, ihre Unsicherheit und Unruhe, die sich auszubreiten begann – und den Parteien der „Populisten" Zustrom verliehen. Dafür scheinen zwei Faktoren verantwortlich zu sein: Erosion, Unterwanderung und Aushöhlung von innen, und ein Gefühl der Bedrohung von außen.
In diese Entwicklung mischt sich ein – zumeist unbewusstes – Gefühl der Absurdität, das den Menschen die Orientierung nimmt: sie sehen sich verwickelt in eine Konfrontation von Patriotismus gegenüber Nationalismus, auch von einer Art Populismus innerhalb der Demokratie selbst, jener Selbstregierung des Volkes, die als politisch korrekt gilt in seiner populistischen Abwehr des „offiziell anerkannten" Populismus, jenes, den die Parteien der Mitte und der Linken an ihren Gegnern der Rechten verteufeln. Verwirrung breitet sich aus und regt zu Fragen an: wie können wir Menschen uns vor selbstschädigendem Irrglauben bewahren? Wie können wir evidenzbasierte Entscheidungsmechanismen ohne parteipolitisches Geplänkel bewerkstelligen und uns gleichzeitig vor dem Machtmissbrauch derer schützen, die für uns an der Basis für diese Evidenz arbeiten?
Alle diese fundamentalen Fragen wurden schon gestellt, die Antworten füllen ganze Bibliotheken und Massengräber von Millionen Opfern. Aber vor allem: jede Ära, jede Generation, jede Kultur benötigt ihre eigene Orientierung. Ich greife daher diese Herausforderung dort auf, wo der österreichisch-britische Philosoph Sir Karl Popper sie damals vor 80 Jahren formulierte: "Große Männer machen große Fehler; ... einige der größten Führer in der Vergangenheit unterstützten den immer wiederkehrenden Ansturm auf Freiheit und Vernunft. Ihr Einfluss ... führt weiterhin jene in die Irre, von deren Verteidigung die Zivilisation abhängt, und trennt sie weiterhin. Für diese tragische und möglicherweise fatale Trennung werden wir selbst verantwortlich, wenn wir zögern, in unserer Kritik dessen deutlich zu sein, was zugegebenermaßen Teil unseres intellektuellen Erbes ist. Durch unser Zögern in dieser Kritik könnten wir dazu beitragen, dass insgesamt alles zerstört wird".*1
Wer diese großen Männer auch immer waren oder sind, und was sie auch immer sagten oder sagen, ob in der Politik, in der Philosophie oder in der Wissenschaft: unsere Orientierung liegt in unserer eigenen Verantwortung. Kritisches Argumentieren mit der Vorgabe der Fairness befähigt uns, solche Irrtümer aufzudecken und den nächsten vernünftigen Schritt auszuforschen, wieder im Sinne von Popper's Vorschlag, "... die Prinzipien demokratischer gesellschaftlicher Rekonstruktion, die Prinzipien dessen, was ich als „schrittweises gesellschaftliches Engineering" bezeichnen möchte im Gegensatz zu „utopischem Sozial-Engineering".*1 Und wiederum im Sinne von Poppers Entscheidung kam ich zu dem Entschluss, erneut am Beginn unserer schriftlich dokumentierten Kulturgeschichte anzusetzen, um den Mythos der Demokratie zu entzaubern, ihre hässliche Seite zu zeigen, die Gefahr ihrer Kurzlebigkeit und ihre Anfälligkeit für Selbstzerstörung. Im Gegensatz zum Jahr 1939, als Popper an seinem Buch „Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde" zu schreiben begann - in Neuseeland fern ab von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges - im Gegensatz dazu also besteht die Gefahr heute – noch nicht in einer autokratischen Beherrschung (und ich meine damit die westlichen Demokratien, nicht die gesamte Welt), jedoch in einer Kombination von Faktoren: Ausbeutung des Gemeinwohls durch unbegrenzten Kapitalismus, Vernachlässigung und Abbau des Sozialen durch Individualismus und Isolationismus, eine Mischung von Vorgängen, die Gesellschaften von innen heraus zerstört und Autokraten nachgerade hereinbittet.
Eine der Fragen wird sein, ob man für ein Überleben der modernen Demokratie tatsächlich „die Logik davon verstehen" 11 muss, oder ob man nicht besser entsprechend meinem Vorschlag die entwicklungsgeschichtlichen Verhaltensmuster von uns Menschen einbeziehen sollte. Denn die Ideologie, auf der die Demokratie mit all ihren inhärenten Widersprüchlichkeiten basiert, ist für ein dauerhaftes Sozialsystem nicht haltbar, besonders nicht auf der Basis ihrer Werte, die im Wesentlichen aus dem Versprechen bestehen, Wohlstand und vor allem Freiheit für Alle zu gewährleisten.N7
Vielleicht ist die Demokratie tatsächlich zum Scheitern verurteilt, solange ihre Jünger glauben, dass man „die Logik davon verstehen" müsse, anstatt zu versuchen, uns Menschen als Individuen und als Teil einer Menge zu verstehen und ein politisches System diesen biologischen und psychologischen Gegebenheiten anzupassen. „Der Wille des Volkes" ist einer jener Ausdrücke, der die Politik in eine völlig irrationale Schattenwelt führt N8 und damit Demokratie von vornherein der Selbstzerstörung aussetzt. Bevor also irgendein System verbessert werden kann, sei es in der Ökonomie, der Wissenschaft oder der Politik, müssen dessen Schwachstellen und Unzulänglichkeiten identifiziert werden: im Laufe der 2500-jährigen Geschichte einer Konzeption von Demokratie hat es entmutigende Kritik ebenso wie eine Reihe idealistischer und realistischer Ansätze gegeben. In den 70 Jahren des Bestehens moderner westlicher liberaler Demokratie mit allgemeinem Wahlrecht hat sich die Sozialstruktur nicht in dem versprochenen und daher theoretisch zu erwartenden Umfang geändert. Vielmehr erscheint die Gesellschaft aus den folgenden drei Perspektiven weitgehend unverändert: 1- Zum Unterschied von den meisten vorangegangenen Monarchien repräsentiert nunmehr der Geldadel die wenigen Reichen – damals die Aristokraten – als Gegenpol zur Masse der Bevölkerung. 2- In jeglicher Diskussionsrunde von Demokraten fallen Entscheidungen nicht auf der Basis rationaler Argumente sondern entsprechend der archaischen hierarchischen Sozialstruktur von Führern und Untergebenen. 3- Menschen beuten aus, was sich an Möglichkeiten bietet, ungeachtet drohender Konsequenzen. Umgeben von Warnsignalen verlassen wir uns weiterhin selbstzufrieden auf das vage Gefühl, welches dem irreführend beruhigenden Glauben daran entströmt, Demokratie "zu haben". Die nach wie vor immer weiter sich öffnende soziale Schere ("social divide"), und zusätzlich die Massenmigration in einer globalisierten Welt, beschleunigen die Destabilisierung. Ich werde versuchen, in Kapitel II mehr Licht auf diese Entwicklung zu werfen.
Es zeichnet sich jedoch ein Weg aus diesem Dilemma ab, zwischen einer politischen Ideologie von oben herab, die einen präexistierenden „Soll-Menschen" verlangt, und dem tatsächlichen „Faktor Mensch": ich werde mich damit in Kapitel III auseinandersetzen.
Dieses Buch ist keineswegs als ein Plädoyer gegen Demokratie gemeint, wie ich mit dem Zitat zur Einleitung deutlich zu machen versuchte – ganz im Gegenteil: es ist vor allem gedacht als eine Warnung davor, „Freiheit" wissentlich falsch als Lizenz zum Libertinismus und zur persönlichen Befreiung von sozialer Verantwortung zu interpretieren. Ich erachte auch kein anderes, früheres oder gegenwärtiges, politisches System als der Demokratie überlegen, aber ich sehe die Gefahr für die heutige westliche Gesellschaft, sich selbst zu zerstören, anstatt ihre angestammten Fähigkeiten zur Einführung von Verbesserungen zu nutzen. Dieses Buch ist also als ein Plädoyer für eine bessere Demokratie gedacht, als Aufforderung, sie endlich wirklich zum Funktionieren zu bringen, bevor sie für viele künftige Generationen endgültig verloren ist. In diesem Bemühen treffe ich mich mit Herbert Marcuse; was den Weg dorthin angeht, kann ich mich allerdings seinen radikalen Lösungsversuchen nicht anschließen und bleibe beim zuvor erwähnten Ansatz von Karl Popper – ich komme darauf Wiederholt zurück.
Dieser ohne Bewusstheit ablaufende soziale Prozess als Begründung für den politischen Prozess wird von den geisteswissenschaftlich interessierten Politologen und Soziologen seit einem halben Jahrhundert kommentiert und mit - ismen der verschiedensten Schattierungen von "Postmoderne" kategorisiert. Der deutsche Politikwissenschaftler Ulrich Menzel verfasste darüber um die Jahrtausendwende eine Zusammenfassung mit dem Titel "Globalisierung versus Fragmentierung".22 Darin konnte naturgemäß die gleichzeitige Durchleuchtung dieser zeitgeschichtlichen kulturellen Evolution aus der Sicht biologischer, oder genauer gesagt human-ethologischer, Erkenntnisse nicht vorkommen, - wiederum als treffender Spiegel der gesamten Szene geisteswissenschaftlicher Begleitung des sozialpolitischen Geschehens. Daher mussten auch die beiden Phänomene, "Globalisierung" und "Fragmentierung", als nachgerade gegensätzliche Bewegungen in einer Hilflosigkeit einander gegenüber stehen bleiben. Erst die Betrachtung aus biologischer Sicht ermöglicht wie selbstverständlich die Erkenntnis der notwendigen Gleichzeitigkeit beider Abläufe: dass nämlich die Ambivalenz der Xenophobie beides in sich birgt, zu beider Verwirklichung drängt: einerseits zum nachbarschaftlichen Austausch voll der Neugier, aber auch der Gier an sich, andererseits zur Abgrenzung des Eigenen, der Abwehr bedrohlicher Nähe. Ich biete mit meinem Beitrag die Beschreibung eines Brückenkopfes in eine mögliche Zukunft von Menschsein an. Er beginnt mit der Anerkennung der eigenen, der Evolution entwachsenden Kreatürlichkeit, verbindet diese aber mit dem aus der Erkenntnis der Erkenntnisfähigkeit sich zeigenden Auftrag, Methoden zur Zivilisierung dieser Kreatürlichkeit im Sinne eines reziproken Altruismus zu entwickeln. Es erscheint dies als der einzige Ausweg, den die Evolution ihren Lebewesen, den Trägern der Genstraßen, bislang für uns erkennbar gemacht hat, um ihrer eigenen Falle, dem Überlebenwollen auf Kosten der Anderen, zu entkommen. Der Ausdruck eines in die Tat umgesetzten Erkannthabens dieses Ausweges auf der gemeinschaftlichen Ebene wäre eine Demokratie von Demokratien auf der Basis dieses reziproken Altruismus. Davon erzählt dieses Buch.
Wenn Ihnen die Geschichte der Demokratie ohnehin geläufig ist oder Ihnen aus der heutigen Perspektive als irrelevant erscheint, und wenn Sie sich nicht auch noch eine weitere Interpretation der heutigen Situation nahebringen lassen wollen, können Sie gerne sogleich zum dritten Kapitel vorblättern um zu sehen, was es mit meinem Plädoyer denn tatsächlich auf sich hat, das es wert machte, noch ein weiteres Buch zum Thema zu präsentieren, worin also die neuen Vorschläge für künftige Schritte bestehen sollen. Ich versuchte, dort gegenwärtige Meinungen anderer Autoren zusammenzufassen und zu diskutieren und schließlich mit meinen eigenen Vorstellungen zu vergleichen: ich gehe dabei ziemlich eindeutig über die Grenzen des derzeitigen Verständnisses von Demokratie hinaus, zum Beispiel mit Bezug auf Wahlen und Entscheidungsprozesse. Die Frage wird also letztlich sein, ob künftige Generationen ein derart geändertes System noch immer als Demokratie bezeichnen wollen werden, vor allem, weil sie unser derzeitiges Verhalten ohnehin verabscheuen und verlachen könnten.
1 neben Max Weber, Karl Marx und Karl Mannheim.
2 Sein erstes Buch über dieses Thema, "L'homme et les sociétés" (Mensch und Gesellschaft), erschien im Jahr 1881.
Kapitel I
Fragen zur Definition
Antworten aus der Geschichte
Was ist Demokratie – und ist es überhaupt eine?
"Nehmen wir den Begriff in seiner strikten Bedeutung, dann hat es nie eine wirkliche Demokratie gegeben, noch wird es je eine geben." *
Jean-Jacques Rousseau12
Bevor ich mit Ihnen nun den breit ausgetretenen Pfad der Geschichte betrete, wollte ich Ihnen vorab noch einen Blick auf das Wirrwarr von Fragen, Meinungen und Zweifeln zumuten, das am Beginn und entlang eines Großteils des Weges durch unsere eigenen Gedanken wie auch die Überzeugungen anderer steht. Dabei hoffe ich vor allem, Ihre Zweifel anzuregen, Ihre Überzeugungen durcheinander zu bringen und Ihren Geist für Veränderung zu öffnen.
In Übereinstimmung mit Popper's Zitat in meinem Vorwort beabsichtige ich hier keine pauschale feindselige Kritik an Demokraten oder Demokratie an sich, sondern will auf dem guten Willen der Akteure und dem Versprechen der Idee aufbauen, wenn ich Vorschläge zur Heilung bestehender Mängel diskutiere. Dazu muss man allerdings vorausschicken, dass die Frage, was denn Demokratie überhaupt sei und was genau es ist, das sie von anderen Regierungsformen unterscheidet, über die Jahrhunderte Gegenstand erheblicher Debatten geblieben ist. Damit habe ich sie zwar bereits als eine Form von Regierung definiert. Dennoch bleibt weitgehend unklar, was der Begriff „Regierung" im Fall der Demokratie bedeuten solle. Denn immerhin regiert „das Volk", der Souverän, also nach der ursprünglichen Vorstellung der Herrscher, in dieser modernen Version von Demokratie gar nicht selbst, sondern delegiert diese Funktion an eine Gruppe von Leuten und lässt sich damit in der heutigen „repräsentativen Demokratie" regieren. Interessanterweise betrachten manche die Demokratie heute überhaupt nicht mehr als eine politische Angelegenheit, sondern vielmehr einfach als eine Art „way of life".13
Bei Betrachtung der historischen Entwicklung sieht man, dass moderne Demokratie nicht als Folge einer rationalen Entscheidung eines Volkes begann, sich von nun an selbst zu regieren; vielmehr entstand sie zunächst als chaotischer und brutaler Ausbruch in Unruhen, Umsturz und Bürgerkrieg.N9
Selbstverständlich gibt es auch eine einfache Definition, scheinbar klar und eindeutig, bestehend aus Bedingungen für ein Land, das sich als Demokratie bezeichnen will: Regierung durch das Volk, Gewaltenteilung, freie Wahlen, freie Presse, Redefreiheit, Liberalismus, Verfassung mit Berücksichtigung der Menschenrechte. Im wirklichen Leben sind die Dinge wesentlich komplizierter: so zum Beispiel sind die heutigen westlichen Demokratien keineswegs alle gleich; zwei Drittel der Demokratien West-Europas sind konstitutionelle Monarchien (siehe S. →); die Mehrzahl von ihnen erfüllt nur einen Teil der hier bezeichneten Bedingungen. Damit erhebt sich die Frage:
Wo auf der Welt gibt es Demokratie?
„Im letzten Jahrzehnt ist Demokratie praktisch das einzige politische Modell mit globalem Anspruch geworden, unabhängig von der Kultur." * 14
Kann man dieser Feststellung des Politologen Costa Georghiou tatsächlich Glauben schenken? Während der Autor einerseits Länder und Prozentzahlen auflistet,N10 kommt er letztlich auch selbst zu dem Schluss, dass "... ein Lippenbekenntnis noch nicht notwendigerweise beweist, dass Leute grundlegende demokratische Normen auch tatsächlich annehmen"* 14, N11 Weltweite Untersuchungen bestätigen, dass über 90% der Menschen Demokratie schätzen und bevorzugen, während sie aber gleichzeitig nach einer starken Führungspersönlichkeit rufen15 – die widersprüchliche Natur der Meinungen könnte also kaum größer sein. Und abseits von Lippenbekenntnissen sieht es nochmal wesentlich anders aus: nach Analysen der EIU (Economist Intelligence Unit)16 leben allemal 4,5% der Weltbevölkerung in vollwertigen Demokratien, mit Kanada, Australien und den Skandinavischen Länder an der Spitze. Deutschland, Großbritannien, Spanien, Österreich und Paraguay stehen als Volldemokratien „zweiter Klasse" auf der Liste, Länder wie die USA, Indien, Frankreich, Portugal, Italien, Chile, Griechenland, Japan und Südafrika rangieren unter „mangelhaft" und machen insgesamt 45% aller Länder weltweit aus; 18% der Weltbevölkerung leben in sogenannten Hybrid-Systemen und das restliche Drittel in autoritären Regimen. Demnach leben also 3,3 Milliarden Menschen in autokratischen Staaten. Nach der neuesten EIU-Analyse befindet sich "Demokratie in allen Ländern weltweit im Rückzug"*; außerdem wird gewarnt, dass die "Redefreiheit unter Beschuss"17 stehe.
Republik oder Demokratie – was ist was?
Wie auch Machiavelli und die Gründungsväter der USA, der Vereinigten Staaten von Amerika, so beschrieb auch Rousseau, wenn er von „Republik" sprach, eigentlich wesentliche Züge der Demokratie. Der Unterschied basiert mehr als alle anderen Gründe wohl einfach auf der Verbindung der Begriffe mit Staaten in der Geschichte der Antike, nämlich von „Demokratie" mit Griechenland und von „Republik" mit dem Alten Rom in der Zeit zwischen dem Königtum und dem Kaiserreich. Die modernen Demokratien entstanden als Republiken, die allmählich und schrittweise zu Demokratien wurden, demnach also zu demokratischen Republiken. Sie entstanden in erster Linie als Idee der Wiederbelebung der Römischen Republik, also von einer nicht-monarchischen Regierung ohne Erbfolge in der Führung, außerdem in Form einer gewissen Mitbeteiligung des Volkes. So beschrieb es Nicolò Machiavelli über Florenz, John Milton betreffend England und Montesquieu sowie Rousseau für Frankreich. Danach wurde die Idee von den Gründern der Vereinigten Staaten nochmals aufgegriffen. Als der englische Politik-Philosoph Thomas Paine im Jahr 1792 nach Amerika auswanderte, definierte er die Demokratie als "Regierung durch das Volk, des Volkes und für das Volk".* Aus philosophischer Sicht ist die Sachlage etwas anders: so unterscheidet Kant sehr klar zwischen den beiden Begriffen und bezieht sich dabei auf Montesquieu: „Der Republikanism ist das Staatsprinzip der Absonderung der ausführenden Gewalt (der Regierung) von der gesetzgebenden; der Despotism ist das der eigenmächtigen Vollziehung des Staats von Gesetzen, die er selbst gegeben hat, mithin der öffentliche Wille, sofern er von dem Regenten als sein Privatwille gehandhabt wird. – Unter den drei Staatsformen ist die der Demokratie, im eigentlichen Verstande des Worts, notwendig ein Despotism ... "41
Damit weist Kant gleichzeitig auf eine jener intrinsischen Schwachstellen an der Demokratie hin, die ich in Kapitel II als „a priori" beschreiben werde.
Was bedeutet es nun heute, „demokratisch" zu sein?
Die Diskussion wird hier nicht einfacher: rationalisierende Argumente können nämlich Standpunkte zu einer flüchtigen Angelegenheit werden lassen: eines davon wurde kürzlich damit verdeutlicht, dass zwei Parteien für sich beanspruchen demokratisch zu sein, jedoch einander bezichtigen populistisch und undemokratisch zu sein (so geschehen in Spanien, Österreich, Großbritannien, USA ...). Ein anderes Beispiel bot der damalige britische Brexit-Unterhändler David Davies mit seinen Worten "eine Demokratie ist keine Demokratie mehr, wenn man seine Meinung nicht mehr ändern darf". Sie wurden von Donald Tusk prompt beantwortet mit einer Zustimmung zu dessen Worten mit dem Hinweis, dass die Briten jederzeit gerne ihre Meinung zur EU ein weiteres Mal ändern und den Brexit abbrechen dürfen, die Herzen der Europäer stünden den Briten nach wie vor offen.
Und noch ein weiteres Beispiel: die Grenze zwischen "Redefreiheit" und rechtlicher Verfolgung wegen „Volksverhetzung" wird zunehmend verwischt: Demokratie beginnt hier ihr wahres, ihr hässliches Gesicht zu zeigen, eine Grimasse wie sie ewige Minderheiten aus ihrem Alltag kennen. Dabei handelt es sich wegen seiner Widersprüchlichkeit um das wahre Gesicht, weil der demokratische Liberalismus hier sein eigenes Paradigma bekämpft und damit beweist, dass Demokratie in dieser Form nicht wirklich praktikabel ist: die Mehrheit hält fest, dass sie der Repräsentant der legitimen Demokratie ist, erklärt die Gegenseite zu „Populisten" und versucht, deren Redefreiheit zu unterbinden.
Die Partei der US-Democrats definiert sich als sozial-liberal, was erklärt wird als "eine Ideologie, die eine Balance sucht zwischen individueller Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und dem Gemeinwohl. So wie der klassische Liberalismus unterstützt auch der soziale Liberalismus eine Marktwirtschaft und eine Ausdehnung sozialer Rechte auf alle Bürger." * 18 Die Entwicklung der letzten 50 Jahre, aber besonders der jüngsten politischen Ereignisse, wirft schwerwiegende Fragen auf, insbesondere nun, da sich das Ungleichgewicht zu einer Teilung, ja zu einem tiefen Graben zwischen zwei getrennten Hälften der Bevölkerung der USA entwickelt hat – dasselbe geschieht derzeit in einer Reihe weiterer Länder.
Wieviele Demokratien leben zusammen in einer Demokratie?
Gewiss muss Demokratie als politisches System mangelhaft sein, wenn dessen Werte laut seiner Verfassung keine ausreichende Basis für ein friedliches Zusammenleben in einem Sozialsystem sind, insbesondere, wenn die Gesellschaft obendrein noch durch einen Klassenkonflikt geteilt ist, zerstückelt in eine Vielzahl von Interessensgruppierungen, vertreten durch politische Parteien mit unterschiedlichen Wertesystemen. Demnach ist „das Volk", erwartungsgemäß vereint in seiner Demokratie, in Wahrheit in einem multipolaren Gruppenkonflikt verfangen, wobei jede politische Partei für sich beansprucht, demokratisch zu sein, und die anderen in populistischer Weise als undemokratisch oder eben als populistisch dämonisiert - eine Quadratur des Kreises. Und es gibt eine Vielzahl weiterer Unzulänglichkeiten zu diskutieren: so zum Beispiel kollidiert das „Recht auf Selbstverwirklichung" mit dem Wahlsystem und dessen Folge, nämlich der Dominanz, wenn nicht sogar dem Diktat der Mehrheit. Individualismus, Herrschaft der Mehrheit, Religionsfreiheit, Toleranz, Kapitalismus, Gemeinwohl, sie alle stellen Werte dar, die teilweise miteinander im Konflikt stehen oder einander gar widersprechen, soweit sie nicht überhaupt der Paradoxie zum Opfer fallen, sich selbst als demokratisch zu bezeichnen und dies allen anderen absprechen.
Wir als Individuen – und die Demokratie
Worin also besteht nun die Macht des Einzelnen in der Demokratie? Für die überwiegende Mehrheit von uns geht es um das Wahlrecht – und zwar mehr oder weniger ausschließlich. Die neue Macht aus der Meinungsfreiheit über die sozialen Medien ist derzeit noch eine äußerst unklare Größe.N12 Der Politologe Jason Brennan meint in seinem Buch "Against Democracy": "Demokratie verleiht nicht Individuen Macht, sondern Gruppen", und er stellt fest, dass das Wahlrecht nur einen symbolischen Wert repräsentiere und dass "sie in der Regel nicht in der Lage sind uns zu zeigen, dass demokratische Rechte irgendeinen tatsächlichen Wert für uns haben".*3 Und schließlich stellt er fest: "Demokratie ... zielt darauf ab, Individuen die Macht zu entziehen und sie auf große Gruppen oder Ansammlungen von Individuen zu übertragen. Demokratie verleiht uns Macht, nicht mir".*3
Aber Vorsicht, denn wir als Einzelne haben sehr wohl mehr Bedeutung in der Demokratie als in jedem anderen sozialpolitischen System: nur eben nicht in erster Linie als Wähler, wohl aber als bewusste Individuen mit unseren individuellen Begabungen – und Alle von uns haben spezielle Fähigkeiten, mit denen wir zur Gemeinschaft beitragen können. Die Frage, wie man daraus eine soziale Herausforderung gestalten könnte, mache ich zu einem Kernpunkt in Kapitel III.
Ist "Repräsentative Demokratie" nie eine "echte" Demokratie?
Wenn Gruppen, Sippen, Gangs, Parteien oder Lobbyisten die Macht innehaben, dann ist Demokratie nichts als eine versteckte Variation von Oligarchie, in der mächtige Gruppen und deren Anführer die Regierungsmacht heimlich ausüben. Und in der Tat geschieht in der Demokratie nichts anderes, als dass natürliche Führungstalente ihre Parteimitglieder davon überzeugen, sie zu ihrem Führer zu wählen, um sich damit in die Lage zu versetzen, die gesamte Bevölkerung in gleicher Weise zu bewegen, sie zu wählen. Danach regieren diese Führer das Land, weitgehend in Übereinstimmung mit der Verfassung, ja, aber dennoch unter Ausnutzung aller verfügbaren Ritzen zwischen diesen Regeln, tatsächlich regierend wie ein Souverän, ohne je für ihre Handlungen verantwortlich gemacht zu werden, auch nicht wenn es um das Gemeinwohl geht.N13 Natürlich kann kein politisches System ohne eine Balance zwischen dem Volk und seiner Regierung existieren. Dies würde bedeuten, dass es die Soziokultur eines Landes ist, welche letztlich ein politisches System bestimmt, wobei der charismatische Führer lediglich die momentane Stimmung des Volkes widerspiegelt. Diese Form von Wirklichkeit beschreibt LeBon in seinem Bericht über Beobachtungen der Menschen des 19. Jahrhunderts, der Kolonialstaaten wie deren Kolonien: "Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet... sie ... ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr...".8 Hiermit beschreibt er eine wahnsinnige Menschenmenge in einem Trance-Zustand, die ihrem Anführer befiehlt, sie entsprechend zu unterhalten, allerdings ohne zu bemerken, wann sie selbst irregeleitet und betrogen wird, eine Volksschar, losgelassen in die Demokratie, ein weites Feld für die Erjagung leichter Beute. Es ist eine Menschheit in ihrer Kindheit und frühen Jugend, unfähig zum Umgang mit Macht, ausbeuterisch und rücksichtslos. Die Herausforderung besteht nun darin, eine Lösung zu finden. Karl Popper meint: "Die Frage ist nicht, wer die Macht hat, sondern wie damit umgegangen wird." *1
Wir können jetzt selbstverständlich argumentieren, dass wir uns um all diese künstlichen Konstrukte ewig unzufriedener Meckerer nicht kümmern und einfach sagen: sieh dich doch um und gestehe ein, dass wir in noch nie dagewesenem Wohlstand und in Sicherheit leben; warum also sollten wir uns Sorgen machen um Dinge wie „bedeutungsloses Wahlsystem", „Mediokratie", „wer regiert hier eigentlich, das Volk oder Oligarchen politischer Parteien", „Politik, die in ihrer Machtlosigkeit zulässt, dass ein unkontrollierter Kapitalismus die soziale Schere weiter öffnet" ... wir sind konfrontiert mit einem Prozess, der nur dann ein gutes Ende nehmen kann, wenn, so der Historiker Arnold Toynbee, "... der Mensch ... seine selbstmörderische aggressive Habgier überwindet".19, N14 Abgesehen davon, dass dies nur bedeutet, eine biologische Gegebenheit unbeachtet zu lassen, ist die Frage nicht so sehr „wozu sich darum kümmern", solange es uns besser geht als allen anderen. Die Frage ist vielmehr: wie lange wird ein solches System angesichts all dieser Warnsignale noch überleben?
Die Wohlfahrts-Demokratie?
Die Verteilung des Wohlstands an sich kann kein Argument für die gegenwärtige Demokratie sein, denn es gibt heute mindestens ebenso viele Milliardäre und Multimillionäre als es in früheren Jahrhunderten Aristokraten gab. Im Verlauf der Geschichte wurde die seit dem Mittelalter zunehmende soziale Schere (engl. social divide) nur durch Kriege und Seuchen unterbrochen; er hat sich auch durch die Demokratie nicht verändert, wie wir in einem späteren Abschnitt sehen werden.
Der heutige Wohlstand besteht für Viele in der westlichen Welt – und ich sage bewusst Viele und nicht Alle, denn es gibt allein in Europa an die 50 bis 100 Millionen Menschen in Armut - dieser Wohlstand besteht also nicht etwa wegen der Demokratie, sondern dank Wissenschaft und Technologie – und Ausbeutung – und Staatsverschuldung, was gleichbedeutend ist mit „Wohlstand auf Pump"! Dieser Umfang an Wahnsinn wird nur noch von einem weiteren, mehrheitlich bekannten und gleichzeitig ignorierten, Geheimnis übertroffen: nämlich, dass dieses System nur funktioniert, solange es Wirtschaftswachstum gibt. Dies bedeutet, dass wir an ewiges Wirtschaftswachstum glauben müssen, solange wir daran glauben, dass Demokratie ein stabiles politisches System sei.
Demokratie: der irrationale Staat?
Objektivität und Wahrheit spielten in der Politik noch nie eine Rolle, außer ihr Ziel bestand darin, die Wünsche herrschender Individuen zu befriedigen. Es bringt uns daher nicht weiter anzunehmen, dass diese Faktoren „keine Rolle mehr spielen".20 Der Hinweis von LeBon, dass der Charakter bzw. der emotionale Zustand eines Volkes der eigentliche Regent sei, scheint weitgehend unbeachtet geblieben zu sein. Die Frage ist nun aber, ob die Demokratie in der Lage war, diese Situation zu ändern – die Antwort ist im Großen und Ganzen wohl: nein.
Die moderne Demokratie sollte ein Kind der Aufklärung werden, der Rationalität. Aus der Sicht des Gemeinwohls für eine Gesellschaft sind die Ergebnisse von demokratischen Wahlen jedoch aus mehreren Gründen vollkommen irrational: einer davon ist die Tatsache, dass der einzelne Wähler weitgehend uninformiert ist; ein anderer besteht in externen Faktoren (zum Beispiel dem Wetter am Wahltag) oder in Manipulation, ein weiterer ist das Endresultat selbst, oft zufällig entstanden und selbst wiederum Auslöser einer unerwarteten Folge: nämlich einer Regierung, die niemand wollte (z.B. eine Koalition). Bedingt durch den Liberalismus als treibender Kraft, lässt Demokratie Gesellschaften auf der Basis einer "Übertreibung des Individualismus" entstehen und eine Kultur des Hedonismus "als Selbstverwirklichung verbrämt".21 Der Politologe Ulrich Menzel erklärt diese Widersprüchlichkeit mit einer fehlgeschlagenen „rational cartesianischen Logik'22, gescheitert wahrscheinlich aus demselben Grund wie jegliche andere Ideologie, die in die Sozialpolitik hineingetragen wurde, weil soziale Phänomene eben „von Natur her" irrational sind; daher ist jedes Sozialsystem zum Scheitern verurteilt, solange die Ursachen dieser Irrationalität nicht berücksichtigt und entsprechend behandelt werden.
Diese beklagenswerte Irrationalität ist aus philosophischer wie auch wissenschaftlicher Sicht kommentiert worden: Brennan beschreibt sie als "Burkinian conservativism"3 und meint: "Gesellschaft und Zivilisation sind fragil. Die Gesellschaft wird nicht von Vernunft zusammengehalten sondern eher von irrationalen Überzeugungen und Aberglauben einschließlich derer an Autorität und Patriotismus ... Gesellschaft ist ... komplexer als unsere einfachen Theorien dies bewältigen können – und unsere Versuche, die Probleme zu lösen, haben oft fatale Folgen".* Und er argumentiert weiter, dass "diese Entdeckungen erschreckend [sind]. Man kann die Leute dazu bringen, Fakten, die sie direkt vor Augen haben, zu verneinen ... all dies nur wegen Gruppenzwang [peer pressure]. Diese Wirkung könnte sogar noch stärker werden, wenn es darum geht, politische Überzeugungen herzustellen".*3B. Caplan bezeichnet den Vorgang als "Rationale Irrationalität".*23, N15 Leider hilft es nicht weiter, wenn man feststellt, dass nicht nur die Demokratie sondern auch alle politischen Systeme in vergleichbar wahnsinniger Weise "rational irrational" oder "irrational rational" sind. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass die Demokratie diesen Umstand ebenfalls nicht ändern kann, oder noch schlimmer, dass sie nicht einmal in der Lage ist, sich aus dem Sog ihrer Selbstvernichtung zu befreien. Eines der bedeutungsvollsten Beispiele in diesem Zusammenhang ist wohl der vielfache „atomare overkill", den demokratische Staaten (!) bewerkstelligt haben. Jedoch ist seit dem Ende des Kalten Krieges auch noch ein weiteres Szenario apokalyptischer Selbstvernichtung in den Vordergrund gerückt: die Umweltkrise,N16, N16A die noch dazu von „ökolokratischen" Strategien (siehe S. →) bis zum bitteren Ende verwaltet werden würde, wenn nicht in letzter Minute eine rettende Änderung eintritt.
Demokratie – ein Modell für die Vereinten Nationen?
Die UNO, die Vereinten Nationen, scheinen der ultimative Erfolg der Idee von Demokratie zu sein. Jedoch, die UNO verkörpert all die Schwächen und Mängel der Demokratie: so gibt es Mitgliedsstaaten wie China und Russland, die ihre bedeutendsten Vereinbarungen ignorieren, z.B. betreffend Menschenrechte. Die UNO wird daher auch zur Bühne der Auseinandersetzung zwischen dem westlichen Universalismus und den Kulturen im Rest der Welt. Der zahnlose Tiger UNO zeigt sich an Beispielen wie China's Umgang mit der Internet-Kontrolle seiner Bürger. Das Veto-Recht der ständigen Mitglieder macht den Sicherheitsrat weitgehend wirkungslos und damit viele Aspekte der UNO endgültig absurd (allerdings ganz im Gegensatz zu Einrichtungen wie dem UNHCR). Dennoch bestimmen im Wesentlichen die USA, China und Russland den Aktionsradius der UNO, auch wenn er trotzdem für manche vernachlässigten Länder die einzige Hoffnung auf Unterstützung bleibt. Die UNO hat nun einmal keine Macht gegenüber Signatarstaaten, die gegen jene Abkommen verstoßen, denen sie zuerst selbst zugestimmt haben. Dominierende Akteure wie die USA verweigern zum Beispiel die Teilnahme am Internationalen Gerichtshof.24 Staatliche Interessen und zwischenstaatliche Konflikte lähmen die UNO in beschämendem Umfang – eine der fatalen Folgen war der Völkermord in Ruanda im Jahr 1994.N17
Welche Form von Demokratie?
Diese Frage ähnelt jener, was Demokratie überhaupt sei, auch an Komplexität: wie wir in der kurzen Überschau der historischen Entwicklung sehen werden, entstand Demokratie nirgendwo über Nacht, sondern auf einem schwierigen Weg, gepflastert mit Rückschlägen über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ihre Errichtung hing ab von der politischen Ausgangslage, aber auch von den Gründungsvätern, die ihrem Volk ihre Erwartungen durch die Verfassung mitteilten – sonderbar zwar für eine Regierung durch das Volk selbst. Der Mehrzahl der heutigen Demokratien ist gemeinsam, dass sie keine direkten Demokratien im Sinne des antiken Griechenland mehr sind sondern ihre „repräsentative" Version in der einen oder anderen Form. Demnach haben die Franzosen und die USA eine „präsidiale" Demokratie, die Briten und die Deutschen hingegen eine parlamentarische Form. Einige der Staaten sind demokratische Republiken, die Mehrzahl jedoch sind demokratische, sogenannte konstitutionelle, Monarchien. Sie alle sind keine Staatsverwaltungen "des Volkes für das Volk" sondern politische Repräsentationen verschiedener Interessensgruppen, die gegenseitig versuchen, die Oberhand über die anderen zu bekommen.
Sieht man sich die verschiedenen Ansichten in der neueren Literatur an, erhebt sich die Frage: ist Großbritannien demokratischer als die USA, oder Frankreich mehr oder weniger als Deutschland, oder umgekehrt? Werfen wir einen Blick auf die Situation in jenen zwei Ländern, die für sich die längste Tradition moderner Demokratie beanspruchen, jedes jeweils ein Beispiel für parlamentarische und präsidiale Demokratie:
Demokratie in Großbritannien
Unter Berücksichtigung politischer Systeme weltweit erscheint mir die britische konstitutionelle Monarchie als der erfolgreichste Versuch in seinem aufrichtigen Ansatz, Fairness unter einer Anzahl von Bevölkerungsschichten zu schaffen (ausgenommen die niedrigste in ihrer stabilen Armut und die reichste in ihren unerreichbaren Sphären jenseits jeglichen Systems). Dies gilt auch für die Aufrichtigkeit, mit der eine Monarchie als Symbol des „Soll-Menschen" und als Symbol stabilen Schutzes und von Führung trotz Demokratie aufrechterhalten wird, aufrichtig genug um den Menschen ihren herzenstiefen Wunsch zu ermöglichen, sich selbst als ihre individuelle Majestät in der Demokratie fühlen zu können und gleichzeitig Sicherheit am Busen von weisen, beschützenden und gütigen Monarchen anzustreben.
Andererseits ist Großbritannien auch ein hervorragendes Beispiel zur Demonstration des Risikos, mit dem die Demokratie in diesen Tagen konfrontiert ist: das Land präsentiert sich stolz als die älteste, am längsten gewachsene und daher stabilste Demokratie, wohl wissend dass es weit davon entfernt ist, auch, dass es nicht wirklich und vor allem kaum noch eine repräsentative Demokratie ist. Grayling beschrieb dieses Verhalten kürzlich treffend als hartnäckigen Selbstbetrug von „Demokrationisten" * 11 und verwies auf Lord Hailsham QC, der von Großbritannien als einer „Wahldiktatur"* 11 spricht.
Da sinkt also ein altehrwürdiger Beherrscher der früheren Welt nieder in Liberalismus, der sie weiter in Libertinismus, Anarchie und Chaos hinunterzieht; Neo-Nationalismus und Isolationismus in einer unaufhaltsam globalisierten Welt, verursacht von einer Angst vor ausufernder Immigration, beginnt an der Ökonomie des Landes zu nagen, während sich die soziale Schere - "social divide" - weiter öffnet, ebenfalls scheinbar unaufhaltsam, die Hände am Ruder eines gekaperten Schiffs, dessen offizieller Kapitän das Volk ist. Letzteres hat seine Macht an Politiker abgegeben, die sich bemühen, die Demokratie zu loben, aber auch bemüht sind, der Wirtschaft zu dienen, auch, die eigene Position zu halten, während die Welt rund um sie in kleinen, raschen Schritten zerfällt.
Demokratie – und die USA
Wie schon zuvor berichtet, werden die USA heute nicht als eine vollwertige Demokratie angesehen. Ihre Unabhängigkeit vom Mutterland Großbritannien begann als Republik unter Ausschluss des eigenen Volkes N18. Schon als Alexis de Tocqueville um 1840 die USA besuchte, war er besorgt um eine Entwicklung zur Mediokratie (siehe S. →). Heute werden die USA von einigen Experten eher als Timokratie 3. denn als Demokratie beschrieben,N18 in der vorwiegend Millionäre als Politiker tätig sind, und Milliarden für Lobbying, politisches Gerangel und "Gerrymandering" ausgegeben werden; dabei handelt es sich um eine Form von politischer Trickserei um die Größe von Wahlbezirken (siehe S. →). Einige Autoren gehen sogar noch weiter als der EIU-Bericht und meinen, die USA sei überhaupt keine Demokratie mehr: "... ein dritter Grund besteht darin, [abgesehen von Gerrymandering und der Tatsache, dass der Senat nicht repräsentativ ist] dass eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes es Milliardären gestattet, Wahlkämpfe auf allen Ebenen unbegrenzt finanziell zu unterstützen; politische Ämter werden gekauft und verkauft wie ein Paar Socken" .* 11 (siehe auch Anm.N19). Der deutsch-amerikanische Polit-Philosoph und Soziologe Herbert Marcuse, gerade noch rechtzeitig einem faschistischen System in die Freiheit entflohen, schrieb Mitte der 1970er Jahre ernüchtert: „Die regressive Entwicklung der bürgerlichen Demokratie, der von ihr selbst vollzogene Übergang in einen Polizei- und Kriegsstaat, muß im Rahmen der globalen US-Politik erörtert werden".422„Die konturlosen Massen, die heute die Grundlage der US-amerikanischen Demokratie bilden, sind die Vorboten ihrer konservativ-reaktionären wo nicht gar neo-faschistischen Tendenzen.... In freien Wahlen mit allgemeinem Wahlrecht hat das Volk... eine kriegführende Regierung gewählt, die seit langen Jahren einen Krieg führt, der eine einzige Reihe beispielloser Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt – eine Regierung von Repräsentanten der Großkonzerne ..., eine von Korruption durchsetzte Regierung".422 Als Erklärung für diese Entwicklung führt Marcuse die Zunahme des Wohlstands an. Und weiter: „Das Schauspiel der Wiederwahl von Nixon ist der albtraumhafte Inbegriff der Epoche, in der die Transformation der bürgerlichen Demokratie in den Neofaschismus stattfindet ...".422„Indem das US-amerikanische System das sinnlich wahrnehmbare >lmage<, den >Sex-appeal< einer politischen Führungspersönlichkeit so hervorhebt, beherrscht es auf furchtbar effiziente Weise die Tiefendimension befriedigender Selbstunterwerfung ..."'422 eine Einschätzung, die einige Aspekte der Wahl von Trump durch viele begeisterte Frauen erklären mag. Marcuse's nächster Satz, geschrieben 1973, könnte ein Kommentar zur Situation in den USA der Jahre seit 2017 sein: