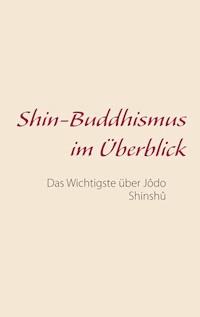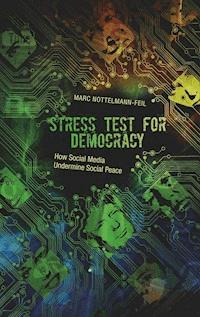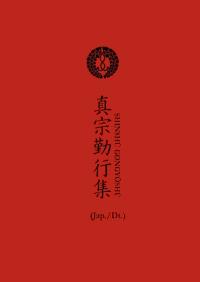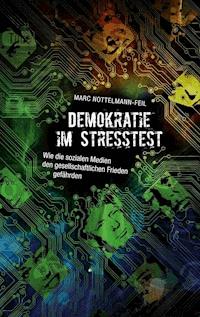
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was gehen uns die sozialen Medien an? Sind sie noch Privatsache oder haben sie schon eine Stellung in der öffentlichen Meinungsbildung erlangt, die nicht mehr wegzudiskutieren ist? Was sind Hashtag-Bewegungen? Und was kommt auf die Demokratie zu, wenn sich das politische Gespräch in die verwinkelte Welt der Chaträume verlagert? Marc Nottelmann-Feil zeigt im vorliegenden Essay, aus welchen Gründen in den sozialen Medien notwendigerweise eine virtuelle Schattengesellschaft entsteht, deren Treiben mit demokratischen Prozessen kaum noch etwas zu tun hat. Die echte Gesellschaft zerbricht, weil sich die Diskussion im Netz in unvermittelte Paralleldiskurse auflöst. Die Struktur der sozialen Medien gehört darum dringend auf den Prüfstand. Schnelles Handeln ist das Gebot der Stunde, denn Gesellschaft, Kultur und Politik stehen schon am Scheideweg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
Vorsicht E-Mails!
Facebook oder die Erfindung der synthetischen Massenkommunikation
Biedermann und die Brandstifter
Die Struktur der angeblichen Dialoge
Nieder mit dem
#Establishment
!
Meinungsbildung ohne Politik
Von klaren Fronten zum Bürgerkrieg
Twitter - Meinungsführerschaft durch Selbst-Advertising
Was ist Wahrheit, Herr Pilatus?
Mensch und Menschenbild der sozialen Medien
Erste-Hilfe-Maßnahmen und falsche Erwartungen
Frieden mit Facebook & Co?
Schlussbemerkung
Weiterführende Literatur
Einleitung
Es gibt Jahre, in denen sich die Geschichte zu beschleunigen scheint. Alte politische Strukturen, die lange als solide und unerschütterlich galten, brechen plötzlich auseinander, etwas Neues ist im Gange, aber man weiß nicht was. Seit 2011 haben sich die Gewichte in der Welt verschoben: der Nahe Osten steht in Flammen, die EU erodiert, Russland ist zur geopolitisch denkenden Expansionspolitik zurückgekehrt und die Vereinigten Staaten von Amerika wählten einen Präsidenten, der das Eigeninteresse seines Landes über alles stellt.
Noch immer führt der Westen Regie. Wenn man das Gesamtbild betrachtet und weit von der Leinwand zurücktritt, alle Details vernachlässigt und nur auf die gröbsten Umrisse sieht, so ist es doch ein im Westen entstandenes Menschenbild, das hinter all diesen Erscheinungen wirkt. Der Mensch gilt als das von Gier geleitete Wesen, das sich im Kampf um das Eigeninteresse gegen die anderen durchsetzen muss. Auf allen Ebenen bis hin zur Ebene der Staaten und der Weltwirtschaft herrscht darum Konkurrenz. Nichts ist wichtiger für den einzelnen Menschen wie für den Staat, als sich so schnell wie möglich weiterzuentwickeln; jede Gewinnaussicht muss frühzeitig erkannt und rigoros, zur Not auf Kosten der Langsameren oder auch nur Besonneneren, genutzt werden. Dies führt zur Deregulierung, zum Freihandel um jeden Preis, zum sorglosen Umgang mit den begrenzten Ressourcen dieser Welt ebenso wie zur immer schmerzhafter werdenden Kluft zwischen Arm und Reich. Letztendlich beginnen mit dem hier skizzierten Menschenbild die meisten, wenn nicht gar alle Probleme, die zu den erwähnten Umwälzungen geführt haben.
Ich möchte aber nicht erklären, warum die Welt in einer Krise ist. Meine Fragestellung geht in eine andere Richtung: Warum können wir im gesellschaftlichen Diskurs keine vernünftigen Antworten auf die Herausforderungen finden, obwohl sich die Möglichkeiten der Kommunikation in den letzten Jahren geradezu in einem Quantensprung verbessert haben? Die sozialen Medien verknüpfen inzwischen die gesamte Welt; niemals war es so leicht, Verbindungen zu schließen, sich über die Probleme und Diskussionen der entferntesten Weltteile zu informieren und auf allen Ebenen mitzureden. Warum schafft es die Menschheit nicht, miteinander zu reden und gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten? Wer sich in Deutschland für die Politik eines afrikanischen Landes interessiert, kann mühelos auf dem Laufenden bleiben: er kann lesen, was die Regierung und Opposition twittern und posten, und sogar in Echtzeit darauf antworten, fast so als lebte er in Afrika. Wann hätte man je eine so unvorstellbare Freiheit gehabt! Ebenso sind alle Parteien und Medien in Deutschland, jeder noch so kleine politische Zirkel, im Internet vertreten. Jeder Bundestagsabgeordnete ist nur ein paar Mausklicke vom Bürger entfernt, die Basisdemokratie scheint also in greifbarer Nähe – und doch scheint unsere Gesellschaft dadurch nicht zufriedener und ausgeglichener geworden zu sein. Im Gegenteil, es brennt an allen Ecken und Enden. Erst kürzlich sprach Bundespräsident Gauck in seiner Abschiedsrede sogar von einer Gefährdung der Demokratie.1 Noch zwei Jahre zuvor hätte die große Mehrheit der Deutschen ihre Demokratie für die stabilste auf der ganzen Welt gehalten.
Täuschen wir uns nicht in etwas Grundsätzlichem? Die sozialen Medien verbinden die Welt und lassen die Gesellschaft enger zusammenrücken – so der erste Anschein, der viel für sich hat. Die Wirklichkeit jedoch, deren Zeuge wir sind, sieht ganz anders aus. Seit der Gründung von Facebook (2004) und Twitter (2006) erodieren staatliche Gebilde: Irgendwo in den Internet-Cafés von Tunis und Kairo nahm der Arabische Frühling seinen Anfang (2011), der unter dem Beifall des Westens die arabischen Autokratien zu Fall brachte. Für einen Augenblick schien es, als hätte sich, einem ewigen Gesetz der Geschichte folgend, die westliche Aufklärung wieder einmal gegen die östlichen Willkürherrschaften durchgesetzt; die verarmten Völker Nordafrikas und des Nahen Ostens erhoben sich gegen ihre korrupten Eliten. Es folgte aber kein Zeitalter der arabischen Vernunft, sondern ein Machtvakuum, in dem die innere Zerrissenheit der Gesellschaft sich deutlicher offenbarte denn je, bis sie sich in fatalen Bürgerkriegen entlud. Warum konnten die sozialen Medien das Staatsgefüge dieser Länder zwar erschüttern, die Gesellschaft aber nicht zusammenhalten? Warum finden diese Länder bis heute nicht zum Frieden zurück, obwohl es doch so einfach wäre, mit dem Feind via Facebook Kontakt aufzunehmen – ganz ohne internationale Diplomatie und mühsam arrangierte Friedenskonferenzen? Die sozialen Medien scheinen zwar die Gesellschaften durcheinanderzuwirbeln, aber irgendwie fehlt ihnen offenbar die Kraft, einen gesellschaftlichen Heilungsprozess einzuleiten.
Im Jahr 2016 hat eine Störwelle, die mit den sozialen Medien eng verflochten ist, auch die westlichen Staaten und Gesellschaften erreicht. Unvorhergesehenes geschah, Dinge ereigneten sich, die so gar nicht im Blickfeld der Meinungsforscher oder der etablierten Medien aufgetaucht waren. Sowohl der Brexit als auch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten schlugen ein wie der Blitz, weil die etablierten Medien – Fernsehen, Presse und Radio – wie eh und je ihre Arbeit gemacht hatten: sie berichteten von Parteitagen und Verlautbarungen der Politiker, sie veranstalteten Talkshows mit unterschiedlichen Teilnehmern und Fernsehduelle; aber sie übersahen dabei die Halböffentlichkeiten (Plural!) der sozialen Medien. Zeitschriften wie „Guardian“ oder „The New York Times“ gaben sich der Illusion hin, sie seien immer noch die unangefochtenen Leitmedien und auch der Diskurs in den sozialen Medien würde sich nach ihnen richten. Aber die sozialen Medien folgen eigenen Gesetzen, das dürfte nun klar geworden sein. Donald Trump hat sich tatsächlich mit Twitter und anspruchslosem TV gegen die gesamte Macht der etablierten Medien durchgesetzt. Ein Beben geht durch die mächtigste Demokratie der Welt, das uns vor Augen führen muss, wie kompromisslos die sozialen Medien als Katalysator der Disruption wirken.
Beschönigen wir also die sozialen Medien nicht weiter als Mittel des herrschaftsfreien Diskurses, als Vorreiter von Basisdemokratie und Werkzeug der Volkserziehung, sondern machen wir uns Gedanken, wie sie tatsächlich funktionieren und welche Konsequenzen ihr Wirken für die Gesellschaft hat! Am Ende sollten wir uns überlegen, wie wir mit diesen sozialen Medien weiterleben können oder anders gesagt: wie sie sich und wir uns verändern müssen, damit ein Leben in dieser neuen Situation möglich wird.
1 Joachim Gaucks Rede zum Ende der Amtszeit vom 17. Januar 2017.
Vorsicht E-Mails!
Der Mensch ist das Wesen, das die Muster seines Kommunizierens abrupt verändern kann. Es gibt keine Gesellschaft ohne Kommunikation, Kommunikation ohne Gesellschaft hingegen ist durchaus möglich. Am Anfang der Menschheitsgeschichte waren das Kommunizieren und die Gesellschaft beinahe identisch: Gesellschaft war geselliges Zusammensein, bei dem kommuniziert wurde. In einer kleinen Horde von Jägern und Sammlern kennt jeder jeden, jeder weiß sehr viel über die anderen, und man hat untereinander kaum Geheimnisse. Die Mitteilung ist im Wesentlichen öffentlich, so wie auch der Beutefang öffentlich verteilt wird. Später wurden die Gesellschaften größer, es war bald unmöglich, alle anderen Menschen zu kennen. Dementsprechend bildeten sich immer komplexere Formen der Rollenverteilung, die darüber entscheiden, wer wo das Sagen hat. Neue Austauschformen kamen auf – der Bote, das geschriebene Wort, der Brief, die Druckerpresse usw. – die jeweils die Muster des Kommunizierens in der Gesellschaft vollkommen veränderten. Die Kommunikation wurde abstrakter, sie hatte auch immer weniger mit menschlichem Zusammensein zu tun. Wenn wir heute die modernen Medien benutzen, die in den letzten hundert Jahren entstanden sind, aber auch wenn wir einen Brief schreiben oder ein Buch lesen, sind wir kommunikativ tätig, aber manchmal fühlen wir uns dabei zutiefst einsam.
Das Aufkommen neuer Kommunikationsformen in einer Zeit des technologischen Umbruchs ist weder überraschend noch per se schlecht. Freilich verlangt alles Neue verstärkte Aufmerksamkeit. Solange das Neue in seiner Bedeutung noch nicht erkannt ist, da es nur für eine spielerische Fortsetzung des Alten gehalten wird, ist Gefahr im Verzug. Es gibt einen kritischen Zustand, in dem althergebrachte Strategien noch fortgesetzt werden und das Neue gleichsam im Gewand des Gewohnten erscheint. Man tüftelt und denkt nach, man ist bereit, dem Neuen einen kleinen, wohl begrenzten Bereich einzuräumen, in der Annahme, man werde sich schon irgendwie mit ihm arrangieren können. Aber das Neue passt nicht in die alten Schubladen, es lässt sich nicht einordnen, sondern ist stark genug, sich selbst das Alte einzuverleiben. Der erste Schritt zur Überwindung einer Innovationskrise ist also, das Neue des Neuen klar zu erkennen.
Vor gut zehn Jahren fiel mir zum ersten Mal auf, wie abhängig der Erfolg oder das totale Scheitern des Kommunizierens vom Medium ist. Damals stand ich vor der Aufgabe, einen kleinen Verein zu führen, dessen Mitglieder geographisch sehr weit verstreut lebten. Wegen der geographischen Distanz kannte weder ich die Mitglieder des Vereins besonders gut, noch umgekehrt sie mich. Etliche administrative Aufgaben mussten aber trotzdem erledigt werden, und darüber hinaus musste man sich konzeptionell Gedanken über die Zukunft des Vereins machen. Dabei machte ich eine erstaunliche Erfahrung: Immer wenn ich E-Mails schrieb, um Vorschläge zu unterbreiten oder über irgendetwas zu informieren, kam es zu oft kruden Missverständnissen; manche der E-Mail-Korrespondenzen entgleisten vollkommen und führten zu gegenseitigen Anschuldigungen, obwohl ich mich aus meiner Sicht immer um ein verständnisvolles und diplomatisches Entgegenkommen bemüht hatte. Die Probleme verschwanden jedoch regelmäßig, sobald ich den Telefonhörer in die Hand nahm und mit den betreffenden Personen ein Gespräch führte. Dann dauerte es nur wenige Minuten, bis die Spannung gelöst, alles Misstrauen überwunden und alle Vorbehalte sich wie Nebel aufgelöst hatten. Offensichtlich reichte das geschriebene Wort nicht aus, um Dinge mitzuteilen und über Sachverhalte zu diskutieren. Erst der Tonfall, das schnelle oder langsame Sprechen, das zustimmende Lachen oder abwartende Zuhören brachten die Kommunikation ins Laufen und führten zu einem für beide Seiten befriedigenden Verhandlungsergebnis. In der E-Mail-Korrespondenz hingegen irrten sich beide Seiten oft in dem Gewicht, das der Schreibende auf eine bestimmte Phrase gelegt hatte; man mutmaßte dahinterstehende Absichten, die gar nicht bestanden, oder fühlte sich schlichtweg nicht ernstgenommen.
Besonders schlimm war es, wenn E-Mails weitergeleitet wurden. Konfliktparteien suchen verständlicherweise immer Bündnispartner. Wenn man der Überzeugung ist, im Recht gegenüber einem anderen zu sein, so ist es äußerst einfach, eine Passage aus einem E-Mail zu zitieren, sie in den eigenen Kontext zu stellen und an einen großen Bekanntenkreis weiterzuleiten. Das Ergebnis ist für den Verfasser des ursprünglichen E-Mails oft verheerend; denn er muss sich nun vor Leuten rechtfertigen, die er gar nicht im Sinn hatte, als er das E-Mail schrieb.
DAS E-MAIL (UND SEIN KLEINER BRUDER, DAS SCHON FAST VERGESSENE FAX) war das erste Geschwindigkeitsmedium ohne Gesicht und Stimme, das jede Form non-verbaler Kommunikation rigoros abschnitt. Es unterschied sich von allen Vorgängermedien aber auch in seiner vollkommen anderen Verwaltung, die ein fast unbegrenztes Kopieren, Weiterleiten und Langzeit-Speichern ermöglichte. Wehe dem, der den Unterschied zu den alten Medien nicht begreift!
Das Telefonat ist die weitaus natürlichere Form des Kommunizierens, nicht nur wegen der Vermittlung nonverbaler Stimmmodulationen, sondern auch, weil es die Einzigartigkeit der Kommunikation sichert. Niemand rechnet damit, in seinem Leben wieder mit der Tonaufzeichnung eines Telefonats konfrontiert zu werden, zumindest war das bisher ein seltener Ausnahmefall. Briefe enthalten zwar fixierte Informationen, aber wenn es sich nicht um amtliche Dokumente oder Rechnungen handelt, landen sie oft im Papierkorb. Ihre Verwaltung ist in jedem Falle sehr mühsam. E-Mails hingegen lässt der User normalerweise auf dem Server liegen, solange er keinen Grund hat, sie zu löschen; der Speicherraum auf einem Server ist fast grenzenlos und die Suchfunktionen arbeiten schnell. E-Mails sind im Nu wieder hervorgekramt und können erneut – exakt so, wie sie einst aufgezeichnet wurden – Gegenstand der Diskussion werden.
Nehmen wir einmal an, Sie hätten einen schlechten Tag gehabt, weil der Handwerker, der Ihre Waschmaschine reparieren sollte, einen falschen Schlauch eingesetzt hat. Obwohl die Handwerkerrechnung schon auf Ihrem Schreibtisch liegt, ist die Waschmaschine immer noch leck. Ehe Sie sich beim Handwerker beschweren, greifen Sie zum Telefonhörer und rufen einen Freund an, allein um Ihrem Ärger Luft zu machen. Nachdem der Freund Ihnen zugehört und ein wenig mit Ihnen über die Handwerker geschimpft hat, haben Sie sich wieder gefasst. Nun rufen Sie den Handwerker an, und erklären ihm in ruhigen und freundlichen Worten, wo das Problem liegt. Hätten Sie statt der Telefonate zwei E-Mails geschrieben, so wären diese im Tonfall und der Aussage vollkommen anders, und Sie kämen vermutlich in eine brenzlige Situation, wenn das E-Mail an Ihren Freund aus Versehen beim Handwerker landen würde. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn Sie ein wichtiger Politiker wären, und ihre E-Mails auf den Server von Wikileaks durchsickerten! Kommentierte Zitate würden sofort bei der Handwerkskammer landen, und Sie könnten schon am nächsten Tag über ihre „Doppelzüngigkeit“ in der Boulevardpresse lesen.
Der Schreibende eines E-Mails hat die Kontrolle über sein Wort abgegeben; und er muss sich sicher sein, dass der Adressat es wie ein rechter Treuhänder verwaltet. Telefonate sind vergänglich, E-Mails sind ewig. Die Aussage eines Telefonats kann man immer wieder revidieren, sie wird in der Erinnerung beider Seiten weichgezeichnet: der Zorn war im Nachhinein nicht so groß (da man ja schon wusste, wie das Problem sich lösen lässt), diese oder jene Formulierung war etwas anders gemeint (da der spätere Kompromiss sich ja schon abzeichnete), und an manches kann man sich nicht mehr so genau erinnern (zum Glück! Schwamm drüber!) – So läuft natürliches Kommunizieren von je her ab, und im Leben üben wir uns darin. Das E-Mail hingegen ist ein Dokument; es lässt sich nicht leicht aus der Welt schaffen.
DAS NEUE NICHT MIT DEM ALTEN ZU VERWECHSELN, ist das Wesen der Medienkompetenz. Die meisten Leute von Lieschen Müller bis Hillary Clinton glauben, ein E-Mail-Server sei so etwas wie ein Briefkasten, den man durch einen einfachen Briefkasten-Schlüssel, genannt Passwort, abschließen kann. Zum Beispiel ist der Briefkasten-Schlüssel, den ich an meinem Schlüsselbund mit mir trage, der primitivste von allen meinen Schlüsseln; mit etwas Geschick kann ich meinen Briefkasten sogar ohne diesen Schlüssel öffnen. Trotzdem mache ich mir nicht viele Gedanken darüber, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sich irgendein anderer für meine übliche Post interessiert. Was könnte ein Dieb schon von meinen Konto-Auszügen haben, die mir die Sparkasse regelmäßig zuschickt? Allenfalls wenn ich als alleinstehende Frau Angst hätte, Opfer eines Stalkers zu werden, würde ich auf meinen Briefkasten aufpassen. Vielleicht hätte ich dann ein Postfach auf dem nächsten Postamt.