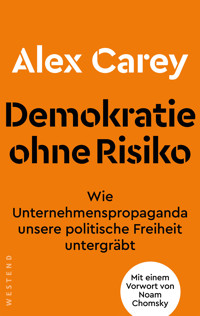
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Alex Carey dokumentiert in seinem Buch, das jetzt endlich in deutscher Übersetzung erscheint, die Geschichte der Unternehmenspropaganda des 20. Jahrhunderts. Carey zeigt und untersucht, wie und warum die Wirtschaftselite ihre Werte und Perspektiven erfolgreich an den Rest der Gesellschaft verkauft und so unsere Demokratien untergraben hat. "Ein einzigartig wichtiges Werk über das 'Ideal einer durch Propaganda gesteuerten Demokratie." Noam Chomsky "Eine einzigartige Studie über das Wachstum und die Entwicklung von Unternehmenspropaganda in westlichen Demokratien. Sie kommt zur rechten Zeit und ist für jeden nützlich, der sich über den Einfluss von Methoden der Massenüberredung auf die Untergrabung der Demokratie Gedanken macht." Elaine Bernard, Harvard University
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ebook Edition
Alex Carey
Demokratie ohne Risiko
Wie Unternehmenspropaganda unsere politische Freiheit untergräbt
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Taking the Risk out of Democracy. Corporate Propaganda versus Freedom and Liberty« © Alex Carey, edited by Andrew Lohrey, published 1995 by arrangement with the University of New South Wales, Ltd.
Mehr über unsere Autor:innen und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-98791-062-3
1. Auflage 2025
© Westend Verlag GmbH, Neu-Isenburg 2025
Übersetzung: Julien Karim Akerma
Lektorat: Emil Fadel
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhalt
Titelbild
Vorwort zur Originalausgabe
Danksagungen
Vorwort zur Deutschen Ausgabe
Anmerkungen
Einleitung
Teil I
1 Die Ursprünge der amerikanischen Propaganda
Der Wille
Die Fertigkeiten
Die Mittel
Die Symbole
2 Die frühen Jahre
Die erste Herausforderung durch das Volk
Die zweite Herausforderung durch das Volk
Der Triumph der Konzernpropaganda in der Nachkriegszeit
Preise
Propaganda innerhalb der Konzerne
3 Die erste Amerikanisierungsbewegung
Ursprünge
Der Einfluss der IWW
Die Amerikanisierungsbewegung nach Lawrence
Das Streben nach rechtlicher und finanzieller Unterstützung durch den Staat
Die Amerikanisierung wird patriotisch
Die weitere Entwicklung 1916
Die Ereignisse des Jahres 1917
1918 – Die Amerikanisierung erhält volle staatliche Unterstützung
Der Amerikanisierungsschub in der Nachkriegszeit
4 Der McCarthy-Kreuzzug
Anmerkungen
5 Die Neuformatierung der Wahrheit
Teil II
6 Graswurzel- und Baumkronen-Propaganda
Graswurzel-Propaganda
Baumkronen-Propaganda
US-Denkfabriken
Die Ablehnung der Arbeitsrechtreform
Bildung und freier Markt
Australiens Baumkronen-Propaganda
Eine unternehmerische Vision gelenkter Demokratie
7 Export der Überzeugungsarbeit
Das Institute of Public Affairs
Die Australian Chamber of Commerce
Die anderen Propaganda-Organisationen
Schulen
Universitäten
Beschäftigte
Die breite Öffentlichkeit
Verbindungen nach Übersee
Politikforschung in Australien
Unternehmen als Quelle des Widerstands?
Die Rolle der Regierungen
Medien und Werbung
Reaktionen der Schulen
Universitäten und Colleges
Gewerkschaftlicher Widerstand
Anmerkungen
8 Die Orwell-Umlenkung
Das Wachstum der Demokratie
Das Aufkommen eines kommunistischen Staates
Die Zunahme der Propaganda
Teil II
9 Der Human-Relations-Ansatz
Hintergrund
Unternehmensstrategien
Einige Schlüsselbegriffe
10 Die Hohepriester der Wirtschaft
US-Vorherrschaft
Ökonomische Ausbildung
Die Human-Relations-Schule
Feldstudien
Die Hawthorne-Studien
Lewin, Lippitt und White
Coch und French
Herzberg
Anmerkungen
11 Die Hawthorne-Studien: Eine Kritik
Hintergrund
Das bevorzugte Anreizsystem und die Arbeitsleistung
Phase I: Testraumstudie zur Relaismontage (neues Anreizsystem und neuartige Aufsicht)
Erste Hypothese: Veränderungen der Arbeitsaufgabe und des Arbeitsumfelds
Zweite Hypothese: Geringere Ermüdung aufgrund von Ruhepausen und kürzeren Arbeitszeiten.
Phase II: Zweite Relais-Montagegruppe (nur neues Anreizsystem)
Phase III: Glimmer-Spaltungs-Testraum (neue Aufsicht, aber keine Änderung des Entlohnungssystems)
Vergleich zwischen den Ergebnissen in Phase I, II und III
Die Belege im Zusammenhang mit den Schlussfolgerungen
Ein genauerer Blick auf die Umsetzung der freundlichen Aufsicht
Veränderungen bei der Aufsicht und Arbeitsleistung
Aufsicht während Phase I
Arbeitsleistung während Phase I
Aufsicht in Phase II
Arbeitsleistung in Phase II
Aufsicht in Phase III
Arbeitsleistung in Phase III
Zusammenfassung der Ergebnisse zu Aufsicht und Arbeitsleistung
Diskussion und Schlussfolgerungen
Anmerkungen
Navigationspunkte
Titelbild
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur Originalausgabe
von Noam Chomsky
Edward Herman und ich begannen unser Buch Manufacturing Consent, in dem es um die Unterordnung der großen Medien unter die Machtinteressen von Staat und Unternehmen geht, mit einer Widmung an Alex Carey. Dies war weit mehr als nur ein Verweis auf einen engen persönlichen Freund und geschätzten Mitarbeiter. Es war zugleich ein – unzulänglicher – Versuch, ihm unseren Dank auszusprechen. Dank für seine herausragende Arbeit zum »Ideal einer durch Propaganda gesteuerten Demokratie«, das die überaus klassenbewusste Unternehmenswelt in den Vereinigten Staaten mit tatkräftiger Unterstützung weiter Teile der intellektuellen Kultur durchzusetzen versuchte. Zum großen Leidwesen aller, die sich mit der Freiheit und ihren Feinden beschäftigen, konnte Carey die Arbeiten an einem großen Werk zur Rolle der Propaganda in demokratischen Gesellschaften nicht mehr abschließen. Mit der Veröffentlichung einiger seiner wichtigsten Beiträge werden seine Vorarbeiten nun endlich einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur teilweise.
»Das zwanzigste Jahrhundert«, schreibt Carey, »ist durch drei Entwicklungen von großer politischer Tragweite gekennzeichnet: das Wachstum der Demokratie, das Wachstum der Konzernmacht und die Zunahme der Konzernpropaganda als Mittel zum Schutz der Konzernmacht vor der Demokratie.« Dass das Wachstum der Konzernmacht Freiheit und Demokratie untergraben würde, war für die klassische liberale Weltsicht bereits klar, lange bevor die Konturen der zukünftigen industriell-kapitalistischen Gesellschaft klar erkennbar waren. In seinen späten Jahren warnte Thomas Jefferson, dass die neu entstehenden »Bankinstitute und Geldgesellschaften« die in der amerikanischen Revolution errungenen Freiheiten zerstören und zur Grundlage einer »homogenen und selbstherrlichen Regierung der Aristokratie« werden würden – wenn man ihnen nur freie Hand ließe. Dies geschah in einem Ausmaß, das Jeffersons schlimmste Albträume noch übertraf, wenn auch nicht als Ausdruck des Volkswillens, sondern in erster Linie durch Gerichte und Anwälte, die in »technokratischer Isolation« von der lästigen Öffentlichkeit agierten, um eine Formulierung aus den Empfehlungen der Weltbank aufzugreifen.
Seit jeher ist die Einführung und Entwicklung der Demokratie eine von den »Herren der Menschheit« gefürchtete Perspektive. Denn sie sehen darin nur ein Hindernis für die Verwirklichung ihrer »schändlichen Maxime«: »Alles für uns selbst und nichts für die anderen« (Adam Smith). Smith hatte dabei vor allem die »Kaufleute und Fabrikanten« im Blick, die zu seiner Zeit »die wichtigsten Architekten« der Politik waren und diese so gestalteten, dass ihre Interessen »in besonderem Maße berücksichtigt« wurden – ungeachtet der Auswirkungen auf andere, einschließlich der Bevölkerung Englands. In der Folgezeit nahmen die Institutionen der »Herren« neue Formen an. Und auch das Problem, die Hebel der Staatsmacht fest in ihren Händen zu halten, stellte sich auf neue Weise. Aber die Grundprinzipien blieben in veränderter Form bestehen.
Zur Zeit der ersten demokratischen Revolution der Neuzeit im England des 17. Jahrhunderts äußerten die selbsternannten »Men of best quality« (»Männer von bester Qualität«) ihre tiefe Besorgnis darüber, dass der »gemeine Mob« versuchen könnte, in die Arena des öffentlichen Lebens einzudringen. – Aufgehetzt von Pamphlet-Schreibern, Wanderpredigern und anderem Gesindel, das »das Volk mit seinem Tun derart neugierig und anmaßend gemacht hat, dass es niemals die nötige Demut aufbringen wird, sich einer zivilen Regierung zu unterwerfen«, wie ein bedeutender Intellektueller warnte. Besonders beunruhigend wirkte der unverhohlene Wunsch der Menge, weder vom König noch vom Parlament – den offiziellen Kontrahenten im Bürgerkrieg – regiert zu werden, sondern »von Landleuten wie uns, die wir unsere Bedürfnisse kennen«. »Solange Ritter und Herren unsere Gesetze machen, die aus einem Gefühl der Furcht heraus gewählt werden und die uns nur unterdrücken, ohne die Leiden des Volkes zu kennen, ist die Welt nicht in Ordnung«, erklärten sie in ihren subversiven Pamphleten. Derlei Sprüche hallen durch die Jahrhunderte und erwecken aufseiten der »besten Männer«, die zu Recht regieren, fortwährend Verachtung und Wut und, wenn nötig, massiven Terror und Gewalt. Sie waren bereit, dem Volk gewisse Rechte zuzugestehen, aber nur innerhalb der Grenzen der Vernunft und nach dem Grundsatz, dass »wir, wenn wir vom Volk sprechen, nicht die wirre zusammengewürfelte Masse des Volkes meinen«, wie eine andere Autorität des 17. Jahrhunderts erklärte. »Tagelöhnern und Kaufleuten, alten Jungfern und Milchmädchen« müsse man sagen, was sie glauben sollen, bemerkte John Locke, nachdem der demokratische Aufstand niedergeschlagen worden war: »Die Mehrheit ist unwissend und muss deshalb glauben.«
Die »Krise der Demokratie« im 17. Jahrhundert brachte eine klare Unterscheidung zwischen »Aristokraten« und »Demokraten« zum Ausdruck, die Thomas Jefferson formulierte, als er über das Schicksal des amerikanischen demokratischen Experiments nachdachte. Jeffersons »Aristokraten« sind »diejenigen, die das Volk fürchten und ihm misstrauen und alle Macht des Volkes in die Hände der höheren Klassen legen wollen.« Seine »Demokraten« hingegen »identifizieren sich mit dem Volk, vertrauen ihm, respektieren es und betrachten es als den ehrlichen und sicheren, wenn auch nicht den weisesten Hüter des öffentlichen Interesses«. Zu den Aristokraten in diesem Sinne gehören Smiths »Kaufleute und Fabrikanten« sowie ihre Nachfolger, die die Kontrolle über die Wirtschaft und das politische System erlangten. – Eine Entwicklung, die Jefferson wegen des offensichtlichen Widerspruchs zwischen Demokratie und Kapitalismus – sei es im staatlich gelenkten westlichen Modell oder einem anderen – mit Besorgnis betrachtete. Zu Jeffersons »Aristokraten« gehören auch die Progressiven des 20. Jahrhunderts, die Alex Carey in den folgenden Aufsätzen erörtert. Dazu gehören auch die angesehenen »öffentlichen Intellektuellen« und die Begründer der zeitgenössischen akademischen Sozialwissenschaften, die die »verantwortlichen Männer« der Gesellschaft dazu aufforderten, die »Unwissenheit und Dummheit [der] … Massen« zur Kenntnis zu nehmen und nicht dem »demokratischen Dogmatismus zu erliegen, wonach die Bürger die besten Verwalter ihrer eigenen Interessen sind« (Walter Lippmann, Harold Lasswell). Die Öffentlichkeit, bei der es sich lediglich um »unwissende und lästige Außenstehende« handelt, darf sich nicht in die Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten einmischen; zu ihrem eigenen Wohl muss sie sich auf ihre »Funktion« als »interessierter Zuschauer des Geschehens« beschränken. Sie darf nicht als »Teilnehmerin« mitwirken, wenngleich es ihr gestattet sein mag, in regelmäßigen Abständen unter den »verantwortlichen Männern« zu wählen, deren Aufgabe es ist, die Dinge zu analysieren, zu entscheiden und zu regieren. Wie William Shepard in seiner Präsidentschaftsrede vor der American Political Science Association im Jahr 1934 erklärte, sollte die Regierung in Händen einer »Aristokratie des Intellekts und der Macht« liegen und nicht von »den Ungebildeten, den Uninformierten und den antisozialen Elementen« geleitet werden. »Die Öffentlichkeit muss in ihre Schranken verwiesen werden«, mahnte Lippmann, damit die »verantwortlichen Männer« »ungestört vom Getrampel und Gebrüll der aufgebrachten Herde« ihrer für das Gemeinwohl erforderlichen Arbeit nachgehen können.
Freilich bleibt hier eine Prämisse unausgesprochen: Die »verantwortlichen Männer« erlangen ihren herausragenden Status dadurch, dass sie den Interessen derer dienen, denen die Gesellschaft wirklich gehört und die sie regieren. Es lag nicht an einem niedrigen IQ, dass die führende Gestalt der amerikanischen Arbeiterbewegung, Eugene Debs, im Gefängnis saß, während diese Überlegungen in den ideologischen Institutionen Ansehen und Bedeutung erlangten.
Das Spektrum der »Aristokraten« reicht von den liberalen und progressiven Denkern bis hin zu jenen, die in ihrer Verachtung des Pöbels noch extremer sind. Typische Beispiele sind die reaktionären Statisten der Reagan-Variante, die im heutigen Neusprech absurderweise »Konservative« genannt werden. Sie sind nicht bereit, der Öffentlichkeit auch nur die Rolle eines »interessierten Beobachters des Geschehens« zuzugestehen, und bevorzugen geheime Operationen – geheim vor niemandem außer der heimischen Öffentlichkeit – und eine strengere Zensur, um den mächtigen Staat zu schützen, den sie als Wohlfahrtsstaat für die Reichen pflegen. Ferner streben sie natürlich nach mehr Macht in den Händen des geschützten und öffentlich subventionierten »Privatsektors«, der praktisch im Verborgenen operiert. Eine andere Version derselben Grundlehre ist die leninistische Variante des Marxismus, die auf der Überzeugung beruht, dass die dummen und unwissenden Massen in eine »Arbeitsarmee« verwandelt werden müssen, die den revolutionären Intellektuellen untergeordnet ist, die sie in die von ihren Führern geplante Zukunft führen werden – wie immer im Interesse der tumben Herde.
Dafür zu sorgen, dass die »unwissenden und lästigen Außenstehenden« die richtigen Überzeugungen haben, ist zu einer Aufgabe von zunehmender Bedeutung geworden, da ihre Kämpfe die Reichweite der demokratischen Institutionen nach und nach erweitert haben. Das Grundproblem dabei beschäftigte schon David Hume, der in seinen First Principles of Government seine Verwunderung kundtat über »die Leichtigkeit, mit der die Vielen von den Wenigen regiert werden«, über die »die stillschweigende Unterwerfung, mit der die Menschen ihre eigenen Gefühle und Leidenschaften denen ihrer Herrscher unterordnen.« »Wenn wir uns fragen, wie dieses Wunder zustande kommt«, so Hume, »stellen wir fest, dass sich die Macht stets auf der Seite der Beherrschten findet und den Regierenden nichts weiter zu Gebote steht als ihre Überzeugungen. Die Regierung beruht also nur auf Überzeugungen, und dieser Grundsatz gilt sowohl für die despotischsten und militärischsten Regierungen als auch für die freiesten und populärsten.«
Hume hat die Fähigkeit der Mächtigen, den Pöbel mit Gewalt unter Kontrolle zu halten, gewaltig unterschätzt. – Eine Lektion, die stets aufs Neue und auf schreckliche Art und Weise erteilt wird. Wenngleich sie der Öffentlichkeit in der Regel vorenthalten bleibt. Es sei denn, es gibt ein gewisses Machtinteresse, dem durch das Lamentieren über sorgfältig ausgewählte böse Taten gedient werden kann. Dieses Thema wurde auf einer wichtigen Konferenz behandelt, die von Jesuiten und Laienmitarbeitern im Januar 1994 in San Salvador veranstaltet wurde und über die in den USA nicht berichtet wurde. Bei ihren Überlegungen zu den Folgen der jüngsten staatsterroristischen Projekte – die Washington in seinen zentralamerikanischen Einflussgebieten organisiert und durchgeführt hatte –, wobei die Kirche ein Hauptziel war, stellten sie insbesondere fest, »wie stark die Kultur des Terrors die Erwartungen der Mehrheit gegenüber Alternativen dämpft, die sich von denen der Mächtigen unterscheiden …« Die Zerstörung der Hoffnung, so erkannten sie, ist eine der großen Errungenschaften der Doktrin der Freien Welt, die als »Konflikt niedriger Intensität« bezeichnet wird. – Und der »Terror« genannt wird, wenn er von offiziellen Feinden ausgeübt wird.
Nichtsdestotrotz ist Humes Grundaussage durchaus zutreffend, und angesichts des Rückgangs herkömmlicher Mittel zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Verwaltung des öffentlichen Raums ist sie von besonderer Bedeutung.
Die Untersuchungen von Alex Carey entschlüsseln die Geschichte, wie sie sich im Laufe des 20. Jahrhunderts entfaltet hat, in mannigfaltiger Hinsicht: Werbung, die sich der Schaffung künstlicher Bedürfnisse verschrieben hat; die riesige PR-Industrie – deren Ziel es ist, die Aufmerksamkeit auf sinnlose Beschäftigungen zu lenken und das »öffentliche Bewusstsein« zu kontrollieren; akademische Einrichtungen und Berufe, die heute erneut dem Angriff privater Macht ausgesetzt sind, die entschlossen ist, das Spektrum des Denkbaren und Sagbaren noch weiter einzuschränken; die zunehmend konzentrierten Medien, in denen – wie ein führender akademischer Medienwissenschaftler vor einigen Jahren schrieb – »das Tabu gegen Kritik am gegenwärtigen Unternehmenssystem auf unausgesprochene Weise nahezu ebenso umfassend ist … wie in der Sowjetunion die Kritik am Kommunismus ausdrücklich verboten ist« (Ben Bagdikian).
Bereits vor geraumer Zeit wurde das »öffentliche Bewusstsein« von Unternehmensführern als »einzige ernsthafte Gefahr« für ihre Firmen erkannt und als die größte »Gefahr für die Industrie«; und zwar zusammen mit der »neu entdeckten politischen Macht der Massen«, die es zurückzudrängen galt. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts war es keine einfache Aufgabe, den Menschen kapitalistische Werte aufzuzwingen, die ganz anderen Vorstellungen von einem menschenwürdigen Dasein entsprachen – Vorstellungen, die in der lebendigen Arbeiterpresse ebenso ihren Niederschlag fanden wie im klassischen liberalen Denken, das längst verworfen und vergessen ist. In den Anfängen des Industriekapitalismus, als das System der Lohnarbeit durchgesetzt wurde, verurteilte die unabhängige Presse die »Erniedrigung und den Verlust jener Selbstachtung, die die Handwerker und Arbeiter zum Stolz der Welt gemacht hatte«. Freie Menschen waren jetzt gezwungen, sich selbst zu verkaufen und nicht das, was sie produzierten. Sie wurden zu »Knechten« und »demütigen Untertanen« von »Despoten«. Die Autoren jener Zeit beschrieben die Zerstörung des »Geistes freier Einrichtungen«. Wobei die Werktätigen auf einen »Zustand der Knechtschaft« reduziert wurden, aus dem heraus sie »eine Geldaristokratie wie eine bedrohliche Lawine über unseren Köpfen erkennen, die jedem Menschen, der es wagt, ihr Recht zu hinterfragen, die Armen und Unglücklichen zu versklaven und zu unterdrücken, die Vernichtung androht.« »Sie, die in den Fabriken arbeiten, sollten sie auch besitzen« und so »den zerstörerischen Einfluss monarchischer Prinzipien auf demokratischem Boden« überwinden, erklärten die Arbeiter in den Betrieben Neuenglands, lange bevor radikale Intellektuelle auf den Plan traten und erkannten, dass innerhalb der neu entstehenden »Industriebevölkerung« die »Tendenz auf der Skala von Zivilisation, Gesundheit, Moral und Intellektualität eindeutig nach unten weist«. Derartige Äußerungen blieben bei den Sklavenhaltern des Südens nicht unbemerkt, die damit ihre paternalistischen Ausbeutungspraktiken als solche von Herren verteidigten, für die Menschen zumindest noch als zu bewahrendes Kapital galten.
Vor siebzig Jahren stellte Norman Ware in seiner klassischen Studie über die amerikanische Arbeiterschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts fest, dass die Durchsetzung des industriellen Kapitalismus und seiner Werte »für einen überraschend großen Teil der früheren amerikanischen Gesellschaft ein Gräuel war«. Der Hauptgrund waren »der Niedergang des gewerbsmäßigen Arbeiters als Person«, die »Entwürdigung« und »psychologische Veränderung«, die aus dem »Verlust von Würde und Unabhängigkeit« sowie von demokratischen Rechten und Freiheiten resultierten. Innerhalb der Arbeiterliteratur fanden diese Reaktionen lebhaften Ausdruck, häufig seitens der Frauen, die trotz ihrer untergeordneten Stellung in der Gesamtgesellschaft eine herausragende Rolle spielten.
»Für die Arbeiter«, so der Historiker David Montgomery, der sich auf die Geschichte der Arbeiterbewegung spezialisiert hat, »war der wichtigste Teil von Jeffersons Vermächtnis der Schutz, den es der Vereinigungsfreiheit, der Glaubensvielfalt und Handlungsfreiheit sowie dem Widerstand gegen vermeintliche Vorgesetzte in der Gesellschaft gewährte.« Die Strukturen der Zivilgesellschaft »standen der unternehmerischen Kontrolle des Lebens in den USA auf Schritt und Tritt im Wege« und mussten daher zerstört werden. Daher die unablässigen Bemühungen, die unabhängige Presse und wirksame Formen der Gemeinschaftssolidarität, von den Gewerkschaften bis hin zu politischen Vereinen und Organisationen, zu zerschlagen. Im Vergleich zu anderen Industriegesellschaften ist die Geschichte der US-amerikanischen Arbeiterbewegung ungewöhnlich gewalttätig. Und erst während der Großen Depression wurden elementare Rechte erkämpft, die bald darauf wieder verloren gingen, was zum Teil auf die von Carey beschriebenen massiven Propagandakampagnen zurückzuführen ist. Diese setzen sich bis heute fort, mit den »konzertierten Anstrengungen« der amerikanischen Geschäftswelt, deren Ziel das Wall Street Journal enthusiastisch dahingehend beschreibt, »die Einstellungen und Werte der Arbeitnehmer zu verändern« – und zwar mit einer Vielzahl von Indoktrinations- und Verdummungsmethoden, die darauf abzielen, »die Apathie der Arbeitnehmer in Loyalität gegenüber dem Unternehmen zu verwandeln«.
Was die Gewerkschaften anbelangt, so ist das bevorzugte Druckmittel der letzten Jahre die Unternehmenskriminalität. In einem Rückblick auf einige der Methoden, die von den »Konservativen« der Reagan-Ära gefördert wurden, berichtet Business Week 1994: »In den letzten zwölf Jahren hat die US-Industrie einen der erfolgreichsten gewerkschaftsfeindlichen Kriege aller Zeiten geführt und Tausende von Arbeitnehmern illegal entlassen, weil sie ihr Recht auf gewerkschaftliche Organisierung wahrgenommen haben.« In den späten 80er-Jahren war ein Drittel aller Gewerkschaftswahlen mit illegalen Entlassungen verbunden, gegenüber 8 % in den späten 60er-Jahren. Kriminelle Handlungen lohnen sich, vor allem, wenn die Staatsmacht dahintersteht. Die unabhängige Presse, die sich in den USA bis zum Zweiten Weltkrieg und in Großbritannien noch dreißig weitere Jahre halten konnte, unterlag schließlich der Konzentration der Kapitalressourcen auf dem »freien Markt«, womit die lebendige Kultur der Arbeiterklasse, die insbesondere unter der fortschrittlichen Wilson-Regierung beträchtliche Repressionen überstanden hatte, eine wichtige Grundlage verlor.
In der Dritten Welt wurden eher direkte Mittel eingesetzt, um die hochgesteckten Erwartungen der nach Freiheit strebenden Menschen zu »zähmen«. Und dies geschah selbst in solchen Ländern mit beachtlichem Erfolg, in denen einst eine demokratische Kultur blühte. Chile ist ein wichtiges Beispiel. Die von den USA unterstützte Militärdiktatur und die anschließende »Aufsplitterung der Oppositionsgruppen« habe Chile – wie die Lateinamerikanistin Cathy Schneider bemerkt – sowohl kulturell als auch politisch von einem Land aktiver, partizipativer Basisgemeinschaften in ein Land isolierter, unpolitischer Individuen verwandelt. Damit wurde genau das Ergebnis erzielt, auf das die immensen Ressourcen der ideologischen Einrichtungen dort hingearbeitet hatten, wo Gewaltmittel nicht ohne Weiteres zur Verfügung standen.
Die Auswirkungen der umfassenden Kampagnen ideologischer Kriegsführung sind mitunter recht komplex. Die Debatte Ende 1993 über das NAFTA-Abkommen – eines jener Abkommen, die fälschlicherweise als »Freihandelsabkommen« bezeichnet werden – war in dieser Hinsicht lehrreich. Man war davon ausgegangen, dass das Abkommen problemlos verabschiedet werden würde. Doch es regte sich öffentlicher Widerstand. Ein Großteil davon wurde von der ansonsten eher stillen Gewerkschaftsbewegung organisiert, die konstruktive Alternativen vorschlug. Dies taten auch das Büro für Technikfolgenabschätzung des Kongresses und andere Organisationen. Sie alle wurden zugunsten der Kurzversion von NAFTA ignoriert, das mit Bedacht als ein Abkommen über Investorenrechte konzipiert worden war. Die unerwartete Reaktion der Öffentlichkeit löste eine ungewöhnlich fanatische Propagandakampagne aus. Die Medien, die NAFTA gemeinsam mit der Wirtschaft im Allgemeinen zu fast 100 Prozent unterstützten, folgten dem Präsidenten, als er die »wirklich ruppigen, robusten Taktiken« der organisierten Arbeiterschaft anprangerte: »die harten Bandagen, den brutalen Druck, den die Arbeiterschaft ausübte«. Dabei ging er sogar so weit, dass er »Bitten … auf der Basis von Freundschaft« und »Drohungen … in Bezug auf Geld und Arbeit im Wahlkampf« aussprach, sollten sie sich an ihre gewählten Vertreter wenden. – Ein schockierender Eingriff in den demokratischen Prozess. In den Schlagzeilen rief der Präsident den Kongress dazu auf, »sich der unnachgiebigen Politik« der »mächtigen Arbeitnehmerinteressen« zu widersetzen. Am äußersten linken Rand des akzeptierten Meinungsspektrums wetterte Anthony Lewis, Kolumnist der New York Times, gegen die »rückständige, unaufgeklärte« Arbeiterbewegung, die mit »plumpen Drohungen« versuche, den Kongress zu beeinflussen. Die Versuche der arbeitenden Bevölkerung, sich an ihre gewählten Vertreter zu wenden, lösten quer durch das Spektrum eine regelrechte Hysterie aus. Der Lobbyismus der Unternehmen, der die bescheidenen Kapazitäten der Gewerkschaften überforderte, blieb praktisch unbemerkt. Und das ist nur folgerichtig, wenn man davon ausgeht, dass die Rolle des Staates darin besteht, den Herren zu dienen. Die Tatsachen lagen derart offensichtlich auf der Hand, dass sich die New York Times nach der Abstimmung sogar den üblicherweise verbotenen Ausdruck »Klassenlinien« erlaubte, um den »hässlichen« und »spaltenden Kampf« um NAFTA zu beschreiben, der nun glücklicherweise beendet ist.
Die heftigen Anschuldigungen gegen die Gewerkschaften hatten einen merkwürdigen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Überraschenderweise waren die meisten Menschen weiterhin gegen die Kurzversion von NAFTA, auf die sich die Überlegungen der ideologischen Institutionen beschränkten. Spätere Umfragen zeigten jedoch, dass etwa zwei Drittel der Befragten die Gewerkschaften kritisierten, weil sie sich unverhältnismäßig stark gegen Veränderungen wehrten und »zu sehr in die Politik involviert« seien, insbesondere in der NAFTA-Frage. Offensichtlich hat die Propagandaschlacht die Meinungen über NAFTA relativ unverändert gelassen, während sich die Menschen gegen die wichtigsten populären Kräfte wandten, die diese Meinungen vertraten und versuchten, sie in der politischen Arena zu verteidigen. Eine genauere Analyse deutet auf weitere Modifikationen von Humes Maxime hin. Wie unter den »despotischsten und militaristischsten Regierungen« ist die Kontrolle der öffentlichen Meinung nicht so wichtig, solange andere Mittel zur Verfügung stehen, um sicherzustellen, dass die Menschen »demütig genug sind, sich der Herrschaft der Herren zu unterwerfen.«
Veränderungen in der Weltordnung bieten neue Möglichkeiten, die von den liberalen Eliten wahrgenommene »Krise der Demokratie« in den Griff zu bekommen, während die Öffentlichkeit versucht, der ihr zugewiesenen Zuschauerrolle zu entkommen. Der enorme Machtzuwachs des Finanzkapitals seit den frühen 1970er-Jahren und die beschleunigte Globalisierung der Wirtschaft haben eine noch nie dagewesene Macht in die Hände zunehmend konzentrierter und praktisch nicht rechenschaftspflichtiger privater und transnationaler Machtinstitutionen gelegt, die zentral gesteuerte Planungen und Transaktionen (von denen viele fälschlicherweise als »Handel« bezeichnet werden) jenseits öffentlicher Kontrolle oder Einmischung durchführen. Wie bereits in früheren Epochen gruppieren sich die Entscheidungsstrukturen um die Zentren der realen Macht und führen zu dem, was die internationale Wirtschaftspresse als »de-facto-Weltregierung« bezeichnet: IWF, Weltbank, GATT und die neue Welthandelsorganisation, die Exekutivgewalt der G-7 und der Europäischen Union und so weiter. Diese Prozesse haben viele erwünschte Effekte. Sie schützen Reichtum und Privilegien sowohl vor der Marktdisziplin als auch vor öffentlichen Eingriffen. Und sie tendieren naturgemäß dazu, die Polarisierung der Weltgesellschaft zu verstärken, da sich das strikt zweigeteilte Modell der Dritten Welt mit Sektoren großen Reichtums inmitten wachsender Armut und Verzweiflung zunehmend auch auf die reicheren Gesellschaften ausweitet, wobei die Vereinigten Staaten und Großbritannien den Weg weisen.
Aber auch diese Entwicklungen sind nicht unproblematisch. Es wird keine leichte Aufgabe sein, die wachsende Anzahl von Menschen zu kontrollieren, die für die Profitmacherei überflüssig sind und daher keine Rechte haben, die den zu etablierenden Wertesystemen entsprechen. Die Probleme sind Variationen bekannter Probleme; und die Mittel, die den »Herren der Menschheit« zur Verfügung stehen, sind ebenfalls Variationen der alten. Ebenso altehrwürdig ist allerdings auch die Notwendigkeit für die Menschen, den Schleier der Täuschung und der aufgezwungenen Unwissenheit beiseite zu schieben und den endlosen Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit fortzusetzen. Zu diesem Anliegen leistet das Werk von Alex Carey einen einzigartigen und gewichtigen Beitrag.
Noam Chomsky, 17. August 1994
Danksagungen
Ich möchte Alex Careys Frau, Joan Carey, und seinen Töchtern, Cathy Carey und Gabrielle Carey, für ihre Ermutigung und Unterstützung bei diesem Projekt danken.
Die in diesem Buch enthaltenen Aufsätze, ob bereits veröffentlicht oder nicht, wurden neu betitelt und in einem einheitlichen Stil bearbeitet. Sie stammen aus folgenden Quellen:
Kapitel 1: »The Origins of Contemporary America«, unveröffentlichtes Manuskript.
Kapitel 2 und 6: »Managing Public Opinion: The Corporate Offensive«, in S. Frenkel (Hg.), Union Strategy and Industrial Change, NSW University Press, Sydney, 1978.
Kapitel 3: »The First Americanization Movement: 1912–1916, unveröffentlichtes Manuskript.
Kapitel 4: »Origins of the Vietnam War III: The McCarthy Era«, unveröffentlichtes Manuskript.
Kapitel 5: »Reshaping the Truth: Pragmatists V Propagandists in America«, Meanjin Quarterly, vol. 35, no. 4, 1976.
Kapitel 7: »Capitalist Corporations and the Management of Democracy«, unveröffentlichtes Manuskript.
Kapitel 8: »Propaganda in the Nuclear Age: Democracy and Beyond 1984«, veröffentlicht in einer Sammlung von Konferenzbeiträgen, Imagining the Real, Australian Broadcasting Corporation, July 1988.
Kapitel 9: »Social Science, Propaganda and Democracy«, in p. Boreham & G. Dow (Hg.), Work and Inequality: The Impact of Capitalist Crisis on Work Experience and the Labour Process, Macmillan, Melbourne, 1980.
Kapitel 10: »Industrial Psychology and Sociology in Australia«, in P. Boreham, A. Pemberton, p. Wilson (Hg.), The Professions in Australia? A Critical Appraisal, University of Queensland Press, Brisbane, 1976.
Kapitel 11: »The Hawthorn Studies; A Radical Criticism«, American Sociological Review, vol. 32, no. 3, June 1967.
Vorwort zur Deutschen Ausgabe
Von Jonas Tögel
Um die Bedeutung des australischen Psychologen und Propagandaforschers Alex Carey zu verstehen, lohnt es sich, einen Blick in das Standardwerk Die Konsensfabrik von Noam Chomsky und Edward Herman zu werfen. Dieses ist dem amerikanischen Soziologen Herbert Schiller gewidmet – und Alex Carey. Im Vorwort von Demokratie ohne Risiko stellt Chomsky nochmals klar, warum er für seinen guten Freund Carey und seine Arbeit so eine große Wertschätzung hegt: Carey habe eine »herausragende Arbeit« (S. 9) geleistet bei der Offenlegung einer »von Propaganda gesteuerten Demokratie« (ebd.). Demokratie selbst, so Chomsky, sei von den »Herren der Menschheit« (S. 20) immer zutiefst gefürchtet worden, und sie wurde auf besonders geschickte sowie hinterhältige Art und Weise durch eine gezielte Steuerung des »öffentlichen Bewusstseins« (S. 14) unterlaufen. Und es ist ein großer Verdienst Careys, dass er diese oft verdeckt ablaufenden Steuerungstechniken seitens Regierung und vor allem von Wirtschaftslobbyverbänden offenlege und so helfe, den Schleier der Täuschung zu lüften, und so einen unschätzbaren Verdienst für den emanzipatorischen Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit leiste.
Auch der bekannte, australische Journalist John Pilger hatte nur Lob für das Schaffen seines Landsmannes übrig und bezeichnete ihn gar wegen seiner vorausschauenden Warnungen als einen »zweiten Orwell«1.
Diese Lobeshymnen mögen zunächst überraschen, denn wer sich nicht ausführlich mit Propaganda beschäftigt, dem ist der Name Alex Carey in den seltensten Fällen ein Begriff, ganz im Gegensatz zum berühmten Noam Chomsky oder John Pilger.
Das ist jedoch ein sehr bedauerlicher Zustand, denn wie bedeutend Carey und sein Schaffen jedoch tatsächlich sind, das wird einerseits deutlich, wenn man das Leben das Australiers betrachtet, und andererseits, wenn man auf sein unglaublich wertvolles, wissenschaftliches Werk blickt. Beides soll in diesem Vorwort in aller Kürze geschehen.
Der in bäuerlichen Verhältnissen aufgewachsene Carey kam erst spät zu einer universitären Karriere, und er behielt zeit seines Lebens einen erfrischenden und im positiven Sinne unakademischen Blick auf das politische und wissenschaftliche Zeitgeschehen. So war sein Leben geprägt von einem leidenschaftlichen Engagement für Frieden, Freiheit und Bürger- sowie Arbeiterrechte. Dieses zeigte sich nicht nur in seinen scharfsinnigen, intellektuellen Analysen, sondern auch seinem Engagement außerhalb der akademischen Welt: Als erbitterter Gegner des Vietnamkrieges nahm er an zahlreichen Friedensdemonstrationen teil, und als engagierter Bürgerrechtler war er Gründungsmitglied der Australian Humanist Society 1960 und wirkte bei der Gründung des Australian Council for Civil Liberties mit (vgl. S. 40).
Es wäre sicherlich lohnenswert, genauer zu untersuchen, ob die langen Jahre von handfester, »ehrlicher« Arbeit auf dem elterlichen Bauernhof zu seinem klaren Blick auf Machtstrukturen und allerlei akademische Täuschungsmanöver beitrugen. Sicher ist, dass bei der Lektüre von Demokratie ohne Risiko an vielen Stellen Careys Engagement für die Arbeitnehmerschicht, dem »common man«, durchschlägt, deren Kampf für gerechtere Löhne und Mitspracherecht im Laufe der letzten 120 Jahre immer wieder durch intensive Unternehmenspropaganda erschwert wurde – wie das Buch eindrucksvoll aufzeigt.
Neben diesem Blick auf die persönlichen Triebfedern wird Careys Bedeutung für heute vor allem dann deutlich, wenn man sein intellektuelles (Lebens-)Werk studiert, wozu an erster Stelle das Buch Demokratie ohne Risiko gehört.
Es wurde nach Careys überraschendem Tod 1987 aus einer Auswahl seiner unveröffentlichten Manuskripte mit Hilfe seiner Familie zusammengestellt und erschien 1995. Das ist heute dreißig Jahre her, viele seiner Schriften sind älter als vierzig Jahre. Dadurch könnte man meinen, es handle sich um veraltete Analysen eines lange verstorbenen Autors. Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall: Um die aktuelle Lage der Welt, um die von Rainer Mausfeld so treffend als »Pleonexie« bezeichnete Tendenz einer immer größeren Macht- und Reichtumskonzentration in den Händen einer immer kleineren Gruppe von Menschen und um das weitgehende Fehlen von Widerstand seitens weiter Teile der Bevölkerung gegen diese Zustände zu verstehen, braucht es einen detaillierten Blick zurück in die Geschichte.
Demokratie ohne Risiko bietet einen solchen Blick zurück und zeichnet die Geschichte der Propaganda detailreich, faktenbasiert und mit für heute hochspannenden und relevanten Erkenntnissen nach.
»Das zwanzigste Jahrhundert ist durch drei Entwicklungen von großer politischer Tragweite gekennzeichnet: das Wachstum der Demokratie, das Wachstum der Konzernmacht und das Wachstum der Konzernpropaganda als Mittel zum Schutz der Konzernmacht vor der Demokratie.« (S. 58)
Die Analysen des Buches fokussieren auf einen Teilaspekt moderner Propaganda (Wirtschaftspropaganda). Es lohnt daher, den Blick zu weiten und zunächst den Beginn moderner Propaganda insgesamt zu skizzieren. Ihre Anfänge können dabei auf den Beginn des 20. Jahrhunderts datiert werden, und sie sind in meinem Buch »Kognitive Kriegsführung« ausführlich dargestellt. An dieser Stelle soll ein kurzer Einblick genügen. Er hilft dabei, Careys Werk als ein Puzzlestück in den Gesamtkontext der (historischen) Propagandaforschung einzuordnen.
Damals trat der grundlegende Interessenskonflikt zwischen dem »common man« (S. 48) und großen Unternehmen (S. 58) sowie deren reichen Besitzern noch offen zutage. Besonders reiche Besitzer großer Unternehmen, Banken oder Betriebe wie Vanderbuild, Astor oder Rockefeller waren damals im Volksmund, ehrlicherweise, als Räuberbarone (»Robber Barons«)2 bekannt, denen auch durch eine kritische Presse vorgeworfen wurde, sich »zu Lasten der übrigen Gesellschaft persönlich zu bereichern«.3 Ein besonders bekanntes Beispiel dafür ist der Streik der Minenarbeiter von John D. Rockefeller Juniors Colorado Fuel & Iron Corporation von 1913 bis 1914. Die Forderung der Minenarbeiter nach einer Gewerkschaft wurde von dem »Räuberbaron« Rockefeller mit aller Gewalt bekämpft und ein Lager von Tausenden Streikenden in Ludlow am 20. April 1914 von der Nationalgarde unter Maschinengewehrfeuer genommen. Dutzende Frauen und Kinder starben, und das Ereignis wurde als »Massaker von Ludlow« landesweit bekannt. Es sorgte nicht nur für große Empörung gegenüber einem der reichsten Männer der damaligen Zeit, sondern es kann auch als die Geburtsstunde moderner Wirtschaftspropaganda angesehen werden. Rockefeller schaffte es durch eine geschickte PR-Kampagne mit Unterstützung eines der Pioniere moderner Propaganda, Ivy Lee, seinen Ruf von einem »Räuberbaron« in einen »Philanthropen« zu verändern – und bis heute ist er als solcher auf Wikipedia aufgeführt.
Nur kurze Zeit nach dem Massaker von Ludlow wurde 1917 unter Präsident Wilson der sogenannte »Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit« gegründet (Committee on Public Information), der bis 1919 eine intensive Kriegspropaganda betrieb, um die Kriegsbereitschaft der US-amerikanischen Bevölkerung sicherzustellen.
Eines der Mitglieder dieses Propagandakomitees ist Edward Bernays, der Neffe von Sigmund Freud. Er ist neben Ivy Lee einer der einflussreichsten und bekanntesten Pioniere moderner Propaganda und führte die sehr erfolgreichen Propagandatechniken des Ersten Weltkriegs als Wirtschaftspropaganda in den 1920er-Jahren landesweit fort: »Als ich erkannte, was in der Welt los war, und gesehen hatte, welch mächtige Waffen Ideen sein konnten, beschloss ich, mal zu sehen, ob wir nicht das, was ich im Krieg gelernt hatte, in Friedenszeiten anwenden konnten«4, so Bernays über die Ursprünge moderner Propaganda.
Auch Alex Carey widmet sich in Demokratie ohne Risiko den Ursprüngen und der Geschichte der Wirtschaftspropaganda, er wählt jedoch andere Beispiele und fokussiert sich unter anderem auf die Tätigkeit des mächtigen Wirtschaftslobbyverbundes NAM (National Association of Manufacturers).
Diese kurze Einführung zu ihren Ursprüngen ist sehr wichtig, wenn es darum geht, die große Bedeutung von Demokratie ohne Risiko zu verstehen: Wie ein Detektiv, welcher den Propagandisten auf die Schliche kommen möchte, setzt Carey in seinem Buch an der historischen Wurzel moderner Propaganda an. Sein Augenmerk liegt hier weniger auf der Kriegspropaganda, die er nur kurz streift, sondern, wie bereits erwähnt, auf der Wirtschaftspropaganda. Im Ersten Weltkrieg sei Propaganda »zu einer Wissenschaft und zu einem Beruf« (S. 63) geworden, erkennt Carey richtig.
Er unterscheidet bei seiner detaillierten Analyse von Wirtschaftspropaganda zwischen jener, »die nach außen gerichtet ist«, sowie jener, »die nach innen gerichtet ist« (S. 49). Mit ersterem ist die Propaganda gemeint, welche bei der breiten Bevölkerung eine Zustimmung zu dem amerikanischen Wirtschaftssystem sicherstellen möchte und Gewerkschaften als »die einzigen Instanzen, die in der Lage sind, die vollständige Beherrschung der Gesellschaft durch die Konzerne zu verhindern« mit »Tyrannei, Unterdrückung und sogar Umsturz« (S. 58) bekämpft. Letztere nimmt die Arbeitnehmerschaft selbst ins Visier mit dem Ziel, ihre Loyalität gegenüber den Gewerkschaften zu schwächen und gegenüber dem Unternehmen zu stärken.
Diese Unterscheidung hilft nicht nur, den Blick auf Wirtschaftspropaganda zu schärfen, sie führt auch das Ausmaß vor Augen, mit dem seit ca. 100 Jahren erfolgreich die gesamte amerikanische Gesellschaft beeinflusst wird. Die PR-Anstrengungen hätten einen »riesigen Komplex von Institutionen ins Leben gerufen, die sich auf Propaganda und die damit verbundene sozialwissenschaftliche Forschung spezialisiert haben«, geführt (S. 59), dessen einziger Zweck es sei, »die öffentliche Meinung zu überwachen und sie innerhalb der ideologischen Grenzen zu lenken, die für die amerikanische Wirtschaft akzeptabel sind« (S. 59).
Immer wieder beschreibt Carey mit deutlichen Worten das schier unvorstellbare Ausmaß an Massenmanipulation, das seither entstanden ist und sich oft einfacher, aber dafür umso wirksamerer Rahmenerzählungen von »gut« gegen »böse«, »heilig« gegen »teuflisch« und »frei« gegen »unfrei« bedient:
»Der erfolgreiche Einsatz von Propaganda als Mittel der sozialen Kontrolle erfordert somit eine Reihe von Voraussetzungen: den Willen, sie einzusetzen; die Kompetenz, Propaganda zu produzieren; die Mittel, sie zu verbreiten; und schließlich die Verwendung ›signifikanter Symbole‹: Symbole denen tatsächliche Macht über emotionale Reaktionen zukommt – idealerweise Symbole des Heiligen und Satanischen. Seit langem schon verfügen die USA über alle diese Voraussetzungen in größerem Maße als jedes andere westliche Land. Ich werde jede dieser Voraussetzungen der Reihe nach erörtern.« (S. 49)
Eine der Haupttechniken ist es laut Carey, Kommunismus oder Sozialismus als das mit dem amerikanischen Kapitalismus konkurrierende System als »die überzogene negative Idealisierung des Bösen, säkularisiert im Kommunismus/Sozialismus als etwas sui generis, an allen Orten und zu allen Zeiten Böses, Schlechtes, Unterdrückerisches, Betrügerisches und Zerstörerisches gegenüber allen zivilisierten und humanen Werten« (S. 55) darzustellen. Demgegenüber seien der American Way of Live und der Spirit von Amerika zu einem Symbol »der irrationalen Kraft des Heiligen« geworden (S. 55). Diese Aussagen lassen sich nochmals besser verstehen, wenn man bedenkt, dass Carey Analysen zu Zeiten des Kalten Krieges geschrieben wurden, während dem die beiden konkurrierenden Wirtschaftssysteme zu einem Kampf der Weltsichten und Ideologien schlechthin wurden.
Solche weitreichenden Aussagen muten zunächst vielleicht etwas weit hergeholt an, und man könnte geneigt sein, dem Autor eine Übertreibung oder Dramatisierung zu unterstellen. Hier zeigt sich jedoch der unschätzbare Wert der Arbeit des australischen Propagandaforschers: Minutiös und detektivisch lässt er solch weitreichenden Aussagen eine solche Fülle an Fakten und Belegen folgen, dass es manchmal schwerfällt, nicht von ihrer Fülle überwältigt zu werden. Seine gut dokumentierten Beispiele sind auch heute noch von unschätzbarem Wert: Von der Inszenierung des amerikanischen Independence Day, der zunächst Amerikanisierungstag hieß (1917), als Businesspropaganda im Kampf um die Köpfe und Herzen der Einwanderer über die Mohawk-Valley-Formel zur gezielten Zersetzung von Streiks (1936) bis hin zur Gründung zahlreicher Denkfabriken, um den intellektuellen Diskurs zu dominieren (ab den 1970er-Jahren) – Careys Werk will nicht nur gelesen, es will genau studiert werden, um aus dem reichen Erfahrungsschatz emanzipatorischer (Propaganda-) Analysen auch heute noch profitieren zu können.
Paradoxerweise ist es wohl auch einer erfolgreichen Wirtschaftspropaganda zu verdanken, dass wir heute so wenig über ihr Wirken während der letzten hundert Jahre wissen: »Man kann argumentieren, dass der Erfolg der Unternehmenspropaganda, uns über einen langen Zeitraum hinweg davon zu überzeugen, dass wir frei von Propaganda sind, eine der bedeutendsten Propagandaleistungen des zwanzigsten Jahrhunderts ist.« (S. 62)
Dem setzt der Australier eine so umfassende und vielschichtige Analyse von (amerikanischer) Unternehmenspropaganda vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 1980er-Jahre entgegen, dass es unmöglich scheint, die Bedeutung von Demokratie ohne Risiko in einem Vorwort umfassend zu würdigen.
Neben der oftmals schwer zu durchschauenden Propaganda von Unternehmen geht Carey auch auf deren allumfassende Bestrebungen ein, um die Bildung von Schulen bis hin zu Universitäten im Sinne der eigenen Interessen zu beeinflussen. Dabei lässt er es sich nicht nehmen, auch Klassiker der psychologischen Forschung, wie die Hawthorne-Studien zu effizienter Mitarbeiterführung (ab 1927), die er einer ausführlichen Kritik unterzieht, oder die Studien von Lewin, Lippitt und White (1939) zur Wirksamkeit einzelner Führungsstile, als in seinen Augen von wirtschaftlichen Interessen durchtränkt zu sein. »Wie kommt es, dass fast alle Autoren von Lehrbüchern, die sich auf die Hawthorne-Studien gestützt haben, die große Diskrepanz zwischen den Belegen und den Schlussfolgerungen in diesen Studien nicht wahrgenommen haben?«, fragt Carey (S. 313). Dies kann auch als Appell an die (psychologische) Forschung verstanden werden, eigene, für selbstverständlich angenommene Prämissen immer wieder ergebnisoffen zu hinterfragen.
Besonders hervorzuheben ist der scharfsinnige, oftmals unkonventionelle Denkstil des Autors, der sich sicherlich an dem eingangs erwähnten Lob Pilgers, er sei ein »zweiter Orwell«, gestoßen hätte:
»Orwell warnte davor, dass ein kruder und brutaler Totalitarismus aus dem linken Lager der Politik kommen und die liberal-demokratischen Freiheiten, von denen wir alle profitieren möchten, untergraben würde. Eine derartige Perspektive ist dabei lediglich ein Teil des Kommunismus-Wahns im zwanzigsten Jahrhundert; denn auch wenn die Freiheiten der liberalen Demokratie zweifellos bedroht sind, so ging die Gefahr doch stets von der »respektablen Rechten« aus. Sie kommt in der Gestalt einer weitverbreiteten sozialen und politischen Indoktrination daher, einer Indoktrination, die Unternehmensinteressen als die Interessen aller propagiert und dabei die Gemeinschaft fragmentiert und das individuelle und kritische Denken ausschließt.« (S. 224–225)
»Drei Jahre nach ›1984‹ liegt es meines Erachtens auf der Hand, dass George Orwells Warnungen vor künftigen Bedrohungen der liberalen Demokratien weitgehend, ja sogar in gefährlicher Weise, falsch verstanden wurden« (S. 232), so Carey in einer für ihn eigenen, scharfzüngigen und prägnanten Kritik an scheinbar etablierten Wahrheiten.
Carey gelingt es immer wieder, seine oft drastisch formulierte Kritik auf ein solides, wissenschaftliches Fundament zu stellen. Dies ist auch seiner ganzheitlichen Herangehensweise zu verdanken, die nicht vor den Schranken einer einzelnen Disziplin Halt macht. So betrachtet er Propaganda aus durchaus unterschiedlichen Perspektiven und lässt sowohl psychologische als auch soziologische und historische Forschungsansätze erkennen, die er ganz im Sinne seines humanistischen Anliegens gewinnbringend miteinander verknüpft.
Ebenso prägnant ist daher auch sein Appell für einen ganzheitlichen Forschungsstil, auch und vor allem bei der Offenlegung gefährlicher Propagandabestrebungen, welche die Grundwerte einer Demokratie oft geschickt aushebeln.
»Im 19. Jahrhundert beschrieb Matthew Arnold das Ziel der Literatur dahingehend, das Leben ›fortlaufend‹ und als ›Ganzes‹ zu erfassen. Im 20. Jahrhundert haben die Sozialwissenschaften diese traditionelle Rolle der Dichter und Schriftsteller als einflussreichste Quelle für Recherchen und Reflexionen über das menschliche Leben und seine Werte in Frage gestellt. Ich denke, dass die Macher unserer Sozialwissenschaften Arnolds Ziel weitgehend aufgegeben haben. Infolgedessen erleben wir alle die Welt heute unbeständiger, als uns lieb sein kann, und in einem doppelten Sinne unvollständiger und fragmentierter.
Ich würde behaupten, dass die Abkehr von einem ganzheitlichen Blick auf die Gesellschaft tiefergehend und gefährlicher ist als je zuvor.«
Wie eingangs bereits erwähnt, wäre es ein großer Fehler, Demokratie ohne Risiko mit Verweis auf das erstmalige Erscheinungsdatum als ein veraltetes und für heute nicht mehr relevantes Werk zu bezeichnen.
So wäre heute beispielsweise kritisch zu prüfen, inwieweit die Aussage, »dass die Sozialwissenschaftler in der US-Wirtschaft als ›Diener der Macht‹ fungierten und dass sie ›der Macht statt dem Geiste dienten‹«, (S. 253) auch heute noch zutrifft – und ob man sie sogar auf die verantwortlichen Wissenschaftler*innen staatlich geförderter, psychologischer Steuerungsprogramme wie dem seit 2008 weltweit eingesetzten »Nudging«5, an dem auch die deutsche Bundesregierung beteiligt ist,6 erweitern muss.
Die kluge Warnung von Carey, dass sich die wirtschaftliche Macht wirksam durch Propaganda tarnt und ihren eigenen Machtzuwachs damit nicht nur absichert, sondern auch verschleiert, ist heute von noch viel größerer Bedeutung als zu der Zeit, als Demokratie ohne Risiko erstmals erschien.
Zwei Studien, die inzwischen selbst schon wieder einer Aktualisierung bedürfen, machen die Aktualität von Careys Warnungen deutlich: So fand eine im Jahr 2011 an der ETH-Zürich publizierte Studie heraus, dass nur ca. 150 Unternehmen weite Teile der Weltwirtschaft kontrollieren,7 was auf eine unglaubliche Machtkonzentration hindeutet. Diese ist jedoch im öffentlichen Diskurs ein ebenso wenig breit diskutiertes Thema wie die Ergebnisse der als »Oligarchie-Studie« bekannten Publikation von zwei amerikanischen Wissenschaftlern aus dem Jahr 2014, die herausfand, dass die ärmeren 70 Prozent der Bevölkerung fast keinen Einfluss auf politische Entscheidungen mehr haben.8 In ihrer umfangreichen Studie untersuchten die Autoren fast 2000 politische Entscheidungen über mehrere Jahrzehnte hinweg (1981–2002) und kamen zu dem Schluss, dass sich die Wünsche der politischen Elite fast immer durchsetzen konnten. »Die USA sind eine Oligarchie, keine Demokratie«9, kommentierte die BBC damals ebenso nüchtern wie treffend.
Wer sich angesichts dieser Ergebnisse verwundert die Augen reibt und sich fragt, wie all das ohne großen Widerstand von weiten Teilen der Bevölkerung über so lange Zeit hin geschehen konnte, dem kann man Demokratie ohne Risiko wärmstens empfehlen. Alex Carey hat mit seinem Standardwerk wertvolle Vorarbeit geleistet, um zu verstehen, welchen Fiktionen wir heute oftmals folgen und wieso wir manchmal den Bezug zur Realität fast vollständig verlieren,10 wie der israelische Historiker Yuval Noah Harari kürzlich feststellte.
Es brauchte heute daher dringender denn je einen unverstellten Blick auf die gegenwärtigen Machtverhältnisse, eine genaue Analyse der Täuschungs- und Indoktrinationsmechanismen der Mächtigen sowie einen kritischen Blick auf die psychologische Forschung, die sich allzu oft als Diener der ökonomischen Eliten erwiesen hat. Demokratie ohne Risiko legt dafür einen umfassenden, ganzheitlichen und scharfsinnigen Grundstein, auf dessen Fundament wir gemeinsam aufbauen können. Sie dienen im Hinblick auf Careys akademisches Wirken und sein Leben sowohl als akademisches Rüstzeug als auch als ein leidenschaftlicher Appel an die (Propaganda-)Forschung und an uns alle, dass wir uns gemeinsam aufmachen, Propaganda zu studieren, zu neutralisieren und die so wichtigen Schritte hin zu einer echten Demokratie gemeinsam zu beschreiten. Diese war immer für die jeweils Mächtigen mit ebenjenem großen Risiko verbunden, das sie für sich bisher wirksam durch Propaganda minimieren konnten.
Anmerkungen:
1 Pilger, John: »The Propaganda War on Democracy«. In: Dissident Voice, 17.05.2005, online unter: [https://dissidentvoice.org/May05/Pilger0517.htm], abgerufen am [29.02.2025].
2 Butterick, Keith (2011). Introducing Public Relations. Theory and Practice. SAGE Publications, S. 10.
3 Leipold, Jimmy (Regisseur) (2017). Edward Bernays und die Wissenschaft der Meinungsmache [Film]. ARTE France und INA.
4 Leipold, Jimmy (Regisseur). (2017). Edward Bernays und die Wissenschaft der Meinungsmache [Film]. ARTE France und INA.
5 Thaler, Richard H. & Sunstein, Cass R. (2008/2019). Nudge. Wie man kluge Entscheidungen anstößt. Ullstein Taschenbuch.
6 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: »wirksam regieren – Mit Bürgern für Bürger«, online unter: [https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte-der-bundesregierung/wirksam-regieren], abgerufen am [05.03.2025].
7 Vitali, Stefania; Glattfelder, James B.; Battiston, Stefano: »The Network of Global Cororate Control.« In: PloS ONE 6(10): e25995, 26.10.2010, online unter: [https://journals.plos.org/plosone/article?id=https://doi.org/10.1371/journal.pone.0025995], abgerufen am [05.03.2025].
8 Gilens, Martin; Page, Benjamin I.: »Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens«. In: Cambridge University Press: Perspectives on Politics, Volume 12, Issue 3, S. 564–581, 18.09.2014, online unter: [https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/testing-theoriesof-american-politics-elites-interest-groups-and-averagecitizens/62327F513959D0A304D4893B382B992B], abgerufen am [05.03.2025].
9 BBC: »Study: US is an oligarchy, not a democracy«. In: BBC News, 17.04.2014, online unter: [https://www.bbc.com/news/blogs-echocham bers-27074746], abgerufen am [05.03.2025].
10 The Diary Of A CEO (11. Januar 2024). Yuval Noah Harari: An Urgent Warning They Hope You Ignore. More War Is Coming! [Video]. YouTube.
Einleitung
von Andrew Lohrey
Die Entwicklung einer Theorie der Überredung begann bereits 500 v. Chr. in den griechischen Stadtstaaten. Damals stellten Philosophen eine Reihe von Regeln für den Einsatz von Rhetorik und Überredungskunst auf. Diese Systeme waren derart überzeugend, dass sich die Theorie nur geringfügig änderte, bis die industrielle Revolution den Weg zur Massenüberzeugung durch Massenmarketing ebnete. Nach 1900 begann man, Studien über die Wünsche und Gewohnheiten der Verbraucher und ihre Aufgeschlossenheit gegenüber alternativen Formen der Verkaufsförderung durchzuführen. Doch erst mit Beginn des Ersten Weltkriegs erhielt die Massenpropaganda ihren zentralen Platz im politischen Denken des 20. Jahrhunderts. Erstmals wurde Propaganda systematisch als Kriegswaffe eingesetzt.
Zwei Männer auf beiden Seiten des Atlantiks zeigten sich von dieser Entwicklung stark beeindruckt. Es waren dies der Demokrat Harold D. Lasswell – der erste moderne Analytiker von Propaganda – und Adolf Hitler, ihr wohl perversester Praktiker. Lasswell schrieb seine Doktorarbeit zu diesem Thema und nannte sie »Propagandatechniken im Weltkrieg«. Einige Jahre zuvor hatte Hitler Mein Kampf geschrieben. Darin beschrieb er die Wirksamkeit der alliierten Propaganda im Gegensatz zur deutschen Überzeugungsarbeit, deren Unfähigkeit seiner Meinung nach zur Demoralisierung der deutschen Soldaten und Zivilisten und damit zur Niederlage Deutschlands beigetragen hatte.
Lasswells allgemeine Schlussfolgerungen zur Bedeutung der Propaganda und zur Frage, wer den Propagandakrieg im Ersten Weltkrieg gewonnen hatte, unterschieden sich nicht wesentlich von denen Hitlers. Später sollte der Faschist Hitler seine Aufmerksamkeit auf die Steuerung der öffentlichen Meinung im totalitären Deutschland richten, während der Demokrat Lasswell die Notwendigkeit einer Kontrolle der öffentlichen Meinung im demokratischen Amerika untersuchte. Während totalitäre Propaganda von der westlichen Welt allgemein als Verlust persönlicher und demokratischer Freiheit verurteilt wird, gilt die Steuerung der öffentlichen Meinung in einer Demokratie allgemein als ein gutes Geschäftsmodell. Warum diese Diskrepanz?
Offenbar war Lasswell allzu sehr von der Macht der Propaganda fasziniert, um eine pluralistische Verteidigung gegen die Steuerung der öffentlichen Meinung in Demokratien wie Australien und den Vereinigten Staaten vorzuschlagen. In diesem Jahrhundert gingen zahlreiche Akademiker wie Lasswell sowie viele Vertreter der »freien« Presse stillschweigend davon aus, dass es notwendig sei, die Risiken der Demokratie zu beseitigen, indem man sich an der Steuerung der öffentlichen Meinung beteiligt – einer Steuerung, die den Interessen der Wirtschaft dient. Diese unreflektierte akademische und mediale Konformität hat dazu beigetragen, den amerikanischen Geist für ebenjene Art von kritischem Denken zu verschließen, die für eine gesunde, kulturell vielfältige und pluralistische Demokratie notwendig ist. Die Tatsache, dass diese Art des Umgangs mit der Demokratie so lange als notwendig und unangefochten angesehen wurde, in einem Land, das oft als die führende Demokratie der Welt bezeichnet wird, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Mentalität der politischen und akademischen Führer der Vereinigten Staaten.
Im Unterschied zu den meisten seiner akademischen Kollegen lehnte Alex Carey diese undemokratische Tradition der Steuerung der öffentlichen Meinung in Demokratien ab. Er tat dies durch eine empirische Analyse der Propagandastrategien und -programme, die in diesem Jahrhundert in den Vereinigten Staaten und Australien eingeführt wurden. – Programme, die das »Risiko« aus diesen Demokratien entfernen sollten. Die in diesem Buch enthaltenen Aufsätze beinhalten eine grundlegende Analyse der anhaltenden Auswirkungen dieser verdeckten und breit angelegten Kampagnen. Alex Carey zeichnet nach, wie die »Gefahr« für die Demokratie aus einer vermeintlichen Gefahr für Wirtschaftsinteressen konstruiert wurde und wie Wirtschaftsinteressen der Öffentlichkeit nicht unverhohlen als sektorale Interessen zum Schutz privaten Reichtums verkauft werden, sondern stattdessen als nationale Interessen ausgegeben werden. Nationale Interessen werden folglich als identisch mit Wirtschaftsinteressen angesehen, und so werden sie gemeinsam durch Reizwörter wie »Freiheit«, »Freiheit des Einzelnen«, »freies Unternehmertum« und »freier Markt« kommuniziert.
Die Identifizierung von Unternehmensinteressen mit nationalen Interessen im Rahmen patriotischer Strategien »für oder gegen« die Nation war lange Zeit erstaunlich erfolgreich. Diese Propagandaprogramme konstruieren die »Gefahr« für die Demokratie als eine Gefahr, die von den Gewerkschaften und von staatlichen Initiativen wie der Wohlfahrts- und Umweltpolitik sowie von allen staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft ausgeht, die auf eine Umverteilung des Wohlstands abzielen. Diese kommunalen und öffentlichen Politiken und Programme werden allerdings niemals deswegen als »Gefahr« für die Demokratie angegriffen, weil sie mit einer gewissen Umverteilung des Wohlstands verbunden sein könnten. Auf eine derart geradlinige Weise funktioniert Propaganda nicht. Vielmehr werden kommunale Politiken und Aktivitäten als »Risiko« bezeichnet, weil sie die »Freiheit« des Einzelnen einschränken, die »Initiative« begrenzen oder das »freie« Unternehmertum behindern. Die Identifizierung von Patriotismus mit der »Freiheit« von Unternehmensinteressen ist die einfachste aller versteckten Botschaften. Dass sich dieses einfache Regime der Gedankenkontrolle als dermaßen erfolgreich erwiesen hat und in der Öffentlichkeit auf so wenig Widerstand stieß, liegt an seiner beharrlichen und wiederholten Inszenierung.





























