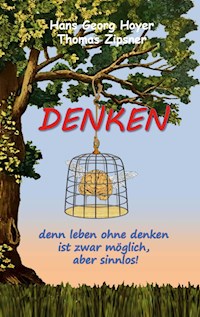
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Informationen verursachen unsere Gefühle, und diese Gefühle bestimmen unser Denken und unser Handeln. Wer das Denken nicht gelernt hat, dessen Handeln wird allein von Gefühlen geleitet. Nur durch gutes, kritisches Denken können wir den "Gefühlskäfig" verlassen und unser Handeln und damit unser Leben selbst bestimmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Wie wir wurden, was wir sind und warum wir denken, wie wir denken
Wo kommen wir her?
Die Evolution, unkonventionell und stark vereinfacht
Die Nahrungskette
Die Evolution des Gehirns
Sinn oder sinnlos
Zufall Leben auf der Erde
Wie tickt ein Gehirn
Die Hypothese von der Fühl- und Denkfabrik Gehirn
Flussdiagramm Fühlen, Denken und Handeln
Das Fühlen mobiler Zellhaufen
Wie das Denken entsteht
Die Fühl- und Denkfabrik von Babyzellhaufen
Wo der Verstand wohnt
Gefühle - unser evolutionärer Rucksack
Das Märchen vom Hasen und dem Igel
Das Unterbewusstsein gewinnt …
Faszination
Wie Stress entstehen könnte
Die alternativen Fakten
Was uns prägt
Die Rolle der Hormone
Warum die Negativspirale fast immer gewinnt
Wie wir eine Positivspirale erzeugen können
Die Macht der Musik
Evolutionäre Fehlleistungen
Verschwörungsmythen
Ein erster Hoffnungsschimmer
Ein zweiter Hoffnungsschimmer
Evolution und Sinn des Lebens
Freier Wille
Was unterscheidet menschliche von tierischen Zellhaufen
Drei Meilensteine bei der Evolution des Denkens
10 Thesen der Hypothese zur Fühl- und Denkfabrik Gehirn
Epilog
Literaturempfehlungen
Prolog
Wenn Sie dieses Büchlein lesen, dann denken Sie dabei mit „fremden“ Gehirnen. Warum?
Was gelesen werden kann, muss vorher geschrieben worden sein. Was geschrieben wurde, muss vorher erdacht worden sein. Jedes Lesen ist also das Wahrnehmen fremder Gedanken und, indem wir über das Gelesene (die fremden Gedanken) nachdenken, denken wir phasenweise mit einem bzw. mit mehreren fremden Gehirnen, je nachdem, wie viele Gehirne beim Schreiben beteiligt waren. Konkret waren an diesem Büchlein letztlich eine ganze Menge von Gehirnen beteiligt – eine genaue Zahl ist jedoch nicht mehr zu ermitteln. Die Bücherliste im Anhang repräsentiert nur einen Bruchteil der tatsächlich „beteiligten“ Gehirne. Natürlich ist Lesen nicht automatisch gleich Denken, das wäre jetzt wirklich ein bisschen zu einfach. Schließlich können wir auch lesen, ohne zu denken. Das macht zwar keinen Sinn, aber es passiert. Wir lesen etwas, sind unkonzentriert, und unsere Gedanken schweifen ab. Hinterher haben wir zwar etwas „gelesen“, haben aber keinen blassen Schimmer davon, was es war. Was sagt uns das? Wir können lesen, ohne zu denken, was aber sinnlos ist. Sinnvoller ist schon „lesen und gleichzeitig denken“, was aber unsere volle Konzentration erfordert. Offensichtlich ist das Denken eine ziemlich komplizierte und manchmal auch anstrengende Angelegenheit.
Der Psychologe Daniel Kahneman unterscheidet in seinem Buch „Schnelles Denken - langsames Denken“ genau zwischen schnellem Denken und langsamen Denken. Nach seiner Auffassung bedeutet „schnelles Denken“ den Anteil des Unterbewusstseins beim Denken.
Wir bekommen ganz fix „Denkergebnisse“, ohne zu wissen, wie wir zu diesen Ergebnissen gekommen sind. Zack, sind sie da, und weil sie da sind, müssen sie von irgendwem bzw. irgendwoher gekommen sein. Einzige passable Antwort: Wenn wir es nicht waren, muss es unser Unterbewusstsein gewesen sein, wer sonst?
Langsames Denken hingegen ist bei Kahneman der Anteil unseres Bewusstseins beim Denken, denn wir müssen die Ergebnisse bewusst „erarbeiten“ bzw. „erdenken“. Eine komplizierte Rechenaufgabe müssen wir z. B. mühsam Schritt für Schritt lösen, da hilft uns niemand und das dauert seine Zeit. Das Unterbewusstsein wäre damit total überfordert.
Bei allem Respekt vor Daniel Kahneman, er ist ein großartiger Psychologe und sein umfangreiches Buch zeugt von ungeheurem Fleiß und Sachverstand. Trotzdem darf zumindest hinterfragt werden, ob die Aktivitäten des Unterbewusstseins wirklich dem Denken zugeordnet werden sollten. Wenn wir selbst überhaupt keinen Zugriff auf die Aktivitäten unseres Unterbewusstseins haben, gehören diese dann zu „unserem“ Denken? Wer oder was denkt außer uns noch „in uns“ herum und wer davon hat das letzte Wort bzw. wer oder was bestimmt dann unser Denken? Können wir auch leben ohne selbst zu denken und wer oder was denkt dann in oder für uns?
Diese und viele andere Fragen rund um unser Leben, unser Fühlen, Denken und Handeln, diskutieren wir in diesem Büchlein. Wir laden Sie ein, unsere und dabei noch jede Menge fremder Gedanken zu lesen und vor allem mit- und nachzudenken. Sie werden erfahren, nicht nur lesen ohne denken ist möglich, auch leben ohne denken ist möglich, aber beides ist sinnlos.
Wie wir wurden was wir sind und warum wir denken wie wir denken
Kennen Sie den Spruch: „Ich denke, also bin ich“? Vor 200 Jahren mag diese damals hochphilosophische Erkenntnis von Descartes in bestimmten Kreisen der Knaller gewesen sein. Aus heutiger Sicht reißt das niemanden mehr vom Hocker. Bleiben doch drei wichtige Fragen unbeantwortet:
Wer oder was bin ich?
Was denke ich und warum?
Was ist Denken?
Auch 200 Jahre nach Descartes nehmen wir unser Denken als natur-gegebene Selbstverständlichkeit hin, praktisch als angeboren. So wie wir ganz normal und selbstverständlich atmen, hören und sehen können, können wir eben auch denken. Denken kann doch jeder, oder? Pustekuchen! In Wirklichkeit haben wir keinen Plan, wer oder was wir wirklich sind, wie wir ticken und warum wir wie und was fühlen, denken und handeln. Warum auch?
Wir haben doch alles, was wir brauchen. Wir haben ein mehr oder weniger vernünftiges Klima und Luft zum Atmen. Wir haben in der Regel sauberes Wasser, genug zu trinken und zu essen, ein Dach über dem Kopf und, ganz wichtig, ein Handy oder ein I-Pad. Damit holen wir uns die „Welt ins Wohnzimmer“ und haben soziale Kontakte im Überfluss. Wenn wir unser Gehirn nicht gerade mit Nachrichten und Fakes aus aller Welt versorgen, können wir unsere Freizeit mit mehr oder weniger sinnfreien Filmen, Talkshows und Computerspielen totschlagen. Natürlich können wir auch mit vermeintlichen Freunden chatten oder twittern und unser Geld auf sogenannten Dating-Portalen vernichten. „C'est la vie“ - das ist das Leben. Falsch, denn nebenbei müssen wir ja noch die Schule besuchen, eine Ausbildung absolvieren oder einer geregelten Arbeit nachgehen, und dabei gibt es viel und oft zu bedenken. Da bleibt halt auch wenig oder gar keine Zeit, über die o. g. Fragen nachzudenken.
Wer oder was sind wir? Auch darüber nachzudenken haben wir keine Zeit, und was „Denken“ wirklich ist, warum wir wie und was denken, dafür müssen wir uns nun wirklich nicht auch noch interessieren und darüber nachdenken. Es ist zweifellos unser großes Dilemma: Wer sich für alles interessieren will, kann sich für nichts richtig interessieren. Dabei gibt es genug Dinge, die uns wirklich interessieren sollten:
Die Klimakrise ist in aller Munde: Trockenheit und Dürre, Überschwemmungen, Tornados usw., die Folgen der menschengemachten Erderwärmung sind deutlich spürbar.
Wir verschmutzen die Luft mit jeder Menge Feinstaub und wundern uns, dass unsere Lungen geschädigt werden.
Nebenbei verpassen ca. 20 % der Weltbevölkerung „freiwillig“ ihren Lungen täglich eine gehörige Portion Schadstoffe durch das Rauchen.
Fakt ist:
Jedes Jahr sterben deutschlandweit schätzungsweise 140.000 Menschen an den Folgen des Rauchens - weltweit sind es über sieben Millionen Menschen. Damit ist weltweit jeder siebte Todesfall oder 13 Prozent aller Todesfälle auf die Folgen direkten Rauchens zurückzuführen, weitere zwei Prozent entfallen auf die Folgen von Passivrauchen. Allein in Deutschland belaufen sich die jährlich durchs Rauchen verursachten Krankheitskosten auf über 20 Milliarden €. (Quelle: Rainer Radtke; de.statista.com vom 21.01. 2020).
Wir verseuchen den Boden und unsere Ozeane und damit unser Trinkwasser mit Mikropartikeln aus Kunststoffen, Chemikalien Arzneimitteln, Düngemitteln, Schwermetallen und diversen anderen giftigen Substanzen.
Wir vertilgen zu viel billiges Fleisch, das unter „tierunwürdigen“ Bedingungen und unter Einsatz von Antibiotika „produziert“ wird, wodurch wir selbst resistent gegen Antibiotika werden.
Wir vertilgen zu viel billigen Fisch, wodurch die ohnehin mit Mikroplastik und Schwermetallen belasteten Fischbestände weiter reduziert werden. Massentierhaltung hat in Form von Fischfarmen längst auch in den Meeren Einzug gehalten und auch hier werden mit Antibiotika die bei der Massentierhaltung zwangsläufig häufiger auftretenden Krankheiten bekämpft.
Zusätzlich vertilgen wir jede Menge mit Pestiziden verseuchtes Obst und Gemüse und jede Menge anderer industriell produzierter Nahrungsmittel, die mit einer Überdosis Zucker schmackhaft und mit zusätzlichen Konservierungsstoffen haltbar gemacht werden .
Alle Menschen können das wissen, und trotzdem wundern wir uns noch darüber, dass pro Jahr Millionen Menschen weltweit an Krebs erkranken, wie folgende Meldungen aus den letzten Jahren belegen:
In Deutschland sind im Jahr 2019 rund 231.000 Menschen an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben – 125.000 Männer und 106.000 Frauen. Das teilte das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltkrebstags mit.
Demnach war Krebs die Ursache für ein Viertel aller Todesfälle in Deutschland. Dieser Anteil habe sich innerhalb der vergangenen 20 Jahre kaum verändert, auch wenn die Zahl der Krebstoten seit 1999 um rund zehn Prozent gestiegen ist. Ein Fünftel aller an Krebs Verstorbenen war jünger als 65 Jahre.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
Der renommierte Krebsbiologe Robert Weinberg hat sein berufliches Leben der Suche nach den Ursachen und Therapiemöglichkeiten bei Krebs gewidmet. Trotzdem verkündete er auf einer Konferenz in Amsterdam 2011 eine für Biologen überraschende Botschaft:
Ungefähr die Hälfte aller Krebserkrankungen hat ihren Ursprung im Verhalten. Rauchen, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel, der zu Übergewicht führt - das sind die entscheidenden Faktoren. Diese Gewohnheiten werden in der frühen Kindheit oder Adoleszenz (Endphase des Jugendalters) angelegt.
Um diese krebsfördernden Gewohnheiten zu verhindern, müssen wir damit früh beginnen, Kindern und Jugendlichen Gesundheitskompetenz zu vermitteln.
(Quelle: Gerd Gigerenzer: „Klick“; C. Bertelsmann).
Leider verhallen diese und viele andere wertvolle Erkenntnisse in den unendlichen Weiten von Bürokratie, Unaufmerksamkeit, Dummergenz und Profitstreben oder sie ertrinken in den Ozeanen von Informationen und Desinformationen. Auch für unser diesbezüglich oberflächliches und ignorantes Verhalten werden die Ursachen bereits in der frühen Kindheit und der Adoleszenz angelegt. Warum? Weil „Denken“ eben nicht gelehrt und gelernt wird.
Kritisches Denken, logisches Denken, strategisches Denken und das Hinterfragen von Informationen und den eigenen Gedanken, diese Fähigkeiten fehlen in den meisten Familien und trotz sprichwörtlicher „Überbildung“ findet sich zum Thema „Denken“ nichts in den Lehrplänen unsere Bildungssysteme.
In unserer Informationsgesellschaft werden wir nicht informiert, sondern mit Informationen förmlich überschüttet. Das bringt uns zwar nicht sofort um, schadet aber unserem Fühlen, Denken und Handeln enorm.
Es schadet erstens, weil unser Gehirn nur eine begrenzte Anzahl von Informationen in einem bestimmten Zeitabschnitt verarbeiten kann.
Es schadet zweitens, weil wenigstens die Hälfte der Informationen aus Müllinformationen, Lügen, Fake News oder „alternative Fakten“ besteht.
Es schadet drittens, weil wir nicht wissen und/oder nicht gelernt haben, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet und welche Folgen das für unser Fühlen, Denken und Handeln, also für unser ganzes Leben hat.
Angesichts der bereits seit Jahrzehnten tobenden Konflikte um Rohstoffe, der andauernden Hungersnöte auf der einen, sowie überbordendem Wohlstand und der Wegwerfmentalität auf der anderen Seite, ist die Frage berechtigt, ob hier nicht irgendetwas gehörig schief läuft. Ich denke, also bin ich, hilft uns da überhaupt nicht weiter.
Die Weltbevölkerung verbraucht jährlich so viele Ressourcen, dass alle 7,5 Milliarden Erdenbürger bei gleichem Lebensstil fünf Planeten wie die Erde bräuchten, um nachhaltig zu leben. Da tatsächlich alle 7,5 Milliarden Erdenbürger einen höheren Lebensstil anstreben, bleibt die Frage, wo wir dann die Ressourcen der 5 Planeten hernehmen sollen.
Angesichts der kleinen Auswahl an Fakten zur Schieflage der Welt dürfen wir schon die Frage stellen, ob unser Fühlen, Denken und Handeln noch zeitgemäß ist, bzw. ob unser Fühlen, Denken und Handeln überhaupt jemals zeitgemäß war. Diese Frage kann nur mit einem klaren „Nein“ beantwortet werden. 14.400 dokumentierte Kriege seit Beginn der Geschichtsschreibung sind nur ein, wenn auch nicht unerheblicher Beleg dafür.
Es wäre ein Leichtes, mit den bisher bekannten menschgemachten Katastrophen mehrere Bücher zu füllen.
Aber darum soll es in diesem Büchlein nicht gehen. Wir wollen ergründen, wie unser Fühlen und unser Denken entstanden sein könnte und wer oder was dieses Fühlen und Denken bestimmt. Warum? Weil Fühlen und Denken unser Handeln und damit unser Leben bestimmen. Wenn unser Leben (Handeln) nicht in Ordnung ist, dann muss entweder unser Fühlen und/oder unser Denken nicht in Ordnung sein.
Bevor wir jedoch versuchen, unser Fühlen, Denken und Handeln zu ergründen, sollten wir uns klar machen, wer oder was hier fühlt, denkt und handelt. Wer oder was sind wir und wie sind wir „wir“ geworden?
Wo kommen wir her?
Dank vieler Wissenschaftler wissen wir, dass der Planet Erde vor ca. 4,5 Mrd. Jahren entstanden sein muss. Das Leben auf diesem Planeten Erde begann wahrscheinlich eines schönen Tages vor ca. 3,8 Mrd. Jahren mit einer winzigen Zelle im Urmeer, der Urzelle. Seither sind einige Jahrmillionen vergangen, in welchen die sogenannte Evolution „wütete“, denn die kleine Urzelle hat die Evolution auf den Plan bzw. in die Welt gebracht.
Dank Darwin u. v. a. wissen wir, dass wir alles, was heute um uns herum so wächst, alles was mit und ohne uns durch die Botanik kreucht und fleucht, einzig der Evolution zu verdanken haben.
Unsere Existenz natürlich auch. Deshalb lohnt es sich, diese „Evolution“ etwas näher zu betrachten. Nur wenn wir einigermaßen nachvollziehen können, wie wir zu fühlenden, denkenden und handelnden Menschen geworden sind, können wir
1. Klarheit gewinnen, wer oder was wir sind und
2. wie und warum wir so fühlen, denken und handeln, wie wir (leider) fühlen, denken und handeln
Die Evolution, unkonventionell und stark vereinfacht
Die ersten lebenden Urzellen müssen eines Tages irgendwo im Urmeer entstanden sein. Wie genau, werden wir vermutlich nie erfahren. Alle bisherigen Versuche von Biologen, eine dauerhaft lebensfähige Zelle im Labor herzustellen, waren erfolglos.
Fakt ist, dass alles was lebt, auch Stoffwechsel betreibt, d. h. Nahrung zur Energiegewinnung aufnehmen muss.
Die ersten „lebenden“ Urzellen können sich nur von „leblosen“ Molekülen in Form von Mineralien (anorganischen Stoffen) aus dem Urmeer ernährt haben, denn es war definitiv nichts Anderes zum Fressen da.
Fakt ist auch, dass eine Zelle aus rein physikalischen Gründen nur eine bestimmte Größe erreichen kann, ohne instabil zu werden und zu zerplatzen. Selbst die Evolution musste sich an die physikalischen Gesetze halten. Alles was zu groß wurde, zerfiel in seine Bestandteile bzw. war nicht lebensfähig.
Aus irgendeinem cleveren Zufall schafften es einige Zellen, sich vor dem Zerplatzen einfach zu teilen. Wahrscheinlich schafften das von Anfang an nicht alle, aber „überlebt“ haben im Sinne von Arterhaltung definitiv nur die Zellen, die sich selbst teilen konnten. Bei der Teilung ging es mitunter nicht ganz korrekt zu. Deshalb entstanden über Jahrmillionen hinweg und wieder aus reinem Zufall große, kleine, dicke und dünne, auf alle Fälle recht unterschiedliche Zellen. Wieder eines schönen Tages muss zufällig eine kleine Zelle in eine große Zelle hineingeschlüpft oder beim Herumtoben hineingepurzelt sein. Die Außenhaut mancher Urzellen war wohl noch ziemlich wabbelig und durchlässig.
Beide Zellen hatten natürlich noch kein Gehirn. Deshalb konnten sie nicht denken und sich auch nicht streiten.
So arrangierten sie sich notgedrungen, lebten fortan (wie ein Paar) glücklich und zufrieden vereint und teilten sich in die täglichen Aufgaben.
Die fachlich korrekte Beschreibung dieses Vorganges beschreibt die „Symbiontentheorie“ von Lynn Margulis.
Die kleine Zelle fühlte sich im Inneren der großen Zelle gut aufgehoben, denn sie hatte ab diesem Tag keine Probleme mehr mit der teilweise unangenehmen und feindlichen Umgebung. Auch für Nahrung in Form von Mineralien war gesorgt. Vermutlich wurde es der kleinen Zelle aber mit der Zeit langweilig, und so fing sie an, die anderen Organe der Zelle herum zu kommandieren und zu koordinieren. Die kleine Zelle wurde zum Bestimmer, zum sogenannten Zellkern, weshalb sie (bzw. der Zellkern) auch als das Gehirn einer Zelle bezeichnet wird.
Die große Zelle stellte diverse Zellorgane für den Stoffwechsel zur Verfügung und machte ansonsten das, was die kleine Zelle in Form des Zellkerns so wollte.
Zwischenfazit:
Zellen sind sowohl der Ursprung allen Lebens als auch die kleinsten Lebewesen. Zellen sind winzig klein und doch in ihrem Aufbau so komplex, dass es noch keinem Menschen gelungen ist, eine lebensfähige Zelle im Labor entstehen zu lassen. Warum?
In der DNS (Desoxyribonukleinsäure) des Zellkerns einer Zelle sind der komplette Bauplan sowie Arbeitsanweisungen für die „Nachwuchszellen“ gespeichert. Bei der Zellteilung werden diese Informationen kopiert, damit jede neue „Teilzelle“ wieder den erforderlichen Bauplan zur Reproduktion besitzt. Und hier liegt der Hase bzw. die ganze Crux der Evolution im Pfeffer. Beim Kopieren dieser hochkomplexen „Bauanleitungen“ passieren zwangsläufig ab und an Fehler. Reiner Zufall, ob, wann und welcher. Es passiert auch nicht oft, aber immer öfter. Aber, ein „veränderter“ Bauplan bringt eine „veränderte“ Zelle zutage - die Mutante. Diese „Zellmutante“ kann entweder schlechter, besser oder genau so gut wie ihre „Mutterzelle“ gegen bedrohliche Umgebungseinflüsse gewappnet sein.
Im ersten Fall sinkt ihre Überlebenschance und ggf. kann sie sich nicht großartig vermehren – Pech gehabt, sie stirbt früher oder später aus.
Im zweiten Fall kommt sie etwas besser zurecht, kann sich deshalb erfolgreich vermehren und gewinnt sozusagen schon quantitativ die Oberhand.
Im dritten Fall kann es mal so oder so ausgehen.
Trotz zum Teil suboptimaler Existenzbedingungen im Urmeer nahm vor Millionen von Jahren nicht nur die nackte Zahl der Zellen rapide zu. Die Mutationen sorgten für eine große Vielfalt ganz unterschiedlicher, lebensfähiger Zellen. Und was passiert, wenn immer mehr Zellen im Urmeer herum wuseln? Es kommt zur Rudelbildung. So entstanden diverse Zellgruppierungen, welche sich Jahrmillionen später zu diversen Zellhaufen zusammenschlossen.
Im Zellhaufen stiegen die Überlebenschancen einzelner Zellen und Zellgruppierungen. Außerdem kam es in der „Gemeinschaft“ ganz automatisch zu Arbeitsteilung und damit zu „Zellspezialisten“, die ihre Aufgaben besonders gut erledigen konnten. Schließlich waren die Zellen im Inneren eines Zellhaufens ebenso gut geschützt wie einst die kleine Zelle in der großen Zelle. Während die äußeren Zellen den Zellhaufen ernähren und schützen mussten, konnten sich die Zellen im Inneren des Zellhaufens um die Organisation kümmern. Logischerweise entstanden aus unterschiedlichen Zellen und Zellgruppen auch ganz unterschiedliche Zellhaufen und selbst äußerlich scheinbar gleiche Zellhaufen zeigten Unterschiede im Verhalten, weil ja immer mal wieder Mutationen bei der Zellteilung vorkamen.
Wie heute noch an diversen lebenden Zellhaufen überall auf der Welt zu beobachten ist, entstanden im Verlauf der Evolution sowohl stockfaule als auch bienenfleißige Zellhaufenmutanten (heute: menschliche Zellhaufen).
Die faulen Zellhaufen trieben ziellos im Urmeer herum und „verstoffwechselten“ an Mineralien alles, was gerade im Urmeer zu finden war. Einige von ihnen wurden an Land gespült und lagen faul herum. Nachdem die Mineralien an der Oberfläche aufgefuttert waren, begannen sie im wahrsten Sinn des Wortes, Wurzeln zu schlagen, um an die Mineralien im Erdboden zu kommen.
Die fleißigen Zellhaufen hatten schon im Urmeer so etwas Ähnliches wie Geißeln bzw. Flossen ausgebildet, mit denen sie sich zielgerichteter herumtreiben konnten. An Land gespült, konnten sie damit auf Mineraliensuche „gehen“. Sie schlugen deshalb keine Wurzeln, sondern wanderten von Mineralienansammlung zu Mineralienansammlung.
Damit war die Trennung in stationäre Zellhaufen, wie z. B. Pflanzen, Pilze etc. und mobile Zellhaufen, den Tieren, vollzogen.
Und während die faulen, stationären Zellhaufen so vor sich hin dümpelten, entwickelte die Evolution bei den fleißigen, mobilen Zellhaufen, wieder mit Hilfe zufälliger Mutationen, aus den „Flossen“ zum einen Extremitäten wie Beine, Arme oder Flügel etc. zur Fortbewegung, sowie ein Steuerungsorgan in Form von Gruppierungen aus speziellen Zellen. Diese Zellgruppierungen waren notwendig, um die Mobilität des Zellhaufens zu organisieren und zu optimieren. Sie waren die Vorläufer der späteren Gehirne.
Wieder Jahrmillionen später muss einigen mobilen Zellhaufen mittels ihres Vorläufers eines Gehirns die „Idee“ gekommen sein, dass es bedeutend einfacher sein müsste, Mineralienansammlungen in Form stationärer Zellhaufen aus der Umgebung zu verspeisen, anstatt mühsam irgendwo selbst nach winzigen Mineralien herum zu suchen. Die stationären Zellhaufen dösten ja sowieso nur faul in der Gegend herum und konnten nicht wegflitzen. Diese Strategie stellte sich, zumindest für die mobilen Zellhaufen, als äußerst erfolgreich heraus. Mit Hilfe dieser genialen Lösung zur Nahrungsabsicherung gelang es der Evolution neue, und auch größere und stärkere mobile Zellhaufenmutanten zu kreieren.
Kreieren ist hier natürlich das falsche Wort. Die Evolution kreiert nicht, sie mutiert völlig zufällig und die Mutation, die es schafft, sich zu vermehren überlebt. Es gilt:





























