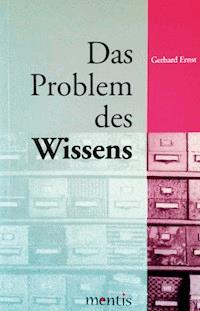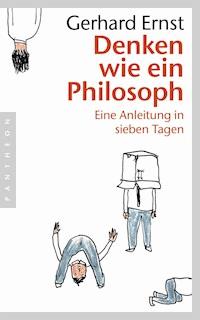
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In sieben Tagen Philosoph
Populäre Bücher über Philosophie gibt es viele, wobei die meisten schon darin irreführend angelegt sind, dass sie die Philosophie als das Äußern von Meinungen darstellen, wo es doch um den Austausch von Argumenten geht. Das Buch des Philosophieprofessors Gerhard Ernst verwechselt Philosophie nicht mit Weltanschauung und ermöglicht so dem interessierten Leser eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Philosophie. Und das alles in nur einer Woche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
»Wenn ich jedoch sage, dies sei das größte Glück für einen Menschen, Tag für Tag über den sittlichen Wert Gespräche zu führen und über die anderen Dinge, über die ihr mich reden hört, indem ich mich selbst und andere einer Prüfung unterziehe, und dass ein Leben ohne Prüfung für den Menschen nicht lebenswert sei, dann werdet ihr meinen Reden noch weniger Glauben schenken. Es verhält sich zwar so, wie ich sage, ihr Männer; doch andere da- von zu überzeugen ist nicht leicht.«
PLATON, Apologie 38a
»Das Maß, o Sokrates, sprach Glaukon, um solche Reden zu hören, ist ja wohl das ganze Leben für Vernünftige.«
PLATON, Politeia 450b
»Nun heißt das aber wahrhaft seine Augen geschlossen halten, ohne daran zu denken, sie zu öffnen, wenn man ohne zu philosophieren zu leben versucht; und die Freude, die man empfindet, alle Dinge zu sehen, die unser Auge entdeckt, ist nicht zu vergleichen der Befriedigung, welche die Erkenntnis all der Dinge verleiht, die man durch die Philosophie findet.«
RENÉ DES CARTES, Die Prinzipien der Philosophie
»Der also eigentlich Philosoph werden will, muss sich üben, von seiner Vernunft einen freien und keinen bloß nachahmenden und, so zu sagen, mechanischen Gebrauch zu machen.«
IMMANUEL KANT, Logik
»Es kann sich überhaupt keiner einen Philosophen nennen, der nicht philosophieren kann. Philosophieren lässt sich aber nur durch Übung und selbsteigenen Gebrauch der Vernunft lernen.«
IMMANUEL KANT, Logik
»Der philosophieren lernen will, darf dagegen alle Systeme der Philosophie nur als Geschichte des Gebrauchs der Vernunft ansehen und als Objekte der Übung seines philosophischen Talents.«
IMMANUEL KANT, Logik
»Es ist völlig richtig und in der besten Ordnung: ›Man kann mit der Philosophie nichts anfangen.‹ Verkehrt ist nur, zu meinen, damit sei das Urteil über die Philosophie beendet. Es kommt nämlich noch ein kleiner Nachtrag in der Gestalt einer Gegenfrage, ob, wenn schon wir mit ihr nichts anfangen können, die Philosophie am Ende nicht mit uns etwas anfängt, gesetzt, dass wir uns auf sie einlassen.«
MONTAG
Wie soll ich leben?
Der Leser und was ihn erwartet
Leser Tolle weiße Wände haben Sie hier!
Philosoph Schön, nicht? Alles aus Elfenbein.
L. Nicht schlecht. Und eine klasse Aussicht hat man. Wird einem fast ein bisschen schwindlig, wenn man die Welt von hier oben betrachtet.
Ph. Das gibt sich mit der Zeit. Sie werden sehen: Nach ein paar Tagen haben Sie sich daran gewöhnt, über die ganze Erde zu schauen.
L. Ist das hier eigentlich die oberste Etage?
Ph. Ganz im Gegenteil: die unterste. Das ist bei Elfenbeintürmen so, dass schon das Erdgeschoss ziemlich hoch oben ist. Aber es gibt noch viel höhere Etagen.
L. Und Sie wohnen ganz oben?
Ph. Nein, gar nicht. Mein Zimmer ist gerade mal ein Stockwerk höher.
L. Wie bin ich eigentlich hierhergekommen?
Ph. Auf dem üblichen Weg: Sie haben ein Buch über Philosophie aufgeschlagen! Und wo Sie nun schon einmal da sind, hoffe ich natürlich, dass Sie meine Einladung annehmen.
L. Wozu wollen Sie mich denn einladen?
Ph. Ich lade Sie dazu ein, eine Woche lang mit mir zu philosophieren.
L. Das trifft sich gut. Es hat mich schon immer interessiert, um was es in der Philosophie eigentlich geht. Aber das können Sie sich vermutlich denken. Ich hätte dieses Buch sonst ja gar nicht erst in die Hand genommen.
Ph. Ja, ich gehe davon aus, dass Sie sich für Philosophie interessieren. Aber können Sie mir nicht ein bisschen mehr über sich verraten?
L. Das geht leider nicht. Aber vielleicht können Sie mir sagen, wen Sie sich als Gesprächspartner vorstellen.
Ph. Oh, da gibt es viele Möglichkeiten.
L. Zum Beispiel?
Ph. Vielleicht sind Sie eine Gymnasiastin, die sich fragt, ob sie Philosophie studieren soll. Oder Sie sind ein pensionierter Englischlehrer, der sich überlegt, ob es ihm nicht Spaß machen würde, sich genauer mit Philosophie zu befassen.
L. Das könnte sein.
Ph. Vielleicht sind Sie auch eine Physikerin, die das Gefühl nicht loswird, dass ihr Fach eine tiefe Verbindung zur Philosophie aufweist, und die gerne einmal etwas genauer wissen würde, was es heißt, wie ein Philosoph zu denken. Oder Sie sind ein Psychologe, dem es so ähnlich ergeht.
L. Gut möglich.
Ph. Sie könnten aber auch eine Menschenrechtsaktivistin sein, der unklar ist, ob die Philosophie Munition für ihren Kampf bereithält. Oder ein Politiker, der sich fragt, ob ihm die Philosophie helfen kann, sich mehr Klarheit über die Grundlagen seiner Politik zu verschaffen. Wie gesagt, ich kann mir viel vorstellen.
L. Und wenn ich einfach ein Mensch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens bin, der sich fragt, ob er diesen in den Büchern der Philosophen finden kann?
Ph. Dann soll es mir auch recht sein. Ich werde jedenfalls davon ausgehen, dass Sie bisher von Philosophie wenig oder nichts wissen, aber ernsthaft etwas darüber erfahren wollen: über die Philosophie selbst.
L. Was meinen Sie mit »die Philosophie selbst«?
Ph. Ich meine damit, dass ich gerne wirklich mit Ihnen philosophieren möchte. Ich will Ihnen einen echten Einblick in einige philosophische Überlegungen geben, nicht einfach nur ein paar Anekdoten über bekannte Philosophen erzählen oder bloß berichten, dass der eine Philosoph dies, der andere das gesagt hat. Ich möchte Ihnen vielmehr helfen, besser zu verstehen, was es heißt, wie ein Philosoph zu denken, indem ich Sie eine Woche lang dazu anleite, selbst über philosophische Fragen nachzudenken.
L. Hört sich gut an. Aber geht das überhaupt?
Ph. Das glaube ich schon. Eine Woche Philosophie kann natürlich kein Philosophiestudium ersetzen, aber man kann sich doch einen ersten Eindruck darüber verschaffen, mit welchen Themen sich die Philosophie beschäftigt und wie sie es tut, so dass man sieht, ob man sich genauer damit befassen möchte.
L. Und wie fangen wir an?
Ph. Am besten mit den philosophischen Fragen, die Ihnen am wichtigsten sind, und dann schauen wir, wohin unsere Unterhaltung uns führt.
L. Kommen wir dann nicht recht durcheinander?
Ph. Keine Sorge, ich werde darauf achten, dass unser Gespräch auf Kurs bleibt und wir im Lauf der Woche zumindest die wichtigsten Fragen der Philosophie einmal ansprechen. Aber vielleicht ist es auch nützlich, wenn wir uns zwischendurch immer mal ein paar Notizen machen, um die Übersicht zu bewahren.
L. Das ist eine gute Idee. Ich will ja nach unserem Gespräch auch etwas mit nach Hause nehmen. Machen wir doch gleich mal eine kleine Notiz.
Erste Gesprächsnotiz
Dies ist ein Buch für alle, die wissen wollen, was es heißt, wie ein Philosoph zu denken, und die es selbst gerne einmal versuchen möchten. Es setzt keine Vorkenntnisse voraus, sondern lediglich die Bereitschaft, sich auf ein philosophisches Gespräch einzulassen und philosophischen Argumenten zu folgen. Demjenigen, der das undeutliche Gefühl hat, Philosophie könnte für ihn von Interesse sein, soll bei der Beantwortung der Frage geholfen werden, ob es sich für ihn lohnt, sich genauer mit Philosophie zu beschäftigen. Dazu wird ein erster Einblick in die wichtigsten Themen und die Vorgehensweise der Philosophie gegeben.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens
Ph. Mit welcher philosophischen Frage möchten Sie denn gerne beginnen?
L. Darf ich gleich in die Vollen gehen?
Ph. Warum nicht?
L. Also gut: Was ist der Sinn des Lebens? Das ist doch eine philosophische Frage, oder?
Ph. Auf jeden Fall! Man kann die Frage allerdings in zweierlei Weise verstehen: Einerseits ist die Frage nach dem Sinn des Lebens doch nichts anderes als die Frage danach, was man mit seinem Leben anfangen sollte, anders gesagt: worin ein gutes Leben besteht. Andererseits zielt die Frage aber auch darauf, ob das Leben überhaupt einen Sinn hat – obwohl es doch endlich ist.
L. Ich habe hauptsächlich an Letzteres gedacht. In ein paar Jahren bin ich nicht mehr da, und bald schon wird auch keiner mehr an mich denken, und überhaupt stürzt irgendwann die Erde in die Sonne und alles Leben ist beendet. Da fragt man sich doch schon: Wozu das alles?
Ph. Das fragt man sich tatsächlich. Und vermutlich gehört es zum Menschsein selbst dazu, sich diese Frage zu stellen. Wir wissen, dass wir sterblich sind, und deshalb betrachten wir unser Leben als Ganzes und fragen nach seinem Sinn.
L. Und die Antwort?
Ph. Wie Sie sich denken können, ist es ziemlich schwer, eine gute Antwort auf diese Frage zu finden. Vielleicht könnte man aber drei Antwortstrategien unterscheiden. Die grundlegende Überlegung sieht doch so aus:
(1) Das Leben ist endlich.(2) Wenn das Leben endlich ist, dann hat es keinen Sinn.(3) Also hat es keinen Sinn.Da der Schluss gültig ist, muss man entweder mindestens eine der Prämissen, (1) oder (2), bestreiten oder aber die Konklusion (3) akzeptieren.
L. Wie könnte man bestreiten, dass das Leben endlich ist?
Ph. Dass der Körper stirbt, kann man schwer bestreiten, aber manche Philosophen haben versucht, für die Unsterblichkeit der Seele zu argumentieren.
L. Soll das dann heißen, wir bekommen nach unserem Tod den Lohn für unsere Taten, und darin liegt der Sinn des Lebens?
Ph. So oder so ähnlich. Wobei Sie sich vorstellen können, dass man gerade für die Vorstellung der späten Abrechnung schwer irgendwelche Argumente finden kann. Das ist mehr eine Hoffnung, die viele haben: dass die Guten ihren Lohn und die Bösen ihre Strafe bekommen – wenn schon nicht in dieser Welt, dann jedenfalls in der nächsten.
L. Das wäre tatsächlich tröstlich – außer natürlich, man gehört zufällig zu den Bösen.
Ph. Aber gerade, weil es tröstlich wäre, liegt die Vermutung nahe, dass dieser Gedanke eher unseren Wünschen entspringt als auf irgendwelchen guten Gründen beruht. Einige Philosophen denken darum, wir sollten uns damit abfinden, dass es keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gibt. Das Leben ist absurd und der Tod ist sein Ende.
L. Also, wie es auf Kaffeetassen und T-Shirts steht: »Life is hard. Then you die.« Keine schöne Aussicht.
Ph. Obwohl es natürlich etwas Heroisches hat, sein Leben im Angesicht der Absurdität zu führen. Existentialisten konnten dem durchaus etwas abgewinnen.
L. Also, ich weiß nicht.
Ph. Wenn man weder die Endlichkeit des Lebens, also die erste Prämisse unseres Arguments, leugnen noch die Konklusion, also die Sinnlosigkeit des Lebens, akzeptieren möchte, dann bleibt nur noch, die zweite Prämisse zurückzuweisen, und das erscheint mir auch als die beste Alternative: Man sollte nicht annehmen, dass die Endlichkeit des Lebens ausschließt, dass es einen Sinn hat.
L. Aber welchen Sinn könnte unser Leben haben, wenn es letztlich einfach aufhört?
Ph. Den Sinn, der in ihm selbst liegt. Nehmen Sie ein triviales Beispiel: Worin liegt der Sinn eines kühlen Getränks an einem heißen Sommertag?
L. Darin, dass es den Durst löscht.
Ph. Und an einem heißen Sommertag seinen Durst zu löschen, ist doch etwas Gutes, auch wenn das kein ewiger Genuss ist. Es ist besser, man hat ihn, als man hat ihn nicht.
L. Und Sie denken, der Sinn des Lebens liegt genauso darin, dass wir das Leben, solange es währt, genießen, so gut es geht?
Ph. Wie gesagt, worin ein gutes Leben besteht, ist eine eigene Frage, die wir gleich ausführlicher diskutieren sollten. Ich wollte zunächst nur deutlich machen, dass die Endlichkeit nicht per se den Wert oder Sinn einer Sache zerstört. Man kann sogar vielleicht noch weitergehen und sagen, dass überhaupt nur ein endliches Leben einen Sinn haben kann.
L. Wieso denn das?
Ph. Wäre unser Leben denn wirklich besser, wenn wir nicht sterben würden? Ich habe eher den Eindruck, dass gerade dadurch alles an Bedeutung verlieren würde. Man könnte dann alle Entscheidungen immer wieder revidieren, alle Ziele, die man erreicht, wären nur Zwischenziele, und ein endgültiges Ziel gäbe es nicht. Das wäre doch wie eine Geschichte ohne Schluss. Man könnte dem eigenen Leben überhaupt keine Form geben.
L. Und es würde vielleicht ein bisschen langweilig werden. Andererseits: Wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann ist das doch so, als würde die Geschichte des eigenen Lebens letztlich gar nicht bewertet. Egal, ob ich gut oder schlecht gelebt habe: Am Ende wäre ich einfach tot. Alles Leiden wäre dann umsonst gewesen und alles Gute nur vorübergehend.
Ph. Ich teile Ihr Unbehagen, und ich glaube nicht, dass man es vollständig loswird. Aber immerhin kann man doch sagen: Auch ein vorübergehendes Gut ist immer noch ein Gut. Der Sinn des Lebens kann also trotz seiner Endlichkeit darin liegen, dass man ein möglichst gutes Leben führt.
L. Wir sollten uns daher hauptsächlich Gedanken darüber machen, was ein gutes Leben eigentlich ausmacht?
Ph. Genau. Und das ist nun wirklich eine ganz zentrale philosophische Frage, während die Frage nach dem Sinn des Lebens in Anbetracht seiner Endlichkeit gar keine so große Rolle in der Philosophie spielt – vielleicht weil es zu wenig gibt, was man dazu mit guten Gründen sagen kann.
Zweite Gesprächsnotiz
Die Frage nach dem Sinn des Lebens hat zwei Dimensionen: Zum einen ist es die Frage danach, was wir mit unserem Leben anfangen sollen, also die Frage nach dem guten Leben. Das ist eine zentrale philosophische Frage. Zum anderen zielt die Frage nach dem Sinn des Lebens darauf, ob überhaupt in Anbetracht seiner Endlichkeit ein sinnvolles Leben möglich ist. Wenn das Leben endlich ist und Endlichkeit Sinnlosigkeit impliziert, dann ist das Leben sinnlos. Man kann versuchen, die Endlichkeit des Lebens zu leugnen (und für die Unsterblichkeit der Seele zu argumentieren); man kann die Absurdität des Lebens akzeptieren (und sich bemühen, das Beste daraus zu machen); man kann aber auch die Vorstellung zurückweisen, dass die Endlichkeit des Lebens seine Sinnlosigkeit zur Folge hat. Warum sollte nur etwas Ewiges einen Wert haben? Setzt der Sinn des Lebens vielleicht sogar seine Endlichkeit voraus?
Philosophen als Experten für das gute Leben
L. Die Frage, worin ein gutes Leben besteht, sagen Sie, ist also eine zentrale philosophische Frage.
Ph. Ja, oder man kann auch einfach sagen, die Frage: »Wie soll ich leben?«
L. Aber möchten die Philosophen denn tatsächlich den anderen Leuten vorschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben?
Ph. Natürlich geht es nicht darum, dass da der eine, der Philosoph, dem anderen, dem Nichtphilosophen, vorschreibt, was er zu tun und zu lassen hat. Wie käme er dazu?
L. Worum geht es den Philosophen dann?
Ph. Sie wollen dabei helfen, dass jeder selbst erkennt, wie er leben sollte. Denken Sie zum Beispiel an den Ethikunterricht in den Schulen. Da geht es doch vor allem darum, die Schüler anzuleiten, über das richtige Handeln richtig nachzudenken.
L. Ich dachte, da sollen Werte vermittelt werden.
Ph. Aber wie wollen Sie das machen, wenn Sie die Schüler nicht zum Nachdenken bringen? Das wäre doch bloße Dressur und Bevormundung. Und gefährlich wäre es obendrein, wenn man jemanden dazu bringt, zu tun, was andere sagen, ohne dass er selber darüber nachdenkt.
L. Damit man jemanden anleiten kann, muss man aber selbst mehr wissen. Sind Philosophen denn besonders gute Menschen?
Ph. Nein, das glaube ich eher nicht. Aber wir sollten vielleicht kurz klären, was ein guter Mensch überhaupt ist.
L. Jemand, der wenig falsch macht, würde ich sagen.
Ph. Es gibt aber zwei ziemlich verschiedene Weisen, wie man etwas falsch machen kann. Einmal gibt es doch den Fall, dass man zwar weiß, was zu tun richtig wäre, es aber nicht tut.
L. Sie meinen, wenn jemand zum Beispiel weiß, dass er morgens früh aufstehen sollte, weil er viel zu tun hat, es aber trotzdem nicht tut, weil es im Bett gerade so gemütlich ist?
Ph. Genau. Das ist ein Fall von Willensschwäche: Man tut nicht, was zu tun man selbst für das Beste hält. Kommt immer wieder vor – bei Philosophen sicher genauso oft wie bei anderen Menschen. Insofern sind Philosophen schon mal keine besonders guten Menschen. – Aber auch, wenn man tut, was man für richtig hält, kann man etwas falsch machen: wenn man nämlich etwas für richtig hält, was tatsächlich falsch ist.
L. An was denken Sie da?
Ph. Wenn ein Ladendieb zum Beispiel meint, es sei ganz richtig, dass er etwas mitgehen lässt, weil er so arm und der Kaufhauskonzern so reich ist. Dann täuscht er sich. Er tut etwas Falsches, das er aber selbst für richtig hält.
L. Und Sie würden auch nicht sagen, dass die Philosophen besser wissen, welche Handlungen richtig und falsch sind?
Ph. Na ja, vielleicht sind die Philosophen tatsächlich in einer ganz günstigen Ausgangslage. Aber Sie müssen bedenken, dass es auf die konkrete Handlung ankommt. Nehmen Sie eine Situation, in der Sie unsicher sind, was Sie tun sollten. Sie fragen sich zum Beispiel, ob Sie einem Freund beim Umzug helfen oder Ihre kranke Großmutter besuchen sollten. Was würden Sie sagen, worauf kommt es bei Ihrer Entscheidung an?
L. Vielleicht darauf, wie dringend der Freund auf mich angewiesen ist, wie gut wir befreundet sind, wie krank die Großmutter ist – so etwas.
Ph. Eben. Und das sind alles Fragen, auf die Ihnen die Philosophie natürlich keine Antwort gibt. In keinem Philosophiebuch der Welt werden Sie irgendetwas zu der Frage finden, wie krank Ihre Großmutter ist.
L. Ah, ich verstehe. Zu der konkreten Handlung sagt die Philosophie also gar nichts. Aber inwiefern sagt sie mir dann überhaupt, wie ich leben soll?
Ph. Die Philosophie kann auf Aspekte hinweisen, die für die richtige Entscheidung wichtig sind, die man aber leicht übersieht. Sie kann auf Zusammenhänge zwischen verschiedenen Situationen aufmerksam machen, die man sich oft nicht klarmacht. Philosophen versuchen, Übersicht über unsere praktischen Überlegungen zu schaffen und deren grundlegende Strukturen offenzulegen. Das wird Ihnen sicher alles klarer werden, sobald wir einmal solche Überlegungen angestellt haben.
L. Aber braucht man all das überhaupt, um die richtigen Entscheidungen zu fällen?
Ph. Ich gebe Ihnen mal einen Vergleich, der sich so ähnlich schon bei Platon findet. Betrachten wir die folgenden drei Personen: Jemanden, der rechtschreiben kann, einen Schriftsteller und eine Grammatiklehrerin. Wie verhalten sich deren Fähigkeiten zueinander?
L. Der Schriftsteller und die Grammatiklehrerin müssen auch rechtschreiben können. Aber der Schriftsteller muss kein Grammatiklehrer sein und die Grammatiklehrerin keine Schriftstellerin. Und jemand, der rechtschreiben kann, muss weder Grammatiklehrer noch Schriftsteller sein.
Ph. Trotzdem gibt man demjenigen, der lernen soll, richtig zu schreiben, auch Grammatikunterricht. Warum wohl?
L. Weil ihm das hilft, richtig zu schreiben, würde ich sagen.
Ph. Also muss der normale Rechtschreiber auch etwas vom Grammatiklehrer haben und der Schriftsteller vielleicht noch mehr. Vielleicht machen beide zwar unbewusst das meiste richtig. Aber leichter werden sie sich tun und sicherer werden sie sein, wenn sie sich auch mit Grammatik beschäftigt haben.
L. Und was hat das alles mit Philosophie zu tun?
Ph. Jeder Mensch soll lernen, richtig zu handeln, so wie alle Rechtschreiben lernen sollen. In beiden Fällen braucht es zunächst einmal hauptsächlich Übung. Aber letztlich tut man sich leichter, wenn man sich auch die jeweiligen Grundsätze vor Augen geführt hat. Man wird sicherer und besser schreiben, wenn man die Grammatik beherrscht. Und man wird sicherer und häufiger richtig handeln, wenn man sich auch über die Grundsätze des richtigen Handelns Gedanken gemacht hat. Genau dabei hilft die Philosophie.
L. Der Philosoph entspricht also der Grammatiklehrerin und der praktisch Handelnde dem normalen Rechtschreiber. Aber wofür steht dann der Schriftsteller?
Ph. Der steht in unserem Vergleich für jemanden, der besonders gut darin ist, praktische Entscheidungen zu treffen, jemanden, der ein besonders gutes praktisches Urteilsvermögen in einzelnen Situationen hat. Kann sein, dass so jemand auch sehr gut über die Grundsätze des richtigen Handelns Bescheid weiß und sich darüber viele Gedanken gemacht hat. Es muss aber nicht unbedingt so sein.
L. Und der Philosoph ist nicht in jedem Fall eine solche Person?
Ph. Nein. Wir Philosophen verbringen ja sehr viel Zeit mit dem Nachdenken hier in unserem Turm und entsprechend weniger Zeit mit dem Handeln draußen. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie einen Bausparvertrag abschließen sollen, fragen Sie also besser keinen Philosophen.
L. Aber was ist mit den ganzen Ethikkommissionen? Da sitzen doch auch Philosophen. Und wenn die im konkreten Einzelfall gar keine besseren Urteile fällen als normale Menschen, sind die Kommissionen dann nicht unnütz?
Ph. Nein, das glaube ich nicht. Zum einen geht es manchmal einfach darum, dass überhaupt ein Außenstehender um Rat gefragt wird. Und das kann wichtig sein, auch wenn eigentlich völlig klar ist, was man machen sollte. Zum anderen geht es in den entsprechenden Bereichen – in der Medizinethik zum Beispiel – um Fragen, bei denen nicht nur die konkreten Umstände eine Entscheidung schwierig machen, sondern bei denen auch nicht so klar ist, was die relevanten Grundsätze sind oder sein sollten.
L. Und das ist dann also eine Frage, mit der sich Philosophen befassen.
Dritte Gesprächsnotiz
Philosophen beschäftigen sich mit der Frage, wie wir leben sollen. Ihre Überlegungen sind jedoch nicht als Anweisungen zu verstehen, sondern als Hilfe beim eigenen Nachdenken. Die Philosophie kann auf Aspekte hinweisen, die man leicht übersieht, auf Zusammenhänge, die man sich oft nicht klarmacht, auf Beobachtungen, die man vielleicht nicht ernst genug nimmt. Sie schafft Ordnung in unseren praktischen Überlegungen und hilft so beim richtigen Handeln. Diese Aufgabe erfüllen Philosophen durch ihre Schriften, aber auch als Ethiklehrer in der Schule und Universität ebenso wie als Mitglieder von Ethikkommissionen in Wissenschaft und Politik. Philosophen sind grundsätzlich ebenso anfällig für Willensschwäche wie andere Menschen, und sie sind, wie jeder andere, mit dem Problem konfrontiert, in konkreten Situationen den richtigen Weg zu finden. Ein vorbildliches Leben führen nicht immer diejenigen, die auch die beste Einsicht in die Natur des guten Lebens haben. Solche Einsicht ist aber hilfreich, ein Mindestmaß davon sogar notwendig für ein gutes Leben.
Ein Leben der Wunscherfüllung
L. Dann helfen Sie mir einmal, darüber nachzudenken, worin ein gutes Leben besteht!
Ph. Am liebsten würde ich wieder davon ausgehen, was Sie meinen.
L. Okay, ich mache einen Vorschlag: Ein gutes Leben hat man dann, wenn man alles bekommt, was man haben will.
Ph. Da kann man, fürchte ich, leicht Gegenbeispiele finden. Stellen Sie sich etwa vor, Sophie möchte Pilotin werden, weil sie glaubt, dass das ein abwechslungsreicher Beruf ist, bei dem man fremde Länder kennenlernt, viel Geld verdient und viel Freizeit hat. Nehmen wir aber einmal an, dass der Beruf tatsächlich ziemlich eintönig ist, dass man von den fremden Ländern nur die Flughafenhotels kennenlernt, dass man gar nicht so viel verdient und dass auch die Freizeit viel beschränkter ist als gedacht. Hätte Sophie ein gutes Leben, wenn ihr Wunsch, Pilotin zu werden, in Erfüllung gehen würde?
L. Nein. Aber ich meinte natürlich, dass es gut ist, wenn man bekommt, was man haben will, sofern man über die Umstände richtig informiert ist. Sophie würde ja gar nicht Pilotin werden wollen, wenn sie wüsste, worauf sie sich dabei einlässt.
Ph. Einverstanden. Aber auch hier gibt es Probleme. Was würden Sie zu dem Beispiel sagen: Nehmen wir an, Herbert ist drogensüchtig und möchte unbedingt die nächste Dosis bekommen. Er ist über die Wirkung der Droge bestens informiert. Trägt es zu seinem guten Leben bei, wenn er sie bekommt?
L. Nein, natürlich nicht. Aber das ist auch kein so klarer Fall, denke ich. Herbert will zwar die Droge, aber vor allem will er doch sicher nicht drogensüchtig sein. Und wenn er das erreicht, macht das sein Leben wirklich besser.
Ph. Aber wie entscheiden Sie, die Erfüllung welcher Wünsche ein Leben besser macht und die Erfüllung welcher Wünsche nicht? Herbert hat ja sowohl den Wunsch, den nächsten Schuss zu setzen, als auch den Wunsch, nicht mehr drogenabhängig zu sein.
L. Hm, das ist tatsächlich nicht so einfach … Sollte man vielleicht sagen, dass es gut ist, wenn unsere stärksten Wünsche erfüllt werden?
Ph. Man kann sich aber doch leicht vorstellen, dass Herberts Wunsch nach der Droge stärker ist als der Wunsch, nicht mehr drogenabhängig zu sein. Immerhin ist es denkbar, dass das Verlangen nach dem nächsten Schuss ihn handeln lässt, der Wunsch, nicht mehr drogenabhängig zu sein, dagegen nicht. Und das würde dann gerade zeigen, dass der Drogenwunsch stärker war.
L. Ja, aber eigentlich will er doch wahrscheinlich nicht mehr drogenabhängig sein. Dann sollte man vielleicht lieber sagen, dass unser Leben umso besser wird, je mehr unserer eigentlichen Wünsche in Erfüllung gehen.
Ph. Was meinen Sie hier mit »eigentlich«?
L. Was jemand eben wirklich will. Das kann ich nicht besser ausdrücken.
Ph. Ist auch nicht einfach. Aber ich weiß ungefähr, was Sie meinen. – Ich hätte übrigens einen guten praktischen Tipp, wie Sie die Zahl Ihrer unerfüllten Wünsche minimieren können.
L. Da bin ich gespannt.
Ph. Wenn man möglichst wenig unerfüllte Wünsche haben möchte, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht, das zu bekommen, was man haben will. Aber dabei muss die Welt irgendwie mitspielen. Wenn ich viel Geld haben, aber wenig arbeiten möchte, werde ich zum Beispiel auf ziemlich viel Widerstand stoßen.
L. Und die zweite Möglichkeit?
Ph. Ich kann meine Wünsche aufgeben. Je weniger ich will, desto größer die Chancen, dass ich bekomme, was ich will. Und wenn mein Glück darin besteht, dass ich möglichst viel von dem bekomme, was ich will, steigen die Chancen für das eigene Glück immens, wenn ich meine Ansprüche senke. Das ist eine alte Weisheit: Befreie dich von deinen Leidenschaften und du wirst völlige Gemütsruhe haben. Die Welt kann dir nichts mehr anhaben!
L. Das ist nicht so ganz, was ich hören wollte.
Ph. Kann ich mir denken. Aber ich glaube sowieso nicht, dass das gute Leben darin besteht, dass man bekommt, was man will, auch nicht darin, dass man bekommt, was man eigentlich will. Man kann ja die irrsinnigsten Wünsche haben! Nehmen Sie an, Heike hat den echten, innersten und eigentlichen Wunsch, nichts zu tun, als den ganzen Tag lang Grashalme zu zählen. Hat sie ein gutes Leben, wenn ihr Wunsch erfüllt wird?
L. Wenn es ihr Spaß macht!
Ph. Das meinen Sie jetzt nicht ernst. Aber vor allem: Von Spaß war gar nicht die Rede, sondern nur davon, dass Heike bekommt, was sie eigentlich will. Und ich sehe beim besten Willen nicht, was daran gut für sie sein sollte, einen solchen idiotischen Wunsch erfüllt zu bekommen. Oder nehmen Sie unmoralische Wünsche. Wird Martins Leben gut, wenn sein Wunsch, tagaus tagein Katzen zu quälen, in Erfüllung geht?
L. Nein, stimmt schon: Ob es etwas Gutes ist, wenn sich die eigenen Wünsche erfüllen, wird schon auch davon abhängen, um welche Wünsche es geht.
Ph. Genau! Es hängt davon ab, ob man etwas Gutes will oder nicht! Und dann spielt doch die Wunscherfüllung selbst gar keine Rolle mehr.
L. Wieso?
Ph. Weil es unser Leben doch wohl besser macht, wenn wir etwas Gutes bekommen, unabhängig davon, ob wir es gerade wollen oder nicht. Umgekehrt macht Schlechtes unser Leben nicht besser, egal ob wir es haben wollen oder nicht. Es kommt also gar nicht darauf an, ob wir bekommen, was wir wollen, sondern darauf, ob wir etwas Gutes bekommen oder nicht.
L. Leuchtet irgendwie ein. Aber dann stellt sich natürlich die Frage: Was ist denn nun gut für unser Leben?
Ph. Richtig, die Frage stellt sich. Wir brauchen einen neuen Vorschlag!
Vierte Gesprächsnotiz
Besteht ein gutes Leben darin, dass man bekommt, was man will? Dieser Vorschlag stößt auf Probleme: Zum einen scheinen nur die eigentlichen Wünsche einer gut informierten Person relevant zu sein. Zum anderen kann selbst die Erfüllung solcher Wünsche einem Menschen schaden und sein Leben misslingen lassen. Umgekehrt kann auch Gutes, das wir uns nicht wünschen, unser Leben besser machen. Ob die Erfüllung der eigenen Wünsche unser Leben gut macht, scheint also davon abzuhängen, ob wir das Richtige wollen oder nicht. Dass wir umso mehr Wünsche erfüllen können, je weniger davon wir haben, ist somit kein großer Trost.
Ein Leben der Lust
L. Wie sollen wir die Frage, worin ein gutes Leben besteht, denn nun angehen?
Ph. Wir können einfach einmal betrachten, was die Leute tatsächlich haben wollen. Wenn sie es haben wollen, heißt das, dass sie es für gut halten. Wir müssen dann nur noch überprüfen, ob sie recht haben, und schon haben wir gefunden, was tatsächlich gut ist.
L. Hört sich sehr einfach an. Aber tatsächlich wollen die Leute doch ständig etwas anderes. Mal dies, mal das. Wie soll man sich da zurechtfinden?
Ph. Wir sind ja nur auf der Suche nach »intrinsischen Gütern«, also Gütern, die in sich selbst wertvoll sind, weil wir doch wissen wollen, was ein Leben letztlich