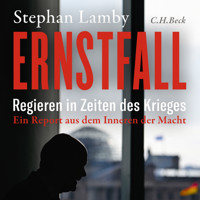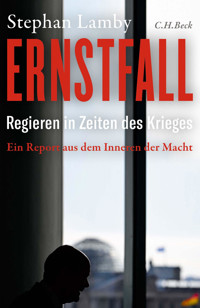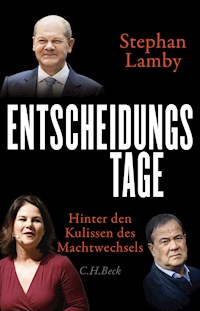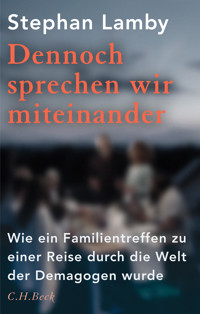
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Stephan Lamby bei einer Familienfeier erfuhr, dass sein amerikanischer Cousin im Januar 2021 beim Sturm aufs Kapitol dabei war, entschied er sich für eine ungewöhnliche Reise. Er wollte herausfinden, warum so viele Menschen aus der Mitte der Gesellschaft abdriften. Warum erliegen sie der Verführungskraft von Demagogen? Warum radikalisieren sich sogar Verwandte und Freunde? Im Laufe eines Jahres reiste Lamby durch vier westliche Demokratien: USA, Argentinien, Deutschland und Italien. Seine Reisen führten ihn in die Welt von Donald Trump, Javier Milei und Björn Höcke – und in die eigene, weitverzweigte Familie. Seit vielen Jahren recherchiert Stephan Lamby für seine Filme und Bücher auf beiden Seiten des Atlantiks. Noch nie hat er die Wut auf etablierte Politiker und auch auf Journalisten als so tiefgreifend und bedrohlich empfunden wie zurzeit. Was ist los in unseren Ländern? Was droht uns noch? Und vor allem: Kann man im persönlichen Gespräch politische Gräben überwinden? Lamby lernte auf seinen Reisen Menschen im ehemaligen Wohnhaus von Benito Mussolini kennen und in Graceland, dem Anwesen von Elvis Presley. Er beobachtete den argentinischen Präsidenten Javier Milei aus der Nähe, er besuchte seinen amerikanischen Cousin in Connecticut und traf sich in Berlin mit dem Anwalt von Björn Höcke zum Mittagessen. Zudem tauchte er tief in die Geschichte der Länder ein, die ihm vertraut sind. Gut 100 Jahre nach dem Aufkommen des historischen Faschismus und 80 Jahre nach dessen Ende ging er der Frage nach, ob der Begriff Faschismus für die aktuelle politische Auseinandersetzung noch taugt. Lamby hat Feinde der Demokratie kennengelernt, aber auch Menschen, die sich den Feinden der Demokratie in den Weg stellen. Einige seiner Begegnungen waren sehr schmerzhaft, andere ermutigend. Fast immer haben sich seine Gespräche gelohnt. Doch es gab auch Grenzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Stephan Lamby
DENNOCH SPRECHEN WIR MITEINANDER
Wie ein Familientreffen zu einer Reise durch die Welt der Demagogen wurde
C.H.Beck
Übersicht
Cover
INHALT
Textbeginn
INHALT
Titel
INHALT
Widmung
PROLOG
IM WESTEN
Martin
Bauernopfer und Planspiele
Nürnberg
Nie wieder ist jetzt
Das Wissen der Alten
Im Bermuda-Dreieck
Memphis
Huey Long
Oh, Jesus!
Birmingham
IM SÜDEN
Das Kettensägen-Massaker
Wenn Pesos rasen
In den Bergen von Córdoba
Mit dem Taschenrechner
Die Spuren der Junta
IM OSTEN
Der Mann mit der Blaupause
Hüben und Drüben
Höckes Sprache
Jena
Unter Juristen
Trump im Sturm
Höckes Anwalt
Der Feind des Staates
«713»
GANZ UNTEN
Kopfüber von der Tankstelle
In der Gruft
Zu Tisch mit Faschisten
«Höcke oder Solingen»
Nordhausen
Signale
Tanja und ihr Bruder
Im Dschungel
Transatlantik
Entscheidungstage
EPILOG
DANK
REGISTER
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
In Erinnerung an Rudolf Vrba 1924–2006
PROLOG
Der Mann neben mir dreht sich noch einmal um. Er erkennt sich auf einem Bild, an dem er eben vorbeigegangen ist. Jetzt will er sich das Bild noch einmal genau anschauen. Es zeigt ihn, wie er eine Kettensäge in die Luft streckt. Darunter steht: «The Enemy of the State», der Feind des Staates. Der Mann ist Präsident des Staates Argentinien, er zögert kurz, dann ruft er laut: «Yes, I am the enemy of the state.» Alle um ihn herum kichern.
In dem Restaurant in Oberitalien dröhnt plötzlich Marschmusik aus den Lautsprechern. Nach ein paar Takten fängt die junge Frau, die mir gegenübersitzt, an zu summen, schließlich gibt sie sich einen Ruck und singt den Text mit, Strophe für Strophe. Sie strahlt übers ganze Gesicht. Als ich sie frage, was das für ein Lied ist, antwortet sie, es sei ein uraltes Kampflied der Faschisten. Ist sie selber Faschistin? Sie wundert sich über meine Frage: «Ja, selbstverständlich.»
Joe ist per Video in die amerikanische Fernsehsendung meines Cousins geschaltet. Er und die anderen Gäste schäumen vor Wut, Donald Trump wurde gerade von einem New Yorker Gericht verurteilt. Joe sagt einen Zusammenbruch der amerikanischen Gesellschaft voraus: «Die nächsten fünf Jahre werden unvorstellbar sein.» Aber was soll’s, brummt er, auf den Ruinen könne man später etwas Neues errichten.
Der Mann mit Strohhut hat sein ganzes Berufsleben lang als Arzt gearbeitet. Jetzt macht er in einer Plattenbausiedlung in Gera Wahlkampf für die AfD. Natürlich bekommt er mit, wie über seine Partei berichtet wird, die ganzen Negativschlagzeilen, die Nazi-Vergleiche. Er findet: «Die Leute können diese Propaganda nicht mehr hören. Die haben ja ihren eigenen Verstand.» Dann schränkt er ein: «Die Leute, die vor der Glotze hängen, werden natürlich vom Staatsfunk manipuliert.» Sobald seine Partei an der Macht sei, würde sie dem Staatsfunk ein Ende setzen.
Seit beinahe 40 Jahren beobachte ich politische Prozesse. Noch nie habe ich die Wut auf das herrschende System, die Sehnsucht nach Umsturz und ja, nach Zerstörung als so tiefgreifend und bedrohlich empfunden wie in den letzten Monaten. Was ist los in unserem Land? Was ist los in anderen Ländern?
Lange Zeit galt die Demokratie doch als stabil, als unzerbrechlich, als die durchsetzungsstärkste, flexibelste, kurzum: als die beste Staatsform der Geschichte. Doch so ist es nicht, zumindest nicht mehr. In immer mehr Gesellschaften wird die Demokratie in Frage gestellt, ihre Fundamente werden brüchig. Schrille Außenseiter und neue Formen der öffentlichen Kommunikation bedrohen das gewohnte politische Gefüge.
Die größte Gefahr lauert im Inneren, das zeigen auch der hasserfüllte Wahlkampf und der rauschhafte Sieg von Donald Trump. Was an die Stelle der Demokratie drängt, hat noch sehr unscharfe Konturen. Der alte Faschismus mit Stahlhelm und Springerstiefeln ist es wohl nicht. Aufmärsche auf Straßen gibt es nur selten, heute toben sich radikalisierte Bürger auf den Schlachtfeldern von TikTok, Telegram und X aus. Noch erleben wir eine Phase der Disruption, des Übergangs. Aber wohin, was soll nach dem Übergang folgen? Figuren, die noch vor wenigen Jahren kaum Chancen im politischen Betrieb gehabt hätten, erhalten plötzlich großen Zuspruch, weil sie versichern, alles andere zu sein, nur keine klassischen Politiker. Sie werden schnell beliebt, wenn sie in Talkshows oder sozialen Medien etablierte Politiker nur wüst genug beleidigen und ihnen jegliche Integrität absprechen. Die müssen wiederum feststellen, dass ihre Überzeugungskraft schwindet, dass ihnen die Zustimmung weiter Teile der Bevölkerung abhandenkommt. Liegt es an ihrer veralteten Form der Kommunikation? Liegt es daran, dass der Vorwurf, «die da oben» seien allesamt korrupt, durch ständig neue Skandale Nahrung erhält? Liegt es daran, dass die Bürger den Versprechungen der Regierungen immer weniger glauben, weil sich an ihren Lebensverhältnissen eh nichts verbessert?
Parallel zu der Erschütterung des westlichen Politikmodells läuft in Argentinien gerade ein Experiment, das sich den bekannten Schemata entzieht und auf dessen Ausgang viele, auch in Deutschland, gespannt blicken: Der argentinische Präsident Javier Milei will den Staat nicht stärken, sondern so weit wie möglich zerstören und seine Aufgaben dem freien Markt überlassen. Sein Vorhaben setzt er mit brachialer Energie durch. Die Debatte über die Stärkung des Staates versus seine gezielte Schwächung wird unter anderen Vorzeichen ja auch hierzulande geführt, auch an diesem Grundsatzstreit ist die Ampelkoalition zerbrochen. In Argentinien kann man außerdem beobachten, was passiert, wenn Regierungen jahrelang an ihrer Bevölkerung vorbeiregieren, wenn das Vertrauen in Politik schwindet. Dann können Personen das Vakuum füllen, die die Demokratie am liebsten in Schutt und Asche legen wollen.
Noch unterscheiden sich die Anführer der neuen Bewegungen in Nord- und Südamerika von den Politikern, die in Deutschland an der Macht sind oder Chancen haben, in Regierungsverantwortung zu kommen. Aber die Versuchung, die von ihren Ansichten und Methoden auch hier ausgeht, wächst rapide. Um aus vielen Anhängern eine Gemeinschaft Gleichgesinnter zu formen, bieten die neuen Anführer schlichte Freund-Feind-Bilder an: wir gegen die. Mitglieder anderer Parteien behandeln sie nicht wie Konkurrenten, sondern wie Feinde, die ausgeschaltet werden müssen, mindestens politisch. Immer hetzen sie gegen Journalisten, gegen eine vermeintliche Verschwörung etablierter Politiker und Medien, gegen eine behauptete «Meinungsdiktatur». Oft machen sie Stimmung gegen Fremde, gegen Menschen aus anderen Ländern, mit anderer Hautfarbe und anderer Religion. Sie zerstören die Toleranz und somit den Wesenskern der Demokratie.
Nicht nur die Demagogen sind angsteinflößend, sondern auch die unzähligen Menschen, die ihnen Macht übertragen. Auch ihre Bereitschaft, sich zu unterwerfen, rüttelt am Fundament der Demokratie. Selbst wenn sich Donald Trump eines Tages aus der Politik zurückziehen sollte, wird seine Make-America-Great-Again-Bewegung (MAGA) wohl von anderen Demokratiefeinden fortgeführt und benutzt werden. Daher werde ich nicht nur auf die Anführer schauen, sondern in erster Linie auf ihre Anhänger. Ihre Argumentationsmuster ähneln sich frappierend, länder- und kulturübergreifend.
Für dieses Buch habe ich mich auf den Weg gemacht. Im Laufe eines Jahres bin ich an Orte gereist, an denen ich den politischen Gezeitenwechsel sehen und begreifen kann. Meistens habe ich einfache Bürger getroffen, fernab der politischen Zentren, es waren zahlreiche Zufallsbekanntschaften darunter. Die Reisen führten mich auch zu Mitgliedern meiner eigenen Familie und zu Freunden. Zu Menschen also, die mir nahestehen und denen ich mich seit langem verbunden fühle. Einige dieser Begegnungen waren ermutigend, andere sehr schmerzhaft. Diese Teile des Buches berühren meine eigene Geschichte, auch die meiner Mutter, ihrer Schwester und die meines amerikanischen Cousins. Von ihnen will ich hier erzählen, weil ihre Lebensläufe und Erfahrungen eine exemplarische Aussagekraft für den Zustand unserer Gesellschaften haben.
Bei vielen Menschen, denen ich in den letzten Monaten begegnet bin, habe ich mich über ihre politischen Ansichten gewundert, über ihren Zorn, nicht nur gegen Politiker, sondern auch gegen uns Journalisten. Dennoch haben wir miteinander gesprochen, oft haben wir gestritten. Fast immer hat es sich gelohnt.
Mit den Ländern und Orten, die ich besucht habe, verbinden mich persönliche Beziehungen. Vor vielen Jahren habe ich eine Weile in den USA gelebt, ein Teil meiner Verwandtschaft ist amerikanisch. Meine italienische Patentante lebt in Mailand, meine angeheirate Familie und auch viele Freunde leben in Argentinien. Und das angespannte Verhältnis zwischen dem Osten und dem Westen, das uns bis heute beschäftigt, kenne ich von Kindesbeinen an aus der eigenen deutsch-deutschen Familie.
Oft habe ich mich auf meinen Reisen gefragt, warum das Bedürfnis vieler Menschen nach einer gänzlich anderen, antidemokratischen Politik so groß ist. Es fällt mir auf, wie einfach dieses Bedürfnis ausgenutzt wird, wie leicht die Demokratie aus den Angeln gehoben werden kann. Auch fällt mir auf, wie anfällig Menschen aus der bürgerlichen Mitte inzwischen für extreme Ansichten sind. Je länger meine Reisen dauerten, desto klarer wurde mir, dass die Diktaturen und faschistischen Regime des 20. Jahrhunderts keine Ausrutscher waren, keine historischen Anomalien. Die Gefahr, dass wieder solche Herrschaftssysteme errichtet werden, ist real.
Wie würden die Demokratien diesmal zu Grunde gehen? Würde ihr Ende von Massenunruhen begleitet werden, wie man es im Januar 2021 in den USA befürchten musste? Würden sie mit lautem Getöse zerbrechen wie in einigen afrikanischen Ländern, die ich vor zwei Jahren einmal bereisen konnte, etwa in Mali oder Niger? Oder würden sie dahinsiechen, in Dunkelheit sterben, wie die Washington Post behauptet?
In den 1920 Jahren, also vor 100 Jahren, führte mit Benito Mussolini erstmals ein Diktator eine faschistische Regierung an. Im April 1945 starben die beiden mächtigsten Faschisten, die die Welt gesehen hat, innerhalb von zwei Tagen. Was ist heute Faschismus? Ist eine solche Bezeichnung für Bewegungen des 21. Jahrhunderts überhaupt noch passend oder ist sie eine polemische Überspitzung, die den Blick verstellt? Ich gehe der Frage nach, auch im historischen Rückblick. So wie es für Wirtschaftsjournalisten wichtig ist, die Dynamik vergangener Wirtschaftskrisen zu untersuchen, etwa die von 1929. Ich will nicht gleichsetzen, sondern Muster erkennen, auch Unterschiede.
So viel lässt sich mit Gewissheit sagen: In den allerwenigsten Fällen putschen sich die neuen Führer gewaltsam an die Macht, sie kommen nach freien Wahlen dorthin, ganz ohne Zwang, getragen von Millionen von Menschen. Sie bezeichnen sich selber auch nicht als autoritär oder faschistisch; natürlich wissen sie, dass derlei Begriffe belastet sind. Sie sind geschickter: Ihr Angriff auf die Demokratie erfolgt im Gewand der Verteidigung der Demokratie.
Um die Demokratien des Westens zum Einsturz zu bringen, braucht es also nicht Wladimir Putin. Viele Menschen zerstören gerade selber ihre Demokratie. Aktuelle Regierungen sind daran nicht schuldlos. Ich habe aber auch Menschen kennengelernt, die sich den Feinden der Demokratie in den Weg stellen, mit Mut und mit Erfolg.
Ich bin durch die Südstaaten der USA gereist, durch Argentinien, durch Deutschland und durch Norditalien. Wo es sich anbietet, blicke ich in die Vergangenheit dieser Länder. Und wo es möglich ist, wage ich einen Blick in ihre Zukunft.
Mein Erlebnisbericht ist eine Momentaufnahme. Noch ist mir nicht klar, ob wir mitten im Sturm sind oder kurz davor.
IM WESTEN
Martin
Den ersten Tag des neuen Jahres verbringen wir an einem für mich besonderen Ort. Vom Petersberg aus kann man weit den Rhein hinabblicken, über Bonn hinaus, sogar die Türme des Kölner Doms sind zu erkennen. Wenn man auf die andere Rheinseite schaut, sieht man Bad Godesberg, auch Muffendorf, dort bin ich aufgewachsen. Meine gesamte Jugend lang habe ich von meinem Elternhaus aus auf den Petersberg und das gelbliche Hotel auf seinem Hochplateau geschaut. Ein Ort, an dem sich deutsche Geschichte und meine kleine Familiengeschichte kreuzen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen hier die Hohen Kommissare der westlichen Siegermächte zusammen, mit ihnen vereinbarte Konrad Adenauer den Weg des von ihnen besetzten Teils Deutschlands in die Eigenständigkeit. Später diente das Haus als Staatsherberge, Kanzler Willy Brandt ließ hier oben Leonid Breschnew nächtigen. Um ihn zu umschmeicheln, schenkte er ihm einen Mercedes Coupé der luxuriösen SLC-Klasse. Die Bonner reißen noch heute Witze darüber, dass Breschnew das teure Spielzeug auf der Serpentinenstraße den Berg hinunter zu Schrott fuhr.
Kurz darauf gab die Bonner Regierung den Betrieb der Herberge auf und ließ das Gebäude verfallen. Wer Teile des Gemäuers und der Innenausstattung suchen will, sollte sich einmal die Privathäuser in den Nachbargemeinden anschauen. Das Haus auf dem Berg diente als Fundgrube für die Bewohner von Nieder- und Oberdollendorf sowie Königswinter, die ihre Eigenheime aufhübschten.
Für uns junge Godesberger wurde der Petersberg zu einem anderen Sehnsuchtsort, und jetzt komme ich zu meiner sehr persönlichen Geschichte. Als Jugendliche träumten wir davon, den leerstehenden Prachtbau zu besetzen und in ein autonomes Jugendzentrum zu verwandeln. In unserer Fantasie teilten wir die riesigen Zimmer unter uns auf, im alten Speisesaal sollten abends Rockbands auftreten. Ich erinnere mich, wie in den späten 70er Jahren mein Cousin Martin aus Chicago zu Besuch kam, wie wir auf meinem Moped die Straße den Berg hoch knatterten und dann durch die prominente Ruine strolchten. Der historische Ort wurde unser Abenteuerspielplatz.
Es gibt noch ein Ereignis, das in unserer Familiengeschichte bedeutsam war. Jahre vor der Hotelschließung, im Jahr 1955, haben meine Eltern hier oben ihre Hochzeitsnacht verbracht.
Das ist auch der Grund, warum meine Mutter uns, ihre Großfamilie, zu Beginn des neuen Jahres 2024, im längst wiedereröffneten Hotel Petersberg um sich versammelt. Sie will hier oben mit drei Generationen ihren 90. Geburtstag feiern. Zu diesem Familienfest kommt auch Martin, er ist mit seiner Frau den langen Weg aus Connecticut angereist. Es ist ein freudiges, ein herzliches Wiedersehen nach vielen Jahren.
Dieser Martin ist der eigentliche Grund, warum ich gleich zu Beginn so viel von dem Gebäude hoch über Bonn und von dem Familientreffen schreibe. Die Begegnung mit ihm erzählt mir einiges über die tiefe Zerrissenheit Amerikas; auch kann man, wenn man die Zeichen richtig deutet, ein wenig in die Zukunft der Demokratie und der großen geopolitischen Verschiebungen schauen. Mein amerikanischer Cousin orientiert sich ganz an Donald Trump, seinem Idol. Das Wiedersehen mit ihm setzt für mich den Ton für das gesamte Jahr. Daher möchte ich ihn kurz etwas näher vorstellen.
Alles nahm Mitte der 50er Jahre seinen Anfang. Bald nachdem meine Mutter in Bonn heiratete, verließ ihre jüngere Schwester Loretta ihre Heimat, das Rheinland, und wanderte in die USA aus, nach Chicago. Sie heiratete ebenfalls, gebar fünf Kinder, darunter Martin. Trotz der großen Entfernung und des trennenden Atlantiks blieben unsere Familien eng miteinander verbunden. Wir freuten uns über den gelegentlichen Besuch der Verwandten aus Übersee, oder wir verbrachten die Sommerferien gelegentlich in Illinois bei Loretta und ihrer Familie. Ich erinnere mich, wie Martin und ich im August 1974 in der amerikanischen Nachbarschaft Zeitungen austrugen. Sogar eine Schlagzeile der Chicago Tribune habe ich noch vor Augen: «Nixon resigns!» Es war der Höhepunkt der Watergate-Affäre, der Präsident war zurückgetreten. Erst viele Jahre später wurde mir klar, wie sehr in diesen Wochen die amerikanische Politik erschüttert worden war und auch das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Volksvertreter.
Martin und ich blieben in Kontakt, als wir erwachsen wurden, nördlich von New York gründete er einen Handwerksbetrieb, er renoviert Häuser, auch ich habe dort mal einige Zeit gejobbt. Wir teilten die Vorliebe für Basketball und laute Rockmusik. In einem Sommer Ende der 80er Jahre lud mich Martin einmal zu einem Ausflug mit seinem Pickup-Truck ein, er saß am Steuer, ein Freund von ihm und ich standen hinten auf der Ladefläche und ließen uns den Wind durch die Haare wehen. Etwa zwei Stunden lang fuhren wir so die Küstenstraße Richtung Süden entlang. In Atlantic City besichtigten wir das Trump Casino. Es war das erste Mal, dass Martin und ich mit dem Namen dieses Glücksritters in Berührung kamen: Trump.
In späteren Jahren kamen Themen auf, die sich zwischen uns schoben, politische Themen. Während ich, um es einfach zu sagen, dem amerikanischen Imperialismus der 1970er und 1980er Jahre skeptisch gegenüberstand, musste ich mir von Martin Sprüche anhören, nach denen die USA die größte Nation auf Erden sei. Er entwickelte sich zum glühenden Anhänger der Republikanischen Partei und verteidigte voller Leidenschaft die Präsidenten Reagan, Bush Senior und später Bush Junior. Und es gab noch eine Überzeugung, in die er sich von früh an eingemauert hatte: Während Amerika – er meinte natürlich die Vereinigten Staaten – Gottes auserwähltes Land sei, war Russland für ihn die Inkarnation des Bösen, ein Reich, das es zu bekämpfen gilt.
Zwei Dinge liegen mir noch auf dem Herzen, bevor ich ausführlicher auf unser Neujahrstreffen zu sprechen komme: In seiner Begeisterung für die Sache der Republikaner sticht Martin aus dem amerikanischen Teil unserer Familie heraus. Der Rest unserer Verwandtschaft denkt gemäßigt liberal oder ist an politischen Themen wenig interessiert.
Und dann gibt es noch etwas, und dieser Hinweis ist mir noch wichtiger: Obwohl uns politisch mehr als ein Ozean trennt, verstehen wir uns als Cousins unverändert gut. Ich möchte es deutlich und unmissverständlich sagen: Martin ist hilfsbereit, er ist überaus charmant, er nimmt jeden und jede mit seinem rheinisch-amerikanischen Humor und seinem durch nichts zu trübenden Selbstbewusstsein für sich ein. Wenn er sich wohlfühlt, und das tut er meistens, legt sich ein verschmitztes Lächeln auf sein Gesicht, wie beim frühen Elvis Presley; auch auf den werde ich später noch zurückkommen. Außerdem ist Martin nicht so verbohrt, dass er sich politischen Grundsatzdiskussionen vollständig verweigern würde; er sucht die Auseinandersetzung. Ich glaube, ich habe ausreichend erzählt, dass mein Cousin ein liebenswerter Mensch ist, den ich sehr mag.
Aber … da steht seit Jahrzehnten ein großes Aber zwischen uns. Als wir uns an diesen ersten Tagen des neuen Jahres wiedersehen, stellen wir bald fest, dass dieses Aber nicht gerade kleiner geworden ist. Nein, das Aber wächst und wächst.
Am Mittag ziehen wir uns zu einem Gespräch in eine Nische der Hotellobby zurück, der Kellner serviert Wasser und Limonade («with lots of ice, please»). Wir sprechen darüber, dass er, wie viele andere Amerikaner und auch ich in Deutschland, im Jahr 2016 vom Wahlsieg Donald Trumps überrascht war. Er sympathisierte mit Trump, als Wahlhelfer wurde er damals sogar ein kleiner Teil von dessen Kampagne, und doch hielt Martin einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl vor acht Jahren für unwahrscheinlich. Am Wahlabend machte er sich von seinem Haus in Connecticut aus auf den Weg und besuchte Trumps Party im New Yorker Hilton Hotel. Als er Stunden später im Sonnenaufgang den West Side Highway von Manhattan entlang nach Hause fuhr, fühlte er sich ganz prächtig: Donald Trump, sein Kandidat, hatte gewonnen. Kein Zweifel, jetzt würde es mit Amerika wieder aufwärts gehen.
Mein Blick auf Martins Held war ganz anders, und ich sah meine Befürchtungen bald bestätigt: Vier Jahre lang verprellte Donald Trump als Präsident westliche Regierungen, auch Angela Merkel, er verhöhnte seine Gegner im eigenen Land, er verbreitete Tausende Lügen und aberwitzige Verschwörungserzählungen, er hetzte gegen ethnische Minderheiten.
Mein Cousin hielt weiter treu zu ihm. Für Amerikaner wie ihn brachte Trump ein Gefühl alter Größe zurück, sie waren stolz auf ihr Land, auf ihren Präsidenten. Vier Jahre lang.
Als im Herbst 2020 feststand, dass Trump die nächste Präsidentschaftswahl verloren hatte, telefonierte ich mit Martin. Er schien sich wie ein fairer Sportler mit der Niederlage abzufinden und bescheinigte Joe Biden, «ein aufrechter Amerikaner» zu sein, immerhin. Für einen kurzen Moment kam mein Vertrauen in die Selbstheilungskräfte der amerikanischen Demokratie zurück – und auch der Glaube an den politischen Anstand meines Cousins. Doch dann entpuppte sich Trump als hundsmiserabler Verlierer, der seinem Rivalen Betrug unterstellte und sich weigerte, dem rechtmäßigen Sieger Platz zu machen. Ging Martin jetzt auf Distanz zu Trump oder folgte er ihm auch in seinem Wahn? Ich wusste es nicht, seit dem Winter 2020 hatte ich nur noch wenig Kontakt mit ihm, und wenn, dann sprachen wir über Privates.
Umso verblüffter bin ich, als mir Martin jetzt, Jahre später auf dem Petersberg, erzählt, wie die Geschichte weiterging ging mit ihm und Trump. Sofort kreist unser Gespräch um den 6. Januar 2021, der in die Geschichte Amerikas eingegangen ist als der Tag, an dem um die Zukunft der Demokratie gekämpft wurde, nicht mit Worten, sondern mit Fäusten und mit Feuerwaffen. Als einige Stunden lang offen war, ob die Angreifer der Demokratie gewinnen würden oder ihre Verteidiger. Jetzt entwickelt sich das Gespräch zwischen Martin und mir in eine Richtung, die ich nicht erwartet hatte. Je länger wir sprechen, desto unklarer ist, wen er für die Angreifer hält und wen für die Verteidiger. Bis mir bewusst wird, was mein Cousin wirklich denkt über diesen Tag, und auch, wo er diesen Tag verbracht hat.
An diesem 6. Januar, als Donald Trump seine Anhänger aufforderte, zu einem Massenprotest in die Hauptstadt zu reisen, machte sich auch Martin auf den Weg nach Washington. Er zog seine «Make-America-Great-Again»-Kappe auf, schulterte eine Stars-and-Stripes-Flagge und mischte sich unter die vielen tausend wütenden Demonstranten. Sie alle wollten den Machtwechsel von Trump zu Biden verhindern, irgendwie. Mit seinem Smartphone führte Martin Interviews mit anderen Trump-Gefolgsleuten und lud die Videos später in sozialen Medien hoch. Niemand wollte die Wahlniederlage, ihre Niederlage, eingestehen. So wurde mein Cousin Teil einer dumpfen, immer lauter und aggressiver werdenden Masse, die in Richtung des Kapitols zog. Eindrucksvoll schildert er mir, wie er vor dem Parlament Schüsse hörte, es habe sich wohl nur um Tränengasmunition gehandelt. Die Knallerei habe ihm dennoch einen mächtigen Schrecken eingejagt.
Im ruhigen Hotel Petersberg zieht Martin plötzlich sein Handy aus der Tasche, er hat immer noch die Videos gespeichert, die er damals aufgenommen hat, und spielt mir ein paar der O-Töne von Demonstranten vor. In einem kleinen Lokalsender seiner Heimatstadt in Connecticut hat er eine eigene TV-Show, einmal pro Woche breitet er seine Sicht auf die Welt aus; kurz nach dem 6. Januar hat er dort ebenfalls seine Videos gezeigt.
Wenn man sich die Interviews mit dem Abstand von ein paar Jahren anschaut, dann fällt vor allem auf, dass Martin und die anderen Demonstranten fest von einem riesigen Skandal überzeugt waren. Ihnen sei die Wahl gestohlen worden, behaupten sie alle. Selbstverständlich, das beteuern sie immer wieder, hätten sie nichts gegen Demokratie als Staatsform einzuwenden. Im Gegenteil, sie reden davon, nicht nur die Wahl sei ihnen gestohlen worden, sondern sie hätten Sorge, dass ihnen gleich die ganze Demokratie weggenommen werden würde. Sie sprechen von ihrer Angst vor einer «Versklavung». Das Wort fällt tatsächlich. Als ob man in Amerika nicht genau wüsste, was «Sklave» bedeutet.
Martin vergleicht die Massenkundgebung von damals sogar mit dem Gefühl einer kollektiven Befreiung und kommt immer mehr ins Schwärmen; so hätten sich wohl auch die Besucher von Woodstock ein halbes Jahrhundert zuvor gefühlt. Jimi Hendrix mit Donald Trump zu vergleichen, friedensbewegte Hippies mit gewaltbereiten Putschisten – ich staune.
Seine Vergleiche mögen abwegig sein, aber sie helfen mir, etwas zu verstehen. Allmählich dämmert mir, dass sich an diesem 6. Januar 2021 zwar ein Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie erhob, aber nicht von Anti-Demokraten, sondern von Menschen, die allen Ernstes glaubten, die Demokratie gegen eine drohende Diktatur verteidigen zu müssen. Was für eine seltsame Verdrehung: Angreifer als Verteidiger. Und Verteidiger als Angreifer. Was für eine Leugnung des tatsächlichen Wahlausgangs, was für eine Leugnung des konstitutionell festgelegten Machtwechsels. Wie kann Martin, mein Martin, bloß einer solchen Erzählung folgen?
Eine ganze Weile sitzen wir zusammen, schauen uns Videos dieses Tages an und tauschen unsere Erinnerungen und Wahrnehmungen aus. Sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Und sie werden uns in den nächsten Monaten noch weiter beschäftigen. Im gerade neu aufziehenden Wahlkampf wird auch die Aufarbeitung des Aufruhrs eine Rolle spielen.
Für Martin ist der Versuch einiger Bundesstaaten wie Colorado oder Maine, Donald Trump wegen seiner Rolle beim Putschversuch nicht zur Wahl zuzulassen, ein neuer Skandal. Wieder geht es um die Demokratie. «Die Gerichte wollen die Demokratie verteidigen, indem sie den Namen des aussichtsreichsten Kandidaten vom Wahlzettel streichen?», spottet er. «So etwas verstehen die Liberalen also unter Demokratie!» Er lacht höhnisch auf. Dann verweist er darauf, dass Trump zwar vorgeworfen wird, die Menge zum Sturm aufs Kapitol angestachelt zu haben, er sei deswegen aber bislang nicht verurteilt worden. Dass der Strafprozess gegen ihn in dieser Angelegenheit noch gar nicht begonnen hat, sagt er nicht.
Immer mehr redet er sich in Schwung und teilt gegen «die Medien» aus: «Niemand ist heutzutage weniger glaubwürdig als Journalisten.» Alle Versuche, Trump anzuhängen, er habe gegen Gesetze verstoßen oder sich undemokratisch verhalten, seien im Sande verlaufen. «All diese großen Journalisten haben gelogen, allesamt gelogen.» Martin argumentiert jetzt nicht mehr humorvoll; aus seiner Stimme ist jegliche Ironie entwichen. Er wird zornig. Für einen Moment scheint er zu vergessen, dass ich selber Journalist bin. Vielleicht bin ich als Deutscher, als Verwandter zumal, kein lohnendes Ziel für seine Erregung. Und außerdem, es stimme zwar, dass beim Sturm aufs Kapitol der Protest ein wenig außer Kontrolle geraten sei. Doch man könne deswegen noch lange nicht von einem Aufstand sprechen. Auch in diesem Punkt unterscheiden sich unsere Wahrnehmungen. Aber okay, Martin stand an diesem Tag vor dem Kapitol, ich saß nur in Hamburg vor dem Fernseher.
Nachdem wir uns eine Weile lang im Kreis gedreht haben, wollen wir nach vorne schauen, auf die kommenden Monate. Martin schwärmt von einer Wiederwahl Trumps im November. Und er hat ein geradezu umwerfendes Argument: «Die Schönheit dieser Kandidatur …», er spricht tatsächlich von Schönheit, also «die Schönheit dieser Kandidatur besteht darin, dass wir diesmal genau wissen, was er tun wird. Er hat es ja vier Jahre lang vorgemacht.» Man kann das als Drohung verstehen, Martin versteht es als Verheißung.
Unstrittig ist, das sieht auch Martin so, dass sich seit Donald Trumps letzter Präsidentschaft Entscheidendes getan hat. Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat das geopolitische Gleichgewicht in der Welt dramatisch verändert.
Was würde ein wiedergewählter Präsident Trump tun? Martin reibt sich förmlich die Hände und erinnert an die herausragenden Fähigkeiten des Geschäftsmanns Donald Trump, der sei schließlich ein begnadeter Dealmaker. Als solcher habe er versprochen, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Aber die Wahl ist an diesem Tag mehr als elf Monate weit weg, elf Monate sind in der Politik, und erst recht im Krieg, eine Ewigkeit.
Wir sprechen dann eine Weile über Wladimir Putin, der ja unabkömmlich für einen solchen Blitz-Deal wäre. Martin hat nicht nur von Trump eine klare Vorstellung, sondern auch von Putin. Er macht sich keine Illusionen, der russische Präsident würde als ehemaliger KGB-Mann von der Wiederherstellung des Sowjetimperiums aus den Zeiten von Leonid Breschnew träumen. Er würde sich von der Osterweiterung der Nato bedrängt fühlen, wolle den Spieß jetzt umdrehen und den Einflussbereich seines Landes wieder nach Westen ausdehnen. In Wahrheit würde es Putin, werfe ich in unsere Diskussion ein, nicht allein um die Eroberung von ein paar Städten und Dörfern in der Ostukraine gehen. Seine Expansionsgelüste würden sich weit darüber hinaus erstrecken. Eine 24-Stunden-Abmachung mit diesem Wladimir Putin anzustreben, könne ja nur darauf hinauslaufen, ihm mindestens ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes zu überlassen. Das sei nicht nur naiv, das sei auch gefährlich für den Rest Europas. Putin könne das als Belohnung für seinen Krieg empfinden und als Ermunterung, weitere Nachbarstaaten zu überfallen.
Das sei eine nicht von der Hand zu weisende Gefahr, gibt Martin zu. Dann sagt er zu meiner Überraschung, dass er sich umfassend mit der Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs beschäftigt habe, da gäbe es eine Parallele, als die englische Regierung versucht habe, mäßigend auf Hitler einzuwirken. Er spielt auf das Münchner Abkommen an. Was Martin nicht weiß, ist, dass die Verhandlungen zu diesem Abkommen ihren Anfang an dem Ort hatten, an dem wir gerade zusammensitzen und Limonade trinken, am Petersberg. Da ich gegenüber auf der anderen Rheinseite aufgewachsen bin, ist mir das Treffen von Neville Chamberlain und Adolf Hitler geläufig. Für Martin ist die Geschichte neu.
Im September 1938 residierte der britische Premierminister hier oben im Hotel und ließ sich ein paar Tage lang immer wieder auf der Fähre zum Rheinhotel Dreesen am anderen Ufer übersetzen, um dort Hitler zu treffen. Nazideutschland hatte massiv aufgerüstet, ein großer Krieg lag in der Luft. In seiner Not bot Chamberlain dem Deutschen das Sudetenland in der Tschechoslowakei an. Er glaubte, ihn so besänftigen und den großen Krieg verhindern zu können. Ein paar Tage später reisten die beiden nach München und setzten, gemeinsam mit dem französischen Premier Daladier und dem italienischen Diktator Mussolini, ihre Unterschrift unter einen Vertrag, der fortan als Münchner Abkommen bekannt war. Überall kann man heute lesen, dass Chamberlains Appeasement-Strategie gescheitert ist, weil sie Hitlers Angriff auf andere europäische Staaten erleichtert hat. Die Eckpunkte des Abkommens wurden also hier am Rhein vorbesprochen.
Es liegt nahe, nach Russlands Einmarsch in der Ukraine Neville Chamberlain mit Donald Trump zu vergleichen, auch wenn beide sonst wenige charakterliche und politische Übereinstimmungen aufweisen. Aber Trumps wiederholte Bemerkung, als neuer Präsident würde er den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden, kann man nur so verstehen, dass er dem Land jegliche Unterstützung entziehen und Putin die bereits besetzten Ostgebiete überlassen würde. Die größte Gefahr für den Weltfrieden geht daher aktuell nicht von Wladimir Putin aus, argumentiere ich, sondern von einer Kombination aus Wladimir Putin und Donald Trump.
Jetzt widerspricht Martin. Er würde doch sehr hoffen, dass Donald Trump, der gerade das Gegenteil eines Berufspolitikers sei, einen wirkungsvolleren Ansatz verfolgen würde, um diesen Krieg zu beenden. Das ist mir zu blauäugig, antworte ich, wenn ein möglicher Präsident Trump seinem Dealpartner Putin ein Fünftel des von ihm überfallenen Staates überließe, würden die Spielregeln der Vereinten Nationen, die die Mitgliedsstaaten zum friedlichen Miteinander verpflichten, auf absehbare Zeit außer Kraft gesetzt werden. Andere Kriegsherren in anderen Nationen könnten es Putin gleichtun.
Ja, diese Gefahr würde er ebenfalls sehen, sagt Martin. Aber der augenblickliche Zustand der Ukraine sei unerträglich. Und dem amtierenden Präsidenten Joe Biden würde er einfach nicht zutrauen, diesen Konflikt zu beenden. Biden sei so altersschwach und senil, dass man sich vielmehr die Frage stellen müsse, wer in der aktuellen amerikanischen Regierung die notwendigen Entscheidungen treffe. Biden sei das wohl nicht. Das kann man glauben oder nicht, sage ich, wer will das von außen beurteilen. Aber energisch widersprechen kann ich ihm in diesem Punkt nicht.
Die anderen Verwandten drängeln schon, unsere Familienfeier soll bald beginnen. Eine letzte Frage habe ich noch an Martin: Wie beurteilt er die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft heute, nach drei Jahren Regierungszeit von Joe Biden? Vordergründig will mein Cousin etwas Zuversicht verbreiten: «Eigentlich sind wir gar nicht so gespalten, wie man gemeinhin denkt.» Die wahre Spannungslinie verlaufe nicht zwischen Republikanern und Demokraten, sondern zwischen den Insidern der Macht und denen, die sich ausgeschlossen fühlen. Am Ende aber würden die Amerikaner zusammenstehen. Auch das kann man glauben oder nicht.
Die Aussichten für sein Land, für den globalen Westen überhaupt, sind zu Beginn dieses Jahres düster. Da ist die Wahl im November, die zur Abstimmung über die Zukunft der Demokratie werden kann. Da ist der Krieg in der Ukraine, der die USA und ihre Verbündeten unter massiven Druck setzt. Da ist der Krieg zwischen Israel und der Hamas, der sich, was zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist, weiter ausweiten wird. Ich denke auch an die Wahlen in Ostdeutschland im September.
Aber da ist auch unser deutsch-amerikanisches Familientreffen. Martin und ich stehen auf, reichen uns die Hand, wir lachen kurz und gehen dann zu den übrigen Verwandten. Heute Abend werden wir im großen Kreis unsere Sorgen wegtrinken und wegsingen.
Was wir nicht wegtrinken und wegsingen können, sind die erheblichen Unterschiede zwischen unseren Standpunkten. Und auch mein Erstaunen über den geliebten Cousin bleibt bestehen. Es wird sogar größer. Wieso hat sich Martin so verändert, wieso hat sich Amerika so verändert? In den nächsten Tagen reift ein Entschluss. Ich werde reisen.
Bauernopfer und Planspiele
An diesem Januarmorgen werde ich durch Motorenlärm und lautes Gehupe geweckt. Ich kann das Getöse nicht gleich einordnen, dann fällt mir ein, dass Deutschlands Landwirte heute protestieren wollen. Auf der Ausfallstraße, die von Schleswig-Holstein aus ins Hamburger Stadtzentrum führt, stauen sich Treckerfahrer und Pendler. Aus unterschiedlichen Gründen sind alle genervt.
Der Ärger hat seinen Ursprung in der Hauptstadt. Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner und ihre Fachleute haben sich verspekuliert, wenn man es böse mit ihnen meint, könnte man auch sagen: Sie haben sich verzockt. Das Bundesverfassungsgericht hält weite Teile ihrer Haushaltsplanung für verfassungswidrig, jetzt müssen schnell hohe Milliardenbeträge eingespart werden. Kurz vor Weihnachten hat die Regierung angekündigt, die Subventionen für Landwirte zu kürzen. Das Timing war schlecht und die Kommunikation mit den Betroffenen nicht besser. Die Bauern sehen sich als Opfer einer verfehlten Politik, die die Lasten des Sparens einseitig auf ihren Schultern ablädt. Vor wenigen Tagen haben Scholz, Habeck und Lindner den Unmut vom Lande kommen sehen und einige ihrer Kürzungspläne zurückgenommen, andere über ein paar Jahre gestreckt. Doch das kommt zu spät. Bei den Bauern hat sich so viel Wut aufgestaut, dass sie sich nicht mehr besänftigen lassen. Sie fahren in Richtung der Städte und blockieren Zufahrtstraßen.
Der Protest zeigt, dass die Regierung in Berlin die Nöte der Bauern völlig falsch eingeschätzt, sogar übersehen hat. Plötzlich wird ein Groll erkennbar, den der Kanzler und seine Leute auf die Schnelle nicht richtig einordnen können. Geht es nur um Sparmaßnahmen oder geht es um mehr? Auf Deutschlands Straßen wird ein Konflikt zwischen Metropole und Provinz ausgetragen, auch zwischen denen, die Macht haben, und denen, die sich ohnmächtig fühlen. War dieses Machtgefälle, das Gefühl, von der Regierung und auch von Journalisten nicht ausreichend beachtet zu werden, nicht eine wesentliche Ursache für den überraschenden Wahlerfolg von Donald Trump, damals im Herbst 2016? Empfindet die Landbevölkerung von Sachsen, Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein genauso wie die Landbevölkerung von Iowa, Kansas oder Wyoming?
Sahra Wagenknecht kommt an diesem Vormittag besser durch den Berliner Straßenverkehr, als sie dachte. Der Fahrer ihres Dienstwagens wurde nirgends aufgehalten, vielleicht kannte er auch die richtigen Schleichwege. Jedenfalls erreicht Wagenknecht mit ihrer Entourage die Bundespressekonferenz zwanzig Minuten zu früh. Dort will sie ihre neue Partei vorstellen, live im Fernsehen, monatelang war über die Trennung von der Linkspartei öffentlich spekuliert worden. Die heute gewonnene Zeit nutzt sie, um sich ausgiebig vor den Fotografen in Position zu stellen. Mal lächelt sie, mal blickt sie nachdenklich, dann entschlossen. Einen Moment lang ist nicht klar, ob sie eine neue Partei oder einen neuen Film vorstellen will. Sie drückt ihren Rücken gerade und genießt den Auftritt. Als alle ihre Fotos gemacht haben und sich hinsetzen, beginnt Wagenknecht, ihre politischen Absichten zu umreißen. Sie will Deutschland wirksamer vor Migranten abschotten, zügig in Verhandlungen mit Wladimir Putin eintreten und Autos mit Verbrennermotoren länger fahren lassen. Das dürfte all denen gefallen, die sich nach einer heilen-Welt-Vergangenheit sehnen. Ihr grob umrissenes Konzept kommt einem auch bekannt vor, die AfD klingt ganz ähnlich.
Gegen die amtierende Bundesregierung holt die Parteigründerin mächtig aus. Eine Politik, von der sich immer mehr Menschen im Stich gelassen fühlen, gefährde «die Demokratie in unserem Land». Sie wolle «die Unfähigkeit und Arroganz im Regierungsviertel» überwinden. Aha, ihr geht es ums große Ganze, darum, den Graben zwischen Politik und Bevölkerung zu überwinden. Ist dieser Graben in Deutschland wirklich so groß oder tut Sahra Wagenknecht nur so und vergrößert ihn damit?
Einige Zeitungen loten an diesem Tag Wagenknechts Chancen bei den anstehenden Wahlen in Europa und Ostdeutschland aus. Mit der neuen Partei ist zu rechnen, vielleicht irgendwann auch als Juniorpartner in einer Regierung. Aber schon in diesem Jahr?
An diesem Tag gehen die Fantasien einiger Redaktionen noch weiter, sie spekulieren über einen vorzeitigen Wechsel im Kanzleramt. Der beliebte Verteidigungsminister Boris Pistorius könne den unbeliebten Olaf Scholz ablösen. Die Hauptstadtpresse kommt schnell auf Betriebstemperatur. Im Minutentakt senden Online-Medien Schlagzeilen zu wütenden Bauern, dem nahen Streik der Lokführer, Szenarien für einen Wagenknecht-Boom und einen Kanzler-Sturz.
Nürnberg
Meine erste Reise in diesem Jahr geht im Schnellzug von Hamburg nach Nürnberg, wo ich über die Erkenntnisse aus meinem letzten Buch über die Ampel-Koalition diskutieren soll. Deutschland liegt friedlich unter einer dicken Schneedecke, mit 250 km/h donnern wir erst durch Brandenburg, dann durch Thüringen. «Über allen Gipfeln ist Ruh’, in allen Wipfeln spürest Du kaum einen Hauch», notierte Johann Wolfgang Goethe, als er durch diese Landschaft wanderte. Wie sich das Reisen doch verändert hat, und damit auch unser Blick.
Bei der rasenden Durchquerung von Thüringen kommt mir die AfD in den Sinn, und dass sie von vielen Bürgern als ernste Gefahr für das Gemeinwesen betrachtet wird, von anderen, ebenfalls zahlreichen Bürgern hingegen als einzig wahre Vertretung ihrer Interessen. Kaum ein Zeitungsartikel, kaum eine Fernsehsendung kommt inzwischen ohne den Hinweis aus, dass die Partei in Thüringen vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch angesehen wird. Was läuft schief in einem Bundesland, in dem die AfD dennoch Chancen hat, die stärkste Fraktion im Landtag zu stellen, vielleicht sogar den Ministerpräsidenten? Ist es ungerecht, unstimmig, bei der Fahrt durch Thüringen nicht nur an den Wanderer Johann Wolfgang Goethe zu denken, sondern wie in einem lästigen, unbeherrschbaren Reflex gleich auch an die Rechtsaußen-Partei? Natürlich ist es das. Aber die düsteren Gedanken drängen sich auf. In diesem Jahr werden mehrere wichtige Wahlen stattfinden und immer mehr Stimmen werden laut, die AfD zu verbieten. Auch gibt es Überlegungen, Björn Höcke, dem thüringischen Fraktionschef, bestimmte Grundrechte zu entziehen und ihn so von der Landtagswahl auszuschließen. Sollen Gerichte die Demokratie retten? Die Diskussionen in den USA und in Deutschland ähneln sich.
Etwas Ungewöhnliches passiert, der Zug kommt pünktlich in Nürnberg an; ich habe noch ein paar Stunden Zeit bis zum Beginn der Veranstaltung. Was mache ich bis dahin? Wie weit ist es von der Stadtmitte zum ehemaligen Reichsparteitagsgelände? Der Portier meines Hotels antwortet im breiten Fränkisch, ich möge einfach die Tram Nummer 8 nehmen, in gut fünfzehn Minuten sei ich am Ziel.
In der Straßenbahn fällt mir der Name einer Haltestelle auf, «Platz der Opfer des Faschismus» steht da in digitalen Buchstaben auf der Anzeigentafel. Das gefällt mir, wer zum ehemaligen Treffpunkt der Nazis will, muss erst am Platz der Erinnerung an ihre Opfer vorbei. Ein paar Stopps weiter stehe ich am Eingang des Geländes, auf dem Hitler Untergebene aus dem ganzen Reich aufmarschieren ließ. Das Areal ist riesig, die Tribüne, die Albert Speer für die Reden des Diktators errichten ließ, ist etwa einen Kilometer entfernt. Dazwischen liegt ein breiter See, um den man üblicherweise herumlaufen muss. In diesen Winterwochen ist er jedoch zugefroren, daher nehme ich die Abkürzung über die Eisfläche, vorbei an schlittschuhlaufenden Kindern. Was für schöne, friedliche Bilder. Wie sehr unterscheiden sie sich von den Bildern, die sich in meiner Erinnerung an diesen Ort eingebrannt haben; Bilder, die Leni Riefenstahl in ihrer hymnischen Verehrung für Hitler auf Celluloid gestaltet hat.
Als ich vor der monumentalen Tribüne stehe, von wo aus Hitler die zahllosen Abgesandten der deutschen Gaus aufmarschieren ließ, staune ich erneut über die Dimension des Geländes und die Menge der hier verbauten Steine. Hitler ging von der Ewigkeit seines «tausendjährigen Reiches» aus, und auch davon, dass ihm die Massen der deutschen Bevölkerung Zeit seines Lebens folgen würden. Deshalb wollte er seine Macht pyramidengleich für immer in unzähligen Quadern festhalten.
Zum Höhepunkt des Nazi-Kults zwischen 1934 und 1938 strömten einmal jährlich über eine Million Menschen nach Nürnberg, Menschen aus allen Gegenden des Reiches. Besonders eindrucksvoll war für die Parteiführer der Aufmarsch der militärischen und paramilitärischen Organisationen von Wehrmacht, der Sturmabteilung SA, der Schutzstaffel SS, der Hitler-Jugend, des Bundes Deutscher Mädels und des Reichsarbeitsdienstes. Bis zu 150.000 Menschen standen zeitgleich auf dem Platz, viele von ihnen versammelten sich auch in der Luitpoldhalle. Wenn man im Internet ein wenig stöbert, stößt man auf eine fotografische Aufnahme der vollbesetzten Halle. Hinter der Bühne ist in riesigen Lettern der Spruch «Alles für Deutschland» zu lesen, er wird mich später noch beschäftigen.
Was haben all diese Menschen gedacht, was haben sie empfunden, als sie Hitler zujubelten? Fühlten sie sich in der Menschenmasse als kleiner, aber wichtiger Teil von etwas, das größer war als sie, viel größer? Fühlten sie sich als Teil einer von der Geschichte legitimierten Bewegung? Haben sie in dem Mann mit strengem Scheitel und kurzem Schnauzbart den ersehnten Retter gesehen, der mit allen Problemen aufräumt, der all seine und all ihre Feinde rigoros beseitigt? Sie müssen zu einem Heilsbringer emporgeblickt haben, zu einem Gottgesandten.
Da ich im kalten Winter des Jahres 2024 hier stehe und die aktuellen Nachrichten im Kopf habe, muss ich an den großen Verführer in den USA denken. Wen hatte Donald Trump wohl im Sinn, als er neulich davon sprach, im Falle seiner erneuten Wahl würde er gerne Diktator sein, für einen Tag, aber immerhin. Den Satz sagte er nur halb im Scherz. Etwas später versprach er, im Fall seines Wahlsiegs «Kommunisten, Marxisten, Faschisten und die radikalen linken Verbrecher, die wie Ungeziefer in unserem Land leben, auszurotten». Das klingt gar nicht nach einem schlechten Scherz.
Während ich auf dem historischen Parteitagsgelände stehe, drängen sich noch weitere Assoziationen auf. Es ist schwer, sich gegen sie zu wehren. Der Für-einen-Tag-Möchtegern-Diktator Trump hetzte gegen illegale Einwanderer: «Sie vergiften das Blut unseres Landes. […] Sie kommen von überall her, aus Afrika, aus Asien, von überall, und dringen in unser Land ein.» Ist Donald Trump ein zweiter Hitler? Nein, das ist er nicht. Ist Donald Trump ein Rassist? Natürlich ist er das.