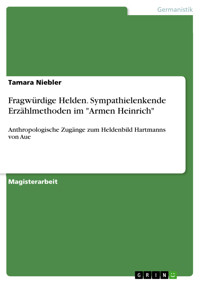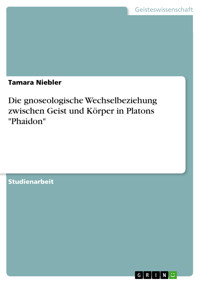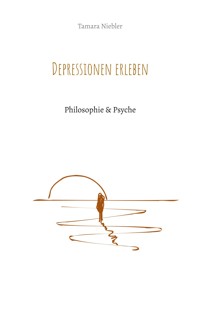
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie fühlt es sich an, depressiv zu sein? Um zu verstehen, was mit einem Menschen in einer Depression passiert, ist ein kritischer Blick hinter die klinische Diagnose notwendig. Depressionen sind etwas anderes als mehr Traurigkeit, weniger Freude oder tiefe Erschöpfung. Vielmehr sind sie ein Mangel an grundlegenden Qualitäten und Möglichkeiten, die stets mit den Strukturen verknüpft sind, in denen sich das Leben eines Menschen abspielt. Dieses Buch untersucht das komplexe Phänomen der Depression aus phänomenologischer Perspektive, und eröffnet damit ein Verständnis, das weit über konventionelle psychopathologische Erklärungsansätze hinausgeht. Die Phänomenologie ist eine philosophische Strömung, die sich mit den Strukturen der Erfahrungen auseinandersetzt und einen Rahmen bietet, der das subjektive Erleben von Depression würdigt. Entsprechend sind depressive Zustände kein persönliches Defizit, sondern eine mögliche Form menschlicher Existenz unter ganz bestimmten Bedingungen. Die Autorin zeichnet empathisch nach, was sich in einer Depression im Selbsterleben Betroffener verändert und wie sich diese Veränderungen auf Wahrnehmung und Bedeutung auswirken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wie fühlt es sich an, depressiv zu sein? Um zu verstehen, was mit einem Menschen in einer Depression passiert, ist ein kritischer Blick hinter die klinische Diagnose notwendig. Depressionen sind etwas anderes als mehr Traurigkeit, weniger Freude oder tiefe Erschöpfung. Vielmehr sind sie ein Mangel an grundlegenden Qualitäten und Möglichkeiten, die stets mit den Strukturen verknüpft sind, in denen sich das Leben eines Menschen abspielt.
Dieses Buch untersucht das komplexe Phänomen der Depression aus phänomenologischer Perspektive – und eröffnet damit ein Verständnis, das weit über konventionelle psychopathologische Erklärungsansätze hinausgeht. Die Phänomenologie ist eine philosophische Strömung, die sich mit den Strukturen der Erfahrungen auseinandersetzt und einen Rahmen bietet, der das subjektive Erleben von Depression würdigt. Entsprechend sind depressive Zustände kein persönliches Defizit, sondern eine mögliche Form menschlicher Existenz unter ganz bestimmten Bedingungen.
Die Autorin zeichnet empathisch nach, was sich in einer Depression im Selbsterleben Betroffener verändert und wie sich diese Veränderungen auf Wahrnehmung und Bedeutung auswirken.
In Gedenken an Yasar Arisoy und Walter Niebler
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Die Phänomenologie
Lebenswelt
Die Verfremdung der Lebenswelt
Leiblichkeit
Die Korporifizierung des Leibes
Zeitlichkeit
Die Störung der Zeit
Intersubjektivität
Der Verlust der Zwischenmenschlichkeit
Willen- und Handlungsfreiheit
Die Disruption von Wollen und Handeln
Zusammenfassung: Phänomenologie der Depression
Resümee
Literaturverzeichnis
VORWORT
„Dem Menschsein ist seine Unfertigkeit, seine Offenheit, seine Freiheit und seine unabschließbare Möglichkeit selber Grund eines Krankseins.”
Karl Jaspers1
Über dieses Buch
Pathologisierung menschlichen Seelenlebens
Individualisierung sozialer Probleme
Elitäres Machtgefälle
Objektifizierung des Menschen
Depressionen verstehen
Depressionen zu erklären, ist fast unmöglich. Sie liegen an der Grenze des Erfahrbaren und Sprachlichen. Inzwischen sind zwar ein paar depressive Symptome aus Magazinen, Zeitungen oder TV bekannt, zum Beispiel Freudlosigkeit, Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit – aber was sagen diese Beschreibungen aus? Die Begriffe sind in ihrer Form schon irgendwie richtig, doch sie können nicht die Fremdheit des depressiven Erlebens wiedergeben oder sinngemäß vermitteln.
Depressionen sind etwas anderes als mehr Traurigkeit, weniger Freude oder tiefe Erschöpfung. Sie verändern nicht einfach nur einzelne Gedankengänge oder ein paar Gefühle. Vielmehr modifizieren sie den Rahmen und die grundsätzlichen Daseins-Bedingungen, in denen ein Mensch wahrnehmen, denken und fühlen kann.
Über dieses Buch
Dieses Buch ist eine philosophische Darstellung davon, wie es ist, depressiv zu sein. Es ist nicht als Ratgeber, Erfahrungsbericht oder wissenschaftliche Abhandlung gedacht. Stattdessen bemühe ich mich mithilfe der Philosophie um einen Deutungsversuch, der verständlich macht:
Wie Betroffene selbst ihre Symptome erleben.
Was auf existenzieller Ebene mit einem Menschen in der Depression geschieht.
Was sich in der Depression verändert und wie es sich verändert.
Im weiteren Sinne geht es hier um das Reflektieren darüber, was einen Menschen eigentlich ausmacht und wie sich das Leben in einer Depression radikal wandelt. Ich hoffe, dass so mehr Betroffene einen sinnvollen Zugang zu ihrem Leid finden. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass Angehörige und Außenstehende besser nachvollziehen, wie immens diese Erfahrungen auf dem Dasein lasten. Und vor allem, wie wichtig soziale Unterstützung, genügend Zeit sowie echte menschliche Empathie für Erkrankte sind.
Selbst wenn sich nicht alle Beteiligten in jedem Detail wiederfinden, können meine Ausführungen zu einem besseren Verständnis beitragen. Das sind allerdings nicht die einzigen Gründe, warum ich dieses Buch schreiben musste …
Pathologisierung menschlichen Seelenlebens
Seit vielen Jahren scheint sich ein Trend zur Pathologisierung psychischer Phänomene durchzusetzen. In der Folge werden immer mehr Befindlichkeiten, Verhaltensweisen, Emotionen und Erfahrungen als problematisch oder krankhaft eingestuft.
Sind Schüchternheit oder Nervosität bereits krankhaft? Handelt es sich um ein behandlungsbedürftiges Problem, wenn ich introvertiert bin? Wie lange darf ich bedrückt und verzweifelt sein, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist?
Die Grenzen zwischen dem, was als normal, und dem, was als pathologisch gilt, sind unscharf, fließend und alles andere als eindeutig. Den Diagnosen psychischer Erkrankungen haftet daher weitaus mehr Subjektivität an, als vielen Fachleuten bewusst zu sein scheint. Psychopathologische Konzepte müssen schließlich von einem Menschen verstanden, gedeutet und praktisch angewandt werden. Ausschlaggebend ist und bleibt die (subjektive) Interpretation der behandelnden Person, ob und welche Diagnose gestellt wird.
Diese subjektive Betrachtungsweise ist nicht das Problem, solange man sich selbstkritisch der eigenen Perspektivität bewusst ist. Gerade das fehlt aber in der Alltagspraxis von Psychiatrie und Psychotherapie. Stattdessen wird jede Eigenart, individuelle Vorliebe und Seinsweise, die im privilegierten Weltbild der Ärzteschaft keinen Platz findet, zum Krankheitszeichen erklärt. Dass psychiatrische und therapeutische Fachkräfte selbst einer Befangenheit unterliegen und diese nicht abstreifen können, scheint ihnen nicht einmal in den Sinn zu kommen.
Dabei sind auch Personen mit Fachkenntnissen nicht vor Unwissenheit, Denkfehlern, Vorurteilen, Projektionen, emotionalen Einflüssen, Vergesslichkeit etc. gefeit. Trotzdem kommt es viel zu oft zu bizarren Aneinanderreihungen von Diagnosen (Komorbiditäten) und erfolglosen Behandlungen, die einen zerstörerischen Einfluss auf das Selbstbild und das Leben betroffener Menschen ausüben.
Individualisierung sozialer Probleme
Nach dem individualistischen Narrativ der heutigen Zeit sind psychische Leiden ausschließlich private Schwierigkeiten einzelner Menschen, die irgendwie Pech hatten oder über zu wenig Kompetenzen im Umgang mit Gefühlen, Bedürfnissen, Problemen und anderen Menschen verfügen.2
Das zeigt sich zum Beispiel an lerntheoretischen Ansätzen (Verhaltenstherapie, Konzept der erlernten Hilflosigkeit) und Konflikttheorien (Psychoanalyse), die das Problem im Individuum verorten. Demnach hat eine Person falsche Glaubenssätze oder dysfunktionale Bewältigungsstrategien verinnerlicht und weist einen Mangel an emotionaler Kompetenz, Selbstbewusstsein, Autonomie etc. auf.
Die Ursachen sollen also im Einzelnen liegen, der oder die sich in Achtsamkeit, Selbstreflexion, Dankbarkeit, Selbstliebe usw., kurz: in der richtigen Haltung und Lebensweise üben müsse, um die persönlichen Defizite in den Griff zu bekommen.
Dieses Prinzip prägt auch (fast) sämtliche öffentliche Darstellungen und Selbstberichte. In Büchern, auf Social Media oder im Fernsehen finden sich immer wieder die gleichen Geschichten (mit Happy End?): Trauma, Gene oder falsche Glaubenssätze als Ursache – Therapie, Anpassung und Achtsamkeit als Heilung.
Andere relevante Faktoren, wie konkrete Lebensbedingungen, gesellschaftliche Einflüsse, wirtschaftliche Situation, Arbeitsbelastung, soziale oder politische Rahmenbedingungen, werden komplett ignoriert. Das ist eine krasse Nummer angesichts der steigenden Anzahl an psychischen Problemen, die vor allem bei Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status verbreitet sind.3 Auffällig ist auch, dass kaum negative und kritische Erfahrungsberichte von Betroffenen öffentlich werden.
Egal, wie viele Influencer, Comedians, Schauspieler und andere privilegierte Personen predigen, eine Psychotherapie zu beginnen – Tatsache ist, dass nur die wenigsten Betroffenen in den Genuss eines solchen Privilegs kommen. Kassenplätze sind bekanntermaßen stark kontingentiert und private Behandlungen für die meisten Menschen viel zu teuer.
Außerdem kann die Psychotherapie keine echte Aussicht auf Heilung bieten, wenn ganze Strukturen an Bedingungen ignoriert werden, die das Leben eines Menschen beeinflussen (Stichwort: Dekontextualisierung4).
Elitäres Machtgefälle
Fachkundige besitzen weitreichenden Einfluss auf die Lebenssituation und Lebensbedingungen ihrer Patienten. Letztere sind zwar das Subjekt der Untersuchung bzw. Behandlung, aber ohne Mitbestimmungsrecht (Partizipation) bleiben sie Objekt. Gleichzeitig wird übersehen, dass gerade Betroffene einen besonderen erkenntnistheoretischen (epistemischen) Status besitzen: ein persönliches Wissen (1.-Person-Perspektive).
Die subjektive Wahrnehmung der Patienten ist daher weit mehr als nur Information. Sie ist authentisches und pointiertes Erfahrungswissen. Eine wirkliche Wertschätzung der Patienten-Sicht findet sich jedoch selten. Diese eingeschränkte Perspektive in der Psychiatrie und Psychotherapie führt nicht nur zu erkenntnistheoretischen Verzerrungen und missglückten Therapien, sondern auch zu ethischen Problemen.
Psychische Krankheiten werden in der Regel von Menschen definiert und behandelt, die in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen sind und leben. Dadurch sind häufig Menschen in diesem Berufsfeld anzutreffen, die wenig mit den Lebensrealitäten ihrer Patienten gemeinsam haben. Hier besteht nicht mehr nur die Gefahr eines Elitediskurses. Die Psychotherapie ist ein reiner Elitediskurs. Und damit eine Form von Unterdrückung, Ausgrenzung und Deprivation, die Selbstbestimmung und Freiheiten ganzer sozialer Gruppen einschränkt.
Dieser Diskurs ist nicht abstrakt, sondern manifestiert sich in der Praxis durch ganz bestimmte Vorstellungen von Normalität, Werten und psychischer Krankheit, die den Therapieprozess einrahmen. Er formt die Diagnosestellungen, die Interventionsstrategien und nicht zuletzt die therapeutischen Beziehungen.
Objektifizierung des Menschen
Die Diskussion über psychische Gesundheit und Krankheit folgt dem naturwissenschaftlichen Paradigma. In fachlichen Beschreibungen ist daher von Automatismen, Druck, Regulation oder Informationsverarbeitung die Rede. Solche naturwissenschaftlichen Erklärungen des Menschen und seines seelischen Erlebens sind nicht nur oberflächlich und mechanistisch, sondern fördern auch die Stigmatisierung von psychisch leidenden Menschen als andersartig und defizitär.
Dazu zählen biologistische Modelle, die das seelische Erleben eines Menschen einfach zum Nebenprodukt neurobiologischer Prozesse erklären, wie es in der Psychiatrie gängig ist. Das subjektive Erleben selbst wird marginalisiert. Anstatt die bewussten Erfahrungen der Person als Teil ihres persönlichen Erlebens und Ausdrucks zu betrachten, werden sie aus ihrem Kontext gerissen, analysiert, beurteilt und abgewertet.
Allerdings verliert eine Humanmedizin, die den Menschen naiv mit seiner physischen Existenz gleichsetzt, das Eigentliche aus den Augen: den lebendigen Menschen in seiner subjektiven, seelisch-leiblichen und sozialen Lebenswirklichkeit. Die Reduktion auf objektive Faktoren fordert immer ihren Preis: die Entfremdung des Menschen vom Menschen, sowohl von anderen als auch sich selbst.
Depressionen verstehen
Vor diesem Hintergrund ist das vorliegende Buch zu sehen. Mir geht es darum, ein alternatives Verständnis von Depressionen zu ermöglichen, welches das Erleben und die Lebenswelt von Betroffenen einbezieht und würdigt, anstatt sie auszuschließen und abzuwerten.
Als Methode wähle ich die phänomenologische Darstellung, mit deren Hilfe ich Erfahrungen so zu beschreiben versuche, wie sie im Moment des Erlebens wahrgenommen werden. Die Phänomenologie ist eine Philosophie, die sich speziell mit der subjektiven Erfahrungswelt des Menschen beschäftigt. Sie bemüht sich, wertende Vorannahmen und Interpretationen zu vermeiden bzw. kontinuierlich zu hinterfragen.
Nach diesem philosophischen Ansatz sind depressive Zustände keine Folge von Denkstörungen, falschen Überzeugungen, Gefühlsproblemen oder Anomalien im Gehirn. Vielmehr sind sie ein Mangel an grundlegenden Möglichkeiten des Mensch-Seins, die stets mit den Strukturen verknüpft sind, in denen sich das Leben eines Menschen abspielt.
Das hier vertretene Verständnis von Depressionen basiert zum Großteil auf den Arbeiten von Thomas Fuchs, Jannis Puhlmann, Daniel Broschmann und Jan Slaby, die sich ihrerseits auf die Philosophie Husserls, Heideggers und Merleau- Pontys beziehen.
1 Vgl. K. Jaspers: Allgemeine Psychopathologie, S. 8.
2 Stichwort: therapeutische Erzählung, vgl. Eva Illouz: Die Errettung der modernen Seele. Therapien, Gefühle und die Kultur der Selbsthilfe. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2011.
3 Es gibt so viele Belege zu diesem Thema, dass ich exemplarisch nur eine Studie nenne: Matthew Ridley et al., Poverty, depression, and anxiety: Causal evidence and mechanisms. Science 370, eaay0214(2020). DOI:10.1126/sci-ence.aay0214
4 Dekontextualisierung bei psychischen Krankheiten bezieht sich auf den Prozess, in dem psychische Probleme und Störungen isoliert von den sozialen, kulturellen und individuellen Rahmenbedingungen betrachtet werden. Kritisch ist vor allem zu sehen, dass psychische Störungen meist als rein biologisches Phänomen aufgefasst werden, bei dem pharmakologische Behandlungen und medizinische Interventionen im Vordergrund stehen. Dadurch werden gesellschaftliche, kulturelle und politische Zusammenhänge vernachlässigt, einschließlich individueller Lebenserfahrungen, sozialer Ungleichheiten und traumatischer Ereignisse.
EINLEITUNG
“Der Wahnsinn ist eine Möglichkeit des Menschen, ohne die er nicht wäre, was er ist.”
Maldiney5
Philosophie als Korrektiv
Mensch-Sein mit Leib und Seele
Seelische Krankheiten in der Philosophie
Das humanistische Menschenbild
Selbst, Wirklichkeit, Bewusstsein – alle Begriffe, die in der Psychologie eine tragende Rolle spielen, haben eine lange philosophische Tradition. Das kommt nicht von ungefähr. Mensch, Selbst und Weltverhältnis sind genuine Themen der Philosophie. Bis ins 19. Jahrhundert hinein galt die Psychologie schließlich noch als Teilgebiet der philosophischen Wissenschaft.
Heute steht die Psychologie den Naturwissenschaften weitaus näher als den Geisteswissenschaften. Daher hätte diese Disziplin es dringend nötig, sich ihrer Wurzeln wieder bewusst zu werden und zum wissenschaftlichen Fundament der fragenden Haltung zurückzufinden.
Philosophie als Korrektiv
Die Philosophie soll hier keinen Gegenentwurf zu den naturwissenschaftlichen Fachgebieten darstellen, sondern eine sinnvolle Korrektur und Ergänzung. Schließlich kann eine vorwiegend biologistisch ausgerichtete Psychologie vieles nicht erklären, was im Menschen vorgeht. Sie ist lediglich imstande, aus einer äußeren Perspektive zu beschreiben. Genauso verhält es sich mit den Hauptströmungen der Psychologie und Psychotherapie: Sie erklären psychische Zustände von einer Außenansicht (3.-Person-Perspektive), die vieles ausklammert, was gerade wesentlich für das menschliche Erleben ist. Für Wissenschaften, die sich auf messbare Faktoren und Daten stützen, ist diese Perspektive sinnvoll. Sie sollen beschreiben, Wissen ordnen und kategorisieren.
Zum Beispiel kann die Biologie erklären, wie lebende Organismen aufgebaut sind, doch über das Leben an sich kann sie nichts aussagen. Das Gleiche gilt für die behavioristische und die kognitionswissenschaftliche Psychologie: Sie können vielleicht Verhaltens- und Gedankenmuster erhellen, doch über das psychische Erleben des einzelnen Menschen ist damit wenig gesagt.
Stattdessen bleiben fundamentale Fragen offen:
Sind Persönlichkeit und psychische Leiden überhaupt zu trennen?
Warum und inwiefern sind Betroffene in ihrem Sein eingeschränkt?
Wie verändern psychische Leiden die Wahrnehmung, das Denken und das Fühlen eines Menschen? Und was ändert sich daran?
Mensch-Sein mit Leib und Seele
Aus philosophischer Sicht geht die heutige Psychologie von zweifelhaften Voraussetzungen aus: einem dualistischen Weltbild, das die Wirklichkeit in Ich und Welt, Geist und Körper, Verstand und Gefühl zerteilt.
Die phänomenologische Philosophie fokussiert sich hingegen auf die subjektive Erfahrung, ohne eine metaphysische Vorannahme zu treffen. Im Selbsterleben eines Menschen zeigt sich, dass die Welt nichts Äußeres ist, das dem Inneren gegenübersteht. Individuum und Welt konstituieren sich vielmehr gegenseitig und können nicht voneinander entflechtet werden. Genau das ist ja das Verzwickte an psychischen Zuständen: Ich kann mein Selbst nicht von meinem Körper oder meiner Lebenswelt trennen.
Egal, ob Depressionen oder ein anderes Leiden – das Ganze spielt sich nicht im Hinterstübchen meiner Psyche ab, sondern es durchwirkt meine Wahrnehmung und meine Handlungen, meine Art zu denken und zu fühlen – kurz: meine Weise des In-der-Welt-Seins.
Seelische Krankheiten in der Philosophie
Die Philosophie sieht psychische Leiden nicht als einen Schicksalsschlag an, der einen Menschen plötzlich von außen trifft. Psychische Probleme sind auch kein selbst verschuldeter Fehler oder einfach nur eine individuelle Panne. Sie sind ein Zustand, der eng mit der menschlichen Existenzform einhergeht. Den praktisch jeder Mensch durchleben kann. Psychisch zu leiden, ist eine spezifische Daseinsform des Mensch-Seins, die seinem Wesen innewohnt. Ein Risiko, das grundsätzlich bei jedem Menschen vorhanden und mit seiner Natur verbunden ist.
Eine strikte Unterscheidung in kranke und gesunde Menschen, wie sie heute noch stattfindet, ist nicht nur kurzsichtig und ethisch fraglich, sondern auch völlig überflüssig. Mit der Philosophie lassen sich psychische Erkrankungen, die in der heutigen Gesellschaft so verbreitet sind, als Formen des Inder-Welt-Seins verstehen: Dieses Anders-Sein in der Krankheit, diese Fremdheit, die jedes psychische Leiden ausstrahlt und ausdrückt, ist in allen Menschen angelegt. Das heißt auch, seelische Leiden sind Möglichkeiten unserer Existenz unter ganz bestimmten Bedingungen.
Das humanistische Menschenbild
Philosophische Ansätze leugnen nicht die (neuro-)biologischen Faktoren psychischer Leiden. Sie kritisieren vielmehr die unreflektierten Vorannahmen und Interpretationen der empirischen Wissenschaften. Auch auf die Grenzen der Sprache ist zu achten, wenn es darum geht, Erfahrungen und Wahrnehmungen auszudrücken und zu interpretieren. Die menschliche Sprache ist beschränkt und kann nicht immer genau das transportieren, was gefühlt oder gedacht wird.
Psychische Krankheiten sind im philosophischen Verständnis eine Verfremdung ganzheitlicher Daseinsbezüge, die sowohl die Beziehung zwischen Welt und Subjekt als auch die zu anderen Menschen erfasst. Plötzliche Bilder im Kopf, übermächtige Impulse oder überwältigende Gefühle sind eine Verselbstständigung von Teilen dieser Ich-Welt-Wir-Komponenten. Trotzdem sind sie immer mit mir als Person verbunden – sie sind untrennbar von mir.
Mache ich gedanklich einen weiteren Schritt nach vorn, dann entstehen Krankheiten nie nur individuell, sondern auch sozial. Gerade das Umfeld und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben großen Einfluss darauf, ob sich eine Krankheit entwickelt, wie sie verläuft und mit welchen Folgen Betroffene leben müssen. So geht ein psychisches Leiden immer mit zwischenmenschlichen Problemen einher, insbesondere in der Kommunikation. Und diese Probleme wirken sich weitreichend auf soziale Beziehungen und die Handlungsfähigkeit in der Gesellschaft aus.
5 H. Maldiney, zitiert nach S. Thoma: Zu Anspruch und Wirklichkeit eines nicht-defizitären Krankheitsverständnisses im Werk von Wolfgang Blankenburgs.
DIE PHÄNOMENOLOGIE
“Man soll öfters dasjenige untersuchen, was von den Menschen meist vergessen wird, wo sie nicht hinsehen und was so sehr als bekannt genommen wird, dass es keiner Untersuchung mehr wert geachtet wird.”
Georg Christoph Lichtenberg6
Die Rolle von Selbsterleben und Subjektivität
Die Qualität der Erfahrung
Gefühle und Stimmungen als Seinsweisen
Die Grundlagen der Phänomenologie
Edmund Husserl (1859 – 1938)
Martin Heidegger (1889 – 1976)
Maurice Merleau-Ponty (1908 – 1961)
Was sind Phänomene?
In der Umgangssprache werden Phänomene (Erscheinungen) als etwas verstanden, was im Gegensatz zur Wirklichkeit steht. Die Erscheinung ist in der Alltagssprache wie ein Schleier, der gelüftet werden muss, um den wahren Wesenskern zu enthüllen und zu erkennen. Ein Phänomen ist demnach nicht das Wirkliche, sondern eben nur eine Erscheinungsform.
Das meint Phänomenologie aber nicht. In dieser Philosophie ist ein Phänomen das, was sich zeigt. Hinter ihm steht nichts, was mehr Sein oder Sinn hätte. Die Erscheinungsformen selbst sind real und mit Bedeutung verknüpft. Dabei können Phänomene durchaus auf verschiedene Art und Weise in Erscheinung treten: von einer bestimmten Perspektive aus, bei starker oder schwacher Beleuchtung, nur in der Vorstellung usw. So kommt es zu wesentlichen Unterschieden in der Wahrnehmung von einfachen Dingen, Musik, Situationen, sozialen Interaktionen u.s.w.
Das bedeutet auch, dass die Welt, wie sie mir unmittelbar erscheint, die Welt an sich ist. Egal, ob ich sie sinnlich wahrnehme oder sie mithilfe wissenschaftlicher Methoden analysiere. Natürlich sind einige Erscheinungsformen irreführend. Doch nach phänomenologischer Auffassung geht es nicht um ein Trugbild und ein Wirkliches, sondern um die Art, wie ich dem Phänomen begegne. Ein flüchtiger Blick auf ein Erscheinendes kann schnell täuschen, eine genaue Betrachtung und Untersuchung die Perspektive komplett ändern. Die eigentliche Wesensart der Phänomene verbirgt sich also nicht hinter der Erscheinung, sondern entfaltet sich in dieser. Eine strikte Trennung in Mensch und Welt, Subjekt und Objekt, Innen und Außen wird in der Phänomenologie hinterfragt.
In Zusammenhang mit Depressionen heißt das, sie sind keine Filter oder Schleier, der sich über die Wahrnehmung der Wirklichkeit einer Person legen und diese verzerren. Betroffene sehen keine verfälschte Version der “tatsächlichen Realität”, sie machen eine wirkliche und bedeutsame Erfahrung. Tiefe Traurigkeit, Interessenverlust, Müdigkeit und das Gefühl der Wertlosigkeit sind nicht einfach nur Zeichen bzw. Symptome dafür, dass die Realitätswahrnehmung in irgendeiner Weise gestört ist. Sie bilden vielmehr authentisch das Erleben eines Menschen ab.
Die Rolle von Selbsterleben und Subjektivität
Während in den empirischen Wissenschaften Begriffe wie Selbst, Subjektivität oder Dasein eine marginale Rolle spielen, sind sie in der Phänomenologie von entscheidender Bedeutung. Das Subjekt bzw. das subjektive Bewusstsein ist deshalb so wichtig und darf nicht übergangen werden, weil es die Basis und Perspektive anlegt, in welcher Weise die Welt erscheint und Bedeutung erhält. Das gilt auch für jede Wissenschaft: Den forschenden Menschen selbst erscheint ja alles perspektivisch. Die eigene Perspektivität ist daher der notwendige Ausgangspunkt jeder Erkenntnis, Wahrnehmung sowie Erfahrung und darf nie übersehen werden.
Die Phänomenologie geht von einer untrennbaren Verbindung von Subjektivität und Welterfahrung aus. Der Mensch ist nur in seinem Verhältnis zur Welt verstehbar und die Welt nur im Verhältnis zum Subjekt.
Diese Schlussfolgerung erfordert einen radikalen Perspektivwechsel. Eine Interpretation von außen (3. Person-Perspektive) bleibt defizitär, da die subjektive Erfahrung (1. Person-Perspektive) mit einem besonderen Erkenntnisvorrang verbunden ist: Sie ist immer die erste und letzte Instanz jeder Wahrnehmung – auch der wissenschaftlichen.
Der oder die Einzelne gewinnt durch und in der Erfahrung ein unmittelbares Wissen über dieses einzigartige Erlebnis, das kein anderer Mensch in vollkommen gleicher Art und Weise teilen kann.