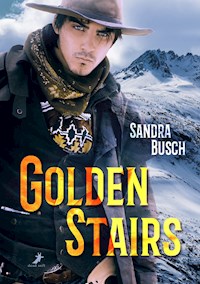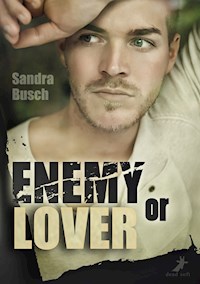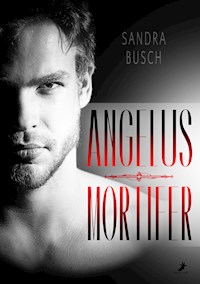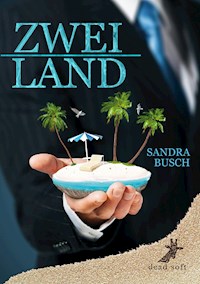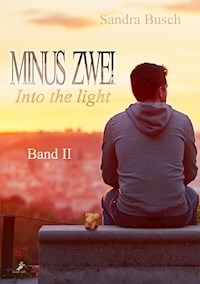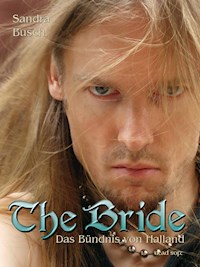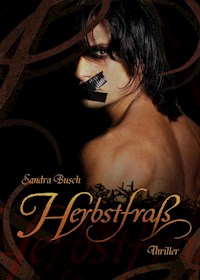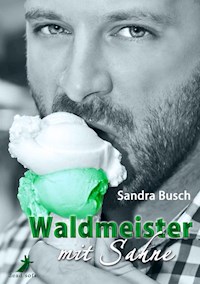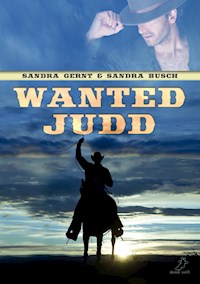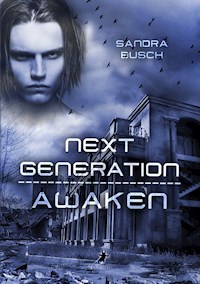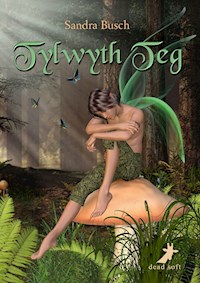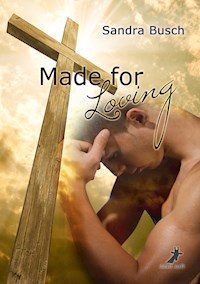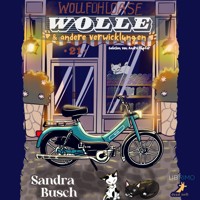Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dead soft verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Niemand hatte ihm gesagt, dass sich die Grenzen verschoben haben. Niemand hatte ihm gesagt, dass dort die Wölfe lauern. Niemand weiß, ob ein 7. Sohn ein Glücks- oder doch eher ein Unglücksrabe ist ... Als der Rabenwandler Raj in die Hände der feindlichen Wolfswandler gerät, erhebt Farres, der Beta des Rudels, Anspruch auf ihn. Er macht ihn zu seinem Sklaven, denn er hat einen ungeheuerlichen Plan, den er nur mit Rajs Hilfe in die Tat umsetzen kann. Gay Fantasy
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der siebte Rabe
von
Impressum:
© dead soft verlag, Mettingen 2013
http://www.deadsoft.de
© the authors
www.sandra-busch.jimdo.com
www.sandra-gernt.de
Coverbild:[email protected]
Covergestaltung: Monika Hanke
1. Auflage
ISBN 978-3-943678-85-7
ISBN 978-3-943678-86-4
Wir verneigen uns voller Ehrfurcht vor Moni, der es gelingt, für unsere Bücher immer wieder wundervolle Cover zu zaubern. Wir halten deine Kreativität in Ehren.
1.
Der Wind zerzauste seine Federn und die ersten Böen des nahenden Sturms verlangten äußerste Konzentration von ihm. Schlauer wäre es, sich ein sicheres Fleckchen zu suchen und das Unwetter abzuwarten. Aber Rajs Ziel war nicht mehr fern und er hatte seine Familie seit fünf langen Jahren nicht gesehen. Er freute sich darauf, seine Brüder nach dieser endlosen Studienzeit in der Hohen Akademie endlich wieder um sich zu haben. Den fröhlichen Haufen hatte er zwischen seinen meist unangenehmen und weniger freundlichen Kommilitonen besonders vermisst. An seine strengen Dozenten mochte er nicht einmal mehr denken. Noch immer zürnte er seinem Vater, dass der ihn nach einem ausgeuferten Streit an die Akademie verbannt hatte, wo er täglich die Nase in staubige Schriftrollen hatte stecken müssen. Nur weil er sich mit jedem Flügelschlag weiter von der Akademie entfernte, genoss er selbst einen so anstrengenden Flug wie diesen.
Der Himmel wurde von Minute zu Minute dunkler, ein nahes Grollen kündete den Sturm an. Als die ersten Blitze herabzuckten, suchte er sich gezwungenermaßen und mit leisem Fluchen einen Landeplatz. Eine Lücke zwischen den Baumwipfeln nutzte er aus, um auf einer kleinen Lichtung mit rotbraunem Herbstlaub zu landen. Nach zwei Hüpfern verwandelte er sich in seine menschliche Gestalt, schüttelte die Falten seines Umhangs aus und schaute sich kurz orientierend um. Das Gestrüpp auf der einen Seite der Lichtung wirkte dicht genug, um ihm einigermaßen Schutz vor dem Sturm zu gewähren. Wie ärgerlich! Er hätte nicht mehr lange fliegen müssen, um sich in der warmen Behaglichkeit seines Zimmers ausruhen zu können. Stattdessen würde er etliche ungemütliche Stunden unter einem nassen Gestrüpp verbringen müssen.
Mit raschen Schritten lief er über die Lichtung, bis ihn ein Geräusch inne halten ließ. Alarmiert spitzte er die Ohren. Lauerte da etwas in den Schatten zwischen den Bäumen? Plötzlich hatte Raj den Eindruck beobachtet zu werden. Nervös drehte er sich einmal um die eigene Achse und versuchte etwas im Halbdunkel des Waldes zu erkennen.
„Ist da jemand?“ Er erhielt keine Antwort, allerdings glaubte er eine gleitende Bewegung im Unterholz zu entdecken.
„Hallo?“
Seine Brüder hatten ihm ein Stück des Weges entgegenkommen wollen. War das etwa ein Streich, den sie ihm spielen wollten? Vielleicht hatten sie ihn zwischen den Gewitterwolken entdeckt und sich spontan zu diesem Schabernack entschlossen, als er sich für eine Landung entschied. Zuzutrauen wäre es ihnen allemal.
„Randyn? Bist du das?“
Stille. Dann ein kaum wahrnehmbares Knacken.
„Rayskel? Ris’tan?“
Donnergrollen. Inzwischen schon sehr viel näher. Eine erneute Bewegung zu seiner Linken ließ ihn herumwirbeln.
„Risser! Rynalph! Rakden! Das ist nicht witzig!“
Es lachte auch niemand, am allerwenigsten er selbst.
„Randyn, du Narrenprinz! Hört auf mit dem Unfug. Ich bin nicht die weite Strecke geflogen, um nun …“
War da ein Knurren? Seine Nackenhärchen stellten sich auf. Schlagartig fühlte er sich bedroht.
„Randyn?“, flüsterte er den Namen seines zwei Jahre älteren Lieblingsbruders. Unruhig trat er von einem Fuß auf den anderen, unschlüssig, wie er sich verhalten sollte. Das war kein Spaß mehr unter Brüdern. Das hier schmeckte nach Gefahr. Ein weiterer Blitz erhellte für einen kurzen Moment die Umgebung und brachte ein verstecktes Augenpaar zum Aufleuchten. Raj fuhr herum und begann zu rennen, wobei er seine Verwandlung einleitete. Doch bevor er Federn ausbilden und sich dem Himmel entgegenwerfen konnte, wurde ein Netz über ihn geschleudert. Er geriet ins Stolpern, verhedderte sich in den Maschen und stürzte hilflos zu Boden. Gleich darauf erstarrte er vor Furcht. Große Pfoten tauchten in seinem Blickfeld auf, tappten direkt auf ihn zu, verschwammen kurz und bewegten sich nun als Stiefel weiter. Neben seinem Gesicht blieben sie stehen. Raj ließ seinen Blick von den Stiefeln aus höher wandern. In ihnen steckte eine lederne Hose in braun-grünen Waldtönen und spannte ein wenig über den langen, kräftigen Beinen. Eine Tunika aus rauer grauer Wolle bildete zusammen mit einem Flickenmantel, der seinen Träger zwischen den Sträuchern sicherlich unsichtbar machte, den Abschluss der Bekleidung. Nun schaute er direkt in das Gesicht seines Angreifers – ein Gesicht von teuflischer Schönheit. Eine Wolke rötlichbraunen Haares rahmte es ein. Grüne Augen musterten ihn eindringlich. Eine Weile schwiegen sie sich an. Dann verzog sich der sinnliche Mund des Fremden zu einem Lächeln und entblößte dabei makellose spitze Zähne.
„Helft ihm auf.“
Hände tauchten wie aus dem Nichts auf und zerrten ihn unsanft auf die Füße. Hektisch schaute sich Raj um. Zwölf Gestalten befanden sich bei ihm auf der Lichtung. Wolfswandler! Einige befanden sich in ihrer Wolfsgestalt, andere hatten sich in Menschen verwandelt. Nicht seine Brüder hatten ihm einen Streich gespielt, erkannte er, sondern er war in die Hände des Feindes gefallen.
Schon seit Jahren herrschte ein erbitterter Territorialkrieg zwischen Raben und Wölfen. Offenbar hatten sich die Grenzen wieder verschoben, ansonsten wäre er hier unter keinen Umständen gelandet. Das hätte Randyn ihm mitteilen müssen!
„Ich habe es ja geahnt, dass wir bei einem Streifzug auf neuem Grund und Boden jemanden aufgreifen, der die Grenze nicht tolerieren will“, sagte ein älterer Wolf. Der Rothaarige ignorierte ihn.
„Wen haben wir denn da?“, fragte der stattdessen und trat einmal um Raj herum, während er in dem unerbittlichen Griff zweier Männer hing.
„Du bist doch einer der Rabenprinzen, nicht wahr? Ihr habt alle die gleiche Fresse. Aber begegnet sind wir uns noch nicht, oder? Jedenfalls kann ich mich nicht an dich erinnern.“
Stumm schüttelte Raj den Kopf.
„Er ist so winzig“, sagte eine Frau rechts von ihm. „Er reicht ja kaum bis an die Schulter eines Maulwurfs.“
Raj funkelte sie wütend an. Seine Größe, oder vielmehr seine mangelnde Größe, war seit jeher sein wunder Punkt. Jetzt lachte sie ihn auch noch aus. Verflixtes Weibsbild!
„Lasst mich los“, zischte er und versuchte sich von den Händen und dem Netz gleichermaßen zu befreien. Ein Schlag in den Magen nahm ihm direkt die Lust an einem weiteren Versuch. Pfeifend klappte er zusammen und wurde nur von den zwei Männern auf den Füßen gehalten. Er würgte, rang nach Atem und das alles gleichzeitig, während er gegen die Schmerzenstränen anblinzelte.
„Hättest du die Güte mir zu verraten, wer genau du bist, Rabenfresse?“
„Raj“, brachte er keuchend hervor.
„Raj? Raj, das Hühnchen? Der siebte Sohn unseres werten Feindes, dieser verdammten Saatkrähe, die sich feige in ihrer Burg versteckt?“
Der Fremde riss das Netz von ihm und umfasste mit eiserner Hand sein Kinn.
„Wo bist du die letzten Jahre gewesen, Hühnchen? Wir haben dich hier vermisst. Hattest du vielleicht Angst, dass die Sagen die Wahrheit berichten und ein siebter Sohn Unglück bringt? Wolltest du deshalb nicht an unserem Spiel um Land und Leben teilnehmen? Nun sprich schon!“
„Ich …ich war an der Hohen Akademie“, antwortete Raj hastig. „Ich habe dort studiert …“
„Oh, wir haben einen Gelehrten unter uns.“ Der Fremde spuckte ihm verächtlich ins Gesicht. Fassungslos stand Raj da und spürte, wie der warme Speichel über seine Haut rann.
„Töte ihn, Farouche!“
Ein junger Mann, der sich aus einer Gruppe Wölfe löste, zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Es war allerdings der Name, den er genannt hatte, der Raj erstarren ließ.
Farouche! Er war in der Gewalt des grausamen Königs der Wölfe. Bis eben hatte Raj noch gehofft, einem kleinen unbedeutenden Rudel in die Hände gefallen zu sein. Hatte er zuvor Angst empfunden, so steigerte sie sich nun zur nackten Panik. Randyn hatte ihm vor einigen Jahren geschrieben, dass Farouche seinen eigenen Vater zerfleischt hatte, um selbst als Alpha der Wölfe zu herrschen. Seitdem wurde die Canisfeste von einem Schlächter regiert.
„Reiß ihm die Kehle heraus!“ Stark humpelnd näherte sich der junge Mann. Respektvoll wichen ihm die übrigen Wölfe aus und sogar Farouche ließ Rajs Kinn los. Verkrustete Schmarren und dunkle Blutergüsse zeugten von einem harten Kampf, den dieser Wolf ausgefochten haben musste. Die rotbraunen, ungebändigten Haare und grünlichen Augen bewiesen die Verwandtschaft zu Farouche. Raj wusste, dass verletzte und alternde männliche Wolfswandler sich harten Hierarchiekämpfen stellen mussten, während bei den Raben für jeden gleichermaßen gesorgt wurde. So war es nicht verwunderlich, dass selbst ein Bruder oder Vetter von Farouche sich den Respekt der anderen verdienen musste, wollte er am Leben bleiben. Dieser Mann strahlte Kälte und heiße Wut zugleich aus, er wirkte noch gefährlicher als der Rudelführer. Hasserfüllt starrte er Raj an.
„Ich will auf seiner Leiche tanzen, Farouche.“
„Das ist mein kleiner Bruder, Hühnchen. Schau ihn dir gut an. Es waren die verdammten Wolfseisen deines Schwarms, die Farres beinahe den Fuß abgerissen und ihn zum Krüppel gemacht haben.“
„Das tut mir leid“, flüsterte Raj.
„Oh ja, es wird dir verflucht leidtun, wenn der Kleine dir jeden einzelnen Knochen im Leib bricht, angefangen mit deinen Fingern. Verabschiede dich vom Fliegen, Hühnchen, denn wir werden dir die Flügel stutzen. Und damit du begreifst, wem du fortan gehörst, eine kleine Lektion.“
Raj bekam einen gemeinen Tritt in die Kniekehlen, dass er erneut Bekanntschaft mit dem Waldboden schloss. Ein Stiefel grub sich in seinen Nacken und drückte ihn nieder. Gleich darauf prasselte es warm und stinkend auf seinen Hinterkopf. Dieser Schlächter pisste ihn an!
„So markieren Wölfe ihren Besitz, Hühnchen.“
Gelächter ertönte rings um ihn herum. Indessen lief der Urin in seinen Kragen und sickerte ihm in die Kleidung. Raj fühlte seine Wangen brennen und Zorn in seinen Eingeweiden kochen. Noch nie war er derartig gedemütigt worden.
Farouche wandte sich von ihm ab. Weiterer Donner grollte und der Himmel begann seine Schleusen zu öffnen.
„Bringen wir ihn in die Festung“, rief Farouche, ehe er sich in einen großen Wolf verwandelte und ihm einen letzten spöttischen Blick zuwarf.
2.
„Zwecklos, wir müssen die Nacht hier verbringen.“ Farouche ballte gereizt die Fäuste.
Das Unwetter hatte die Nande über die Ufer treten lassen. Der Fluss war auch zu besten Zeiten launisch und tückisch, mit gefährlichen Unterströmungen und zahllosen scharfen Felsen. Raj wusste, dass die Wölfe nicht aus Feigheit Respekt vor diesem Gewässer hatten. Solange der Fluss so stark angeschwollen war, würden sie ihn gefesselt nicht lebendig auf die andere Seite schaffen können. Darüber würde niemand eine Träne vergeuden, doch auch sie selbst waren vor den Gefahren des reißenden Wassers nicht gefeit.
„Wir könnten uns die Zeit vertreiben, indem wir mit dem Raben spielen“, sagte einer der Wölfe mit einem gierigen Funkeln in den bernsteingelben Augen.
„Das Recht auf den ersten Biss gebührt Farres.“ Farouche näherte sich Raj, der hilflos am Boden lag, die Arme so grausam auf den Rücken gefesselt, dass er kaum atmen konnte. Nur so konnte eine Verwandlung effektiv verhindert werden, weil er die Arme dazu ausbreiten musste. Ein Arm war dabei verzichtbar, waren beide gefesselt, konnte die Verwandlung nicht einsetzen.
„Wie wäre es damit: Wir binden einen Strick um seinen Hals, den einer von uns festhält und lassen ihn ansonsten frei flattern. Würde sicher lustig aussehen und uns ein langes Spielvergnügen bescheren. Wenn er versucht, sich zu verwandeln, schlachten wir ihn ab.“ Der Anführer lächelte Raj an und riss ihn hoch, sodass er auf den Knien zu liegen kam, wobei Farouche wieder seine spitzen Raubtierfänge entblößte.
Raj brauchte seine ganze Kraft, um seine Angst nicht zu zeigen. Um dem Feind offen ins Gesicht zu blicken, ohne zu zittern, ohne sich durch einen Laut des Schmerzes zu verraten. Er war ein Prinz, er würde aufrecht sterben!
„Warte.“ Farres trat seinem Bruder entgegen, wobei er sich vor Raj stellte. Es hätte eine beschützende Geste sein können, bedeutete aber vermutlich bloß, dass der verkrüppelte Wolf ihn für sich beanspruchen wollte.
„Ich habe nachgedacht, Farouche. Als Geisel könnte er uns mehr bieten als vergängliches Vergnügen, meinst du nicht?“
Die Blicke, die zwischen den Brüdern gewechselt wurden, waren schwer zu deuten. Schließlich nickte der Leitwolf.
„Du hast Recht. Sein Vater soll ihm keine große Liebe entgegenbringen, doch das eine oder andere wird ihm sein Sohn schon wert sein. Die Raben sind immerhin berühmt für ihren Zusammenhalt in der Sippe.“ Farouche holte aus und schlug Raj hart ins Gesicht. Haltlos stürzte Raj zurück auf den Boden. Sofort war der Wolfswandler über ihm und präsentierte seine Reißzähne aus nächster Nähe.
„Freu dich, Federvieh, du wirst den nächsten Sonnenaufgang noch erleben“, grollte er bedrohlich. „Mit beiden Augen und allen Gliedmaßen. Eine beschädigte Geisel ist weniger wert.“
Er stand auf und nickte Farres zu. „Er untersteht deiner Obhut, Bruder. Bring ihn da rüber, ich will seine hässliche Visage nicht die ganze Zeit anstarren müssen.“
Farres packte ihn und zerrte ihn brutal auf die Beine.
„Viel Spaß!“, rief einer der Männer. Alle spuckten in Rajs Richtung, oder knurrten warnend, sobald er ihnen nahe kam.
„Du hast viele Stunden lang Zeit, dir allerlei lustige Spiele auszudenken, um unseren Gast zu unterhalten. Sorg nur dafür, dass er nicht zu laut brüllt und morgen früh noch lebendig und körperlich unversehrt ist. Hm – na ja, und wenn nicht, dann ist er halt was weniger wert.“
Farouches grausiges Lachen ging Raj unter die Haut. Das waren keine Menschen. Das waren keine Tiere. Das hier waren gewissenlose Monster!
~*~
Farres schubste den Gefangenen zu Boden. Er landete auf Steinen und Wurzeln, ohne sich abfangen zu können. Das musste sehr schmerzhaft sein, doch der Rabe gab keinen Laut von sich. Das magere Hühnchen war mutig und tapfer, das musste man ihm lassen. Auch wenn er vor Angst stank, von außen war ihm nichts anzumerken.
Farres beschloss, ihn erst einmal da liegen zu lassen und zu beobachten. Auf Folter warten zu müssen war schlimmer, als sie zu ertragen, wie er aus eigener Erfahrung wusste, seit er als Jugendlicher in Gefangenschaft eines Bärenwandlerclans geraten und erst nach Tagen gegen Lösegeld freigekommen war. Er war gespannt, wie lange es dauern würde, bis Raj um Gnade piepste.
Der Regen prasselte auf sie nieder, die Dunkelheit der Nacht legte sich über sie. Farres’ Augen erkannten dennoch mühelos jedes Detail. Er sah, wie der Kleine sich mühte, nicht vor Kälte zu zittern. Die unruhigen, winzigen Bewegungen verrieten, wie schmerzhaft die Fesseln und Verletzungen sein mussten, die Raj erlitten hatte. Er wurde zunehmend kurzatmiger, da er mit an den Ellenbogen zusammengebundenen Armen nicht richtig Luft holen konnte. Würde er in dieser Position ohnmächtig, könnte er eventuell sogar ersticken.
Minutenlang herrschte Schweigen. Farres witterte, dass Raj sich dem Zusammenbruch näherte. Sein Puls raste, ein Krampf schüttelte seinen kaltschweißigen Körper durch. Beeindruckend, dass er noch immer kein Wort sprach, weder mit Blicken noch auf andere Weise um Hilfe bettelte. Gelehrter oder nicht, er musste mit Schmerzen vertraut sein. Als er begann, sich stöhnend und keuchend zu krümmen, um Atem schöpfen zu können, beugte Farres sich über ihn. Er erwartete Verzweiflung, Panik, ein Zeichen der Todesangst, die er in Raj witterte. Stattdessen blickte er in nachtschwarze Augen, die trotzigen Stolz und Wut spiegelten.
„Du bist stark“, flüsterte Farres verblüfft. Er zückte sein Messer, widerstand der Versuchung, es vor der Nase seines Gefangenen tanzen zu lassen und zerschnitt Rajs Fesseln. Der junge Rabenwandler stieß einen kurzen, schrillen Schrei aus, als seine überdehnten Schultern ruckartig befreit wurden. Er wand sich nach Luft japsend, kämpfte minutenlang stumm um seine Selbstbeherrschung. Erst, als Raj ruhiger wurde, hockte Farres sich auf seinen Rücken und schnitt ihm das Hemd vom Leib.
Der Körper unter ihm wurde starr.
„Du bist ziemlich angeschlagen, auch wenn ich dich ließe, würdest du nicht allzu weit fliehen können“, sagte Farres leise. „Aber dazu lasse ich es gar nicht erst kommen.“
Raj wandte ihm das Gesicht zu. Ein schmutziges, regennasses Gesicht, dessen Jugend und Schönheit etwas in Farres’ wunder Seele berührte. Dieser Rabe war ein tapferes Geschöpf. Ein Gelehrter zudem, kein Krieger. Es hieß, dass Prinz Raj sich mit seinem Vater überworfen hatte, weil er dessen Politik in Bezug auf die Wölfe kritisiert hatte. Hätte es nicht einer der anderen Rabenbrüder sein können, der ihnen in die Fänge geriet? Bei denen hätte er keine Skrupel gehabt, tief in ihre Rückenmuskeln zu schneiden, um sie an der Flucht zu hindern …
Als ihm klar wurde, was es war, das seine Hand verharren ließ, glitt Farres verblüfft von seinem Opfer herab und schubste es herum, damit er ihm von nahem in die Augen blicken konnte.
Kein Hass.
Da waren viele Gefühle, die in dem kleinen Raben tobten. Doch keines davon hatte mit Hass zu tun.
„Du bist seltsam“, murmelte er, packte Rajs Kinn und starrte ihn intensiv an.
„Bist du zu dumm, um deine Feinde zu hassen? Oder sollte in der Brut des Rabenkönigs etwa ein Küken mit Herz und Seele geschlüpft sein?“
Verwirrung war es, die nun in Raj vorherrschte – und tiefe Erschöpfung.
Farres erinnerte sich mit einem Ruck daran, wozu er hier war. Sinnend strich er über die schlanken, starken Arme seines Opfers. Er mochte etwas klein geraten sein – knapp über eineinhalb Schritt höchstens – aber schwach war er nicht. Im Gegenteil, sein wohlgeformter halbnackter Körper war ein wunderbarer Anblick. Wie sollte er ihn am Fliegen hindern, ohne ihm weitere Schmerzen zuzufügen? Überall trug Raj die Blutergüsse, die er sich bei der Gefangennahme zugezogen hatte, er litt bereits genug.
Schließlich band er ihm die Hände vor der Brust zusammen, ohne übertriebene Härte, und schlang ihm ein schmales Lederband derart um die Finger, dass Raj seine Daumen nicht mehr bewegen konnte. Das würde den jungen Mann an jeglichen Aktionen hindern, da er nun heftig zappeln müsste, wenn er versuchte, auf die Beine zu kommen und verwandeln war unmöglich.
„Schlaf, wenn du kannst. In Farouches Verliesen wird es dir nicht allzu gut ergehen.“
Raj gab keine Antwort. Für einen langen Moment duellierten sie sich mit Blicken, ein Kampf, den Farres mühelos gewann. Rajs Lider schlossen sich, der junge Mann war am Ende seiner Kraft.
Farres nahm Wolfsgestalt an, rollte sich nah beim Gefangenen zusammen und überließ sich dem Schlaf eines Raubtieres – stets bereit, sofort aufzuspringen und zu kämpfen, wenn es sein musste.
Raj tat kein Auge zu. Dieser verkrüppelte Wolf verwirrte ihn. Erst schrie er lauthals nach seinem Tod und dann verzichtete er sogar darauf, ihm die zum Fliegen benötigten Muskeln zu durchtrennen. Zitternd stieß er den Atem aus. Er hatte solch eine Angst verspürt. Aber der Albtraum war noch nicht zu Ende, wie ihm bewusst war. Vorsichtig, um den Schlafenden nicht zu wecken, hob er die Hände an und begann wie eine Ratte an seinen Fesseln zu nagen. Das Leder war vom Regen aufgequollen. Wenn es trocknete, würde es ihm schmerzhaft ins Fleisch schneiden. Soweit wollte er es allerdings nicht kommen lassen. Beharrlich kaute er eine Ewigkeit weiter an den Bändern herum. Endlich riss der erste Riemen und er zwang sich zur Geduld, um sich vollends zu befreien. Dann rückte er Fingerbreit um Fingerbreit von dem schlummernden Wolfswandler ab, ehe er langsam davonkroch.
Ich schaffe es, redete er sich Mut zu. Ich schaffe es. Sobald meine Arme nicht mehr krampfen, können sie mir nichts mehr anhaben.
Er warf einen raschen Blick zurück und schluckte trocken. Das Rudel hatte sich beinahe ausnahmslos in Wolfsgestalt zusammengerollt und die Nasen unter die buschigen Ruten gesteckt. Sollten sie sich doch selbst in die Ärsche kriechen, er wollte nur fort. Nachdem er sich etwas von seinem merkwürdigen Wächter entfernt hatte, richtete er sich auf und lief am steinigen Ufer der Nande entlang.
Verwandel dich, forderte er sich auf und bemühte sich die dafür erforderliche Konzentration aufzubringen. Hinter ihm ertönte ein langgezogenes Heulen und brachte ihn aus dem Tritt. Vorbei war es mit der Konzentration.
Ohne sich umzusehen begann Raj um sein Leben zu rennen. An einem Felsbrocken schlug er sich ein Knie auf, stolperte, rutschte aus und zog sich weitere Schrammen zu. Federn begannen auf seinem Körper zu sprießen, schon breitete er die schmerzenden Arme aus und spürte den Triumph einer gelungenen Flucht in sich aufsteigen, da knallte ihm ein enormes Gewicht in den Rücken und warf ihn um. Fänge schnappten nach seinem Gesicht und er ruckte so heftig mit dem Kopf zurück, dass er wuchtig gegen den steinigen Boden schlug. In seinem Schädel explodierten Tausende Sterne und für einen Moment wurde ihm schwarz vor Augen.
„Wolltest du abhauen, Hühnchen?“, brüllte ihn jemand wütend an. Er wurde von einigen Wölfen gepackt und während er noch gegen die Benommenheit ankämpfte, zerrten ihn seine Angreifer ins Wasser. Der Sog riss ihn beinahe von den Füßen, obwohl die Nande ihm an dieser Stelle gerade einmal bis an die Schenkel reichte. Aber es war immerhin tief genug, um grob untergetaucht zu werden. Der Fluss war eisig, das kalte Wasser drang ihm in Nase und Mund. Wild begann er mit Armen und Beinen um sich zu schlagen, was zur Folge hatte, dass man ihm am Haar in die Höhe zerrte. Hustend und spuckend rang er nach Luft.
„…lass … mir … Farou… Ich werde …“
Einzelne Satzfetzen drangen durch das Rauschen in seinen Ohren, bevor er erneut unter Wasser gedrückt wurde. Ein schmerzender Ring legte sich um seine Brust, presste sich immer weiter zusammen. Panisch zappelte er in dem unnachgiebigen Griff, sicher, dass er nun ertrinken würde. Und wieder wurde er in die Höhe gezogen. Wasser rann aus seinen halblangen Haaren. Er atmete hastig ein, hustete erneut … Ein Blitz spaltete den Himmel in zwei Teile und beleuchtete diesen Farres und den Schlächter, die sich wegen ihm zu streiten schienen. Einer der Wölfe, die ihn zu ertränken versucht hatten, schleuderte ihn ans Ufer, wo er zwischen den Pfoten des restlichen Rudels zusammenbrach. Noch immer würgte er Flusswasser aus. Oh verdammt! Hätte er nicht schneller sein können?
„Ich verstehe dich nicht!“, hörte er Farouche schreien. „Einer von denen da“, ein Finger zeigte anklagend auf ihn, „hat dieses verfluchte Wolfseisen aufgestellt, in das du hineingeraten bist. Glaubst du, es war ein schöner Anblick, als ich dich gefunden habe? Mit einem halb abgerissenen Fuß, über und über blutverschmiert und drei Raben an deiner Seite, die dir gerade den Todesstoß verpassen wollten?“ Der Wolf legte seine Hände um das Gesicht seines ziemlich trotzig aussehenden Bruders, eine Geste, die unglaublich zärtlich wirkte.
„Ich liebe dich, Farres. Du bist meine einzige Schwäche. Nicht auszudenken, wenn ich dich verloren hätte. Und ich schwöre dir, dass ich jedem einzelnen Raben die Federn ausreißen und ihn an einen Spieß stecken werde, bis diese Geflügelzucht ausgerottet ist.“
„Er gehört mir. Es ist allein mein Recht, ihn zu töten“, knurrte Farres.
Farouche ließ seine Hände sinken, schaute seinen Bruder resignierend an, ehe er ihm durch den Schopf wuschelte. Aufatmend sank Raj in sich zusammen. Er würde am Leben bleiben. Jedenfalls vorerst. Aber ob das gut oder schlecht war, würde sich erst noch herausstellen. Sein Blick glitt in den Himmel und überrascht riss er die Augen auf: Zwischen den Blitzen kreiste ein dunkler Schatten. Deutlich hatte er ihn in dem Wetterleuchten gesehen. Und diese Silhouette hätte er überall erkannt: Randyn! Sein Lieblingsbruder suchte ihn selbst in einem solchen Sturm.
Er musste sich durch irgendeinen Laut verraten haben, denn plötzlich stand Farouche neben ihm und spähte ebenfalls in die nächtlichen Wolken.
„Ein Kundschafter aus der heimatlichen Burg? Suchen sie ihren kleinen Prinzen?“, fragte er hämisch, um gleich darauf zu brüllen: „Hey, du da oben! Du kommst zu spät! Wenn ich mit ihm fertig bin, werden lediglich ein paar Federn von ihm übrig sein!“
Der Rabe am Himmel kreiste machtlos weiter über ihnen. Sehnsüchtig beobachtete Raj seinen Flug. Daher bemerkte er das Messer in Farouches Hand erst viel zu spät.
„Umdrehen!“, knurrte der Wolf und sein Gefolge beeilte sich, dem Befehl nachzukommen. Raj wurde auf den Bauch gerollt und eisern festgehalten. Im nächsten Moment wurde ihm das Messer in den Rücken gerammt.
~*~
Ein Rabe konnte nicht weinen, ansonsten wären Randyn während des Fluges die Tränen nur so gelaufen. Rajs schrecklicher Schrei war bis zu den Gewitterwolken hinauf zu hören gewesen und hatte sich tief in sein Herz geschnitten. Wie er zurück nach Zwanzig Türme gelangt war, wusste er hinterher nicht mehr, aber die vielen schlanken Türme seiner Burg ragten unvermittelt vor ihm auf. Er steuerte eine der zahlreichen Plattformen an, die ihn auf dem kürzesten Weg zu seinen Brüdern führen würde. Ärger würde er bei den Nachrichten, die er brachte, sicherlich nicht bekommen, obwohl er gegen einen Befehl gehandelt und Raj gesucht hatte. Noch dazu in einem solchen Sturm wie diesen. Er war sich der Gefahr bewusst gewesen, doch wenn es um Raj ging, verlor er schnell den Verstand. Kaum berührten seine Füße die Plattform, verwandelte er sich zurück und rannte in den großen Saal. Wie erwartet fand er dort seine Brüder. Ihr Lachen war bereits weithin zu hören, denn noch machten sie sich um ihren Jüngsten keine Sorgen.
Wie versprochen waren sie Raj ein Stück weit entgegengeflogen, hatten ihn allerdings nicht abpassen können. Als Rakden dann die Vermutung aussprach, dass Raj sicherlich bei Aufziehen des Sturms in einem Gasthaus Schutz gesucht hätte, waren sie umgekehrt, obwohl Randyn seine Zweifel geäußert hatte. Er wusste, wie sehr sich sein Bruder auf seine Heimkehr gefreut hatte. Bestimmt hatte Raj nicht den Sturm abgewartet, sondern versucht, sie vor dem schlimmsten Unwetter zu erreichen. Jetzt verfluchte sich Randyn dafür Recht behalten zu haben.
Tropfnass platzte er mitten in ihre Witzeleien hinein. Er hatte keine Ahnung, was sein Gesicht seinen Brüdern verriet, als sie sich über sein hastiges Auftreten überrascht zu ihm umwandten, doch es herrschte schlagartig erschrockene Ruhe.
„Raj!“ Randyn rang nach Atem und stieß dann hervor: „Die Wölfe haben Raj!“
Rakden war der Älteste von ihnen. Er würde einst Vaters Nachfolge antreten. Besonnen und ruhig war er und auch der Erste, der sich nach dieser furchtbaren Nachricht wieder fasste. Er nahm ihn am Arm und führte ihn zu einem Stuhl, auf den er ihn niederdrückte.
„Wo?“, fragte er.
„An der Nande“, antwortete Randyn erschöpft. Der Rückflug war alles andere als ein Kinderspiel gewesen. Blitze, Luftwirbel und heftige Böen hatten ihm das Vorankommen erschwert. Die Regenmassen hatten ihr Übriges dazu getan. „Ich habe sie an der Nande entdeckt. Ich glaube, sie wollen ihn in die Canisfeste bringen. Zwölf Wölfe habe ich gezählt – und Farouche.“
Niemand sagte ein Wort. Jeder wusste, was das bedeutete und versuchte zu begreifen, dass es ausgerechnet ihren kleinen Bruder getroffen hatte.
„Farouche?“, fragte Rakden endlich nach, packte ihn an den Schultern und begann ihn heftig zu schütteln. „Bist du sicher, dass du Farouche gesehen hast?“
Randyn klapperten unter dieser Behandlung die Zähne. Er nickte eilig.
„Der Schlächter bringt ihn um“, flüsterte Risser entsetzt.
„Wie konnte er ihnen in die Hände fallen?“, fragte Ris’tan kopfschüttelnd. „Er muss doch gewusst haben, dass er an der Nande nirgendwo landen darf. Dass sich die Grenzen verschoben haben und dort nun Wolfsgebiet ist.“ Er wandte sich direkt an ihn: „Du hast Raj doch informiert, oder, Randyn?“
„Natürlich habe ich ihm einen Boten geschickt“, sagte er empört. „Für wie blöd hältst du mich?“
„Das wie ist doch völlig unerheblich“, mischte sich Rayskel ein. „Wichtig ist, was wir jetzt unternehmen.“
Rais’tan nickte eifrig. „Wir trommeln unsere Leute zusammen und befreien ihn, bevor sie die Canisfeste erreichen. Bei dem Wetter führt die Nande Hochwasser. So einfach …“
„Er hat einen Fluchtversuch unternommen, gerade als ich sie entdeckt habe“, unterbrach Randyn seinen Bruder. „Sie haben ihn wieder eingefangen und … und Farouche … Er wird nicht mehr fliegen können“, würgte er schließlich tränenblind heraus. Schreckensstarr standen sie beisammen. Endlich erklärte Rakden heiser:
„Ich werde Vater informieren.“
3.
Farres begutachtete die Wunden, die Farouches Messer hinterlassen hatte. Raj lag ohnmächtig am Ufer des Flusses, was insoweit gut war, dass er ihm keinen Widerstand bot. Farouche hatte ihm zielgenau an zwei Stellen in den rechten Trapezmuskel gestochen. Nicht so tief, dass er in die Lunge eingedrungen war – in diesem Fall wäre der Rabe bereits tot – aber der Kleine würde in den nächsten Wochen unfähig sein, den rechten Arm zu heben. Eine dauerhafte Lähmung wäre allerdings nur zu befürchten, falls sich die Wunden entzünden sollten.
Leise ächzend schob er Rajs Unterkörper zurück ins Wasser. Mit der Besinnung hatte der junge Mann auch die Kontrolle über gewisse Funktionen verloren und sich selbst benässt. Nun gut, es war nicht seine Schuld, und vielleicht hätte Farres daran denken sollen, dass sein Gefangener durchaus Bedürfnisse haben könnte. Die Nande nahm ihm freundlicherweise jede weitere Verantwortung in dieser Sache ab.
Sein Bruder hatte sich derweil mit Ephrim beraten. Der ältere Wolf war der Dritte in der Hierarchiefolge und der besonnenste Denker und Stratege des Rudels. Wenn Farres als Beta darin versagte, seinen hitzköpfigen Bruder aufzuhalten, trat Ephrim für ihn ein.
„Der Sturm lässt nach“, sagte Farouche, als er zu Farres zurückkam. „Die Raben werden in spätestens einer halben Stunde angreifen. Wir ziehen uns in den Wald zurück und teilen uns dabei auf. Das Federvieh wird es schwer haben, uns überhaupt zu finden. Du übernimmst ihn.“ Mit dem Kinn wies er verächtlich auf Raj und trat ihm dabei heftig in die Seite.
„Sorg dafür, dass er nicht noch einmal fliehen kann und uns auf keinen Fall durch Geschrei verrät!“
Farouche drehte sich um und brüllte dem Rudel die Befehle zu, die sofort befolgt wurden. Inzwischen lud sich Farres den Besinnungslosen auf die Schulter. Es würde hart werden, ihn zu tragen, ohne mit seinem Klumpfuß das Gleichgewicht zu verlieren. Doch solange er seinen Platz als Beta beanspruchte, durfte er sich nicht schonen.
„Pass auf dich auf, Bruder.“ Farouche zog ihn am Kopf heran und küsste ihm die Stirn. „Falls es eng wird, schlachte ihn einfach ab und bring dich in Sicherheit. Ich will dich nicht verlieren, du bist der Letzte, der mit mir Vaters Blut teilt. Und, Farres: Markier ihn, wenn du ihn wirklich für dich haben willst. Andernfalls wird er auf der Canisfeste keine Nacht überleben. Nicht, wenn er bereits nach Blut riecht.“
Übergangslos verwandelte er sich und eilte mit langen Sätzen in den Wald hinein. Auch Farres humpelte los. Gottverfluchte Rabenbrut! Sie hatten seine Schwester regelrecht in Stücke gehackt, als diese sich mit König Rajadas treffen wollte, um Territorialverhandlungen zu führen. Die beiden Wölfe, die sie begleitet hatten, wurden erst Tage später gefunden. Man hatte ihnen die Augen ausgestochen, ihre Nasen zertrümmert und sie orientierungslos in der Wildnis zurückgelassen. Beide hatten es nicht geschafft. Seit dieser völlig sinnlosen grausamen Tat war aus dem schwelenden Konflikt zwischen Raben- und Wolfswandlern über die Grenze zwischen ihren Reichen ein offener Krieg geworden, der von beiden Seiten mit aller Härte geführt wurde. Nicht alle Rudel und Rabenschwärme zogen dabei mit, doch zwischen Rajadas und Farouche gab es keine Gnade oder Erbarmen.
Farres humpelte schneller, als der Wind ihm die Witterung von Raben zutrug. Noch waren sie rund eine Meile entfernt und die Bäume schützten ihn bereits vor ihren Blicken. Ein Glück, dass diese Bastarde zwar scharfe Augen besaßen, Gehör und Geruchssinn hingegen vergleichsweise schwach ausgeprägt waren. Andernfalls hätten die Wölfe gar keine Chance gegen das hinterhältige geflügelte Pack.
In einem nahezu undurchdringlichen Tannenwald ließ Farres schließlich seinen Gefangenen liegen, verwischte seine Spuren, so gut es ging – ein Hoch dem anhaltenden Regen! – und kroch zurück zu Raj, der sich mittlerweile schwach regte.
Sicherheitshalber knebelte er ihn mit einem langen Streifen seiner eigenen Tunika und fesselte seine Hände dergestalt um den Stamm einer Tanne, dass der verdammte Rabe sich diesmal nicht den Weg in die Freiheit beißen konnte. Die niedrigen Äste des Baumes entfernte er, bevor sich einer von ihnen beiden ein Auge ausstach. Noch immer sickerte Blut aus den Stichwunden und bei der Überstreckung des Armes stöhnte Raj gequält. Wenn das nicht besser wurde, musste Farres ihn verbinden, falls er seinen Gefangenen lebend mitnehmen wollte.
Farres witterte die Raben, die nun über den Bäumen kreisten und hörte ihre krächzenden Rufe. Raj reagierte nicht, er war offenkundig blind und taub für die Nähe seiner Sippe. Gut so. Im Schutz der Dunkelheit würde Farres ein weites Stück stromaufwärts laufen und dort die Nande ungefährdet überqueren, ohne dass die Raben etwas davon mitbekommen würden. Noch vor dem Morgengrauen würde er die Canisfeste erreichen. Bis dahin hieß es abwarten … Und eine wirklich unliebsame Aufgabe übernehmen.
~*~
Raj wimmerte unwillkürlich vor Schmerz, als der Wolf ihm fluchend die Fesseln löste und begann, seine anhaltend blutenden Wunden zu versorgen. Bei jeder Bewegung der rechten Schulter durchzuckte ihn höllische Pein. Er war dankbar für den Knebel, der sein würdeloses Gewinsel dämpfte. Als Farres fertig war, dachte Raj zunächst, es wäre nun vorbei und er bekäme ein wenig Ruhe. Stattdessen machte sich der Kerl an seiner Hose zu schaffen.
Raj erstarrte. Ja, vielleicht wollte Farres es ihm lediglich etwas bequemer machen und befreite ihn deshalb von den durchweichten Stiefeln und dem anderen Zeug. Hier unter den Tannen war der Boden trocken und selbst die piksigen Nadeln, unebenen Wurzeln und zahllosen Äste waren besser als der Matsch zuvor. Aber es war wenig wahrscheinlich, dass es um sein Wohlbefinden ging. Warum sollte es den Wolf kümmern, ob er sich unbehaglich fühlte oder nicht? Er wollte nicht nackt vor seinem Feind liegen! Am liebsten hätte er sich mit aller Kraft gewehrt, wenn sein Rücken ihm soviel Gezappel erlauben würde.
„Ich tue das nicht gerne“, flüsterte Farres, während er sich dicht über ihn beugte, nachdem er ihn erneut gefesselt hatte. Viel zu dicht. Der Wolf nestelte an seiner eigenen Kleidung. Innerlich zog sich alles in Raj zusammen, als er die Bedeutung der Worte verstand. Gütiger Gott, nein!
„Nimm ihn ab!“, brüllte er undeutlich gegen den Knebel und riss hektisch an den Fesseln, bis der Schmerz ihn stoppte.