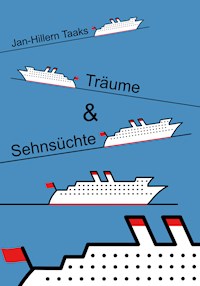Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Alte spinnt" ist die Geschichte des 79-jährigen Max Berber, eines einst erfolgreichen Mannes, der zurückgezogen in seiner Villa in Hamburgs "Speckgürtel" lebt. Max hat die Verbindung zu den Nachbarn abgebrochen, nachdem seine Frau gestorben war. Kontakte zu ehemaligen Geschäftspartnern hat er vernachlässigt, sie gibt es nicht mehr. Irgendwo gibt es eine Enkelin, die er nicht kennt. Der einst erfolgreiche und bekannte Geschäftsmann wurde zu einem einsamen, komischen Alten. Seine Einsamkeit hat er gewollt, und doch erdrückt sie ihn. Er bricht zaghaft aus und fährt einmal pro Woche nach Hamburg, um in einem griechischen Restaurant zu essen. Eines Tages sieht er vor dem Restaurant einen Menschen von mehr als 50 Jahren, der seine Aufmerksamkeit erregt. Er lädt ihn zum Essen im Restaurant ein. Der Fremde heißt Franz, er ist Witwer wie Max, Vater von drei Kindern (16, 20 und 22 Jahre alt), arbeitslos, der mit sich und den Kindern nicht mehr fertig wird. Max und Franz treffen sich jeden Dienstag im Restaurant und essen gemeinsam. Franz redet, Max hört zu. Es entwickelt sich eine Freundschaft, die auch nicht mit dem Tod von Franz endet. Max kümmert sich um die Jugendlichen, nimmt sie zu sich auf ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan-Hillern Taaks
Der Alte spinnt
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
Impressum neobooks
1. Kapitel
"Der alte Berber kommt," sagte Lilo, die unten in der Schalterhalle der Bank arbeitete. Sie war gerade frei. Also nahm sie das Telefon und rief Herrn Markwardt, ihren Chef, an. Der Chef hatte mal gesagt, dass er sofort zu benachrichtigen sei, wenn der alte Berber komme. Und so sagte sie, als sich der Chef gemeldet hatte: "Der alte Berber kommt".
Da kam der Alte auch schon. Er durchschritt schnell die Schalterhalle und ging zu Treppe, die zum ersten Stock führte, zur Chefetage. Den Fahrstuhl verschmähte der Alte. Er war groß, breit und wirkte kräftig und gesund, wenngleich er seinen Gehstock bei sich hatte und ihn auch benutzte. Den Gehstock hatte er immer schon bei sich, meinte Lilo. Der Alte hatte einen grau-schwarzen Mantel an, und er trug einen schwarzen Hut mit breiter Krampe. Er hielt sich sehr grade und wirkte trotz seines fortgeschrittenen Alters fit aus. Lilo sah, wie der Alte oben verschwand.
Der alte Max Berber ging sofort auf die Tür des Chefs zu, durcheilte das kleine Vorzimmer, betrat das Büro des Herrn Markwardt, der sich erhoben hatte und ihn mit ausgestreckter Hand begrüßte. Er bat ihn, sich zu setzen. Er bot keinen Kaffee oder Tee an, denn er wusste, dass der Alte das abgelehnt hätte. Der Alte kam wegen irgendeines Geschäftes, nicht wegen einer Tasse Kaffee.
„Bitte, verkaufen Sie alle meine Anteile an der Real-Immo AG,“ bat Max Berber, ohne sich mit Begrüßungsfloskeln aufzuhalten.
Er und Herr Markwardt saßen im recht großen und hellen Büro des Bankdirektors. Der Raum war einigermaßen gemütlich eingerichtet, jedenfalls saß Herr Berber recht bequem. Er hätte sich auch auf einen Küchenstuhl gesetzt. Er hätte das Geschäft auch im Stehen abwickeln können. Herr Markwardt schaute Herrn Berber überrascht, fast fassungslos an und wusste zunächst nichts zu sagen. Das freundliche Lächeln war verschwunden. Schließlich fragte er:
„Darf ich fragen, warum Sie verkaufen wollen? Der Kurs ist in den letzten sechs Woche rapide gestiegen, und der Aufwärtstrend geht weiter.“
„Das ist mir bekannt. Bitte führen Sie den Auftrag schnellstmöglich aus,“ Herr Berber ließ keinen Zweifel zu. Er wollte verkaufen, aber er hatte keine Lust, dem Direktor seine Gründe mitzuteilen.
Bei dem Verkauf handelte es sich um keine Kleinigkeit. Es drehte sich um Millionen. Er hatte vor knapp einem Jahr die Anteile für rund € 4,5 Millionen gekauft. Der Wert lag jetzt bei knapp über € 8 Millionen, und den Gewinn wollte der alte Berber einstreichen. Warum? Und warum jetzt? Der Kurs würde vermutlich stark zurückgehen, wenn plötzlich so viele Anteile der Real-Immo auf dem Markt erscheinen würden. War das die Absicht des Alten? Wollte er Real-Immo in Schwierigkeiten bringen? Oder hatte er Informationen, die die Bank nicht hatte? Und was wollte der Alte mit dem Geld machen?
„Haben Sie schon daran gedacht, das Geld wieder anzulegen?“ fragte Herr Markwardt schließlich Er wagte es nicht, Vorschläge zu machen. Das war ihm einmal passiert, und er hatte eine tüchtige Abfuhr erlebt. Der alte Berber hatte ihm kalt gesagt, dass er über gute Anlagen mehr wisse als er und als seine Mitarbeiter.
„Ja, ich weiß, was ich mit dem Geld tun werde. Sie werden es rechtzeitig erfahren,“ sagte der Alte jetzt.
Damit erhob sich Herr Berber, nickte dem Bankdirektor kurz zu und verließ das Büro.
Nein, Herr Berber war in der Bank und vor allem beim Bankdirektor nicht besonders beliebt, und doch gehörte er zu den wenigen wichtigen Kunden, die hofiert werden mussten. Herr Markwardt würde seinen Posten verlieren, wenn der Alte die Bank wechseln würde. Für ihn wäre das eine gelinde Katastrophe und ganz sicher ein Knick in seiner Karriere.
Der Alte war Rentner, das behauptete er von sich selbst. Das mochte richtig sein. Er war nicht mehr aktiv im Berufsleben, und er hatte nach und nach alle Posten in Aufsichtsräten und Stiftungen abgegeben. Aber führte er das Leben eines Rentners? Was für ein Privatleben hatte er? Man wusste, dass er in Harburg, außerhalb der Stadt natürlich, eine große Villa hatte, man kannte natürlich die Adresse. Früher hatte sich die Geschäftswelt Hamburgs oft in der Villa getroffen, aber das gab es nicht mehr, und man sagte sich, der Alte lebe ganz zurückgezogen.
2. Kapitel
Das Haus des Herrn Berber war das letzte und isolierte Haus hinter einer kleinen Reihe von Villen im Speckgürtel von Hamburg. Es lag abgelegen, und es hatte keine unmittelbaren Nachbarn. Büsche und Bäume grenzten das Grundstück ein, und der große Garten glich eher einem Park. Herr Berber ging täglich, morgens zu früher Stunde, die Straße hinab, die von seiner Villa an einem kleinen Waldstück vorbei zu den Nachbarhäusern und dann zur Hauptstraße führte. Dort angekommen, kehrte er um und ging zurück, schnellen Schrittes. Nur selten begegnete ihm einer der Nachbarn. Im Sommer gab es hier und da sogar Spaziergänger aus der weiteren Umgebung. Man grüßte sich, mehr aber auch nicht. Nachbarn, die ihn schon recht oft gesehen haben, hielten ihn für unnahbar.
Auf diesen morgendlichen Spaziergängen beschäftigte sich Max Berber mit vielerlei Themen. Manche Themen hatten etwas mit der Wirtschaft und der Wirtschaftsentwicklung zu tun. Seiner Meinung nach war der gesamte Finanzsektor krank, auch wenn die Finanzkrise allem Anschein nach überwunden war. Aber das war nur ein Thema. Er beschäftigte sich auch mit dem ersten Weltkrieg, der vor einhundert Jahren die damalige Welt in großes Unglück stürzte und rund 17 Millionen Menschenleben gekostet hatte. Der zweite Weltkrieg war seiner Meinung nach eine logische Folge des ersten Krieges. Wieder ein anderes Thema war die Zeit, die im Sekundentakt tickt und die nicht aufzuhalten ist.
Wenn Max sich mit diesen Themen beschäftigte, sah er keine Menschen, oder er sah sie, bemerkte sie aber nicht. Das war nicht immer so gewesen, erinnerte sich ein Herr Gimmel, der der nächste Nachbar war. Seine Frau und die verstorbene Frau Berber hatten einen recht guten Kontakt mit Nachbarn gehabt, der jedoch abgebrochen war, als sie gestorben war. Der alte Berber, allein geblieben, lud niemanden zu sich ein, und er wurde auch nicht eingeladen. Herr Gimmel hatte einmal versucht, auf der Straße ein Gespräch anzufangen, aber das Gespräch endete, bevor es überhaupt so richtig begonnen hatte. Der schrullige Alte, so nannte er ihn, hatte ihn geradezu unhöflich abblitzen lassen. Jetzt mied er den Alten. Man hatte sich nichts zu sagen.
Seine Frau traf von Zeit zu Zeit Frau Ilse Kranig, die Haushälterin des Alten, im Supermarkt, der sich in der Nähe befand. Man kannte sich, man grüßte sich, man wechselte auch Worte miteinander, und so fragte Frau Gimmel eines Tages, was denn Herr Berber so mache, denn man sehe ihn kaum noch. Frau Kranig zuckte mit den Schultern und entgegnete:
„Ja, er hat sich etwas zurückgezogen, aber sonst – was soll er tun?“ Frau Kranig sprach nicht besonders gern über ihren Chef. Sie wusste, dass er ein Einzelgänger war, dass er schroff sein konnte, aber sie verehrte ihn. Ihr gegenüber war er immer korrekt, gelegentlich auch liebenswürdig, und das Gehalt war sehr großzügig bemessen. Mehr noch, war sie in Not, so half er.
Er zahlte auch Ferdinand, das war der Gärtner, der auch als Chauffeur diente, ein sehr gutes Gehalt, und die beiden Putzfrauen arbeiteten gern bei ihm.
„Neulich wollte sich mein Mann erkundigen, wie es ihm gehe, aber Herr Berber hat ihn – nun, er hat eigentlich nicht geantwortet,“ sagte Frau Gimmel, und sie verzog ihr Gesicht.
„Meine Güte, der Chef wollte vielleicht seine Ruhe haben,“ antwortete Frau Kranig. „Er ist eben so. Man darf nicht vergessen, dass er kein junger Mann mehr ist. Er geht so langsam auf die 80 zu.“
Frau Kranig hatte sich in den beiden vergangenen Jahren große Sorgen gemacht, denn ihr Chef hatte sich mehr und mehr zurückgezogen. Erst in letzter Zeit hatte sich an dem Zustand etwas geändert: einmal pro Woche ging er aus. Jeden Dienstagnachmittag verließ ihr Chef das Haus und fuhr mit der S-Bahn – bitte sehr: mit der S-Bahn – nach Hamburg. Frau Kranig konnte sich nicht vorstellen, warum ihr Chef die S-Bahn nahm. Er hatte einen großen Wagen in seiner Garage, mit Ferdinand hatte er einen Chauffeur, warum sollte er mit der S-Bahn fahren? Na ja, sagte sie sich, der Chef hatte eben so seine Eigenarten. Die aber wollte sie nicht mit Frau Gimmel besprechen, denn das ging sie nichts an.
Frau Gimmel erfuhr tatsächlich nicht sehr viel von Frau Kranig. Ihrem Mann konnte sie nichts sagen, und so malte sich das Ehepaar Gimmel aus, dass der Alte vielleicht ein Verhältnis mit seiner Haushälterin haben könnte. So etwas existiere eben, sagte Frau Gimmel, und wenn man so viel Geld hat wie der Alte, dann fragte man nicht nach Schönheit, Jugend oder Alter.
3. Kapitel
Max Berber spazierte an diesem Frühlingsabend über die Reeperbahn. Er war mit der S-Bahn gekommen, und nun bummelte er. Er kannte den Weg, denn er ging ihn normalerweise viermal pro Monat, nämlich jeden Dienstag, um genau zu sein. Er wohnte in Harburg in seiner schönen, großen Villa, die von hohen Bäumen und Büschen umgeben war. Es war ein Paradies, um das er beneidet wurde. Aber jeden Dienstag brach er aus. Seit Ende letzten Jahres tat er das, weil ihm sein Zuhause zu still vorgekommen war, zu groß vielleicht. Er nannte ein Paradies sein eigen, aber es war ein Paradies mit Schattenseiten. Ja, er gab zu, dieses Ausbrechen war ein wenig verrückt. Na, und?
Er verließ am frühen Abend sein Zuhause, ging zum Harburger Bahnhof und fuhr nach Hamburg. Er aß manchmal am Hauptbahnhof eine heiße Wurst. Die heiße Wurst hatte sicher keine gute Qualität, und feine Leute stellten sich nicht vor die Bude und aßen heiße Würstchen. Aber was heißt "feine Leute"? Einer der Nachbarn hatte ihn einmal zufällig an der Würstchenbude gesehen. Er hatte dann zu Hause erzählt, dass der Alte entweder verrückt sein müsse, oder dass er plötzlich Geldprobleme haben müsse. Max wusste nichts von solchem Gerede, und wenn er es gewusst hätte, so hätte er womöglich mit den Schultern gezuckt.
Nach dem Essen der Bratwurst - wenn er denn eine Wurst gegessen hatte - fuhr er nach Altona und lief entlang der Reeperbahn, von wo aus er auch durch einige Nebenstraßen ging. Das ging so weiter, Woche für Woche, bis er das Restaurant „Akropolis“ entdeckt hatte. Das Restaurant war von außen nicht besonders schön, aber es war innen recht gemütlich. Vor allem faszinierte ihn die zarte und doch rhythmische Musik, die den Gästen geboten wurde. Typisch griechische Musik? Das wusste er nicht so genau. Aber ihm gefiel sie. Nun hatte er ein Ziel. Dienstags spazierte er ein wenig herum, dann ging es ins Restaurant. Er erwähnte das Lokal einmal beim Gespräch mit Frau Kranig, und er hatte gesagt: "Und dann gehe ich zur Akropolis!"
"Was ist das denn?" fragte Frau Kranig misstrauisch.
"Das ist ein Restaurant," sagte er lachend. Max beschrieb es ihr. Mehr wollte sie nicht wissen. Ihrer Meinung nach konnte das Restaurant nichts zur ersten Klasse gehören.
Max war mit seinen 79 Jahren kein junger Mann mehr. Sein längliches Gesicht mit der langen Nase war eine einzige Faltenlandschaft, die Hüfte und die Kniegelenke machten ihm gelegentlich zu schaffen. Morgens und abends futterte er Tabletten, die ihm sein Arzt verordnet hatte. Aber er lebte, und solange er lebte, würde er das Leben genießen. Natürlich würde er auch Momente der Einsamkeit haben und den Wunsch, der Einsamkeit von Zeit zu Zeit zu entfliehen. Warum auch nicht? Gewiss, ihm tat sein rechtes Knie weh, und die Hüfte war auch nicht mehr schmerzfrei. Aber das war für ihn kein Grund, Tag für Tag zu Hause die erwünschte Ruhe und die unerwünschte Einsamkeit zu ertragen. Das Alleinsein und die immer wiederkehrende Einsamkeit waren eigentlich gewollt. Vielleicht hatte er sich das Alleinsein etwas anders vorgestellt, und doch wollte er nicht mehr zurück in die Vergangenheit, in die Zeit voller Dynamik. Oh ja, die Vergangenheit mit all der Hektik war interessant gewesen. Es war eine gute Vergangenheit gewesen, und er hatte Erfolge erlebt. Aber er hatte einen Schlussstrich gezogen, und das war gut so, sagte er sich.
Als er zum ersten Mal mit der S-Bahn von Harburg nach Hamburg gefahren war, war er sich wie ein kleiner Junge vorgekommen, der ein großes, unbekanntes Abenteuer erlebt, nicht wie ein alter Mann, der alles schon hinter sich gebracht hatte. Im Harburger Bahnhof hatte er vor dem Fahrkartenautomaten gestanden, und er hatte erst gar nicht gewusst, was er zu tun hatte, um einen Fahrschein zu bekommen. Es brauchte mehr als eine Viertelstunde, ehe er begriffen hatte, wo er das Geld hineinzustecken hatte, und wo schließlich die Fahrkarte herauskommen sollte. Ohne die Hilfe einer freundlichen, jungen Frau wäre er beim ersten Mal nicht zurechtgekommen. Jetzt war es kein Problem mehr. Aus dem abenteuerlichen Erlebnis wurde so etwas wie eine Alltäglichkeit.
Früher, als seine Frau noch gelebt hatte, hatte auch das große Haus Leben gehabt. Es waren Nachbarn gekommen, es waren auch frühere Kollegen und Geschäftsfreunde gekommen, und es waren auch zwei alte Studienkollegen erschienen. Seine Frau war kurz nach Erreichen seines „Ruhestandes“, den er mit der Vollendung des 70. Lebensjahres angetreten hatte, gestorben. Ab da an waren nach und nach die Besucher ausgeblieben. Das lag an ihm selbst, musste er sich eingestehen, denn er besuchte auch kaum noch Freunde oder Kollegen oder Partner. Frühere Klassenkameraden und Studienkollegen, die lediglich alte und uralte Zeiten heraufbeschwören wollten, interessierten ihn nicht. Frühere Arbeitskollegen waren zum Teil bereits gestorben, die anderen waren ihm etwas gleichgültig geworden. Er hatte ein aktives Berufsleben gehabt, und in Fachkreisen war er berüchtigt gewesen als ein zupackender, scharfer Hund. Als er den letzten von mehreren Aufsichtsratsposten abgegeben hatte, war Schluss, ganz einfach.
In den Aufsichtsräten der Unternehmen, in die er berufen worden war, hatte er immer die gleichen Gesichter getroffen. Gewiss, es waren verdiente und vielleicht auch intelligente Leute gewesen, aber alle waren mehr oder weniger in seiner Altersklasse, und alle hatten das Gleiche geredet und dafür gutes Geld bekommen. Als Max vor ein paar Jahren den letzten Aufsichtsratsposten niedergelegt hatte, hatte er sich wie befreit gefühlt.
Ja, er hatte eine Tochter mit dem schönen Namen Elaine gehabt. Sie war bei der Geburt ihrer Tochter Brigitte gestorben. Der Ehemann, ein Herr Wilfried Stöbig, hatte wieder geheiratet und das kleine Mädchen, ein halbes Jahr alt, mit in die neue Ehe eingebracht. Max hatte keine Verbindung zu seiner Enkelin. Und so war er allein in einem großen Haus zurückgeblieben. Er hatte die Haushälterin, die tüchtige Frau Kranig, die seine Frau vor vielen Jahren eingestellt hatte. Außerdem kamen die Putzfrauen regelmäßig, er hatte auch den Gärtner Ferdinand, der den großen Garten pflegte und gelegentlich den Chauffeur spielte, aber damit endete auch fast jeder regelmäßige und geregelte Kontakt zu den Menschen. Natürlich, gelegentlich war er in der Bank, und gelegentlich hatte er auch Telefonate mit Menschen, die früher einmal sehr wichtig gewesen waren. Aber was war jetzt wirklich wichtig? Jetzt war im Grunde nichts mehr wichtig.
4. Kapitel
Max hatte, das musste er zugeben, ein sehr schönes Zuhause mit einer umfangreichen Bibliothek und einigen wertvollen Gemälden, um die er früher oft beneidet worden war. Die Bibliothek, in der er meistens auch arbeitete, hatte einen schönen Blick hinaus zum Garten, der mehr einem Park als einem Garten glich. Der Nachteil war nur der, dass sein Zuhause von Zeit zu Zeit sehr langweilig wurde. Er nannte es Langeweile, aber vielleicht war es lediglich seine Unrast, die ihn immer noch trieb. Wegen dieser Langeweile oder Unrast machte er die Ausflüge in die Stadt, und meistens dorthin, wo er früher nie hingekommen war. Früher war sein Leben ausgefüllt gewesen. Der Gedanke, sich in St. Pauli oder in St. Georg herumzutreiben, wäre ihm damals nie in den Kopf gekommen. Das hatte sich geändert, denn das, was er sah und hörte, waren spannende Abenteuer. Er sah und hörte eine Welt, die ihm bislang fremd gewesen war. Diese fremde Welt war gewiss nicht schön, aber anregend.
Wenn er nach einem solchen Ausflug, der meistens weit nach Mitternacht endete, wieder nach Hause kam, genoss er sein Zuhause, und die ihm vertraute Langeweile fand er sogar wohltuend schön. Dieser Zustand dauerte für gewöhnlich eine Woche bis zehn Tage an, dann drängte es ihn wieder hinaus. Bei seinen Ausflügen zog er sich sehr durchschnittlich an. Jetzt hatte er seine graue Kombination angezogen, eine graue Hose und einen guten, warmen Pullover, dazu hatte er seinen Regenmantel angezogen. Einen Hut brauchte er nicht. Seine vollen, weißen Haare waren ein wenig unordentlich, das störte ihn jedoch nicht. So gekleidet sah er mit seinen knapp 1.75 m sehr, sehr durchschnittlich aus, das jedenfalls sagte ihm der Spiegel. Tatsächlich, er fiel nicht weiter auf, weder auf der Reeperbahn noch an anderen Plätzen, und er wurde auch nicht belästigt. Frau Kranig hatte ihn einmal gewarnt und gesagt, er solle nachts nicht in den anrüchigen Vierteln von Hamburg herumlaufen, denn man höre und lese immer wieder, dass alte Menschen belästig und ausgeraubt würden. Nun, ihm war das noch nicht passiert, und er konnte sich auch nicht vorstellen, dass es ihm passieren würde.
Die gute Frau Kranig, die übrigens nicht im Hause wohnte, schüttelte regelmäßig den Kopf, wenn er von seinen Ausflügen erzählte. So sehr er Frau Kranig schätzte, er war beim „Sie“ geblieben. Und doch saß er ihr beim Frühstück in der Küche gegenüber und erzählte von seinen Ausflügen, wenn er draußen gewesen war. Mit diesem Erzählen erlebte er das kleine Abenteuer zum zweiten Mal, und er verarbeitete es.
Frau Kranig hielt ihren Chef für ein wenig verrückt, denn sie kannte ihn ganz anders aus früheren Tagen. Damals war er ein hoher Herr gewesen, der sich stets ordentlich kleidete, der mit Wagen und Fahrer zur Arbeit fuhr, der seine Dienstreisen unternahm und der Gäste empfing, alles honorige Leute. Und heute zog er sich sehr gewöhnlich an und machte Ausflüge in Gegenden, die sie für gefährlich und anrüchig hielt. Sie fand das nicht in Ordnung. Aber sie hütete sich, mit anderen Menschen darüber zu reden. Sehr gelegentlich machte sie Andeutungen Ferdinand gegenüber. Dieser Ferdinand war nun schon so viele Jahre ihr Kollege, da konnte man schon mal eine Indiskretion begehen.
5. Kapitel
Max hatte sein Haus gegen vier Uhr Nachmittag verlassen. Es war inzwischen gegen acht Uhr abends. Max hatte etwas Hunger – nein, Hunger war es nicht, sagte er sich, es war Appetit, angeregt durch die Gerüche aus „seinem“ griechischen Restaurant in einer der „hinteren Straßen“ der Reeperbahn. Dort hatte er inzwischen mehrfach gegessen, und immer hatte es ihm gefallen. Das Restaurant war gewiss nicht das beste Restaurant in dieser Gegend, und das Publikum war sehr gemischt. Vor allem waren dort Osteuropäer zu gast, vielleicht auch einige Araber, so genau wusste er es nicht, und er wollte es auch nicht wissen. Die Musik war nie laut, was er als wohltuend empfand, und die gesamte Inneneinrichtung war einfach und vielleicht nicht immer ganz sauber. Aber es war gemütlich, man saß auf üppigen Polstern, es roch nach Gebratenem und es gab für seinen Geschmack wunderbaren Rotwein. Ihm war bewusst, dass gute Weinkenner die Nase gerümpft hätten, aber ihm schmeckte dieser Wein. Dass das Restaurant auch für Raucher zugänglich war, störte ihn nicht. Dieser Zigarettenrauch trug, so fand er, zur Atmosphäre, die im Lokal herrschte, bei. Er selbst war kein Raucher. In seiner Jugend hatte er mal geraucht, aber das hatte er bald aufgegeben.
Er wollte wie gewohnt das Restaurant betreten, das den hochtrabenden Namen „Akropolis“ trug. Offenbar gibt es viele Restaurants, die den Namen „Akropolis“ trugen, aber das war letztlich gleichgültig, denn der Name war nicht so wichtig. Gerade als er durch die Tür hinein gehen wollte, fiel ihm ein leicht gekrümmter Mann auf der anderen Straßenseite auf. War der Typ besoffen? Das wäre keine Überraschung, denn betrunkene Menschen gehörten in dieser Gegend fast zum Straßenbild, zumindest abends. Max grinste. Als er genauer hinsah, verwischte sich der Eindruck. Nein, ein Betrunkener war das nicht. War der Mann krank? Das mochte sein, dachte sich Max. Die Beleuchtung war nicht besonders gut, und er war neugierig.
Max überquerte nach einigem Zögern die Straße und ging auf den Mann zu. Der Mann mochte vielleicht etwas mehr als 50 Jahre alt sein. Er sah leicht heruntergekommen und abgewirtschaftet aus, war aber sauber. Max hatte einen kurzen Blick auf die schwarzen Schuhe geworfen: sie waren alt, aber geputzt. Der Fremde trug einen schwarz-blauen Anorak, der bereits bessere Tage gesehen hatte, eine graue Hose, und die dunklen, glatten Haare waren windzerzaust. Was Max aber besonders beeindruckte war, dass das Gesicht des Mannes eine gewisse Hoffnungslosigkeit, eine Traurigkeit, ausdrückte. Vielleicht hatte er Schmerzen, denn er hielt sich etwas krumm, oder er hatte Kummer, mit dem er nicht fertig werden konnte..
„Kann ich Ihnen helfen?“ fragte Max einem Impuls folgend. Normalerweise sprach er keine Menschen an, vor allem nicht in dieser Gegend, von der gesagt wurde, dass sie gefährlich sein könnte. Dieser Mann war aber nicht gefährlich. Der Mann richtete sich halbwegs auf und schaute Max an. Er war etwas größer als Max, sehr hager, und die großen Augen leuchteten. Max hatte den Eindruck, als könne der Mann Fieber haben. Betrunken war er sicherlich nicht, denn das hätte Max spätestens jetzt gerochen. Der breite Mund wirkte blass, die Nase schien etwas gerötet zu sein.
„Nein, danke,“ sagte der Mann mit einer klaren Stimme, und er versuchte so etwas wie ein Lächeln. „Ich komme zurecht. Besten Dank.“
„Vielleicht,“ entgegnete Max. Er wollte sich abwenden, aber dann kam ihm der Gedanke, dass der Mann, der auf ihn keinen schlechten Eindruck machte, doch Hilfe brauchen könnte.
„Hören Sie die Musik aus dem Restaurant?“ fragte Max, und er fügte hinzu: „Es ist eine wundervolle Melodie, finden Sie nicht?“ Es war ein griechisches Lied, wie nicht anders zu erwarten. Was die Sängerin da mit einer rauchigen Stimme von sich gab, konnte Max nicht verstehen. Aber das Lied gefiel ihm. Es war eine einschmeichelnde Melodie, rhythmisch, und doch nicht aufdringlich. Der Fremde richtete sich vollends auf. Er schaute Max erstaunt an, dann nickte er.
„Melodie?“ fragte er mit rauer Stimme, dann hustete er und wiederholte dieses Wort mit klarer Stimme.
„Ja, diese Melodie berührt mich,“ bekannte Max. Er lauschte für einen Augenblick der Musik, dann sagte er:
„Ich gehe hinein. Kommen Sie mit?“
Als Max keine Antwort hörte, sah er den Mann an, der den Kopf schüttelte.
„Kommen Sie nur, ich lade Sie ein,“ drängte Max, und er nickte dazu.
„Ich kann mich nicht revanchieren,“ entgegnete der Mann abwehrend.
„Davon redet kein Mensch. Kommen Sie nur, leisten Sie mir Gesellschaft.“
Der fremde Mann lächelte verhalten, dann nickte er.
6. Kapitel
Das Restaurant war gut besucht, aber es war nicht voll. So war es jeden Dienstag. Es gab noch freie Tische. Max war, wie er dem Fremden sagte, nicht zum ersten Mal hier, und er fand in der hinteren Ecke den Tisch, an dem er bereits mehrfach gesessen hatte. Von dem Tisch aus konnte man das Lokal überblicken, ohne selbst gesehen zu werden.
Der Kellner, von dem Max wusste, dass er kein Grieche, sondern ein Italiener war, eilte herbei und fragte, womit er den Herren dienen könne. Max bestellte „seinen Wein“, wozu nur ein Kopfnicken nötig war. Der Kellner, der auf den Namen Guiseppe hörte, wusste, dass Max wieder den roten Demestika nehmen würde. Das war ein Durchschnittswein, gewiss, aber Max trank ihn gerne. Was das Essen anging, so wollte Max einen Fleischspieß, während sich der Fremde – etwas zögerlich – eine Fischsuppe wünschte.
„Ich heiße Franz Hallbeg,“ stellte sich der Fremde vor, worauf Max auch seinen Namen, Max Berber, nannte und meinte, man könne ihn auch Max nennen, das sei einfacher, und in dieser Atmosphäre sei ein „Du“ angemessener. Max grinste, als er das sagte. Ihm gefiel dieser Franz, auch wenn er abgerissen aussah, und sicherlich nicht zur Sonnenseite der Gesellschaft gehörte. Vielleicht hatte er nie eine Chance gehabt. Und das „Du“? Max war kein Mensch, der leicht andere Menschen duzte. Warum tat er es jetzt? Vielleicht, weil er in dieser Umgebung „ein anderer“ sein wollte, nicht der, der er immer gewesen war, nicht der, der im Berufsleben "ganz oben" gewesen war, und der eine Villa in Harburg hatte.
„Ich bin Rentner,“ sagte Max, „und im Augenblick genieße ich es, einfach Rentner oder Ruheständler zu sein. Aber allgemein gesprochen weiß ich nicht so recht, ob ich gerne Rentner bin oder nicht.“
„Und ich?“ Franz schüttelte den Kopf und bekannte, dass er arbeitslos sei. „Seit gut zwei Jahren. Ich bin 57 Jahre alt – so schnell finde ich nichts mehr.“
„Was hast du denn gemacht?“ wollte Max wissen, aber er fügte gleich hinzu: „Du brauchst mir nichts zu sagen, wenn du nicht willst. Eigentlich geht es mich nichts an. Ich bin einfach zufrieden, dass wir zusammen sitzen können, dass wir miteinander reden können. Weißt du, ich bin Witwer. Ich habe zu Hause Niemanden, mit dem ich richtig reden kann.“
So ganz richtig war das nicht, denn er hatte Frau Kranig, mit der er täglich redete. Aber dieses Reden miteinander hatte keinen Tiefgang, glaubte er. Es war nicht anregend oder geistig befruchtend. Man redete über das Wetter und andere Tagesereignisse. Das galt auch für die Gespräche mit dem Gärtner, mit dem er oft redete, nicht zuletzt wegen des Gartens, an dem Max seine Freude hatte.
Der Wein wurde gebracht, dann das Essen, die Suppe und der Spieß. Dazu gab es Weißbrot. Max und sein „neuer Bekannter Franz“ aßen. Max mit großem Appetit, Franz eher vorsichtig und zögernd, als würde es ihm nicht so richtig schmecken.
„Ich bin auch Witwer,“ sagte Franz. „Seit fast zwei Jahren.“ Nach einer Weile fügte er hinzu: „Ich habe drei Kinder – nun, sie sind nicht mehr klein. Zwei Jungen und ein Mädchen.“
Max schaute Franz an. Erst wollte er sagen, dass er eine Tochter gehabt hatte, die nicht mehr lebte, dann aber tat er es doch nicht. Die Tochter lebte seit fast 30 Jahren nicht mehr, es war müßig, jetzt darüber zu reden. Vielleicht später einmal. Er fühlte, dass Franz reden wollte, vielleicht reden musste. Dieser Franz war vielleicht genauso einsam wie er selbst, oder vielleicht noch einsamer.
„Eigentlich tut es mir leid, dass ich hier so gut esse – ich weiß nicht, was die Kinder sich zurechtmachen, oder ob sie überhaupt etwas essen, oder ob sie zuhause sind,“ erzählte Franz sehr nachdenklich. „Heinrich, das ist der Älteste, der studiert. Ich meine, er arbeitet nebenher in einem Verlag, denn anders wäre es nicht zu machen. Ich kann ihm mit der Unterstützung, die ich kriege, nicht viel geben. Mia, so nenne ich meine Tochter, wollte auch studieren. Aber das geht im Augenblick nicht. Sie macht eine Banklehre durch, die ihr nicht besonders gefällt. Das heißt, so genau weiß ich es nicht, aber ich nehme es an. Vielleicht kann sie später studieren, wenn die Lehre beendet ist. Und der Jüngste?“ Franz zuckte mit den Schultern.
„Weißt du, bevor meine Frau starb, hatten wir viele Pläne. Na ja, wie das so ist. Man plant und plant und hat Träume, Wünsche, Hoffnungen, und am Ende ist dann alles anders. Nichts ist übrig geblieben, und alle Wünsche haben sich nicht erfüllt.“
Max nickte freundlich, und er deutete damit an, dass er zuhöre. Der Fremde mit dem Namen Franz wollte offensichtlich weiter reden. Langsam beendete Franz seine Suppe. Er führte jeweils den Löffel zum Mund und schluckte auffallend vorsichtig.
„Jetzt mache ich den Haushalt, weißt du? Ich wasche, ich bügele, ich putze, wenn ich nicht gerade bei der Arbeitsagentur bin – das heißt, da gehe ich auch nicht mehr hin. Dort bin ich ein Mensch zweiter Klasse. Einer, der gescheitert ist. Ich bin – ich war Mechaniker, und ich war im Schiffsbau tätig gewesen. Mein Gebiet waren Schiffsmotore. Ich hatte wirklich gut verdient. Wie das so ist. Dann wurde meine Frau krank, und unser Gespartes ging drauf. Ich habe immer geglaubt, dass Renate es schaffen würde. Es hatte nicht sein sollen.“
Max nickte wieder. Die Geschichte berührte ihn, und er konnte nicht genau sagen, warum das so war. Seine Frau war auch gestorben, auch das hatte viel Geld gekostet, aber er hatte gut verdient, und der Verlust des Geldes, das die Krankheit seiner Frau gekostet hatte, hatte ihm nicht weh getan. Er hätte das Zehnfache zahlen können, ohne es finanziell zu merken.
„Weißt du, Renate und ich wollten unsere Kinder studieren lassen,“ fuhr Franz fort. „Der Heinrich, das ist unser Ältester, hatte gute Zeugnisse, und er fing mit seinem Studium hier in Hamburg an. Er studiert Geschichte und Politik. Er macht viel in Politik. Er fing bei den Linken an, und jetzt ist der bei der FDP,“ Franz musste grinsen. „Weißt du, die Linken kümmern sich um alles, und die Liberalen kümmern sich um so wenig wie möglich – das sagt mein Heinrich immer. Und was ist besser? Ich weiß es nicht.“
Das Gesicht von Franz verzog sich, er krümmte sich etwas nach vorne, aber nur für einen kurzen Augenblick. Dann schaute er Max an und sagte weiter: „Mia, unsere Tochter, hat Abitur gemacht, aber zum Studium fehlte das Geld. Und so fing sie eine Lehre in einer Bank an. Vielleicht kann sie nach der Lehre studieren.“ Franz schüttelte den Kopf, als er weiter sagte: „Ich glaube, das habe ich bereits erzählt. Na, das macht nichts." Franz grinste, ehe er fortfuhr: "Unsere Mia ist ein schwieriges Mädchen. Die Phase der Discobesuche und lauten Parties ist noch nicht ganz vorüber. Vor ein paar Jahren hatte sie noch Piercing-Ringe überall im Gesicht. Meine Frau hätte sich um Grab umgedreht. Als sie sich bei der Bank vorstellte, hatte der Personalleiter gleich gesagt, dass das Metall zu verschwinden habe. Jetzt läuft sie ohne Metall herum. Aber sie ist immer noch etwas wild.“ Nach einer kleinen Weile sagte er weiter: „Sie lässt sich nichts sagen.“ Franz zuckte mit den Schultern, dann fuhr er fort: „Ich habe ihr auch nichts zu sagen. Sie ist viel zu unabhängig.“
Max dachte an seine Tochter, die ebenfalls eine recht schwierige Phase gehabt hatte. Das aber lag mehr als 40 Jahre zurück. Seine Frau hatte damit fertig werden müssen. Er selbst hatte kaum etwas von der problematischen Lebensphase seiner Tochter gemerkt. Das, was er wusste, hatte er von seiner Frau gehört. Diese Periode, so erinnerte er sich, mochte vielleicht zwei oder drei Jahre gedauert haben. Als sie geheiratet hatte, war sie eine ganz normale, gesittete Hausfrau geworden. Nun, das war Geschichte, es hatte keinen Zweck, sich an das zu erinnern, was dann folgte. Überhaupt: es ist nie gut, zurückzublicken, wenn es ein „Voraus“ gibt. Was aber war das Voraus - für ihn?
„Ich glaube, ich sollte nach Hause gehen,“ sagte Franz. Er hatte seine Suppe beendet. Max wollte für Franz noch etwas bestellen, aber das wollte Franz nicht. Er sagte, dass die Suppe ausreichte. Es war eine gute Suppe gewesen, aber nun habe er keinen Hunger.
"Was willst du denn zu Hause tun?" fragte Max aus reiner Neugier. Der Mann interessierte ihn.
"Wenn eines der Kinder da ist, werden wir uns vielleicht unterhalten - aber sonst?" Franz zuckte mit den Schultern. "Ich gehe dann zu Bett, vielleicht. Fernsehen? Ich gucke schon lange kein Fernsehen mehr. Irgendwie gefällt es mir nicht mehr."
Max schaute auf die Uhr. Es war kurz nach zehn Uhr. Gewiss, wenn man am nächsten Morgen früh aufstehen musste, war es Zeit, zu Bett zu gehen. Vielleicht musste Franz früh aufstehen, um dafür zu sorgen, dass die Kinder rechtzeitig aus dem Haus kamen.
„Ja, ich habe mir die Arztberichte geholt, und vielleicht wollen die Kinder wissen, was drin steht.“
„Arztberichte? Bist du krank?“ fragte Max.
Franz zuckte mit den Schultern. Schließlich sagte er:
„Ja, das betrifft mich, die Berichte, meine ich.“
„Ist es ernst?“ fragte Max.
Wieder zuckte Franz mit den Schultern, aber er sagte nichts. Max drängte nicht weiter, denn es war ganz offensichtlich, dass Franz nicht darüber reden wollte.
Max zahlte, verabschiedete sich mit Handschlag von Guiseppe, dann gingen die beiden Männer hinaus.
„Ich bedanke mich für den Abend,“ erklärte Max, und als Franz abwehren wollte, sagte er weiter:
„Ja, es ist so. Ich war an diesem Abend nicht allein, und das habe ich gebraucht. Es war gut, dass du da warst.“ Dann dachte Max, dass er sich vielleicht für einen weiteren Abend verabreden sollte. Und so sagte er:
„Was hältst du davon, wenn wir uns nächsten Dienstag hier treffen? Hier, in diesem Restaurant?“
Erst zögerte Franz, dann meinte er: „Warum nicht? Es war auch für mich ein schöner Abend. Mal etwas anderes, und einmal Pause von den Kindern, und Pause auch von schlechten Gedanken. Ja, warum nicht? Ich würde mich freuen.“
"Gut, prima, ich werde um acht Uhr hier sein," meinte Max.