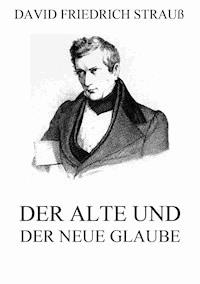
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem Werk "Der alte und der neue Glauben" aus dem Jahr 1872 vertrat Strauß bereits einen vom Materialismus beeinflussten Monismus. Die Frage, ob "wir" noch Christen seien, beantwortete er offen mit "Nein". Eine sich auf das als gesetzhaft funktionierend verstandene Universum richtende Religiosität sah Strauß zwar für sich nicht, hielt sie aber für eine legitime Alternative zum christlichen Glauben an Gott.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der alte und der neue Glaube
David Friedrich Strauß
Inhalt:
David Friedrich Strauß – Biografie und Bibliografie
Der alte und der neue Glaube
1.
2.
3.
I. Sind wir noch Christen?
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
II. Haben wir noch Religion?
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
III. Wie begreifen wir die Welt?
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
IV. Wie ordnen wir unser Leben?
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Erste Zugabe. Von unsern großen Dichtern.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Zweite Zugabe. Von unsern großen Musikern.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Ein Nachwort als Vorwort zu den neuen Auflagen meiner Schrift: Der alte und der neue Glaube.
Der alte und der neue Glaube, D. F. Strauß
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849637224
www.jazzybee-verlag.de
David Friedrich Strauß – Biografie und Bibliografie
Prot. Theologe und Schriftsteller, geb. 27. Jan. 1808 zu Ludwigsburg in Württemberg, gest. daselbst 8. Febr. 1874, bildete sich in dem theologischen Stift zu Tübingen, ward 1830 Vikar, 1831 Professoratsverweser am Seminar in Maulbronn, ging aber noch ein halbes Jahr nach Berlin, um Hegel und Schleiermacher zu hören. 1832 wurde er Repetent am theologischen Seminar in Tübingen und hielt zugleich philosophische Vorlesungen an der Universität. Damals erregte er durch seine Schrift »Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet« (Tübing. 1835, 2 Bde.; 4. Aufl. 1840) ein fast beispielloses Aufsehen. S. wandte darin das auf dem Gebiete der Altertumswissenschaften begründete und bereits zur Erklärung alttestamentlicher und einzelner neutestamentlicher Erzählungen benutzte Prinzip des Mythus auch auf den gesamten Inhalt der evangelischen Geschichte an, in der er ein Produkt des unbewußt nach Maßgabe des alttestamentlich jüdischen Messiasbildes dichtenden urchristlichen Gemeingeistes erkannte. Die Gegenschriften gegen dieses Werk bilden eine eigne Literatur, in der kaum ein theologischer und philosophischer Name von Bedeutung fehlt. Strauß' Antworten erschienen als »Streitschriften« (Tübing. 1837, 3 Hefte). Für die persönlichen Verhältnisse des Verfassers hatte die Offenheit seines Auftretens die von ihm stets schmerzlich empfundene Folge, dass er noch 1835 von seiner Repetentenstelle entfernt und als Professoratsverweser nach Ludwigsburg versetzt wurde, welche Stelle von ihm jedoch schon im folgenden Jahre mit dem Privatstand vertauscht wurde. Früchte dieser ersten (Stuttgarter) Muße waren die »Charakteristiken und Kritiken« (Leipz. 1839, 2. Aufl. 1844) und die Abhandlung »Über Vergängliches und Bleibendes im Christentum« (Altona 1839). Von einer versöhnlichen Stimmung sind auch die in der 3. Auflage des »Lebens Jesu« (1838) der positiven Theologie gemachten Zugeständnisse eingegeben, aber schon die 4. Auflage nahm sie sämtlich zurück. 1839 erhielt S. einen Ruf als Professor der Dogmatik und Kirchengeschichte nach Zürich; doch erregte diese Berufung im Kanton so lebhaften Widerspruch, dass er noch vor Antritt seiner Stelle mit 1000 Frank Pension in den Ruhestand versetzt ward. 1841 verheiratete sich S. mit der Sängerin A. Schebest, doch wurde die Ehe nach einigen Jahren getrennt. Sein zweites Hauptwerk ist: »Die christliche Glaubenslehre, in ihrer geschichtlichen Entwickelung und im Kampf mit der modernen Wissenschaft dargestellt« (Tübing. 1840–41, 2 Bde.), worin eine scharfe Kritik der einzelnen Dogmen in Form einer geschichtlichen Erörterung des Entstehungs- und Auflösungsprozesses derselben gegeben wird. Auf einige kleine ästhetische und biographische Artikel in den »Jahrbüchern der Gegenwart« folgte das Schriftchen »Der Romantiker auf dem Thron der Cäsaren, oder Julian der Abtrünnige« (Mannh. 1847; 3. Aufl., Bonn 1896), eine ironische Parallele zwischen der Restauration des Heidentums durch Julian und der Restauration der protestantischen Orthodoxie durch den König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. 1848 von seiner Vaterstadt als Kandidat für das deutsche Parlament aufgestellt, unterlag S. dem Misstrauen, das die pietistische Partei unter dem Landvolk des Bezirkes gegen ihn wachrief. Die Reden, die er teils bei dieser Gelegenheit, teils vorher in verschiedenen Wahlversammlungen gehalten hatte, erschienen unter dem Titel: »Sechs theologisch-politische Volksreden« (Stuttg. 1848). Zum Abgeordneten der Stadt Ludwigsburg für den württembergischen Landtag gewählt, zeigte S. wider Erwarten eine konservative politische Haltung, die ihm von seinen Wählern sogar ein Misstrauensvotum zuzog, in dessen Folge er im Dezember 1848 sein Mandat niederlegte. Seiner späteren, teils in Heidelberg, München und Darmstadt, teils in Heilbronn und Ludwigsburg verbrachten Muße entstammten die durch Gediegenheit der Forschung und schöne Darstellung ausgezeichneten biographischen Arbeiten: »Chr. Friedr. Daniel Schubarts Leben in seinen Briefen« (Berl. 1849, 2 Bde.); »Christian Märklin, ein Lebens- und Charakterbild aus der Gegenwart« (Mannh. 1851); »Leben und Schriften des Nikodemus Frischlin« (Frankf. 1855); »Ulrich von Hutten« (Leipz. 1858; 6. Aufl., Bonn 1895), nebst der Übersetzung von dessen »Gesprächen« (Leipz. 1860); »Herm. Samuel Reimarus« (das. 1862); »Voltaire, sechs Vorträge« (das. 1870; 8. Aufl., Bonn 1895; Frankf. a. M. 1906); ferner »Kleine Schriften biographischen, literatur- und kunstgeschichtlichen Inhalts« (Leipz. 1862; neue Folge, Berl. 1866; 3. Aufl., Bonn 1898), woraus »Klopstocks Jugendgeschichte etc.« (Bonn 1878) und der Vortrag »Lessings Nathan der Weise« (4. Aufl., das. 1896) besonders erschienen. Eine neue, für das Volk bearbeitete Ausgabe seines »Lebens Jesu« (Leipz. 1864; 13. Aufl., Stuttg. 1904) ward in mehrere europäische Sprachen übersetzt. Einen Teil der hierauf gegen ihn erneuten Angriffe wies er in der gegen Schenkel und Hengstenberg gerichteten Schrift zurück: »Die Halben und die Ganzen« (Berl. 1865), wozu noch gehört: »Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte, eine Kritik des Schleiermacherschen Lebens Jesu« (das. 1865). Noch einmal, kurz vor seinem Tod, erregte S. allgemeines Aufsehen durch seine Schrift »Der alte und der neue Glaube, ein Bekenntnis« (Leipz. 1872; 16. Aufl. als Volksausg., Stuttg. 1904), in der er mit dem Christentum brach, alle gemachten Zugeständnisse zurücknahm und einen positiven Aufbau der Weltanschauung auf Grundlage der neuesten, materialistisch und monistisch gerichteten Naturforschung unternahm. S.' »Gesammelte Schriften« (mit Ausschluss der spezifisch theologischen und dogmatischen), hat Zeller herausgegeben (Bonn 1876–78, 11 Bde., auch die von ihm hinterlassenen »Literarischen Denkwürdigkeiten« und die Gedichte enthaltend), dazu »Poetisches Gedenkbuch«, Gedichte (das. 1878) und »Ausgewählte Briefe« (das. 1895), die Briefe an Binder-Ziegler (in der »Deutschen Revue«, 1905). Vgl. Hausrath, David Friedrich S. und die Theologie seiner Zeit (Heidelb. 1876–78, 2 Bde.); Zeller, David Friedrich S. in seinem Leben und seinen Schriften geschildert (Bonn 1874); Eck, David Friedrich S. (Stuttg. 1899); Harräus, David Friedrich S. (Leipz. 1901).
Der alte und der neue Glaube
Ein Bekenntniß
1.
Der großen kriegerisch-politischen Bewegung, die im Laufe der letzten sechs Jahre die Verhältnisse Deutschlands nach außen und innen umgestaltet hat, ist auf dem Fuß eine kirchliche gefolgt, die sich kaum weniger kriegerisch anläßt.
Schon in dem Machtzuwachse, den die Beseitigung Österreichs durch Preußen und die Bildung des Norddeutschen Bundes dem Protestantismus zu bringen schien, hat der römische Katholizismus eine Aufforderung erkannt, seine ganze geistlich-weltliche Gewalt in der Hand des für unfehlbar erklärten Papstes dictatorisch zusammenzufassen. Das neue Dogma ist innerhalb der katholischen Kirche selbst auf einen Widerspruch gestoßen, der sich seitdem in der Partei der sogenannten Altkatholiken Gestalt gegeben hat; während die neubegründete deutsche Staatsgewalt, nach allzulangem ihr von der preußischen Politik der drei letzten Jahrzehnte vererbten Gehenlassen, endlich zu nachdrücklicher Abwehr der drohenden kirchlichen Uebergriffe entschlossen scheint.
Dieser Bewegung innerhalb der katholischen Kirche gegenüber kann im Augenblick die protestantische als die stabilere erscheinen. Ohne innere Gährung ist gleichwohl auch sie nicht; nur daß dieselbe, der Natur dieses Bekenntnisses gemäß, mehr einen religiös- als politisch-kirchlichen Charakter trägt. Dem Gegensatze zwischen dem alten Consistorialregiment und den auf eine Synodalverfassung gerichteten Bestrebungen liegt hinter dem hierarchischen Zuge auf der einen, dem demokratischen auf der andern Seite, doch eine dogmatisch-religiöse Differenz zu Grunde. Zwischen den Altlutheranern und den Unionsfreunden, und weiterhin den Männern des Protestantenvereins, wird in der That um religiöse Fragen, um eine verschiedene Auffassung des Christenthums und des Protestantismus selbst gestritten. Wenn diese protestantische Bewegung sich nicht so laut macht wie die katholische, so kommt dieß nur daher, daß eben Machtfragen ihrer Natur nach mehr Geräusch mit sich bringen als Glaubensfragen, so lange sie nur dieses bleiben.
Indessen, wie dem sei: von allen Seiten regt man sich doch, erklärt man sich doch, rüstet man sich doch; nur wir, scheint es, bleiben stumm und legen die Hände in den Schooß.
Welche Wir? Es spricht ja vor der Hand nur ein Ich, und zwar ein solches, so viel wir wissen, das, ohne Verbindung, ohne Anhang, eine möglichst vereinzelte Stellung einnimmt.
O, weniger noch als das; es hat nicht einmal eine Stellung, dieses Ich und Geltung nur so viel, als man sein Wort ebenfalls will gelten lassen. Und zwar das geschriebene und gedruckte Wort; da es zum Redner in Versammlungen, zum wandernden Missionär seiner Ueberzeugungen, weder begabt noch aufgelegt ist. Aber man kann ohne Stellung sein, und doch nicht am Boden liegen; ohne Verbindung sein, und doch nicht allein stehen. Wenn ich Wir sage, so weiß ich, daß ich ein Recht dazu habe. Meine Wir zählen nicht mehr bloß nach Tausenden. Eine Kirche, eine Gemeinde, selbst einen Verein, bilden wir nicht; aber wir wissen auch warum.
Nicht zu zählen jedenfalls ist die Menge derer, die von dem alten Glauben, der alten Kirche, sei es evangelische oder katholische, sich nicht mehr befriedigt finden; die den Widerspruch theils dunkel fühlen, theils klar erkennen, worin beide immer mehr mit den Erkenntnissen, der Welt- und Lebensanschauung, den geselligen und staatlichen Bildungen der Gegenwart gekommen sind, und die hier eine Aenderung, eine Abhülfe, für ein dringendes Bedürfniß halten.
An diesem Punkte jedoch theilt sich die Masse der Unbefriedigten und Weiterstrebenden in zwei Richtungen. Die einen – und sie bilden, wie nicht zu leugnen, die weit überwiegende Majorität, und zwar in beiden Confessionen – halten es für genügend, die notorisch dürre gewordenen Zweige des alten Baumes zu entfernen, in der Hoffnung, ihn dadurch von Neuem lebenskräftig und fruchtbar zu machen. Dort will man sich wohl einen Papst gefallen lassen, nur keinen unfehlbaren; hier will man an Christus festhalten, nur soll er nicht mehr für den Sohn Gottes ausgegeben werden. Uebrigens aber soll es in beiden Kirchen bleiben wie es war: in der einen Priester und Bischöfe, die den Laien als geweihte Spender der kirchlichen Gnadenmittel gegenüberstehen; in der andern, wenn auch mit freigewählten Geistlichen und nach selbstgegebenen Ordnungen, die Predigt von Christus, die Austheilung der von ihm eingesetzten Sakramente, die Feier der Feste, die uns die Hauptereignisse seines Lebens in der Erinnerung halten.
Neben dieser Mehrheit indeß gibt es eine nicht zu übersehende Minderheit. Sie hält große Stücke auf den engen Zusammenhang des kirchlichen Systems, überhaupt auf Consequenz. Sie ist der Meinung, wer einmal den Unterschied von Klerus und Laien, das Bedürfniß der Menschheit, in Fragen der Religion und Sitte sich jederzeit bei einer von Gott durch Christus eingesetzten Behörde untrügliche Belehrung holen zu können, zugestehe, der könne auch einem unfehlbaren Papste, als von jenem Bedürfniß gefordert, seine Anerkennung nicht versagen. Und ebenso, wenn man einmal Jesus nicht mehr für den Sohn Gottes, sondern für einen Menschen, wenn auch noch so vortrefflichen, ansehe, so habe man kein Recht mehr, zu ihm zu beten, ihn als Mittelpunkt eines Cultus festzuhalten, Jahr aus Jahr ein über ihn, seine Thaten, Schicksale und Aussprüche, zu predigen; zumal wenn man unter jenen Thaten und Schicksalen die wichtigsten als fabelhaft, diese Aussprüche und Lehren aber zum guten Theil als unvereinbar mit dem jetzigen Stande unserer Welt- und Lebensansichten erkenne. Sieht aber so diese Minderheit den geschlossenen Kreis des kirchlichen Cultus sich lösen, so bekennt sie, nicht zu wissen, wozu überhaupt ein Cultus vorerst noch dienen soll; wozu ferner ein besonderer Verein wie die Kirche neben dem Staate, der Schule, der Wissenschaft, der Kunst, an denen wir alle Theil haben, noch dienen soll.
Diese so denkende Minderheit sind die Wir, in deren Namen ich zu reden unternehme.
2.
Nun kann man aber in der Außenwelt nichts wirken, wenn man nicht zusammensteht, sich verständigt und dieser Verständigung gemäß mit vereinigten Kräften handelt. Wir sollten mithin, so scheint es, den alt- und neukirchlichen Vereinen gegenüber einen unkirchlichen, einen rein humanitären und rationellen, gründen. Aber es geschieht nicht, und wo es einige versuchen, machen sie sich lächerlich. Das dürfte uns nicht abschrecken, wir müßten es nur besser machen. So scheint es Manchen, aber uns scheint es nicht so. Wir erkennen vielmehr einen Widerspruch darin, einen Verein zu gründen zur Abschaffung eines Vereins. Wenn wir thatsächlich erweisen wollen, daß wir keine Kirche mehr brauchen, dürfen wir nicht ein Ding stiften, das selbst wieder eine Art von Kirche wäre.
Verständigen aber sollen und wollen wir uns doch. Das kann indeß in unserer Zeit geschehen auch ohne Verein. Wir haben den öffentlichen Vortrag, wir haben vor Allem die Presse. Ein Versuch, mit meinen Wir mich auf diesem letzteren Wege zu verständigen, ist es, den ich gegenwärtig hier mache. Und zu dem, was wir zunächst allein wollen können, reicht dieser Weg auch vollkommen hin. Wir wollen für den Augenblick noch gar keine Aenderung in der Außenwelt. Es fällt uns nicht ein, irgend eine Kirche zerstören zu wollen, da wir wissen, daß für Unzählige eine Kirche noch Bedürfniß ist. Für eine Neubildung aber (nicht einer Kirche, sondern nach deren endlichem Zerfall einer neuen Organisirung der idealen Elemente im Völkerleben) scheint uns die Zeit noch nicht gekommen. Nur an den alten Gebilden bessern und flicken wollen wir gleichfalls nicht, weil wir darin eine Hemmung des Umbildungsprocesses erkennen. Wir möchten nur im Stillen dahin wirken, daß aus der unvermeidlichen Auflösung des Alten sich in Zukunft ein Neues von selber bilde. Dazu genügt eine Verständigung ohne Verein, eine Ermunterung durch das freie Wort.
Was ich zu diesem Zwecke im Folgenden auszuführen gedenke, davon bin ich mir wohl bewußt, daß es Unzählige ebenso gut, Manche sogar viel besser wissen. Einige haben auch bereits gesprochen. Soll ich darum schweigen? Ich glaube nicht. Wir ergänzen uns ja alle gegenseitig. Weiß ein Anderer Vieles besser, so ich doch vielleicht Einiges; und Manches weiß ich anders, sehe ich anders an als die Uebrigen. Also frischweg gesprochen, heraus mit der Farbe, damit man erkenne, ob sie eine ächte sei.
Dazu kommt für mich persönlich noch ein Weiteres. Ich bin nun bald 40 Jahre in der gleichen Richtung schriftstellerisch thätig gewesen, habe für das, was mir als das Wahre, vielleicht mehr noch gegen das, was mir als unwahr erschien, fort und fort gekämpft, und bin darüber an die Schwelle des Greisenalters, ja in dieses selbst hineingeschritten. Da vernimmt jeder ernstgesinnte Mensch die innere Stimme: "Thue Rechnung von deinem Haushalt, denn du wirst hinfort nicht lange mehr Haushalter sein."
Daß ich ein ungerechter Haushalter gewesen wäre, dessen bin ich mir nicht bewußt. Ein ungeschickter mitunter, und wohl auch ein lässiger, das weiß der Himmel; aber im Ganzen that ich, wozu ich Kraft und Trieb in mir empfand, und that es ohne rechts oder links zu sehen, ohne jemands Gunst zu suchen, ohne jemands Abgunst zu scheuen. Aber was ist es, das ich that? Man hat wohl schließlich ein Ganzes im Sinne, aber man sagt immer nur gelegentlich Einzelnes; hängt und stimmt nun dieses Einzelne auch unter sich zusammen? Man schlägt im Eifer manches Alte in Trümmer: aber hat man denn auch ein Neues bereit, das an die Stelle des Alten gesetzt werden könnte?
Dieser Vorwurf besonders, nur zu zerstören ohne wiederaufzubauen, wird gegen die in solcher Richtung Thätigen beständig wiederholt. In gewissem Sinne wehre ich mich gegen denselben nicht: nur daß ich ihn nicht als Vorwurf gelten lasse. Nach außen schon jetzt etwas zu bauen, das, wie gesagt, habe ich mir ja gar nicht vorgesetzt, weil ich die Zeit dazu noch nicht gekommen glaube. Es kann sich nur um innere Vorbereitung handeln, und Vorbereitung eben in denen, die sich durch das Alte nicht mehr befriedigt, durch halbe Maßregeln nicht beruhigt finden. Ich wollte und will keine Zufriedenheit, keinen Glauben stören, sondern nur wo sie bereits erschüttert sind, will ich nach der Richtung hinzeigen, wo meiner Ueberzeugung nach ein festerer Boden zu finden ist.
Dieser Boden kann in meinem Sinne kein anderer sein, als was man die moderne Weltanschauung, das mühsam errungene Ergebnis) fortgesetzter Natur- und Geschichtsforschung, im Gegensatze gegen die christlich-kirchliche nennt. Aber eben diese moderne Weltanschauung, wie ich sie fasse, habe ich bis jetzt immer nur in einzelnen Andeutungen, niemals ausführlich und in einer gewissen Vollständigkeit entwickelt. Ich habe noch nie genugsam zu zeigen versucht, ob sie festen Grund, sichere Tragfähigkeit, Einheit und Zusammenhang in sich selbst besitze. Diesen Versuch einmal zu machen, bekenne ich mich nicht nur Andern, sondern auch mir selber schuldig. Man denkt sich Manches halbträumerisch im Innern zusammen, was, wenn man es einmal in der festen Gestalt von Worten und Sätzen aus sich herausstellen will, nicht zusammengeht. Auch mache ich mich zum Voraus keineswegs anheischig, daß mir der Versuch durchaus gelingen, daß nicht einzelne Lücken, einzelne scheinbare Widersprüche übrig bleiben sollen. Eben daran aber, daß ich diese nicht zu verdecken suche, mag der Prüfende die Redlichkeit meiner Absicht erkennen, und durch eigenes Ueberdenken mag er sich selbst ein Unheil darüber bilden, auf welcher Seite, ob auf der des alten Glaubens oder der neueren Wissenschaft, der in menschlichen Dingen nicht zu vermeidenden Dunkelheiten und Unzulänglichkeiten mehrere sind.
3.
Zweierlei also werde ich darzulegen haben: einmal unser Verhältniß zum alten Kirchenglauben, und dann die Grundzüge der neuen Weltanschauung, zu der wir uns bekennen.
Der Kirchenglaube ist das Christenthum. Es stellt sich folglich unsere erste Frage dahin, ob und in welchem Sinne wir noch Christen sind. Das Christenthum ist eine bestimmte Form der Religion, deren allgemeines Wesen von jener Form noch verschieden ist: es kann einer vom Christenthum sich losgesagt haben, und doch noch religiös sein: es entwickelt sich also aus jener ersten Frage die andere, ob wir überhaupt noch Religion haben.
Auch unsere zweite Hauptfrage, nach der neuen Weltanschauung, spaltet sich näher betrachtet in zwei. Wir wollen nämlich fürs Erste wissen, worin diese Weltanschauung besteht, auf welche Beweise sie sich stützt, und was, besonders der alten kirchlichen Ansicht gegenüber, ihre bezeichnenden Grundzüge sind. Fürs Andere aber wollen wir erfahren, ob uns diese moderne Weltansicht auch den gleichen Dienst leistet, und ob sie uns denselben besser oder schlechter leistet, als den Altgläubigen die christliche, ob sie mehr oder weniger geeignet ist, das Gebäude eines wahrhaft menschlichen, d. h. sittlichen und dadurch glückseligen Lebens darauf zu gründen.
Wir fragen also in erster Linie:
I. Sind wir noch Christen?
4.
Christen in welchem Sinne? Denn das Wort hat jetzt einen nicht blos nach den Confessionen, sondern noch mehr nach den mancherlei Abstufungen zwischen Glauben und Aufklärung, verschiedenen Sinn, Daß wir es im Sinne des alten Glaubens irgend einer Konfession nicht mehr sind, versteht sich nach dem Bisherigen von selbst; auch von allen den verschiedenen Schattirungen, in denen das heutige Christenthum schillert, kann es sich bei uns nur etwa um die äußerste, abgeklärteste handeln, ob wir uns zu ihr noch zu bekennen vermögen. Indeß auch an ihr würde uns manches unverständlich bleiben, wenn wir uns nicht vorher den alten Christenglauben wenigstens in seinen Umrissen zur Vorstellung gebracht hätten; die Mischformen sind nur aus der reinen Grundform zu verstehen.
Wollen wir sehen, wie der alte unverfälschte Kirchenglaube beschaffen war und wie er sich heute ausnimmt, so müssen wir ihn nicht bei einem heutigen Theologen, auch keinem orthodoxen, suchen, wo er ohne Ausnahme immer schon gemischt erscheint, sondern aus der Quelle, aus einem der alten Glaubensbekenntnisse schöpfen. Wir nehmen das seiner Grundlage nach älteste, das zugleich heute noch in kirchlichem Gebrauche ist, das sogenannte apostolische Symbolum, indem wir es gelegentlich aus spätern Lehrbestimmungen ergänzen und erläutern.
Das apostolische Symbolum ist in drei Artikel getheilt nach dem Schema der göttlichen Dreieinigkeit, dem Grunddogma des altkirchlichen Glaubens. Von dieser selbst sagt es weiter nichts aus; um so mehr thun das die späteren Glaubensbekenntnisse, das nicänische und besonders das sogenannte athanasianische. "Der katholische Glaube ist," sagt das letztere, "daß wir Einen Gott in der Dreiheit und die Dreiheit in der Einheit verehren, ohne weder die Personen zu vermischen, noch das Wesen zu theilen." Eine andere sei nämlich die Person des Vaters, eine andere die des Sohnes, eine andere die des heiligen Geistes, und doch alle drei nur Ein Gott.
Ist es doch, als hätten diese alten Christen, je unwissender sie in allen natürlichen Dingen waren, um so mehr Denkkraft für dergleichen Uebernatürlichkeiten zur Verfügung gehabt: denn derartige Zumuthungen, drei als eins und eins als drei zu denken, wobei unser Verstand uns geradezu seine Dienste versagt, waren ihnen eine Kleinigkeit, ja eine Liebhaberei, worin sie lebten und webten, worüber sie Jahrhunderte lang mit allen Waffen des Scharfsinns und der Sophistik, zugleich aber auch mit einer Leidenschaft, die vor Gewalt und Blutvergießen nicht zurückscheute, streiten konnten. Noch ein Reformator ist es gewesen, der um einer Ketzerei in dieser Lehre willen einen verdienstvollen Arzt und Naturforscher, der nur die Schwachheit hatte, zugleich von der Theologie nicht lassen zu können, auf den Scheiterhaufen brachte.
Wir Heutigen können uns für ein solches Dogma nicht mehr weder erhitzen noch auch nur erwärmen: ja selbst denken können wir uns nur dann noch etwas dabei, wenn wir etwas anderes dabei denken, d, h. es umdeuten; statt dessen wir aber besser thun, uns deutlich zu machen, wie die alten Christen nach und nach zu einer so seltsamen Lehre gekommen sind. Doch dieß gehört der Kirchengeschichte an, die uns zugleich zeigt, wie die neueren Christen wieder davon gekommen sind; denn, wird sie auch äußerlich noch mitgeführt, so hat doch die Dreieingkeitslehre sogar in übrigens rechtgläubigen Kreisen ihre frühere Lebenskraft verloren.
5.
Der erste Artikel des apostolischen Symbols sofort spricht einfach den Glauben an Gott den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde aus.
Auf den allgemeinen Begriff eines weltschaffenden Gottes kommen wir als auf einen religiösen Grundbegriff später noch zurück; hier werfen wir auf die nähern Bestimmungen einen Blick, die der kirchlichen Vorstellung von der Weltschöpfung aus der biblischen Erzählung 1. B. Mosis 1, die geradewegs zum Glaubensartikel gestempelt wurde, erwachsen sind.
Es ist dieß das berühmte Sechstagewerk, wornach Gott die Welt nicht durch einen einfachen Willensact auf einmal, sondern, im Anschluß an die jüdische Wocheneintheilung, nach und nach in 6 Tagen ins Dasein gerufen haben soll. Nehmen wir diese Erzählung wie sie lautet, fassen nur sie als Product ihrer Zeit, und vergleichen sie mit den Schöpfungsgeschichten oder Kosmogonien, die wir bei anderen alten Völkern antreffen, so werden wir sie bei all ihrer Kindlichkeit höchst sinnig finden und mit Achtung und Wohlgefallen betrachten. Daß er vom kopernicanischen Weltsystem und den neueren Ergebnissen der Geologie nichts wußte, werden wir dem alten hebräischen Dichter nicht zum Vorwurfe machen.
Welches Unrecht thut man doch einer solchen biblischen Erzählung, die uns an und für sich nur lieb und ehrwürdig sein könnte, wenn man sie zum Dogma versteinert. Denn da wird sie alsbald zum Riegel, zur hemmenden Mauer, gegen die sich nun der ganze Andrang der fortschreitenden Vernunft, alle Mauerbrecher der Kritik, mit leidenschaftlichem Widerwillen richten. So hat es ganz besonders dieser mosaischen Schöpfungsgeschichte ergehen müssen, die, einmal zum Dogma gemacht, die ganze neuere Naturwissenschaft gegen sich unter die Waffen rief.
Den Hauptwiderspruch mußte die Stellung erregen, die sie der Erschaffung der Himmelskörper gab. Diese kommen bei ihr in jedem Betrachte zu spät. Die Sonne wird erst am vierten Tage geschaffen, nachdem bereits drei Tage lang der Wechsel von Tag und Nacht, der ohne die Sonne nicht denkbar ist, stattgefunden haben soll. Ferner wird die Erde mehrere Tage vor der Sonne geschaffen, und dieser wie dem Monde nur eine dienende Beziehung zur Erde gegeben, der Sterne aber nur ganz nebenher gedacht. Eine Verkehrung der wahren Rangverhältnisse unter den Weltkörpern, die einem geoffenbarten Berichte schlecht anstand. Auch das mußte auffallen, daß Gott sich zur Erschaffung und Ausbildung der Erde ganze fünf Tage, zur Hervorbringung der Sonne dagegen sammt allen Fixsternen und übrigen Planeten (die freilich in der biblischen Erzählung dieß nicht, sondern nur angezündete Lichter sind) nur einen einzigen Tag Zeit genommen haben sollte.
Waren dieß astronomische Bedenken, so kamen aber bald nicht geringere geologische hinzu. An Einem Tage, dem dritten, sollen Meer und Land von einander gesondert und überdieß noch die gesammte Pflanzenwelt geschaffen worden sein; während unsere Geologen nicht mehr blos von Tausenden, sondern von Hunderttausenden von Jahren zu sagen wissen, die zu jenen Bildungsprocessen erforderlich gewesen. Am sechsten Tage sollen, die Tags zuvor geschaffenen Vögel abgerechnet, sämmtliche Landthiere, die kriechenden miteingeschlossen, und zuletzt der Mensch in's Dasein getreten sein; Entwicklungen, die gleichfalls, wie die jetzige Wissenschaft uns belehrt, Erdperioden von unermeßlicher Dauer in Anspruch nahmen.
Nun gibt es freilich noch heute nicht blos Theologen, sondern selbst Naturforscher, die hier allerlei Hausmittelchen in Bereitschaft haben. Daß Gott die Sonne erst drei Tage nach der Erde geschaffen, soll heißen, daß sie damals erst dem dunstigen Erdball sichtbar geworden: und die Tage, obwohl von dem Erzähler unmißverstehbar zwischen Abend und Morgen eingerahmt, sollen keine Tage von 12 oder 24 Stunden, sondern Schöpfungsperioden bedeuten, die man so lang annehmen kann als man sie braucht.
6.
Wem es Ernst ist mit dem alten Christenglauben, der hat hier vielmehr zu sagen: Wissenschaft hin, Wissenschaft her, so stehts einmal in der Bibel, und die Bibel ist Gottes Wort. Diese Benennung nimmt die Kirche, und ganz besonders die evangelische, im strengsten Wortverstande. Die heilige Schrift mit ihren verschiedenen Büchern ist wohl von Menschen geschrieben, aber diese waren dabei nicht ihrem lecken Gedächtniß, ihrem irrthumsfähigen Verstande überlassen, sondern Gott selbst (d.h. der heilige Geist) gab ihnen ein was sie schreiben sollten: und was Gott eingibt, muß untrügliche Wahrheit sein. Also wo diese Bücher erzählen, ist ihnen unbedingter historischer Glaube beizumessen: was sie lehren, ist ebenso unbedingt als Richtschnur für Glauben und Leben anzusehen. Von irrigen und widersprechenden Berichten, von falschen Meinungen und Urtheilen kann in der Bibel keine Rede sein. Sie mag erzählen oder lehren, wogegen unsere Vernunft sich noch so sehr sträubt: wo Gott spricht, da steht der menschlichen Vernunft einzig bescheidenes Schweigen an.
Wie, oder wäre die heil. Schrift etwa nicht Gottes Wort? Nun, so erkläret denn, wie Jesaia, wenn er seinem menschlichen Wissen überlassen war, vorhersagen konnte, daß Jesus als Sohn einer Jungfrau, wie Micha, daß er in Bethlehem zur Welt kommen sollte? Wie konnte derselbe Jesaia anderthalbhundert Jahre vorher den Perser Cyrus als denjenigen mit Namen nennen, der die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft (die sie damals noch gar nicht angetreten hatten, entlassen würde: wie konnte gar Daniel unter Nabonned und Cyrus ohne göttliche Eingebung so vieles Einzelne aus der Geschichte Alexanders des Großen und seiner Nachfolger bis auf Antiochus Epiphanes prophezeien?
Ach, das alles hat sich ja seitdem nur gar zu gut – für die Wissenschaft nämlich; für den alten Glauben freilich sehr schlimm – erklärt. Weder Jesaias mit seinem Jungfrauensohne noch Micha mit seinem Herrscher aus Bethlehem haben von ferne an unseren Jesus gedacht: das letzte Drittheil aber der sogenannten Jesaiasweissagungen rührt von einem Zeitgenossen des Cyrus, wie das ganze Buch Daniel von einem Zeitgenossen des Antiochus her, von denen sie also in sehr menschlicher Art, nämlich nach oder während der Erfüllung, weissagen konnten. Aehnliches hat sich längst auch in Bezug auf andere biblische Bücher gefunden: wir haben keinen Mose, keinen Samuel unter ihren Verfassern mehr; die nach ihnen genannten Bücher sind als weit spätere Kompilationen erkannt worden, in die mit wenig Kritik und viel Tendenz ältere Stücke aus verschiedenen Zeiten zusammengearbeitet sind. Daß in Betreff der Schriften des Neuen Testaments das Ergebniß im Wesentlichen ein gleiches war, ist bekannt, und wir werden bald weiter davon zu sprechen haben.
7.
Wir sind nun schon einmal von dem apostolischen Symbolum abgekommen; es faßt sich auch in seinem ersten Artikel gar zu kurz. Gehen wir jetzt lieber noch einen Schritt weiter mit der mosaischen Erzählung, deren zweites und drittes Kapitel wie das erste mit zur Grundlegung der christlichen Kirchenlehre verwendet worden sind. Auf die Schöpfungsgeschichte folgt die Geschichte des sogenannten Sündenfalls der ersten Eltern: ein Punkt von eingreifender Wichtigkeit, sofern zur Tilgung seiner Folgen später der Erlöser in die Welt geschickt worden sein soll.
Auch hier wie in der Schöpfungsgeschichte haben wir in der alten Erzählung ein Lehrgedicht vor uns, das, an sich aller Ehren werth, erst durch seine Erhebung zum Dogma in die unangenehme Lage versetzt worden ist, zunächst vielfach mißdeutet, dann angefeindet und bestritten zu werden. Der Dichter will erklären, wie doch in die von Gott sicherlich gut geschaffene Welt all das Uebel und Ungemach, worunter der Mensch jetzt leidet, hereingekommen? Gott kann die Schuld nicht haben, der Mensch soll sie wenigstens nicht allein haben: so wird ein Verführer eingeschoben, der das erste Menschenpaar zur Übertretung des göttlichen Verbots beredet, und dieser Verführer ist die Schlange.
Darunter verstand der Verfasser des Schriftstücks nichts anders als das bekannte räthselhafte Thier, von dem das höhere Alterthum so manches Seltsame zu erzählen wußte: aber das spätere Judenthum und bald auch die Christenheit verstand den Teufel darunter, der aus der Zendreligion in die jüdische eingewandert, bald in ihr, und weit mehr noch in der christlichen, eine so große Rolle spielen sollte.
Denken wir nur an Luther, der in diesem Teufelsglauben lebte und webte. Auf Schritt und Tritt machte er sich mit dem bösen Feinde zu schaffen. Nicht blos böse Gedanken und Anfechtungen, auch äußere Unfälle, die den Menschen betreffen, Krankheit und jähen Tod, Feuersbrunst und Hagelschlag, leitete er von unmittelbarem Einwirken des Teufels und seiner höllischen Spießgesellen her. So unleugbar dieß für einen niedrigen Stand seiner Naturkenntnisse wie seiner Bildung überhaupt zeugt, so kann doch in einem großen Menschen gelegentlich auch der Wahn sich großartig gestalten. Jedermann kennt Luthers Ausspruch über die Teufel in Worms, wenn ihrer soviel als der Dachziegel wären: aber schon auf dem Wege dahin hatte er mit dem alten bösen Feind einen Strauß bestanden. Als er auf der Durchreise in Erfurt predigte, krachte die überfüllte Empore; der Schrecken war groß, Gedräng und Unglück konnte entstehen; da donnerte Luther von der Kanzel aus den Teufel an, den er in dem Spuke wohl erkenne, dem er aber rathen wolle, sich ruhig zu verhalten; worauf wirklich Ruhe ward und Luther seine Predigt zu Ende bringen konnte.
Aber gefährlich bleibt es immer, mit dem Teufel zu spielen. Ihn selbst konnte man nicht verbrennen, da ja das Feuer sein Element ist, aber die armen alten Weiber, die mit Hülfe des Teufels eben jene Dinge, die Luther dem Teufel zuschrieb, Krankheit, Hagelschlag u. dgl., bewirkt haben sollten. Bilden die Hexenprocesse eines der entsetzlichsten und schmachvollsten Blätter der christlichen Geschichte, so ist der Teufelsglaube eine der häßlichsten Seiten des alten Christenglaubens, und es ist geradezu als ein Culturmesser zu betrachten, wie weit diese gefährliche Fratze die Vorstellungen der Menschen noch beherrscht oder daraus vertrieben ist.
Andrerseits jedoch ist die Herausnahme eines so wesentlichen Steins für das ganze Gebäude des Christenglaubens gefährlich. Der jugendliche Goethe ist es gewesen, der gegen Bahrdt bemerkte, wenn je ein Begriff biblisch gewesen, so sei es dieser. Ist Christus, wie Johannes schreibt, erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören, so konnte er entbehrt werden, wenn es keinen Teufel gab.
8.
Doch die Figur der Schlange in der althebräischen Erzählung war nicht das Einzige, was in der christlich-dogmatischen Auffassung umgedeutet wurde. Der Urheber der Erzählung wollte erklären, warum die Menschen so elend, so unglücklich sind; die christliche Auslegung ließ ihn in erster Linie erklären, warum sie so schlecht, so sündhaft sind. Er hatte unter dem Tode, womit Gott den Ungehorsam des erstgeschaffenen Paares bestrafte, den leiblichen Tod verstanden; die christliche Kirchenlehre verstand dazu noch den geistlichen, die ewige Verdammniß, darunter. Von dem Sündenfalle der ersten Eltern her vererbt sich sowohl Sündhaftigkeit als Verdammniß auf das ganze menschliche Geschlecht.
Das ist die berufene Lehre von der Erbsünde, ein Grundpfeiler des kirchlichen Glaubenssystems. Die Augsburgische Confession bestimmt sie so: "nach Adams Fall werden alle natürlich erzeugte Menschen (hier ist der Ausnahme für Christus Raum vorbehalten) mit der Sünde geboren, d. h. ohne Gottesfurcht, ohne Gottvertrauen, und mit der bösen Lust; und diese Erbkrankheit oder Erbfehler sei in der That eine Sünde, die auch jetzt noch den ewigen Tod für alle diejenigen nach sich ziehe, die nicht durch die Taufe und den heil. Geist wiedergeboren werden."
Für eine Verderbniß also, die der Einzelne sich nicht selbst zugezogen, von der es auch gar nicht bei ihm steht, sich aus eigener Kraft loszumachen, soll er, oder für den einmaligen Ungehorsam eines kindisch unerfahrenen Erstlingspaares soll dessen ganze Nachkommenschaft, bis auf die unschuldigen Kinder, soweit sie ungetauft sterben, hinaus, zu ewigen Höllenqualen verdammt sein! Man muß sich wundern, wie eine solche Vorstellung, die gleicherweise Vernunft wie Rechtsgefühl empört, die Gott aus einem anbetungs- und liebenswerthen zum entsetzlichen und abscheulichen Wesen macht, zu irgend einer Zeit, so barbarisch wir uns diese auch denken mögen, annehmbar gefunden, wie die Spitzfindigkeiten, durch die man ihre Härte zu mildern suchte, überhaupt nur angehört werden mochten.
9.
Doch den vom Teufel angerichteten Schaden wieder gutzumachen, ist ja Christus in die Welt geschickt worden, und so kehren wir zum apostolischen Symbolum zurück, dessen zweiter Artikel, an den ersten von Gott dem Vater anknüpfend, so lautet: "Und (ich glaube) an Jesum Christum, seinen eingebornen Sohn, unsern Herrn, der empfangen ist vom heiligen Geist, geboren aus Maria der Jungfrau, gelitten hat unter Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben und begraben, ist abgefahren zur Höllen, am dritten Tage wieder auferstanden von den Todten, aufgefahren gen Himmel, sitzet zur Rechten Gottes, seines allmächtigen Vaters, von wannen er wieder kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten."
Hier findet sich das Eigene, daß wir unter allen den aufgezählten Stücken gerade nur denjenigen noch Glauben schenken, ja überhaupt nur bei denjenigen noch etwas denken können, die für den Glauben im kirchlichen Sinne an sich keinen Werth haben, weil sie von Christus nur solches aussagen, das jedem Menschen begegnen kann. Was ein eingeborener Sohn Gottes des Vaters sein soll, wissen wir nicht mehr. Bei dem "Empfangen vom heil. Geist, geboren aus Maria der Jungfrau", wittern wir mythologische Luft, nur daß uns die griechischen Götterzeugungen besser erfunden dünken als diese christliche. Das Leiden und Sterben am Kreuz unter Pontius Pilatus, wie gesagt, beanstanden wir um so weniger, als es an sich nichts Unwahrscheinliches und überdieß von dem römischen Geschichtschreiber bezeugt ist. Nun aber kommt es desto wunderlicher. Die Höllenfahrt ist nicht einmal von einem Evangelisten bezeugt. Die Auferstehung wohl von allen, aber von keinem, der sie mitangesehen hätte, und von jedem anders und mit anderen Belegen, kurz so, wie eine Sache bezeugt sein muß, die wir als unhistorisch erkennen sollen. Und was für eine Sache? Eine so unmögliche, so allem Naturgesetze zuwiderlaufende, daß sie zehnfach sicher bezeugt sein müßte, wenn wir sie auch nur bezweifeln und nicht von vorne herein von der Hand weisen sollten. Endlich die Auffahrt in den Himmel, wo wir nur Weltkörper, aber keinen Thron Gottes mehr haben, zu dessen Rechten man sich setzen könnte; und ein Wiederkommen zum Gericht am jüngsten Tage, während wir entweder von keinem, oder nur von einem solchen göttlichen Gericht wissen, das gegenwärtig und alle Tage sich vollzieht.
Das alles aber sind nicht etwa phantastische Vorstellungen eines späteren Symbols, sondern, wie oben der Teufel, ausdrückliche Lehren des Neuen Testaments.
10.
Den zweiten Artikel des apostolischen Symbolums nennt der kleine lutherische Katechismus den von der Erlösung, und erläutert ihn auch vorzugsweise nach dieser Seite hin. Er bezeichnet Christus als denjenigen, "welcher mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst und von allen Sünden, dem Tod und der Gewalt des Satans frei gemacht hat; nicht durch Gold und Silber, sondern durch sein heiliges theures Blut und sein unschuldiges Leiden und Sterben."
Dieß ist der einzig ächte kirchliche Begriff der Erlösung und des Erlösers. Wir Menschen hatten durch unsere Stammeltern wie durch unsere eigene Sünde Tod und ewige Verdammniß verdient, waren auch bereits der Herrschaft des Teufels übergeben; da ist Jesus in's Mittel getreten, hat den Tod in seiner schmerzhaftesten Form auf sich genommen, auch den göttlichen Zorn an unserer Statt empfunden, und dadurch uns, wenn wir nur an ihn und diese Wirkung seines Todes glauben, von der verdienten Strafe, d. h. dem Hauptstück derselben, der ewigen Verdammniß, befreit.
Luther stellt dem Blute, mittelst dessen wir von Christus losgekauft worden, Gold und Silber gegenüber, wodurch es nicht geschehen sei. Das, obwohl es biblische Ausdrücke sind, ist doch schon nicht mehr der ursprüngliche Gegensatz; dieser findet sich in den Worten des Hebräerbriefs: nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes habe es Christus zu Stande gebracht. Aus dem alten jüdischen Opferwesen ist die christliche Versöhnungslehre hervorgewachsen. Dem uralten Brauch des Sühnopfers liegt gewiß ein frommes Gefühl zu Grunde, aber es steckt in einer groben Hülle, und die Umwandlung, die sie im Christenthum erfahren, können wir mit nichten als eine Läuterung betrachten. Im Gegentheil. Jedermann weiß, daß die Opfer, womit rohe Völker den Zorn ihrer Götter zu besänftigen meinten, ursprünglich Menschenopfer gewesen sind. Ein Fortschritt, eine Läuterung war es, wie man anfing, an der Stelle von Menschen Thiere als Opfer darzubringen. Nun trat ja aber an die Stelle der Thieropfer von Neuem ein Menschenopfer. Es war freilich zunächst nur eine Vergleichung: es handelte sich nicht um ein förmliches priesterlich dargebrachtes Opfer; sondern die frevelhafte Verurtheilung und Hinrichtung des Messias, des Gottessohnes, der sich mit gelassenem Willen in sein Schicksal ergab, durch ein irregeleitetes Volk und seine Oberen wurde als ein Sühnopfer betrachtet. Aber wie das geht; mit der Vergleichung wurde es nur gar zu bald Ernst. Gott selbst hatte es so geordnet; es war die Bedingung, unter der allein er den Menschen vergeben wollte oder konnte, daß Jesus sich für sie hinschlachten ließ.
11.
Wenn sonst ein Unschuldiger, sei es durch rohe Gewalt oder einen ungerechten Urtheilsspruch, sein Leben verliert, besonders wenn es eine von ihm ausgesprochene Wahrheit, eine durch ihn vertretene gute Sache ist, als deren Märtyrer er stirbt, so bleibt die Wirkung niemals aus, und ist nur im Verhältniß zu der Stellung und Bedeutung des Hingemordeten nach Art und Tragweite verschieden. Die Hinrichtungen eines Sokrates und eines Giordano Bruno, eines Karl I. und Ludwig XVI., eines Oldenbarneveldt und Jean Calas, haben jede in ihrer Art und in bestimmtem Umfange gewirkt. Aber gemeinsam war doch allen diesen Fällen, daß ihre Wirksamkeit moralisch, durch den Eindruck auf die Gemüther der Menschen vermittelt war.
Eine solche moralische Wirkung hatte auch der Tod Jesu: der tiefe erschütternde Eindruck, den er auf die Gemüther der Jünger machte, die Umwandlung ihrer ganzen Ansicht von der Bestimmung des Messias und dem Wesen seines Reichs, die er in ihnen hervorbrachte, liegt geschichtlich vor. Das war aber nach der Lehre der Kirche das Geringste. Die Hauptwirkung des Todes Jesu, worin der eigentliche Zweck desselben lag, war vielmehr eine so zu sagen metaphysische: nicht zunächst in den Gemüthern der Menschen, sondern vor Allem in dem Verhältniß Gottes zur Menschheit sollte sich etwas verändern und hat sich etwas verändert durch diesen Tod: er hat, wie wir bereits vernommen, Gottes Zorne, seiner strafenden Gerechtigkeit Genüge gethan und ihn in den Stand gesetzt, den Menschen trotz ihrer Sünden seine Gnade wieder zuzuwenden.
Daß in dieser Vorstellung eines Erlösungstodes, einer stellvertretenden Genugthuung, ein wahres Nest der rohesten Vorstellungen stecke, bedarf heutiges Tages kaum noch der Ausführung. Den einen für das Vergehen des andern zu strafen, einen Unschuldigen, und wäre es auch sein freier Wille, leiden, und dafür den Schuldigen straflos ausgehen zu lassen, das erkennt jetzt jedermann als die Handlungsweise eines Barbaren; bei einer moralischen Schuld wie bei einer Geldschuld es als gleichgültig zu betrachten, ob der Schuldner selbst oder ein anderer für ihn sie abträgt, darin erkennt jetzt jedermann die Vorstellungsweise eines Barbaren.
Ist einmal die Unmöglichkeit einer solchen Uebertragung im Allgemeinen erkannt, so macht es keinen Unterschied mehr, ob die Person, auf welche das Leiden übertragen sein soll, ein bloßer Mensch oder der Gottmensch war. Darauf legte aber bekanntlich die Kirchenlehre großes Gewicht. "Denn wo ich das glaube", sagt Luther, "daß allein seine menschliche Natur für mich gelitten habe, so ist mir Christus ein schlechter Heiland, und bedarf wohl selbst eines Heilandes. Freilich kann die Gottheit nicht leiden und sterben, aber die Person leidet und stirbt, die wahrhaftiger Gott ist; darum ist's recht geredet: Gottes Sohn ist für mich gestorben."
Diese Vereinigung der beiden Naturen in der Einen Person Christi und der Austausch der Eigenschaften, worin sie miteinander stehen, ist dann überdieß in der kirchlichen Lehre zu einem System ausgesponnen worden, durch dessen spitzfindige Bestimmungen die menschlich-geschichtliche Persönlichkeit Jesu vollkommen ertödtet werden mußte: während das Verhältniß des Gottvaters zum Opfertode des Sohnes einem Diderot das Witzwort in den Mund gab: II n'y a point de bon père qui voulût ressembler à notre père céleste.
12.
Das apostolische Symbolum schließt den Christenglauben durch seinen dritten Artikel ab, der so lautet: "Ich glaube an den heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben."
Die zweite Person der Gottheit hat in ihrer Vereinigung mit der menschlichen Natur durch ihr stellvertretendes Leiden uns wohl die Sündenvergebung erworben : damit uns diese aber wirklich zu Theil werde, muß nun auch noch die dritte, der heilige Geist, in Thätigkeit treten und sie auf uns gleichsam herüberleiten. Dieß geschieht durch die Kirche und die Gnadenmittel, denen diese angebliche dritte Person der Gottheit besonders vorsteht.
In der Kirche wird das Wort Gottes gepredigt, das wesentlich das Wort vom Kreuze, d. h. die Lehre von der durch Christi Tod uns erworbenen Sündenvergebung ist; um des Glaubens an diese Wirkung des Todes Jesu willen werden wir vor Gott gerechtfertigt, ohne Rücksicht auf unsere Werke, d. h. auf die Besserung unseres Lebens, die zwar nachfolgen muß, aber im Urtheile Gottes nicht in Betracht kommt, der uns lediglich um der durch den Glauben uns angeeigneten Gerechtigkeit Christi willen für gerecht ansehen will.
So Luther im Gegensatze gegen die katholische Praxis seiner Zeit, welche durch äußere Werke, wie Fasten, Wallfahrten u. dgl. die Rechtfertigung vor Gott erwerben zu können meinte. Hätte er diesen an sich gleichgültigen Aeußerlichkeiten gegenüber die sittliche Gesinnung als dasjenige, worauf es ankomme, betont, und von Gott gesagt, daß er auf den ernstlich guten Willen sehe, da, von jenen Aeußerlichkeiten gar nicht zu reden, auch die Ausführung des sittlich Gewollten beim Menschen immer höchst unvollkommen bleibe: so müßte ihm, der katholischen Kirche gegenüber, die feinere und tiefere Auffassung dieses Verhältnisses zugestanden werden. Aber seine Lehre vom rechtfertigenden Glauben, neben dem selbst die gute Gesinnung Nebensache sein soll, war einerseits überspannt, und andrerseits für die Sittlichkeit äußerst gefährlich.
Neben dem Worte wirken in der Kirche als Conductoren der Sündenvergebung noch die Sacramente. Unter diesen hat bekanntlich das Abendmahl im Abendlande ungefähr ebensoviel Streit und Krieg erregt, als einst die Dreieinigkeitslehre im Morgenlande; während uns jetzt die im Reformationszeitalter so hitzig verhandelte Frage, ob und in welcher Art dabei etwas von dem wirklichen Leibe Christi genossen werde, so gleichgültig und unverständlich geworden ist, wie jene andere, ob Gott der Sohn gleichen oder nur ähnlichen Wesens mit dem Vater sei. In dem Zusammenhange des christlichen Glaubenssystems übrigens spielt das andere Hauptsacrament, die Taufe, eine noch entscheidendere Rolle. "Wer glaubt und getauft wird, der wird selig," hatte Christus gesagt; wer also nicht getauft ist, wird verdammt. Ist es aber immer die eigene Schuld des Menschen, wenn er nicht getauft wird? Z. B. der kleinen Kinder, die vor der Taufe sterben? oder der Millionen Heiden, die vor der Einsetzung der Taufe gestorben sind, der Millionen Nichtchristen, die noch jetzt in fernen Welttheilen von Taufe und Christenthum kaum etwas wissen? Die Augsburgische Confession sagt ausdrücklich: "Wir verdammen die Wiedertäufer, die behaupten, die Kinder können ohne Taufe selig werden." Nur ein Zwingli war Humanist und zugleich human genug, tugendhafte Heiden, wie Sokrates, Aristides u. a. trotz der mangelnden Taufe ohne Weiteres in den Himmel zu versetzen.
13.
Die Auferstehung des Fleisches, diese dem messiasgläubigen Juden und Judenchristen einst so hochwillkommene Vorstellung ist in unserer Zeit selbst für die Gläubigen zur Verlegenheit geworden. Der Jude wollte an den Tagen des Messias, wo es hoch hergehen sollte, selbst wenn er bis dahin schon gestorben wäre, seinen Antheil nicht verlieren; diesen konnte er aber nur so erhalten, daß seine Seele aus dem Schattenreiche, wo sie mittlerweile ein kümmerliches Dasein gefristet, durch Gott oder den Messias heraufgerufen, mit ihrem wiederbelebten Leibe vereinigt, und so von Neuem lebens- und genußfähig gemacht wurde. Wenn sich in der christlichen Welt die Vorstellung von den messianischen Genüssen auch allmählig verfeinerte: darin hing der Kirche doch immer ein gewisser Materialismus an (den wir unsrerseits ihr nicht verargen), daß sie sich ein wahres und vollständiges Leben der Seele ohne Körperlichkeit nicht denken konnte.
Mit den Schwierigkeiten, die es haben mußte, so viele bis auf die Knochen vermoderte, ja gänzlich vernichtete Menschenleiber wiederherzustellen, nahm es natürlich die Kirche leicht, da ließ man die göttliche Allmacht sorgen; uns leisten hierin unsere besseren Naturkenntnisse einen schlimmen Dienst, indem sie uns eine solche Vorstellung geradezu unmöglich machen. Und just die Unsterblichkeitsgläubigsten zu unserer Zeit sind überdieß solche Spiritualisten geworden, daß sie ihre liebe Seele zwar in alle Ewigkeit conserviren zu können hoffen, mit dem Leibe aber, wenigstens diesem verstorbenen, nichts weiter anzufangen wissen.
Die Auferstandenen gehen in das ewige Leben ein, doch nicht alle; es giebt ja eine zwiefache Auferstehung, die eine zum Leben und die andere zum Gericht, d. h. zur ewigen Verdammniß. Und leider zeigt sich, daß die Zahl der Verworfenen die der Erwählten ganz unendlich übersteigt. Verdammt wird fürs Erste die ganze Menschheit vor Christus, so weit nicht einzelne bevorzugte Seelen, wie die der jüdischen Erzväter, durch besondere Veranstaltungen aus der Hölle frei gemacht worden sind: dann auch jetzt noch fort und fort alle Heiden, Juden und Muhammedaner, sowie in der Christenheit selbst die Ketzer und Gottlosen: und unter allen diesen nur die Letztern mit eigener persönlicher Schuld, alle Uebrigen lediglich um der Sünde Adams willen: denn daß das Christenthum ihnen nicht zugekommen, dafür konnten sie, mit wenigen Ausnahmen unter den nach Christus Geborenen, nichts.
Das ist ein sehr unbefriedigender Rechnungsabschluß: und wenn man etwa gehofft hatte, für so manches Empörende, das in den Voraussetzungen des kirchlichen Glaubenssystems, besonders in den Lehren vom Sündenfall und der Erbsünde, liegt, durch die endlichen Ergebnisse der Erlösung entschädigt zu werden, so findet man sich bitter getäuscht. "Die meisten Menschen," sagt Reimarus, "fahren dennoch zum Teufel, und von Tausend wird kaum Einer selig". Mein grüblerisch frommer Großvater quälte sich lebenslang mit der Vorstellung: wie in einem Bienenstocke auf viele tausend Bienen nur eine einzige Königin, so komme unter den Menschen auf Tausende von verdammten Seelen nur Eine, die selig werde.
14.
Das also war in feinen Umrissen der alte Christenglaube, an dem für unsern Zweck die Verschiedenheit der Confessionen nur einen geringen Unterschied macht. So trat er aus dem Reformationszeitalter herüber der neueren Zeit entgegen, deren erste Regungen schon im 17. Jahrhundert vorzüglich in England und den Niederlanden zu spüren waren. An der Hand einer beginnenden Natur- und Geschichtsforschung besonders entwickelte sich das vernünftige Denken, und fand, je mehr es in sich selbst erstarkte, die überlieferte Kirchenlehre immer weniger annehmbar. Die Bewegung der Geister schlug im 18. Jahrhundert aus England zuerst nach Frankreich, das schon durch seinen Bayle vorbereitet war, dann auch nach Deutschland herüber, so daß wir in dem Geschäfte der Bekämpfung des alten Kirchenglaubens jedes dieser drei Länder seine eigene Rolle übernehmen sehen. England fiel die Rolle des ersten Angriffs und der Bereitung der Waffen zu, was die Arbeit der sogenannten Freidenker oder Deisten war; Franzosen brachten dann diese Waffen über den Kanal und wußten sie in unaufhörlichen leichten Gefechten keck und gewandt zu führen: während in Deutschland vorzugsweise Ein Mann im Stillen eine regelmäßige Einschließung und Belagerung des rechtgläubigen Zions unternahm. Die Rollen von Frankreich und Deutschland insbesondere vertheilten sich wie Spott und Ernst: einem Voltaire dort stand hier ein Hermann Samuel Reimarus durchaus typisch für beide Nationen gegenüber.
Das Ergebniß der Prüfung, die der Letztere mit Bibel und Christenthum angestellt hatte, war für beide durchaus ungünstig ausgefallen; sie kamen bei dem ernsten Reimarus nicht besser weg, als bei dem Spötter Voltaire. In dem ganzen Verlaufe der biblischen Geschichte hatte auch Reimarus nichts Göttliches, um so mehr Menschliches im schlimmsten Sinne gefunden. Die Erzväter waren ihm irdisch gesinnte, eigennützige und verschmitzte Menschen; Mose ein herrschsüchtiger, der kein Bedenken trug, einer mittelmäßigen Gesetzgebung durch Betrug und Verbrechen Eingang zu verschaffen; David, dieser "Mann nach dem Herzen Gottes," ein grausamer, wollüstiger, heuchlerischer Despot; selbst bei Jesus fand Reimarus zu bedauern, daß er das Bekehrungswerk nicht zu seinem eigentlichen Geschäft gemacht, sondern nur als Vorbereitung zu seinem ehrgeizigen Plane betrieben habe, ein irdisches Messiasreich auszurichten; darüber ging er zu Grunde, und seine Jünger stahlen dann seinen Leichnam, um ihn für auferstanden auszugeben, und auf diesen Betrug ihr neues Glaubenssystem und ihre geistliche Herrschaft zu begründen. Dieses christliche Glaubenssystem verleugnet denn auch nach Reimarus seinen Ursprung nicht. Es ist Satz für Satz falsch und voller Widersprüche, allen gesunden religiösen Begriffen entgegen, und der sittlichen Vervollkommnung der Menschheit entschieden hinderlich. Die Punkte in dem alten Kirchenglauben, woran dieses Urtheil sich halten konnte, sind in der bisherigen Darstellung bemerklich gemacht.
Doch je ernster man in Deutschland das negative Ergebniß ins Auge faßte, das die Prüfung des alten Glaubens vom Standpunkte einer veränderten Denkweise aus haben zu müssen schien, desto nothwendiger ergab sich auch der Versuch einer Vermittlung. Ueber einen so grellen Widerspruch, wie der, was man noch gestern mit der ganzen umgebenden Gesellschaft als das Heiligste verehrte, heute voll Abscheu und Verachtung von sich zu weisen, mag man sich wohl durch Scherz und Spott hinwegsetzen: wer es ernst damit nimmt, hält den Widerspruch nicht lange aus. So wurde Deutschland, nicht Frankreich, die Wiege des Rationalismus.
15.
Der Nationalismus ist ein Compromiß zwischen dem alten Kirchenglauben und dem schlechthin negativen Ergebniß seiner Prüfung durch die neue Aufklärung. In der biblischen Geschichte ist ihm zwar Alles natürlich, aber in der Hauptsache Alles ehrlich zugegangen; die hervorragenden Männer des Alten Testaments waren Menschen wie andere, doch auch nicht schlechter als andere, im Gegentheil in manchem Betracht ausgezeichnet; Jesus zwar nicht der Sohn Gottes im kirchlichen Sinne, aber auch kein Ehrgeiziger, der sich zum weltlichen Messias aufwerfen wollte, sondern ein Mann von ächter Gottes- und Menschenliebe, der als Märtyrer des Bestrebens, unter seinem Volke eine reine Religions- und Sittenlehre zu verbreiten, unterging; die zahlreichen Wundergeschichten in der Bibel, besonders auch in den Evangelien, beruhen nicht auf Betrug, sondern auf Mißverstand, indem bald die Augenzeugen oder die Geschichtschreiber für Wunder hielten, was doch natürlich zugegangen war, bald aber auch nur die Leser als Wunder fassen, was der Erzähler gar nicht für ein solches ausgeben will.
Wie sich der Rationalismus zu dem extremen Standpunkt eines Reimarus verhält, das will ich an zwei Beispielen erläutern, deren eines ich aus dem ersten Anfang, das andere aus dem Ende der heiligen Geschichte nehme. Die Erzählung vom Sündenfalle, die er übrigens für eine fabelhafte hielt, hatte Reimarus vor allem auch darum so anstößig gefunden, weil sie Gott durch die Hinpflanzung des verlockenden Baumes vor die Augen der unerfahrenen Erstlingsmenschen, durch die Reizung ihrer Begierde mittelst des willkürlichen Verbots, und durch die Zulassung der versuchenden Schlange zum Urheber des ganzen Unheils mache. Doch wer weiß, ob das Verbot der Baumfrucht so ganz willkürlich war? fragte der Rationalist Eichhorn. Der Baum war vermuthlich ein Giftbaum, dessen Früchte dem Menschen schädlich waren. Den ausdrücklich verbietenden Gott freilich konnte der Rationalist so wenig wie die redende Schlange brauchen; vielleicht aber sahen die Urmenschen einmal ein Thier, nachdem es von der Frucht genossen, unter Zuckungen sterben, ein andermal eine Schlange in gleichem Falle keinen Schaden nehmen, und so wagten sie jener Warnung zum Trotz den Genuß, der für sie zwar nicht augenblicklich, doch späterhin todtbringend, und auch für ihre Nachkommen von übeln physischen und moralischen Folgen war.
Das andere Beispiel sei die Auferstehung Jesu. Da war, wie schon erwähnt, unserem Reimarus nichts gewisser, als daß die Apostel den Leichnam ihres Meisters aus dem Grabmal hinweggestohlen haben, um ihn für wiederbelebt ausgeben, und darauf ein neues schwärmerisches Religionssystem gründen zu können, bei dem ihre Herrschsucht und auch ihr Eigennutz seine Rechnung fand. Nichts weniger! sagte auch hier der Rationalist. Von einer solchen Niederträchtigkeit waren die Jünger um so weiter entfernt, je weniger sie ihrer bedurften. Jesus war gar nicht wirklich todt, obwohl man ihn dafür hielt, als man ihn vom Kreuze nahm und mit den Specereien in die gewölbte Gruft legte; hier kam er wieder zu sich und überraschte durch sein Wiedererscheinen seine Jünger, die ihn von da an, so lange er sich noch unter ihnen sehen ließ, trotz aller seiner Bemühungen, sie vom Gegentheil zu überzeugen, für ein übernatürliches Wesen hielten.
Und in ähnlicher Art, wie mit der biblischen Geschichte, verfuhr der Rationalismus mit der christlichen Lehre. Dem Anstoß, den der Radicalismus der Freidenker an ihren vernunftwidrigen Voraussetzungen oder sittengefährlichen Folgerungen genommen hatte, wich er dadurch aus, daß er ihre Spitze abbrach oder umbog. Die Dreieinigkeit eine mißverstandene Redensart; die Menschheit nicht von Adam her verderbt und verflucht, wohl aber vermöge ihrer natürlichen Beschaffenheit sinnlich und schwach: Jesus nicht Erlöser durch einen Opfertod, wohl aber durch seine Lehre und sein Beispiel, die bessernd, also von der Sünde lösend, auf uns alle wirken; der Mensch gerechtfertigt nicht durch den Glauben an ein fremdes Verdienst, sondern durch Ueberzeugungstreue, d. h. durch das ernste Bestreben, stets so zu handeln, wie er es als Pflicht erkennt.





























