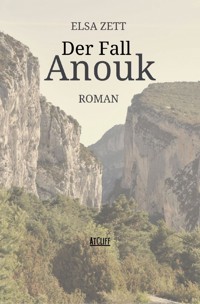Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lorenz Lehner, pensionierter Biologielehrer und begeisterter Vogelkundler, erzählt seiner Nichte Noemi eine lang verschwiegene Familiengeschichte. Er tut es widerwillig, aber Noemi will die Wahrheit erfahren. Und so muss sich Lorenz an die Kindheit mit seinen drei Geschwistern erinnern. Die Brüder Rudolf und Max waren von Anfang an verfeindet. Lea, die Schwester, versuchte zwischen den beiden zu vermitteln und Lorenz hielt sich aus den Streitigkeiten heraus. Als die vier erwachsenen Geschwister nach dem Tod der Mutter das beträchtliche Erbe unter sich aufteilen müssen, holt sie die Vergangenheit ein. Die feindlichen Brüder fühlen sich beide betrogen und verstricken sich immer tiefer in Misstrauen und Hass. Weder Vermittlungsversuche noch Drohung und Erpressung vermögen die Streithähne zu einigen. Auf der Familie scheint ein Fluch zu liegen, der sie ins Verderben zu reißen droht. Und Jahre später hat Noemi wieder Grund, den ererbten Fluch zu fürchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch:
Lorenz Lehner, pensionierter Biologielehrer und begeisterter Vogelkundler, erzählt seiner Nichte Noemi eine lang verschwiegene Familiengeschichte. Er tut es widerwillig, aber Noemi will die Wahrheit erfahren. Und so muss sich Lorenz an die Kindheit mit seinen drei Geschwistern erinnern. Die Brüder Rudolf und Max waren von Anfang an verfeindet. Lea, die Schwester, versuchte zwischen den beiden zu vermitteln und Lorenz hielt sich aus den Streitigkeiten heraus. Er erzählt von seinem Elternhaus und von beklemmenden Umgangsformen in einer ganz normalen Familie. Und wie die Vergangenheit die längst erwachsenen Geschwister einholt, als sie nach dem Tod der Mutter das beträchtliche Erbe unter sich aufteilen müssen. Die feindlichen Brüder fühlen sich beide benachteiligt und betrogen und verstricken sich immer mehr in Misstrauen und Hass. Weder Leas Vermittlungsversuche noch Drohung und Erpressung vermögen die Streithähne zu einigen. Auf der Familie scheint ein Fluch zu liegen, der sie ins Verderben zu reißen droht. Und Jahre später hat Noemi wieder Grund, den ererbten Fluch zu fürchten.
Autorin:
Die Autorin mit dem Pseudonym Elsa Zett lebt und schreibt in ihrer Heimatstadt Basel. Sie studierte Psychologie und Pädagogik und arbeitete in verschiedenen Berufen, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Ihre Romane entstehen aus Zeitungsmeldungen über Unfälle und Verbrechen (Der Fall Anouk, 2023) oder aus eigenen Erlebnissen (Als der Bambus erwachte, 2024). Auch am Anfang des vorliegenden Romans standen Berichte in Zeitungen – und eine stark verzögerte Bahnfahrt von Husum nach Basel.
Von Elsa Zett sind bereits erschienen:
Der Fall Anouk (2023)
Als der Bambus erwachte (2024)
www.elsa-zett-autorin.com
ELSA ZETT
Der ANDER und sein Bruder
ROMAN
»Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie
ist unglücklich auf ihre Weise.«
Leo Tolstoi
Teil 1
Eine Familie
Lorenz
Er rief den Hund und hörte die Ungeduld in seiner eigenen Stimme. Er sollte sich zusammennehmen. Der Hund konnte nichts dafür, dass heute ein schwieriger Tag war. Der hatte mit der Sache nichts zu tun. Oder fast nichts. Gab es überhaupt etwas in seinem Leben, das mit dieser Sache nichts zu tun hatte? Er rief noch einmal nach dem Hund, der schon auf den Weg nach links eingebogen war. Dort ging es um den Friedhof herum nach Hause. Aber Lorenz wollte noch nicht zurück. Ihm blieb noch ein wenig Zeit und er wollte sie nutzen. Durchatmen. Allein sein. Einen Anfang finden.
Er wandte sich nach rechts und nahm den steilen Weg auf den Hügelkamm hinauf, von wo man ins nächste Tal hinuntersehen konnte.
Der Hund zögerte, zu Hause wartete sein Frühstück auf ihn. Verfressen, dachte Lorenz. Das war der Nachteil dieser Rasse. Aber er würde nie einen andern Hund wollen. Seit Leander damals den Welpen bei ihm in Sicherheit gebracht hatte, hatten sie immer Hunde dieser Rasse gehabt. Der dritte war das jetzt schon.
Der Hund hatte sich besonnen und kam angesaust. Mit fliegenden Ohren.
Das ist jedenfalls das Gute an dieser Geschichte, dachte Lorenz. Zuvor hatten sie nie Hunde gehabt. Gab es sonst noch etwas Gutes? Kaum. Dabei wäre es vielleicht hilfreich, wenn er mit etwas Schönem beginnen könnte. Aber ihm fiel nichts ein. Und eigentlich war es unwichtig. Es war eine schreckliche Geschichte, egal wie er sie anfing. Heute würde er sie erzählen. Musste er sie erzählen. Er konnte gut erzählen, das wusste er. Noch die Achtzehnjährigen am Gymnasium hatten gebannt gelauscht, wenn Doktor Lorenz Lehner, der Vogellehner, in der Biologiestunde von seinem Lieblingsthema erzählte. Vom noch viel zu wenig erforschten Leben der einheimischen Vögel. Aber darum würde es heute nicht gehen.
Er schritt zügig den Abhang hinauf, obwohl jetzt wieder Wind aufgekommen war. Womöglich würde es gleich wieder regnen. Seit Tagen war es mal trüb, mal sonnig, mal goss es in Strömen und gleich darauf wirbelte ein ungestümer Wind die Wolken fort und neue heran. Aber er war wetterfest ausgerüstet. Regenjacke, Wanderschuhe, wasserdichte Schiebermütze. Ein rüstiger Rentner, dachte er ironisch. Gut erhalten. Zufrieden. Ja, er konnte zufrieden sein. Sie hatten die Katastrophe überstanden, er und Christine. Sie hatten drei tüchtige Kinder und vier reizende Enkelinnen und waren eine normale Familie.
Der Hund war vorausgelaufen, stand oben auf dem Hügelkamm und sah auf Lorenz herunter. Der Wind zauste sein langes Nackenfell und wehte ihm ein Ohr über die Augen.
Als Lorenz oben ankam, öffnete sich ein Loch in der Wolkendecke. Sonnenschein. Er hatte Lust weiterzugehen. Und fast schien es, dass es dem hungrigen Hund ähnlich erging. Er sah Lorenz herausfordernd entgegen. Aber sie mussten zurück. Vielleicht war Noemi schon angekommen. Nur einen Blick wollte er hinunterwerfen ins Tal. Er hatte sich das vorgenommen. Als Einstimmung.
Da unten lag der Ort, wo sie aufgewachsen waren, er und seine Geschwister. Schon damals, als sie Kinder waren, vor sechzig Jahren oder so, war F. ein großes Dorf gewesen. Stattlich, aber überschaubar. Seither hatte es sich den Hügel hinauf ausgebreitet und war in die Ebene vorgedrungen. Aber der Rebenweg endete immer noch am äußersten Dorfrand. Zwar wand sich die schmale Straße jetzt nicht mehr zwischen Hecken und verstreuten Häusern bis fast zum Wald hinüber, sondern war dicht gesäumt mit neuen Einfamilienhäusern verschiedener Stilrichtungen. Da und dort blitzte in den schrägen Sonnenstrahlen ein Pool auf. Und ganz am Ende, wo die Straße in einen Fußweg überging und ein Fahrverbotsschild stand, das natürlich von hier oben aus nicht zu sehen war, dort wo mitten auf der Wiese sein Elternhaus gestanden hatte, da stand der Wohnblock. Fünf Stockwerke hoch, mit rot gestreiften Markisen und schmalen Terrassen sah er modern aus und freundlich. Nichts erinnerte an die Tragödie, die sich dort abgespielt hatte. Es war zu lange her. Mehr als zwanzig Jahre.
Nein, dachte er beim Abstieg, der Wohnblock war kein guter Anfang. Er wäre bloß eine Ausrede. Der Wohnblock war nicht schuld an dem Unglück, das ihnen widerfahren war. Aber wie sollte er sonst beginnen? Er brauchte einen Anfang, musste das Ende eines verschlungenen Fadens packen, dem er folgen, den er aufwickeln konnte. Dann würde er irgendwie hineinfinden. Hoffte er. Die Fakten hatte er beisammen. Er hatte sich auf dieses Gespräch vorbereitet, seit Lea vor einer Woche angerufen hatte.
»Sie ahnt es«, sagte Lea am Telefon, »Noemi will es wissen, jetzt sofort. Aber ich kann es ihr nicht erzählen.« Die Schwester schluchzte, fast wie damals, als er sie am Bahnhof in B. abholte. Am Tag nach der Katastrophe. »Bitte sag ihr, was passiert ist.«
So war es immer gewesen. Frag Lorenz, sprich mit Lorenz. Lorenz kann es erklären, Lorenz wird vermitteln, beruhigen, besänftigen. Er ist der Besonnene in der Familie, der Ruhige zwischen den schwierigen Brüdern.
Er wollte es aufschieben. Steckte Noemi nicht gerade in den Abschlussprüfungen? Da war eine solche Geschichte wohl das Letzte, was sie brauchen konnte.
»Sie will es jetzt wissen. Sie werde notfalls die Prüfungen verschieben. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Vielleicht ist sie krank.« Lea weinte wieder.
Seit jenem Anruf der Schwester hatte er gesucht und geforscht. In seinem Gedächtnis, in Zeitungsartikeln, Fotoalben, in spärlichen Aufzeichnungen und übrig gebliebenen Briefen. Es hatte ihn mitgenommen, sich an das zu erinnern, was er so gerne vergessen wollte, was er beiseitegeschoben hatte, all die Jahre. Und heute musste er es erzählen. Er hatte es seiner Schwester versprochen. Dabei hatte er es noch nie jemandem wirklich erzählt. Nicht einmal Christine wusste viel mehr, als das, was damals in den Zeitungen stand.
Er pfiff den Hund zurück, der schon weit voraus war. Der hatte es wieder eilig, nach Hause zu kommen. Aber Lorenz schritt nicht besonders zügig aus.
Warum wollte seine Nichte diese Geschichte gerade jetzt so dringend erfahren? Sie war Anfang zwanzig. Konnte es wirklich sein, dass man mit ihr das ganze Leben lang nie darüber gesprochen hatte? Das konnte nicht nur sein, musste Lorenz sich eingestehen, das war mit Sicherheit so. Er jedenfalls hatte mit seinen Kindern nie über die Familientragödie gesprochen. Ein Unfall, hatte er gesagt. Das hat uns auseinandergebracht. Das war alles. Mehr wusste Noemi auch nicht. Aber jetzt wollte sie mehr wissen. Frag du sie warum, hatte Lea noch gesagt. Mir erzählt sie doch nichts.
War das normal, dass eine junge Frau ihrer Mutter nichts erzählte? Sicher, hatte Christine gesagt und gelacht, glaubst du, unsere hätten uns immer alles auf die Nase gebunden?
Aber bei Noemi und Lea war es vielleicht doch nicht normal. Er solle sie fragen, was mit ihr los sei, hatte Lea gesagt. Ich fürchte, sie ist magersüchtig. Sie habe sie im Bad würgen hören, als Noemi kürzlich bei ihr übernachtete.
Lorenz blieb stehen und rief den Hund. Er wollte nicht nach Hause. Er wollte umkehren, wieder den Berg hinaufsteigen, nach F. hinunterlaufen und von dort weiter bis nach B., wenn es sein musste.
Die Sonne war wieder verschwunden, der Wind hatte aufgefrischt. Der Hund kam erst auf den zweiten Zuruf zurück. Er setzte sich und stieß mit der Schnauze gegen die linke Jackentasche, wo die Hundekuchen drin waren. Da begann es plötzlich heftig zu regnen.
So ein Mist, dachte Lorenz. Warum hatte er sich darauf eingelassen? Er kannte seine Nichte kaum. Lea lebte mit ihrer Familie tausend Kilometer entfernt an der Nordsee. Ein Stück weiter nördlich von Husum. Dort war Noemi aufgewachsen. Deshalb hatte er sie in den vergangenen Jahren nur selten gesehen. Momentaufnahmen ihres Heranwachsens vom blonden Baby zur jungen Frau. Und jetzt sollte er herausfinden, was mit ihr los war, ob sie krank war, magersüchtig vielleicht, warum sie diese schreckliche Geschichte hören wollte. Und er sollte ihr diese wirre Geschichte erzählen, die er noch nie jemandem erzählt hatte und die seine Schwester Lea ihrer Tochter Noemi nicht erzählte, weil sie es nicht konnte.
Er hätte Nein sagen müssen. Aber das hatte er noch nie gut gekonnt.
Er gab dem Hund ein Biskuit und kraulte ihn hinter den Ohren.
»Na dann los!«, sagte er und setzte sich wieder in Bewegung.
Er hatte Christine gebeten, Noemi in der Stadt abzuholen. Die junge Frau war fast 1000 Kilometer mit dem Zug gereist. Bei dem schrecklichen Wetter wollten sie ihr den Weg mit dem Bus von B. zu ihnen heraus nicht auch noch zumuten. Aber er mochte nicht fahren. Dann hätte er womöglich schon im Auto mit Erzählen angefangen. Und das wollte er nicht. So hatte Christine Noemi abgeholt.
Als er in die Einfahrt zu seinem Haus einbog, stand der Wagen auf dem Vorplatz. Sie waren angekommen.
Während Lorenz aus den Wanderschuhen stieg und die nasse Jacke aufhängte, stürzte sich der Hund auf den Futternapf, der in der Garderobe für ihn bereitstand. Durch das Schlabbern und Schlingen hindurch konnte Lorenz die Frauen in der Küche sprechen hören. Er erkannte Noemis Stimme, hell und lebhaft, und sie rief ihm das Bild seiner Nichte zurück, wie er sie zuletzt gesehen hatte. Bei Leas letztem Geburtstag war das gewesen. Eine hübsche junge Frau mit den hellen Haaren ihrer Mutter. Da hatte Noemi ihnen ihren Freund vorgestellt, mit dem sie zusammenlebte. Boris – oder Iwan? Jedenfalls ein sympathischer junger Mann an der Seite der attraktiven Noemi. Ob sie sich seither verändert hatte? Wie sahen magersüchtige junge Frauen aus?
Sie hatte die Haare wachsen lassen. Rötlich schimmernd fielen sie ihr in Strähnen über die Schultern herab und sahen zerzaust aus. Als er eintrat, stand sie auf. Sie war groß und schlank und trug dunkelblaue Schlabberhosen und einen schwarzen Pullover, der ihr viel zu weit war.
»Entschuldige«, sagte sie befangen und wickelte eine Haarsträhne um den Zeigefinger, »das Wetter.« Und als er nicht antwortete, er wusste nicht, was sie meinte, lächelte sie ihn an. Halb verlegen und halb amüsiert. Da erst kam sie ihm wieder bekannt vor. »Danke, dass ich so schnell kommen durfte«, sagte sie. »Und dass du dir die Zeit für mich nimmst. Christine hat mir erzählt, dass du gerade sehr beschäftigt bist.«
Er schrieb an einem Artikel für eine Vogelzeitschrift. Keine große Sache, aber der Ablieferungstermin war nicht mehr fern. Er war gerade ganz gut vorangekommen. Aber heute würde er nicht weiterschreiben. Schade.
»So schlimm ist es nicht«, sagte er zu Noemi. »Und es wird ja nicht lange dauern.«
»Das hoffe ich«, mischte sich Christine ein. »Um acht gibts Abendessen.«
Lorenz sah auf die Uhr an der Wand gegenüber. Es war noch nicht ganz zehn. Bis zum Abendessen blieben zehn Stunden.
»So lange werden wir bestimmt nicht brauchen.«
»Na dann mal los.«
Christine reichte Lorenz ein Tablett mit einer Kanne Kaffee, zwei Tassen, Milch und Zucker und scheuchte sie aus der Küche hinauf in sein Studierzimmer. Er sollte anfangen. Sie wusste, wie schwer es ihm fiel.
Noemi
»Was ist denn eigentlich passiert? Deine Mutter war ganz durcheinander.«
Lorenz rührte in seiner Kaffeetasse, obwohl da weder Zucker noch Milch zu verrühren waren. Er trank den Kaffee immer schwarz.
»Nichts«, sagte Noemi und hob die Schultern ein wenig an. »Ich habe ein Buch gesucht. Im Wohnzimmer meiner Eltern.«
Sie saßen in Ledersesseln an einem kleinen Couchtisch. Gegenüber von Lorenz‹ schwerem Schreibtisch.
»Und dann?«
»Das ist nicht so einfach. Ein Buch zu finden, meine ich.«
Sie lachte und warf einen Blick auf die hohen Bücherregale an den Wänden des Arbeitszimmers. »Du hast da sicher eine bestimmte Ordnung, damit du deine Bücher finden kannst. Aber im Wohnzimmer meiner Eltern steht alles sinnlos durcheinander im Regal. Vielleicht sind die Bücher nach der Größe geordnet oder nach Farben, was weiß ich. Jedenfalls findet man nichts. Aber ich wusste, dass das Buch da sein musste, und ich brauchte es für die Vorlesung.«
Sie streute bedächtig eine Löffelspitze Zucker in ihre Tasse und sah zu, wie die weißen Körnchen versanken.
»Pädagogik, weißt du. Ich schreibe meine Abschlussarbeit.«
Sie mag auch nicht anfangen, dachte Lorenz. Vielleicht sollten wir es lassen.
Er sah durch die verglaste Balkontür hinaus in den nassen Garten. Der Regen hatte aufgehört. Dafür waren die Windböen wieder stärker geworden. Die hohe Pappel im Garten der Nachbarin bog sich beängstigend und schnellte dann in einem Bogen zurück. Eines Tages fällt die uns noch aufs Dach, dachte er mürrisch.
»Da war ein Fotoalbum«, sagte Noemi unvermittelt. »Ich glaube, Mama hatte es dort versteckt. Es war hinter die Bücher gerutscht, aber oben schaute es ein wenig heraus. Ich bin größer als Mama. Deshalb konnte ich es sehen.«
»Und da hast du es hervorgezogen?«
Dumme Frage.
Sie steckte den Löffel in die Zuckerdose zurück. Sah zu, wie er sich langsam neigte und dann vornüber kippte. Wie ein verwundeter Bösewicht am Ende eines Wildwestfilms. Dann sah sie Lorenz an. Sie hatte die Augen ihrer Mutter. Und die gleichen Sommersprossen auf der Nase. So hatte Lea ausgesehen, damals, vor der Tragödie. Helle Haut, rötliche Haare, Sommersprossen. Aber die Kleider ...
»Papa hat mir geholfen beim Suchen nach dem Buch. Und als er sah, dass ich das Fotoalbum ... Er sagte, ich solle es lieber dort lassen.«
Lorenz konnte es sich vorstellen. Sein Schwager war genauso konfliktscheu wie seine Schwester. Sie hatten es vor der Tochter geheimgehalten, hatten in zwanzig Jahren nie davon gesprochen. Genau wie er. Sie alle hatten nie mehr davon gesprochen.
»Da musstest du es natürlich nehmen.«
Sie führte die Tasse zum Mund. Setzte sie wieder auf den Couchtisch ab. Vielleicht war der Kaffee zu heiß.
»Ich habe mir nichts dabei gedacht.« Sie hob kaum merklich die Schultern an.
»Ein rotes Album«, sagte Lorenz, ohne nachzudenken, »mit schwarzen Seiten im Innern.« Er sah sie vor sich. Vier fast identische Fotoalben. Für jedes Kind eines. Der Vater hatte die Fotos gemacht, damals in den Fünfzigerjahren, als sie noch klein waren. Schwarz-Weiß-Bilder, die er selber entwickelte. In der unheimlichen Dunkelkammer im Keller unten. Jedes Bild in vierfacher Ausführung. Und die Mutter hatte sie in die Alben geklebt, mit diesen Fotoecken, die man damals brauchte, und manchmal schrieb sie etwas dazu. Eine Jahreszahl, einen Namen oder einen Ort.
»Nein«, sagte Noemi. »Ein blaues.«
Ein blaues Album. Drei rote, eines für jeden Jungen. Auf dem Deckel standen die Namen. Rudolf, Lorenz, Max. Und ein blaues für das Mädchen. Lea.
»Stimmt. Meines war rot. Das für deine Mutter war blau. Hast du es mitgebracht?«
Das wäre hilfreich. Vielleicht könnte er den Bildern entlang erzählen. Auf Fragen antworten.
Aber sie schüttelte den Kopf. »Mama hat es mir weggenommen. Sie ist völlig durchgeknallt.«
»Aber warum denn?«
»Da waren Bilder von euch. Ich glaube jedenfalls, dass ihr es wart. Als Kinder. Mama und ihre drei Brüder. Ich habe diese Fotos noch nie gesehen. Einer der Brüder sei gestorben, als ich klein war, haben sie mir immer gesagt. Meine Eltern sprachen nie darüber. Aber ich wusste, dass es etwas Schlimmes war. Und jetzt wollte ich es wissen. Und da ...«
Noemi schluckte.
»Was hat sie gesagt?«
»Sie könne mir das nicht erzählen, sagte sie. Dann nahm sie das Album und lief aus dem Haus. Sie kam erst am Abend zurück. Papa war sehr beunruhigt.«
»Hast du deinen Vater nicht gefragt, was los sei?«
»Er wollte es mir nicht erzählen. Ich müsse Mama fragen?«
»Und?«
»Als sie endlich zurückkam, war es spät. Wir waren alle müde und ich bin nach Hause gefahren.«
Lorenz erinnerte sich. Sie lebte mit ihrem Freund zwei Dörfer weiter in einem alten Bauernhaus.
»Ich habe meine Eltern dann ein paar Tage lang nicht gesehen.«
Da hat sie mich angerufen, dachte Lorenz. Das war vor einer Woche. Eine Woche Zeit hatte er sich ausbedungen, um sich auf dieses Gespräch vorzubereiten. Und immer noch fragte er sich, was er seiner Nichte sagen sollte.
Sag ihr, was gewesen ist, hatte Lea ihn angefleht.
Was meinte sie? Die Familie, die Kindheit, die Tragödie? Die Brüder.
Drei Brüder waren sie. Der Älteste, der Mittlere, der Kleine. Rudolf, Lorenz, Max. Und Lea, die Schwester.
So viel würde Noemi wissen, auch wenn sie sonst kaum etwas wusste. Wahrscheinlich wusste sie wenig, aber sie ahnte viel. Das konnte er ihr ansehen. Sie hatte manches aufgeschnappt, mitgehört, sich zusammengereimt. Aus Bemerkungen und Blicken der Erwachsenen. Und aus ihrem Schweigen. Aber jetzt wollte sie wissen, was wirklich geschehen war. Und sie wollte verstehen, warum. Konnte man das? Konnte man verstehen, warum das alles geschehen war? Wie so etwas hatte geschehen können. In ihrer Familie. Einer Familie, die doch eigentlich eine ziemlich normale Familie gewesen war. Bis die Zwillinge geboren wurden.
Dort musste er anfangen. Bei den feindlichen Brüdern. Er musste zuerst von Rudolf erzählen, dem Großen, dem Erstgeborenen, dem Stolz der Mutter. Auch wenn er es lieber nicht wollte.
Rudolf
»Als wir Kinder waren, war Rudolf der Stolz unserer Mutter.«
Rudolf, der Kluge, der Vernünftige. Er war groß für sein Alter und ein hübscher Junge mit schwarzen Locken und dunklen Augen. Eine ganze Kindheit lang hatte Lorenz zu ihm aufgeschaut. Rudolf war kaum zwei Jahre älter, aber er war der große, der viel ältere Bruder. Rudolf war irgendwie früh erwachsen. Er ist schon so vernünftig, sagte die Mutter. Sie meinte damit, dass er seine Sachen in Ordnung hielt, nie den Turnbeutel vergaß, sich jeden Morgen wusch und sich nie schmutzig machte.
Und dass er mit ihr Schach spielte. Lily Lehner war in ihrer Jugend, als sie noch Müller hieß und ihr Flair für Namen mit L noch nicht entdeckt hatte, eine begeisterte Schachspielerin gewesen. Sie war Mitglied im Schachklub ihres Heimatortes und gewann regelmäßig Pokale bei regionalen Wettkämpfen. Als frisch verheiratete Ehefrau vermisste sie das Schachspiel. F. war ein großes Dorf, aber es gab dort keinen Schachklub. Und Vater Lehner konnte sich mit dem Spiel nicht anfreunden. Er müsse im Beruf schon so viel denken, pflegte er zu sagen. Und außerdem sei er es leid, gegen seine Frau immer zu verlieren. So sprang Rudolf früh in diese Lücke. Wenn er mit Mutter über dem Schachbrett saß, durfte niemand ihre Eintracht stören. Sie verriet ihm die Geheimnisse des geliebten Spiels. Und Rudolf hing an ihren Lippen.
Aber im Kinderzimmer war Rudolf der Boss. Wenn sie miteinander spielten, gab Rudi die Themen vor. Baustelle, Eisenbahn, Flugplatz. Und er bestimmte die Regeln. Der Lastwagen brachte das Material zur Baustelle. Langsam kroch er schwer beladen vom äußersten Ende des Zimmers heran. Die gewundene Straße führte unter dem Hochbett hindurch, durch Tunnels und über eine steile Rampe. Man musste langsam und vorsichtig fahren, denn die Ladung war schwer und durfte auf keinen Fall herunterfallen. Rudi, auf allen vieren und Motorengeräusche vor sich hinbrummend, nahm jede Kurve mit Bedacht. Es war auf keinen Fall erlaubt, den Weg abzukürzen oder die Ladung in der Kurve mit der freien Hand festzuhalten, damit sie nicht verrutschte. Auf der Baustelle angekommen, musste der Lastwagen dann rückwärts fahren, damit »die Männer« abladen konnten. Die Steine wurden ordentlich aufgestapelt, bevor sie, einer nach dem andern, mit dem Kran hochgehoben und zu Türmen und Mauern aufgeschichtet wurden. Es war verboten, einen Bauklotz »einfach so«, mit der Hand auf einen andern zu setzen. Auch Eisenbahnwagen durften nicht aus den Schienen gehoben und woanders wieder aufgesetzt werden. Man musste rangieren. Endlos und verantwortungsvoll. Lorenz hätte gerne einmal einen Zusammenstoß verursacht, einen Lastwagen umgekippt, eine Eisenbahnkatastrophe arrangiert, damit er den Krankenwagen zum Einsatz bringen und mit dem Polizeiauto alle verbotenen Abkürzungen entlang rasen konnte. Aber das kam nicht infrage. Rudolf verabscheute jede Art von Chaos. Wenn Lorenz mitspielen wollte, hatte er das zu respektieren. Die Eisenbahn gehörte Rudolf. Sie war ein Heiligtum. Und wehe, die Kleinen kamen ihr zu nahe.
»Er war kein besonders guter Schüler, aber er war mir weit voraus in den praktischen Dingen. Er war sehr selbstständig.«
Er mochte es nicht, wenn jemand ihn anfasste. So lernte er früh, Knöpfe und Reißverschlüsse zu öffnen und bald auch, sie zu schließen. Er konnte seine Schuhe selber binden, lernte ohne Hilfe Radfahren und fuhr ganz allein auf seinem kleinen grünen Fahrrad in die Stadt, zum Flughafen oder wer weiß wohin.
»Einmal bekamen wir zu Weihnachten zwei Meerschweinchen. Eines für Rudolf und eines für mich.«
Da war Lorenz sieben Jahre alt. Er wünschte sich ein Tier. Einen Hund oder eine Katze. Aber das wollte die Mutter nicht. Tiere bringen Dreck in die Wohnung. Bakterien. Ungeziefer. Und die Mutter verabscheute Schmutz und Bakterien, so wie Rudolf Chaos und Verwirrung auf seinen Eisenbahnstrecken verabscheute. Aber Lorenz hörte nicht auf, sich ein Tier zu wünschen. Und die Eltern schenkten den Söhnen Meerschweinchen.
Lorenz freute sich, als sie endlich in einer großen Kiste unter dem Weihnachtsbaum herumraschelten. Für ihn bedeuteten sie doppeltes Glück. Denn Rudolf wollte nichts mit den Tieren zu tun haben. Er blickte misstrauisch über den Rand der Holzkiste, wo die beiden Jungtiere neugierig zwischen Holzwollebüscheln herausspähten und mit rosaroten Näschen nach der Karotte schnupperten, die Lorenz ihnen hinhielt. Rudolf wollte sie nicht anfassen, nicht streicheln, nicht aus der Kiste nehmen und auf dem Schoß halten, sie mit Leckerbissen füttern und ihnen zuschauen, wie sie die Wohnung erkundeten. Wenn Lorenz eines herausnahm, zog sich Rudolf in sein Zimmer zurück und schloss die Tür.
»Hau ab«, sagte er, wenn Lorenz ihm mit dem Meerschweinchen folgte. »Bring’s in den Zoo, die werfen es der Schlange vor.«
Er hasste es, wenn ein Tierhaar an seinem Pulli klebte. Dann wurde er ganz steif, zog mit spitzen Fingern den Pullover aus, trug ihn mit ausgestrecktem Arm ins Bad, wo er ihn im Wäschekorb versenkte, und holte sich aus dem Schrank einen frischen.
»Mach doch nicht so einen Aufstand«, sagte die Mutter, »deine Pullover sind aus Wolle. Das sind Haare von Schafen.«
Von da an trug Rudolf nur noch Hemden oder Pullis aus Baumwolle.
»Es war, als ob er sich vor allem fürchtete, was lebte oder gelebt hatte. Er liebte Maschinen, Autos, Waffen, interessierte sich für Baustellen, Straßen, Krieg.«
Bei jeder Gelegenheit schimpfte er auf die Meerschweinchen. Flohsäcke. Schlangenfraß. »Pass bloß auf, dass mir keins in die Quere kommt. Ich dreh ihm den Hals um.«
»Hast du nicht Angst gehabt?«, fragte Noemi.
»Wir hatten manchmal Angst vor Rudolf. Aber um die Meerschweinchen machte ich mir keine Sorgen. Rudolf hätte nie einem Tier etwas angetan.«
Nicht aus Tierliebe. Er mochte sie einfach nicht anfassen. Er ekelte sich vor Tieren. Vor ihrem Pelz und ihrem Fleisch, vielleicht auch vor ihrem Geruch. An seinem zehnten Geburtstag schob er den Teller mit dem Kalbfleisch, das die Mutter gekocht hatte, weil sie glaubte, dass es Rudolfs Lieblingsessen war, zurück. »Gib’s den Schweinen.« Er meinte die Meerschweinchen. »Ich esse kein Fleisch.«
»Nein danke«, sagte er höflich, wenn die Familie bei Verwandten zu Besuch war und die Tante dem Älteren der Lehner-Jungen ein besonders saftiges Hühnerbein auf den Teller legen wollte. »Ich esse kein Fleisch.«
»Hundefutter«, brummte er zu Hause, wenn es Hackfleisch gab.
Er hatte zwei Gesichter. Ein Außengesicht, wie Vater es nannte, und ein Familiengesicht. Bei Fremden wusste er sich zu benehmen. Er war ein angepasster Schüler, höflich, ordentlich, zurückgezogen. Ein Außenseiter, aber er wurde nie gemobbt. Und er hatte auch Freunde. Kollegen, die seine Interessen teilten. Autos, Maschinen, Militär.
»Habt ihr noch miteinander gespielt?«, fragte Noemi.
»Immer seltener.« Lorenz lachte. »Mit meinem Bauernhof musste ich allein spielen. Ich interessierte mich schon damals für Tiere, für die Natur.«
»Und für Chaos und Katastrophen?«, fragte Noemi.
Aber Lorenz winkte ab. »Nein. Ich glaube, ich war ein sehr harmoniebedürftiges und vorsichtiges Kind.«
»Das hat Mama auch über dich gesagt. Und sie muss es wissen. Sie ist ja selber so. Macht sich ständig Sorgen über alles Mögliche.«
»Wirklich? Als Kind war sie furchtlos. Ich habe sie oft bewundert, obwohl sie so viel jünger ist.«
Lea scheute sich nicht, ihre Meinung zu sagen. Die Kleine sei nicht unschuldig an den ewigen Streitereien, sagte die Mutter oft. Aber das war ungerecht. Lea kam mit allen aus. Irgendwie hatte sie schon als kleines Mädchen zwischen den Brüdern vermittelt. Sogar der viel ältere Rudolf hörte ihr zu.
»Mama hat immer Angst, einen Fehler zu machen. Und wenn etwas passiert, fühlt sie sich schuldig, auch wenn sie gar nichts dafür kann.«
Er wusste, dass es so war. Nach der Katastrophe hatte Lea sich verändert. Sie suchte nach den Gründen und fand die Schuld für das Unglück am Ende bei sich selber. Aber in seiner Erinnerung war sie die strahlende Kleine, die die Brüder und den Vater um den Finger wickeln konnte.
Zwillinge
Die Zwillinge, zwölf Jahre nach Rudolf geboren, waren die Kleinen und blieben es für Lorenz bis heute. Als sie zur Welt kamen, war die Mutter noch nicht vierzig, aber für die damalige Zeit fürs Gebären schon zu alt. Sie hätte kein Kind mehr bekommen dürfen, soll ein Arzt gesagt haben. Aber sie freute sich. Ihr bekommt ein Brüderchen oder ein Schwesterlein, sagte die Mutter.
Da war Lorenz zehn, streifte mit seinem besten Freund nach der Schule durch den Wald, trocknete Blumen und Baumblätter zwischen den Seiten dicker Bücher und las die Abenteuer von Old Shatterhand, statt Hausaufgaben zu machen. Ob Schwester oder Bruder war ihm herzlich egal. Aber wenn die Eltern sich Gedanken über den richtigen Namen machten, hörte er zu. Das fand er interessant.
Wenn es ein Junge ist, heißt er Leo. Leo und Lorenz, das gefiel ihm, das passte. Und wenn es ein Mädchen ist? Luzia, schlug die Mutter vor, Luzia Lehner, das klang doch gut. Aber der Vater war dagegen. Wenn es ein Mädchen wurde, sollte es Regina heißen, wie die Mutter des Vaters, die schon lange tot war.
Da mischte sich ganz überraschend Rudolf ein. R sei schön, sagte er, stand auf und ging in sein Zimmer. Er hieß nach seinem Großvater.
»Aber dann hat sich das L doch durchgesetzt. Mama heißt nicht Regina. Oder hatte die Oma eine Fehlgeburt?«
»Nein. Aber es waren Zwillinge.«
Noemi hob überrascht den Kopf. Hatte sie das nicht gewusst?
Damals gab es für Schwangere keinen Ultraschall. Oder vielleicht doch. Lorenz wusste es nicht. Jedenfalls war es nicht üblich, das Baby schon im Bauch zu fotografieren und es zu filmen, wie es durchs Fruchtwasser schwimmt. Lorenz hatte die Ultraschallbilder der eigenen Kinder gesehen, undeutliche Schemen in einer Art Schneetreiben, und später die lebensechten Videos von den Enkelkindern.
»Ich glaube, meine Eltern wussten es nicht. Die Hebamme sagte, es sei alles in Ordnung.«
Aber es war nicht in Ordnung. Die Mutter gebar ein Mädchen, ein kräftiges gesundes, wunderschönes Mädchen. Sie kam in die Welt wie eine Königin auf dem Weg zur Krönung, und hinterher, wie eine Staubfluse an ihrer Schleppe, kam der Junge.
Und es war eine lange Schleppe. Der Kleine wollte nicht herauskommen, wollte drin bleiben. Auch später war es so. Lea spielte draußen mit den andern Kindern. Max wollte drinnen bleiben. Wollte malen. Als er klein war, malte er. Später schrieb er Gedichte.
Das zweite Baby, als sie es endlich herausgeholt hatten, war winzig. Blau im Gesicht sei es gewesen. Blau am ganzen Körper. Zu wenig Sauerstoff. Verschrumpelt, mit der Zange herausgezogen.
Für den geb‹ ich Ihnen keinen Fünfer, soll die Hebamme zum Vater gesagt haben. Als wolle sie ihn auf das Unvermeidliche vorbereiten. Aber Sie haben ja ein wunderschönes Mädchen.
»Sie bekam den Namen, der für den Jungen vorgesehen war. Lea.«
Er passte zu einer starken, schönen kleinen Prinzessin. Das fand auch Lorenz. Lorenz und Lea, das gefiel ihm mit einem Mal besser als Lorenz und Leo. Leo hätte einfach nicht gepasst zu dem schrumpeligen kleinen Wesen, das erst ein paar Wochen nach der Geburt aus dem Krankenhaus in die Familie kam und alle durcheinanderbrachte mit seinem Geschrei. Da hatte er schon seinen Namen. Er hieß Max.
Vielleicht hätte er auch so werden sollen wie Lea. Hübsch, zufrieden und freundlich zu allen. Aber er war der Zwilling, der Schwächere, der Nachgeborene, der Kümmerling, der kleine Bruder der großen Schwester.
Warum ist sie größer?
Weil sie älter ist.
Dreißig Minuten älter.
Max, das Sorgenkind. Ein zeterndes, kreischendes, wimmerndes Wesen, das seinen Körper seltsam nach hinten bog und nächtelang schrie. Lorenz verstand nicht, was die Eltern an ihm fanden.
Rudolf musterte den Neuankömmling misstrauisch und machte einen Bogen um ihn, wie um die Meerschweinchen.
»Bring den zurück ins Krankenhaus«, sagte er zur Mutter.
»Lass ihm ein wenig Zeit. Bald könnt ihr mit ihm spielen.«
Natürlich war er dafür noch zu klein. Auch Lea war noch viel zu klein für die großen Brüder. Aber sie sahen zu, wenn die Mutter sie badete, schüttelten die Rassel vor ihrem runden Gesichtlein, lugten über den Rand des Stubenwagens und freuten sich, wenn sie sie aus hellen Augen betrachtete. Bald schon lächelte sie, wenn einer der Jungen kam, und sie durften sie halten, wenn sie dabei auf dem Sofa saßen. Auch Rudolf hielt sie gerne auf den Knien und sah ihr ins Gesicht. Und Lea lachte und gluckste, wenn er sie wiegte.
»Deine Mutter war der Liebling der ganzen Familie.«
»Und Max?«
Lorenz suchte nach einer Antwort.
»Er war das Sorgenkind. Die Sorgenkinder sind den Eltern ja oft die liebsten. Aber die erste Zeit war für alle sehr schwierig.«
Damals machten Ärzte noch Hausbesuche. Nach der Ankunft des kleinen Max war der Kinderarzt ein Dauergast bei Lehners. Er kannte die Familie seit Rudolfs Geburt. Wenn sie bei ihm in der Praxis waren, meist um eine Impfung zu erhalten oder einen lang dauernden Husten abzuklären, sprach der Arzt aufmerksam und interessiert mit den Kindern. Während Lorenz verlegen war und knapp antwortete, gab sich Rudolf, wie immer gegenüber Autoritäten, erwachsen und abgeklärt. Einmal bemerkte Lorenz, wie der Arzt der Mutter einen fragenden Blick zuwarf. Sie lächelte. Ihr Ältester sei schon sehr vernünftig.
»Kommst du klar mit dem neuen Bruder?«, fragte der Arzt bei einem seiner Besuche, während Max heftig strampelte und quäkte.
»Er ist schrecklich«, sagte Rudolf unumwunden. »Ich finde, man sollte ihn ins Spital zurückbringen.«
»Das darfst du nicht sagen!« Die Mutter schrie beinahe. Das tat sie sonst nie. Sie war eine beherrschte, kühle Frau, die sich ihre Gefühle nicht gerne anmerken ließ. Rudolf warf ihr einen irritierten Blick zu und ging aus dem Zimmer. Max brüllte wie am Spieß. Die Mutter kämpfte gegen die Tränen.
»Was habe ich falsch gemacht?«, fragte sie den Arzt.
Lorenz war zehn und die Antwort des klugen Mannes konnte er damals nicht verstehen. Vielleicht hatte er sie deshalb nie vergessen. »Sie sind nicht schuld Frau Lehner. Aber ich fürchte, Sie haben hier eine schwierige Konstellation.«
»Ich glaube, für unsere Mutter war Max eine Prüfung, vielleicht sogar eine Strafe. Er hat ihre ganzen Kräfte aufgezehrt. Sie sei hochmütig gewesen, sagte sie einmal, sie habe sich eingebildet, sie könne auch mit vierzig noch gesunde Kinder auf die Welt bringen. In der ersten Zeit war ihr Lea deshalb ein großer Trost. Mutter freute sich, dass wir, die Großen, die kleine Prinzessin so gern hatten.«
»Wurde es denn mit der Zeit nicht besser mit Max?«
Lorenz zögerte. Er war ja selber ein Kind gewesen. Auch noch, als Max größer wurde. War es besser geworden? Er erinnerte sich an ein quengeliges, kränkelndes Kleinkind, das schreckliche Wutanfälle bekommen konnte. Max war ungeschickt und seine Missgeschicke trafen ihn wie ungerechte Strafen. Er robbte auf dem Bauch und stieß sich mit einem Ellenbogen vorwärts, als Lea sich schon aufrecht den Wänden entlang tastete und mutig kleine Zwischenräume überwand. Er schielte und hatte einen nässenden Ausschlag um den Mund. Er kreischte, wenn ihm etwas nicht passte, und stieß die Brüder weg, als Lea schon nein und Mama sagte und winkte, wenn jemand wegging. Und wenn Lea strahlte und kleine Freudenschreie ausstieß, wenn die großen Brüder aus der Schule heimkamen, schielte Max sie aus entzündeten Augen an und sabberte.
»Schwächling«, sagte Rudolf, »Memme, Schwachkopf.«
»War er das, ein Schwachkopf?«, fragte Noemi.
»Ein Schwachkopf war er nicht, aber es war schwierig, mit ihm klarzukommen.«
Wenn Lorenz mit Lea spielte, wollte Max dabei sein, aber das Spiel endete fast immer mit Tränen und Geschrei. Manchmal kam die Mutter aus der Küche und schimpfte mit Lorenz. Schäm dich, er ist doch so viel kleiner als du.
»Später habe ich kaum mehr mit ihm gespielt. Aber als ich älter wurde, tat er mir oft leid.«
»War Max nicht eifersüchtig auf Lea?«, fragte Noemi, die angehende Pädagogin. »Weil sie doch der Liebling war und Max so ein Störenfried.«
»Nein!«, sagte Lorenz, diesmal ohne nachzudenken. »Die beiden waren von klein auf ein Herz und eine Seele.«
Lorenz machte eine Pause, als sei er an etwas hängen geblieben.
»Das klingt so abgegriffen. Aber auf die beiden traf es zu. Sie schienen sich nie zu streiten. Steckten immer beisammen und wussten alles voneinander. Oder: Lea wusste alles von ihrem Bruder. Oder sie fühlte alles, was er fühlte. Schon als sie noch klein waren, als Max häufig Wutanfälle hatte und sich lange nicht beruhigen konnte, rief unsere Mutter Lea zu Hilfe.«
»Was hat sie gemacht?«
»Lea? Ich weiß es nicht. Sie sagte etwas zu ihm, sprach auf ihn ein. In einer Kindersprache. Wir verstanden nie, was es war. Aber Max verstand es. Er gab sogar Antwort, sprach mit Lea, lange bevor er ein vernünftiges Wort sagen konnte. Es war magisch!«
»Ich habe darüber gelesen. Zwillinge haben manchmal eine eigene Sprache, wenn sie noch klein sind. Aber das geht vorbei. Oder?«
Lorenz nickte. Die Sprache war vergangen, verschwunden, irgendwie verdunstet. Aber die Verbundenheit war geblieben. Noch viele Male hatten sie Lea zu Hilfe gerufen, wenn der Kleine Probleme machte. Nur sie konnte dann mit ihm umgehen, konnte ihn besänftigen, beruhigen, zurückholen in die Welt. Auch ganz zuletzt hatten sie nach ihr gerufen. Aber da hatte es nicht funktioniert.
»Weißt du«, sagte Lorenz. Aber da wurden sie gestört. Christine schaute durch den Türspalt und fragte, ob sie noch einmal Kaffee bringen solle.
Er hatte seine Frau gebeten, das zu tun. Komm ab und zu herein oder ruf mich an. Das Handy lag auf dem Couchtisch. Er wollte nicht zu lange allein sein mit seiner Nichte, dieser jungen Frau, die er so wenig kannte, und der er eine Geschichte erzählen musste, von der er nicht wusste, wie sie sie aufnehmen würde. Eine Geschichte, von der er nicht wusste, wie er selber darauf reagieren würde, wenn er sich sie erzählen hörte.
Leander
Er betrachtete seine Nichte, während Christine hinausging. Sie war fast noch ein Baby gewesen, als es passierte. Ein hübsches Baby mit seidigen Haaren und blauen Augen. Wie früher die kleine Lea.
Max war kein hübsches Baby. Er war auch äußerlich das Gegenteil seiner Schwester. Er war dunkel wie Rudolf und hatte ebenso schwarze Locken, aber ihm standen sie störrisch vom Kopf ab. Es war fast unmöglich, seine Haare zu waschen. Da ließ es die Mutter häufig einfach bleiben. Max schien ohnehin immer schmutzig zu sein, auch wenn sie ihn gerade gewaschen und er das Haus mit markerschütterndem Protest gefüllt hatte.
»Weißt du«, nahm Lorenz den Gedanken wieder auf, bei welchem ihn Christine unterbrochen hatte, »das, was ich über den kleinen Max gesagt habe, dass er so schwierig war und manchmal eine richtige Plage, das ist schon richtig. Aber er hatte auch eine ganz andere Seite, eine liebenswürdige und mitreißende. Er hatte etwas an sich, das ihn beschützte.«
Max war anstrengend und konnte einem gewaltig auf die Nerven gehen. Und trotzdem liebten ihn außer Rudolf alle. Sein Ungestüm, das überschäumende Bedürfnis nach Beachtung und Respekt und die Entschlossenheit, mit der er um seinen Platz in der Familie kämpfte, hatte sogar für Lorenz etwas Berührendes, obwohl er doch noch selber ein Kind war. Max liebte die Welt, die sich vor ihm zu verschließen und ihn zurückzustoßen schien, und in die er sich immer von Neuem hineinstürzte, begeistert und mutig, wie in ein aufgewühltes Meer.
Freude war ein genauso gewaltiges Ereignis wie Frust. Wenn ihn etwas beglückte, führte er einen Freudentanz auf, jauchzte und johlte, klatschte in die Hände und hüpfte auf und ab. Sein Lachen war laut und ansteckend. Sein Strahlen ein Geschenk. Seine Liebe zu Mutter und Schwester war tief wie ein See und konnte alles überschwemmen. Und wenn Lorenz ihm eine Freude machte, sprang der Kleine ihm an den Hals und küsste ihn schmatzend und nass dorthin, wo er gerade traf.
Dann lächelte die Mutter pikiert. Umarmungen und Küsse waren in der Familie nicht üblich. Man behielt seine Gefühle für sich. Und Rudolf verließ ganz schnell den Raum. Obwohl er nichts sagte, war ihm anzusehen, dass er dieses Verhalten unangenehm, peinlich, ja eklig fand. Es machte ihm Angst, das wurde Lorenz mit den Jahren klar. Tief in Rudolf, hinter seiner Ordnungsliebe und Vernünftigkeit, mochten ähnlich heftige Ausbrüche lauern. Vielleicht hätte sich Rudolf keine so beherrschte und unterkühlte Fassade zugelegt, wenn da nicht der Kleine gewesen wäre, der ihm vorführte, was passieren mochte, wenn er die Kontrolle verlor über seine Gefühle.
»Aber«, sagte Noemi plötzlich, als wäre ihr etwas aufgefallen, ein Fehler in Lorenz‹ Geschichte, »Mama spricht nicht freundlich über Max.«
»Spricht sie denn von ihm?«
»Kaum. Und nie so, wie über einen Zwillingsbruder, den sie sehr geliebt hat.«