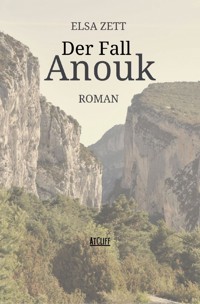
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der Schriftsteller und Journalist Luc Dubois in einem Hotel im Schwarzwald eine alte Bekannte wiedererkennt, würde er am liebsten wieder abreisen. Vor zwanzig Jahren, während der Sommerferien in einem kleinen französischen Dorf, war Isabelle das Kindermädchen seiner Tochter Anouk. Und damals verschwand die kleine Anouk spurlos. Luc hat sich nach der Tragödie in einem neuen Leben eingerichtet und will nicht an die Vergangenheit erinnert werden. Aber die Tischgespräche mit Isabelle drehen sich alle um das mutmaßliche Verbrechen und um die Frage, was damals wirklich geschah. An drei langen Abenden entwerfen die beiden ein Bild des Dramas um das verschwundene Kind und erinnern sich an die Menschen, die darin verwickelt waren und bis heute nicht davon loskommen. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart treffen sie auf überraschende Erkenntnisse und verwirrende Ungereimtheiten. Der Fall Anouk wird nie gelöst werden, davon ist Luc überzeugt. Bis das Gespräch eine unerwartete Wendung nimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch:
Als der Schriftsteller und Journalist Luc Dubois in einem Hotel im Schwarzwald eine alte Bekannte wiedererkennt, würde er am liebsten wieder abreisen. Vor zwanzig Jahren, während der Sommerferien in einem kleinen französischen Dorf, war Isabelle das Kindermädchen seiner Tochter Anouk. Und damals verschwand die kleine Anouk spurlos. Luc hat sich nach der Tragödie in einem neuen Leben eingerichtet und will nicht an die Vergangenheit erinnert werden. Aber die Tischgespräche mit Isabelle drehen sich alle um das mutmaßliche Verbrechen und um die Frage, was damals wirklich geschah. An drei langen Abenden entwerfen die beiden ein Bild des Dramas um das verschwundene Kind und erinnern sich an die Menschen, die darin verwickelt waren und bis heute nicht davon loskommen. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart treffen sie auf überraschende Erkenntnisse und verwirrende Ungereimtheiten. Der Fall Anouk wird nie gelöst werden, davon ist Luc überzeugt. Bis das Gespräch eine unerwartete Wendung nimmt.
Autorin:
Elsa Zett lebt in ihrer Heimatstadt Basel. Sie studierte Psychologie und Pädagogik, arbeitete als Lehrerin und Dozentin, publizierte Fach- und Sachtexte, gewann mit Kurzgeschichten Wettbewerbe und widmet sich jetzt dem Schreiben von Romanen.
Ihre Ferien verbringt sie gern in Frankreich. Die Idee zum Roman »Der Fall Anouk« hat sich aus einer Meldung in einer regionalen Zeitung entwickelt – und wurde dann zu einer ganz anderen Geschichte.
ELSA ZETT
Der Fall Anouk
Roman
Ich danke allen,
die mich ermutigt und unterstützt haben.
Ganz besonders
Anne
Lila
Dieter
und Jörg
Erster Tag
Erinnerungen
1
Auch die Stimme altert, dachte sie, und trotzdem erkennt man sie wieder.
Es war seine Stimme, da war sie ganz sicher, ein wenig schnarrend und gepresst wie aus einer zu engen Kehle.
Sie blieb an der Tür zum großen Saal stehen, die halb offen war, und spähte über die Köpfe der Seminarteilnehmer nach vorn zum Tisch des Lehrers.
Ja, das war er. Sie hätte ihn sofort erkannt, auch wenn sie nicht gewusst hätte, dass er es sein musste. Luc Dubois, der Dozent für literarisches Schreiben, der die Methode des fremden Blicks erfunden und ein halbes Dutzend Bücher über die Kunst und das Handwerk des Schriftstellers veröffentlicht hatte.
»Natürlich können Sie den Fall ungelöst lassen«, sagte er gerade in die Reihen seiner Zuhörer hinein. »Aber Ihre Leser werden damit nicht zufrieden sein. Eine Geschichte muss ein Ende haben, das keinen Raum für Fragen lässt.«
Er war womöglich noch etwas hagerer geworden und grau, aber wenn sie es nicht gestern ausgerechnet hätte, würde sie ihm die fast sechzig Jahre nicht geben. Er kam ihr jünger vor, vielleicht weil er Jeans trug und keine Krawatte oder weil seine Brille immer noch diese kreisrunden Gläser hatte. Harry-Potter-Brille hatte sie es damals genannt. Es gab dem Gesicht etwas Jungenhaftes.
»Die Regeln sind da, damit sie eingehalten werden«, sagte er als Antwort auf den Einwand einer Studentin. »Wenn man sie bricht, muss man die Folgen auf sich nehmen. Das ist beim Schreiben nicht anders als im wirklichen Leben.«
Er lächelte, freundlich und ein wenig spöttisch, und blickte in den Raum, prüfte die Wirkung seiner Worte. Auch das erkannte sie wieder, dieses Lächeln in dem mageren Gesicht, das sagte: Ich weiß es besser, aber ich will nicht mit euch streiten. Ich bin ein freundlicher Mensch.
Le professeur. So hatten sie ihn im Dorf genannt. Er wirkte einfach so. Die Art wie er sprach, wie er lächelte, wie er durch die Brillengläser schaute, wie ein Professor eben. Obwohl er damals noch gar keiner war. Aber schon damals konnte er alles erklären. Und schon damals stritt er nicht gern, hielt seinen Kritikern dieses Lächeln entgegen wie eine abwehrende Geste.
War es möglich, dass er sich so wenig verändert hatte? Nach allem, was geschehen war?
Da sah er sie an der Tür stehen, hielt in der Bewegung inne und hob fragend die Brauen. Ob er sie erkannte?
»Oh, Elisabeth, komm doch herein«, rief eine Frauenstimme von der anderen Seite des Raumes her. Es war die Kursleiterin. Sie musste im selben Moment auf sie aufmerksam geworden sein und eilte ihr jetzt durch den Saal entgegen.
»Ich habe dich schon angekündigt.«
Sie wandte sich dem Dozenten zu: »Herr Dubois, das ist Frau Gerber, meine Vorgesetzte.«
Die Studierenden drehten die Köpfe. Sie hätte ihn lieber später begrüßt, mit weniger Publikum. Aber es gab kein Entrinnen.
2
Luc Dubois machte zwei Schritte hinter seinem Tisch hervor und sah ihr entgegen.
Eine Frau um die vierzig, schätzte er, mittelgroß, schlank, enge Jeans und eine kurze Cordjacke. Mit dem professionellen Lächeln der Gastgeberin trat sie auf ihn zu und reichte ihm die Hand. Die Haare waren dunkel und gelockt, helle Haut, Sommersprossen, die Augen grün ...
»Entschuldigen Sie, ich wollte nicht stören«, sagte sie.
Ein Erdrutsch. Ein paar Steine brachen von der Felskante, auf der er stand, und schlitterten prasselnd in die Tiefe. Aber er fing sich und sagte:
»Enchanté, Madame la Directrice.«
Einige der Kursteilnehmer grinsten. Er war schlagfertig, der Professor. Er hatte ihnen heute seine Methode des fremden Blicks erläutert. Der Autor soll sich vom Gebrauch der Worte und Bilder in einer fremden Sprache anregen lassen. Luc Dubois schöpfte seine Beispiele gerne aus dem Französischen und verwies dabei auch auf das, was er die französische Überschwänglichkeit nannte. Nehmen Sie es wörtlich, sagte er, und lassen Sie es wirken. Ich bin entzückt, meine Dame die Direktorin.
Aber es war ihm herausgerutscht und Elisabeth Gerber wusste das. Mit diesen spöttischen Worten hatte er sie jeden Morgen begrüßt, in jenem Sommer vor zwanzig Jahren, als sie ihr französisches Abitur geschafft hatte, das Baccalaureat in der Tasche trug, und ihr Stiefvater so stolz auf sie war, dass er jedem sagte, sie würde bestimmt einmal eine Direktorin werden.
»Haben Sie etwas dagegen, den Unterricht für heute zu beenden?«
Sie wartete seine Antwort nicht ab und wandte sich zu den Zuhörern. »Es ist schon spät und Herr Dubois ist ja morgen auch noch da. Genießen Sie den Abend.«
Die Leute begannen ihre Sachen zusammenzupacken. Einige trollten sich schnell, ein paar standen noch herum, hatten Fragen an die Kursleiterin oder an Frau Gerber.
Luc ging zur Fensterbank, wo er seine Unterlagen abgelegt hatte. Er blätterte sie durch, als müsse er sich vergewissern, dass keine Seite fehlte, schob sie in die Ledermappe, suchte die Stifte zusammen, verstaute den Laptop und zog die kleine Flasche mit dem Brillenreinigungsspray aus dem Rucksack.
Sie trug keine Brille.
Der Geruch des Reinigungsmittels stieg ihm scharf in die Nase. Sie war es nicht. Er hatte sich getäuscht. Es war ein langer Tag gewesen. Er war müde. Es war dämmrig in dem Raum, die Luft verbraucht, seine Brille war verschmiert und es war zwanzig Jahre her. Es konnte gar nicht sein.
Er drehte sich um. Sie stand in der Mitte des Raums und sah zu ihm herüber.
»Kommen Sie«, sagte sie, als ob sie seine Verwirrung nicht bemerkte, »ich zeige Ihnen das Hotel.«
Er nahm seinen Rucksack auf und folgte ihr durch das enge Treppenhaus ins Freie.
Auf der Dorfstraße mussten sie hintereinandergehen. Ein hochbeladener Traktor kroch ihnen entgegen. Er zog ein Jauchefass hinter sich her und eine Kolonne ungeduldiger Autos. Die Leute wollten nach Hause zum Abendessen. Aber die Dorfstraße war eng. Die Autoabgase vermischten sich mit der Ausdünstung des Jauchewagens. Der Motor des Traktors dröhnte in seinen Ohren und brachte das Zwerchfell zum Vibrieren. Das ist nun also der idyllische Schwarzwald mit Ruhe und gesunder Luft, dachte er verstimmt.
Das Jauchefass tropfte und zog eine wackelige Spur auf dem löchrigen Pflaster. Die Direktorin hielt sich so dicht wie möglich an den Hausmauern und Gartenzäunen. Sie ging schnell, als wollte sie ihn abhängen, aber ab und zu wandte sie sich halb nach ihm um, um zu sehen, ob er ihr folgte.
Und er folgte ihr. Benommen und verwirrt, als hätte er eben eine ganz unglaubliche Nachricht erhalten. Alles stimmte. Seltsam, dachte er, man erkennt einen Menschen viel sicherer an der Art, wie er sich bewegt, wie er den Kopf trägt, wie er die Tasche auf die Schulter schwingt, die Füße setzt beim Gehen, sich umdreht und zurückschaut. Man braucht das Gesicht nicht zu sehen, um einen Bekannten aus der Ferne zu erkennen. Auch wenn man nicht sagen könnte, warum man so sicher ist.
Im Eingang des Hotels zur Linde blieb sie stehen.
»Wir sehen uns beim Abendessen«, sagte sie. »Ich wohne auch hier. Ich habe mir erlaubt, uns auf 19 Uhr einen Tisch zu reservieren. À toute!«
Leichtfüßig lief sie die Treppe hinauf. Er sah ihr nach, sprachlos.
À toute, sagte sie, bis später. Nicht à toute à l’heure, wie es zwar auch nicht besonders formell, aber wenigstens korrekt geheißen hätte, sondern diese flapsige, familiäre Kurzform. Wie sie es damals immer zueinander gesagt hatten.
»Guten Abend, Herr Dubois. Haben Sie gut angefangen?«
Ein gemütlicher Herr mit wirrem grauem Haar war hinter der Empfangstheke erschienen. Zweifellos der Wirt des Hotels zur Linde. Er reichte ihm einen Schlüssel.
»Zimmer 25, zweiter Stock.«
»Oh ja, danke.«
3
Luc schulterte den Rucksack und stieg dieselbe Treppe hinauf, auf der die Direktorin entschwunden war. Die Stufen waren schmal und knarrten. Einen Lift schien es hier nicht zu geben. Ruhe und Gelassenheit in familiärer Atmosphäre, hatte Luc im Internet gelesen. Einfach und gut, sei die Devise. Das gelte auch für das Essen. Der Chef kochte selber.
Das Zimmer war groß und hell. Ein breites Bett mit Kissen wie Wolkenberge, am Fenster ein winziger Schreibtisch, auf dem er gerade mal den Laptop platzieren konnte, an der Wand ein Ledersofa, davor ein riesiger runder Klubtisch.
Er warf den Rucksack auf den Teppichboden und begann, im Zimmer hin und her zu gehen. So lief das nicht! So war es nicht abgemacht. Er wollte allein sein. Das hatte er sich ausbedungen. Luc Dubois kam, um im Seminar zu unterrichten, ganz egal, wo es stattfand und wer es veranstaltete. Im Seminar stand er zur Verfügung, da konnte man ihm Fragen stellen, da war er freundlich und mitteilsam, da geizte er nicht mit seinen Erfahrungen und Ratschlägen. Aber danach musste er für sich sein. Er wohnte nie dort, wo die Seminarteilnehmer wohnten, und er aß auch nicht, wo sie aßen.
Er könnte sich das Abendessen aufs Zimmer bestellen. Allerdings wäre das ziemlich unhöflich. Es war die Direktorin, die mit ihm zu Abend essen wollte. Und es würde nicht gehen. Das war hier ein traditionelles Schwarzwaldhotel mit guter Küche und familiärer Atmosphäre. Zimmerservice war kaum vorgesehen. Abreisen, dachte er. Er musste unverzüglich abreisen. Er würde einen Grund dafür erfinden. Jemand war krank geworden, verunglückt. Ein Freund, ein Kind. Nein, er hatte kein Kind. Und Freunde eigentlich auch nicht.
Er zog das Handy aus der Tasche, schaltete es ein und starrte auf den Bildschirm, wie auf eine schwer verständliche Gebrauchsanweisung. Andrea hatte angerufen. Musste das jetzt sein? Nur gut, dass er das Telefon im Unterricht immer abstellte. Er kannte die Nummer. Eine Nachricht hinterließ sie nie. Sie würde sich wieder melden. Und dann wieder. Bis sie ihn erreichte. Da konnte er sicher sein. Wenn es ihr nicht gut ging, wenn die immerzu schwelende Hoffnung aufloderte und sie nachts nicht schlafen ließ, dann rief sie ihn am Tag darauf an. Dann musste er sagen, dass es Unsinn sei, was sie glaubte herausgefunden zu haben, und dann konnte sie mit ihm streiten, ihm vorwerfen, dass er aufgegeben habe, dass er zu träge sei, um zu glauben. Es war ein Ritual, eine Geisterbeschwörung. Ob es ihr half, wusste er nicht. Aber irgendwie war er es ihr schuldig. Und diesmal könnte es ihn retten. Er würde sagen, seiner Frau gehe es nicht gut. Er müsse sofort zu ihr.
Er drehte sich um, das Telefon in der Hand. War schon an der Tür. Aber nein, dachte er dann. Andrea war schon lange nicht mehr seine Frau. Wer es nicht ohnehin wusste, konnte es leicht herausfinden. Und vielleicht fand sich noch mehr, wenn eine neugierige Studentin einmal anfing, zu recherchieren. Es war gewiss nicht ratsam, sich bei einer Lüge ertappen zu lassen. Schließlich lebte er von seinem guten Ruf als Dozent. Er konnte es sich nicht leisten, ein Seminar mit fragwürdiger Begründung platzen zu lassen. Und er wollte nicht, dass jemand in seiner Vergangenheit herumstocherte.
Er trat ans Fenster und blickte hinaus auf ein stattliches Bauernhaus mit ebensolchem Misthaufen davor. Ein Traktor holperte auf der Straße vorbei. Ohne Jauchefass diesmal, aber mit einem langen Anhänger, auf welchem ganz allein ein Kinderdreirad, ein Traktor aus Plastik, aufgeladen war und bei jeder Unebenheit im Straßenbelag in eine andere Richtung rollte. Er saß hier in der Pampa, fiel ihm ein. Wie sollte er jetzt noch wegkommen? Der letzte Bus nach Schopfheim hinunter war längst abgefahren. Er musste hierbleiben.
Er öffnete die Tür des Kleiderschranks. Stand einfach da und blickte auf die leeren Kleiderbügel. Er konnte nicht weg. Er sollte sich einrichten.
Wäre er doch mit dem Auto hergekommen. Er hatte es vorgehabt. Aber die Sekretärin der Hochschule, die diesen Kurs organisierte, hatte ihm dringend davon abgeraten. Hier oben könne schon im Oktober der erste Schnee fallen und die Straßen seien ohnehin schlecht. Letzteres stimmte, davon hatte er sich überzeugt, aber das Wetter war spätsommerlich warm und sonnig. Beim nächsten Mal, falls es ein nächstes Mal gab, würde er nach Basel fliegen und am Flughafen einen Mietwagen nehmen. Die Zugfahrerei war ohnehin eine Zumutung. Die Reise hierher, jedenfalls der Abschnitt von Dresden nach Schopfheim, war eine einzige Strapaze gewesen. Schon in Frankfurt war er um Stunden verspätet und dachte ans Umkehren, und als er spätabends in Basel ankam, kurz vor acht statt am hellen Nachmittag, sah er den Zug nach Schopfheim gerade noch wegfahren. Da spielte er mit dem Gedanken, die Frau von der Hochschule anzurufen. Er sei in Frankfurt stecken geblieben, wollte er sagen. Er könne es nicht wie geplant bis Schopfheim schaffen, würde sich wohl um einen Tag verspäten. Aber er traute sich nicht. Die Lüge wäre zu durchsichtig gewesen.
Wenn man lügt, muss man geschickt lügen. Oder viel Glück haben, dachte er.
Es gab keinen Grund, umzukehren.
Von Basel fuhr die Wiesentalbahn noch bis spät in die Nacht hinein in regelmäßigen Abständen nach Schopfheim. Und dort war im Löwen ein Zimmer für ihn reserviert. Die Hochschule geizte nicht bei den Spesen. Er hatte gut geschlafen im Löwen und am frühen Morgen den Bus hier herauf genommen. Eine schöne Fahrt war das, im leeren Bus mit hundert Kurven zwischen Wiesen und durch Wald. Er hatte es genossen. Aber jetzt wünschte er doch, er wäre unten geblieben. Er wollte nicht mit dieser Direktorin zu Abend essen. Er wollte mit niemandem zu Abend essen.
Luc setzte sich aufs Sofa, schlüpfte aus den Schuhen und legte die Füße auf den Klubtisch.
Er musste seine Ruhe haben. Dreißig Seminarteilnehmer würden morgen früh wieder auf ihn warten, angehende Autorinnen und Autoren, die seine Bücher gelesen hatten, die von ihm etwas erwarteten, die er nicht enttäuschen sollte. Darauf musste er sich konzentrieren. Er wollte ganz allein etwas essen. An einem Tischlein für sich. Wie gestern im Löwen. Und dann aufs Zimmer gehen und tief und traumlos schlafen. Schnell im Schlaf verschwinden, bevor das Grübeln begann. Das war sein Rezept. Damit war er in den letzten Jahren ganz gut gefahren.
Aber es ging nicht. Er nahm die Füße vom Tisch und rappelte sich auf. Er musste mit der Direktorin zu Abend essen, ob es ihm nun passte oder nicht. Es gehörte nun einmal zum Job. Er war hierhergekommen, um zu unterrichten. Dafür wurde er bezahlt. Darüber würde er mit ihr sprechen.
Er öffnete den Rucksack, begann, seine Sachen auszupacken. Es gab keinen Grund zur Panik. Der erste halbe Tag war gut gelaufen, wie immer. Er versuchte, sich im Spiegel zuzugrinsen, als er im Bad seine Toilettensachen verstaute. Die Marke Dubois stand für Tradition und Qualität. Der fremde Blick, das war seine Erfindung und sie hatte sich tausendfach bewährt. Genau wie der Titel des Seminars. Zwischen Anfang und Ende hieß es diesmal. Manchmal nannte er es Anfang, Mitte, Schluss. Beides kam gut an.
Er räumte die Wäsche in den Schrank, hängte die Hemden auf die Bügel. Ganz unten im Rucksack lag sein erstes Buch. Er nahm es immer mit, wenn er ein Seminar gab. Es war sein Markenzeichen und sein Glücksbringer. Der Neuanfang.
Wie lange war das her? Er stand jetzt mitten im Zimmer, immer noch auf Socken, und versuchte, sich zu erinnern. Er hatte das Buch geschrieben, nachdem er ... Aber daran sollte er nicht denken. Schon gar nicht heute. Das war vorbei. Mit der Methode des fremden Blicks hatte er den Neubeginn geschafft. Seither hatte er die Theorie weiterentwickelt, die Textbeispiele ausgewechselt, den fremden Blick auf andere Inhalte gerichtet. Jedes Jahr ein neues Buch. Das Prinzip war dasselbe: die Suche nach dem Ungewohnten, dem Auffälligen im Leben und in der Literatur. Alles, was ihm fremd vorkommt, soll der Autor in sich aufsaugen und verwandeln und zu etwas Eigenem machen.
Er merkte, dass er dabei war, das Inputreferat für morgen früh vorzubereiten.
Warum bloß war er so nervös? Er musste seine Referate schon lange nicht mehr vorbereiten. Schließlich war der fremde Blick seine Methode. Die konnte er jederzeit erklären und anwenden. Er hatte sie erfunden, oder jedenfalls bekanntgemacht, und auf alle Fälle hatte er sie weiterentwickelt und mehrere Bücher darüber geschrieben.
Was hatte er zu befürchten? Noch zwei ganze Tage und einen halben bis zum Mittag. Dann würde er schnell abreisen, ganz allein zu Tal fahren, bevor das Seminar auch für die Teilnehmer zu Ende war. Dieses Abendessen mit der Direktorin würde ihn doch nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil. Ein Essen mit einer charmanten und gut aussehenden Frau, die er von früher kannte und lange nicht gesehen hatte. Das musste doch interessant werden. Von damals plaudern wollte er allerdings nicht. Aber man konnte von der Zeit erzählen, die zwischen heute und ihrem letzten Treffen lag. Zwischen Ende und Anfang, dachte er, wie sinnig. Was hast du gemacht? Wie geht es dir? Was ist aus dir geworden? Und aus den anderen? Das wollte er ganz gerne erfahren. Und er würde vorsichtig sein. Keinen Wein trinken, ermahnte er sich.
Von draußen hörte er eine Turmuhr schlagen. Halb sieben. Es reichte nicht mehr für eine Dusche. Er musste sich beeilen, wenn er nicht zu spät kommen wollte.
Sie sieht gut aus, zufrieden, vielleicht glücklich, dachte er, während er ein frisches Hemd glattstrich. Und sie war ein hohes Tier in dieser Hochschule. Wie hatte die Kursleiterin gesagt? Direktorin? Er hatte nicht aufgepasst. Danach musste er sie fragen. Das war unverfänglich. Ob sie wirklich Deutsch studiert hatte? Das war doch ihr Traum gewesen. Damals, als ihre Haare noch rötlich waren und kurz geschnitten.
Er ging ins Bad, warf einen Blick in den Spiegel, fuhr sich durch die Frisur. Jedenfalls hatte er noch Haare und sie waren noch nicht einmal alle grau. Ob er ihr sehr alt vorkam? Ob er sie das auch fragen sollte?
Im Treppenhaus begann sein Herz zu klopfen. Vorfreude? Nein, Angst. Sie waren selten geworden in den letzten Jahren, diese unverhofften Anfälle von Panik aus nichtigem Anlass. Am Anfang hatte er sie oft gehabt, Herzrasen, Atemnot, Zittern, richtige Panikattacken. In der Klinik hatten sie das in den Griff bekommen, mit Medikamenten und Psychotherapie. Jetzt brauchte er die Betablocker schon lange nicht mehr. Er hatte das alles hinter sich gelassen. Oder nicht?
Ich muss weg hier, dachte er. Einfach verschwinden. Er konnte sich morgen bei ihr entschuldigen, ihr eine Geschichte erzählen. Dass er sich bei einem Spaziergang verirrt habe meinetwegen. Irgendetwas würde ihm einfallen. Er war gut im Erfinden von Geschichten. Man glaubte ihm.
Er blieb auf dem Treppenabsatz im ersten Stock stehen, atmete tief ein und tief aus, wie er es gelernt hatte, und spähte durch den Gang, der hier zu den Zimmern führte. Dort hinten schimmerte ein grünes Licht. Ein rennendes Männchen, ein Pfeil. Der Fluchtweg. Da musste er hin.
»Monsieur Dubois!« Eine Stimme hinter ihm. Eine vertraute Stimme. »Hier geht’s zum Speisesaal.«
Er atmete noch einmal durch, presste die Handflächen gegen die Oberschenkel, damit das Zittern verging, und fügte sich ins Unvermeidliche. Sie hatte ihm aufgelauert.
»Ich habe uns ein ruhiges Tischlein reservieren lassen«, sagte sie, während sie hinter ihm die Treppe hinunterstieg.
4
Die Wirtin kam ihnen hinter dem Tresen hervor entgegen. Sie trug ein kurzes Kleid über engen Leggins und silberne Schuhe mit Plateausohlen. Er starrte darauf, während sie vor ihnen her zu ihrem Tisch ging. Was hatte er erwartet? Eine Schwarzwaldtracht?
Der Tisch stand am Rand des Speisesaals in einer Art Nische. Die nächsten Tische waren ein Stück entfernt. Ein Platz wie extra bereitgestellt für ein Liebespaar, das zu zweit sein wollte. Oder für Geschäftsleute, die die Konkurrenz fürchteten. Für Ganoven, die einen Plan ausheckten, für Verschwörer, die einen Umsturz planten, oder für unentdeckte Kriminelle, die auf ihr Leben zurückblickten.
Sie ließ ihm den Vortritt, als wäre sie auch hier die Gastgeberin. Man kannte sie, wusste, wer sie war, das merkte er an der Art, wie man sie grüßte und mit ihr sprach. Er setzte sich auf den Platz an der Wand, auf die gepolsterte Bank, die rund um das Lokal lief. Von hier konnte er den ganzen Raum überblicken. Die spärlich besetzten Tische, eine gedeckte Tafel für zwölf Personen vor den Fenstern auf der linken Seite. Schräg gegenüber die Theke, dunkel, aus altem Holz, dahinter bis an die Decke Regale mit Gläsern und Flaschen. Und seitlich musste eine Tür sein, Luc konnte sie nicht sehen, aber gerade verschwand dort ein Kellner. Vermutlich in die Küche. Weiter hinten sah er die Eingangstür, durch die sie gekommen waren.
Wovor fürchtete er sich?
Die Wirtin erkundigte sich, ob der Tisch richtig sei. Luc hatte Zeit, zu atmen und sich ein wenig zu fassen. Sie hat sich verändert, dachte er, früher habe ich den Tisch bestimmt und das Personal hat mich gefragt, ob alles in Ordnung sei.
Die Wirtin schritt auf ihren hohen Sohlen davon und entschwand jetzt ebenfalls durch die unsichtbare Tür hinter der Theke. Er musste etwas sagen.
»Darf ich Sie noch Isabelle nennen?«
»Wenn ich dich noch Luc nennen darf.« Sie lächelte anders als früher. Selbstbewusster.
»Warum nicht? Ich habe mir ja keinen neuen Namen zugelegt.«.
Das stimmte zur Hälfte. Er hatte zwei Namen, seit sie sich kannten. In der Öffentlichkeit, wenn er schrieb, war er Luc Dubois, nicht Lukas Oberholzer. Das war schon lange so. Und seine Freunde hatten ihn schon immer Luc genannt.
Sie zuckte die Schultern. »Bei dir war das ja auch nicht nötig.«
»Du hättest mich wenigstens vorwarnen können. Ich meine, dass du das bist, diese Elisabeth Gerber.«
Die Wirtin war wieder da, brachte die Speisekarten.
»Was möchten Sie trinken?«
»Zwei Glas Sherry bitte, vom Trockenen«, sagte sie schnell und lächelte ihn an.
Sherry. Sein Herz klopfte wieder schneller. Er hatte sie zu einem Glas trockenem Sherry eingeladen, an jenem Abend im Frühling 1998, nachdem sie den ganzen Tag durchs Tal der hundert Furten gewandert waren. Und sie hatte gesagt, das ist der erste Sherry meines Lebens, den werde ich nie vergessen.
»Gerne.« Die Wirtin drehte sich um und ging auf den hohen Sohlen leichtfüßig davon.
»Und ein Wasser!«, rief Luc ihr hinterher.
Bis die Getränke kamen, vertieften sie sich in die Speisekarten. Oder sie taten so. Luc konnte sich nicht darauf konzentrieren. Dabei hatte er den ganzen Tag kaum etwas gegessen. Er war in der Mittagspause spazieren gegangen. Er hatte allein sein wollen. An diesem Tag wollte er an Anouk denken.
Die Wirtin stellte zwei Gläser mit Sherry auf den Tisch, schenkte umständlich Mineralwasser ein, fragte nach ihren Wünschen. Isabelle bestellte eine Vor- und eine Hauptspeise.
»Für mich dasselbe«, sagte Luc. Er hatte nicht hingehört.
Was sie zu trinken wünschten?
»Bringen Sie uns eine Flasche vom Üblichen«, sagte Isabelle.
»Gerne. Zum Wohl.«
»Ich trinke hier immer den gleichen Wein«, erklärte Isabelle. »Du wirst ihn mögen.«
»Für mich noch eine Flasche Wasser«, rief Luc, aber die Wirtin war schon durch die unsichtbare Tür hinter dem Tresen verschwunden.
Isabelle hob ihr Glas. »Auf unser Wiedersehen.«
Auch Luc hob das Glas. »Auf Ihr Wohl, Frau Gerber.«
»Es ist der Name meines Vaters«, sagte sie, als sie das Glas wieder abstellte.
»Deines Vaters? Den hast du doch gar nicht gekannt, oder?«
Nein. Er hatte ihre Mutter verlassen, bevor Isabelle geboren war. Sie hatte ihn nie gesehen und er war früh gestorben, an Krebs, hatten sie damals gesagt. Ihre Mutter nahm sie zu seiner Beerdigung mit, als sie vierzehn war. Und da hatte sie ihre Großeltern kennengelernt, die Gerbers. Aber dann zog sie mit ihrer Mutter nach Frankreich und der Kontakt verlor sich wieder.
»Der Rummel, den sie damals um mich machten, hatte etwas Gutes. Meine Großeltern erfuhren, wie elend es mir in Frankreich ging, und luden mich nach Zürich ein. Ich zog Anfang 1999 zu ihnen und begann zu studieren. Es war eine Befreiung.«
Das konnte er sich denken. In ihrem Dorf in Frankreich war sie eine Geächtete.
»Aber dann wurde René verhaftet. Plötzlich kreuzten Journalisten bei den Großeltern auf, wollten mich interviewen und versuchten, Fotos zu machen.«
Sie seufzte ein wenig. »Das war ein Flashback. Ich war damals ziemlich traumatisiert.«
»Kein Wunder«, sagte er. Er erinnerte sich gut, wie es gewesen war, im Sommer 1998, in Frankreich, wie die Fotografen und Reporter ihr auflauerten, ihr Leben recherchierten, ihre Freundinnen befragten, ihren Namen in die Zeitung schrieben, mit den Namen ihrer Eltern und Verwandten, mit ihrer Wohnadresse und mit ihren Geheimnissen.
»Die Züricher Großeltern kannten das. Mein Vater hatte keinen Krebs. Er ist an AIDS gestorben. In dem kleinen Dorf, wo sie wohnten, war das ein Riesenskandal. Und eine unvergessliche Sensation. Am Ende verkauften sie das Haus und zogen in die Stadt, wo niemand sie kannte. Die Gerbers haben mir geholfen, eine neue Identität anzunehmen.«
»Und der Vorname?« Er fand Elisabeth schrecklich.
Sie lachte. »Den habe ich behalten. Isabel ist die spanische Abwandlung von Elisabeth. Und Isabelle ist die französische Variante davon.«
Elisabeth Gerber. Gut schweizerisch und unauffällig. Wie es schien, hatte der Name sich bewährt. Immerhin war sie Professorin an einer pädagogischen Hochschule.
Und jetzt wusste er auch, warum er sie nicht gefunden hatte. Damals, als er sich aufgerappelt hatte, als er aus der Klinik kam und sein erstes Buch schrieb, sein erstes nach der Katastrophe. Da hatte er ein schlechtes Gewissen. Er wollte sie nicht treffen, auf keinen Fall. Aber er wollte ihr schreiben.
»Ich habe nach dir gesucht«, sagte er. »Wollte dir sagen, dass ich deine Idee geklaut hatte.«
»Der fremde Blick«, sagte sie prompt. »Ja, das hat mich geärgert. Du hättest mich wenigstens erwähnen können.«
Es war ihr Aufsatz gewesen, der ihm die Idee gegeben hatte. Einer der vielen Aufsätze in deutscher Sprache, die die Abiturientin Isabelle Bernasconi dem Journalisten und Autor Lukas Oberholzer zum Lesen gegeben hatte. Im Frühling 1998, als er ohne Frau und Kind in sein Ferienhaus nach Frankreich gekommen war, um in Ruhe zu arbeiten, wie er sagte.
»Das war unmöglich.« Er schüttelte entschieden den Kopf. »Wenn ich dich offiziell erwähnt hätte, hätte Andrea mich ermordet. Sie war rasend eifersüchtig, weil sie damals deine Texte nicht lesen durfte.«
Sie musterte ihn argwöhnisch. »Willst du mir weismachen, dass du sie ihr nicht zum Lesen gegeben hast?«
»Das hatte ich dir doch versprochen. Die Texte waren ja auch sehr persönlich.«
Sie seufzte und lächelte selbstironisch. »Mein ganzes Unglück war darin gespiegelt. Meine Ankunft in einer fremden Welt.«
Als ihre Mutter Armand heiratete und zu ihm in das kleine Dorf im Drômetal zog, war sie, Isabelle, gerade vierzehn. Sie verlor ihre Stadt, ihre Schule, ihre Freundinnen, ihre erste Liebe und ihre Sprache. In der schönen Wildnis der Rhône-Alpes sollte sie das französische Baccalaureat erwerben, statt einer Schweizer Matura. Sie musste französisch sprechen, das französische System nachholen, französisch schreiben und französisch denken lernen, aber sie war entschlossen, den gymnasialen Abschluss zu schaffen. Sie wollte zurück in die Schweiz und in Basel oder in Zürich Deutsch studieren. Und deshalb las sie neben all der französischen Pflichtlektüre deutsche Literatur von Eichendorff bis Grass und schrieb die Schulaufsätze zuerst auf Französisch und dann, heimlich zu Hause, noch einmal auf Deutsch. Und sie litt, weil niemand sie korrigierte, niemand ihr sagte, dass sie gut seien, gut geschrieben, gut erzählt, originell gedacht. Bis Luc kam und sie sich traute, ihm ihre Texte zu geben, zuerst die Aufsätze, dann die Geschichten und zuletzt die Gedichte.
Der Wein wurde gebracht. Luc bestellte noch einmal Wasser.
»Hast du das Buch gelesen, der fremde Blick, meine ich?«
Sie nickte.
»Dann hast du gesehen, dass ich deine Idee ziemlich ausgebaut habe.«
»Stimmt«, gab sie zu. »Aber die Grundidee ist von mir. Die Auseinandersetzung mit einer fremden Sprache schärft den Blick auf die eigenen Sprachgewohnheiten. Das war meine Erfahrung. Und ein paar schöne Beispiele, die du so gern verwendest, sind auch von mir.«
»Welche denn?« Es war so lange her und er hatte so viel darüber nachgedacht, darüber geschrieben und damit gearbeitet, dass er das wirklich nicht mehr wusste.
»Il pleut comme vache qui pisse.«
Sie grinsten beide. Es regnet wie Kuh, die pisst. Ein sicherer Lacher in jeder Vorlesung.
»Das zählt nicht. Was noch?«
»Être tout sucre, tout miel.«
Darüber hatte er sich in seinem Buch länger ausgelassen. Und er hatte das Beispiel auch heute im Unterricht gebraucht. Sie war ganz Zucker, ganz Honig.
»Das regt die Leute immer an. Heute schrieb jemand: Er konnte nicht mehr klar denken, war ganz Nebel, ganz Sumpf.«
»Nicht schlecht«, sagte sie.
»Aber weißt du«, er wollte den Vorwurf des Ideenklaus nicht einfach so auf sich sitzen lassen, »diese Beispiele findest du in jedem guten Wörterbuch. Die kannst du nicht für dich patentieren.«
»Laisse tomber!«
Er sah irritiert auf. Was meinte sie? Lass es fallen, lass los. Die Franzosen brauchten es für »Lass gut sein« oder einfach für »egal«.
Sie sah seine Verwirrung und lachte. »Ich meine es genau so.«
»Dann bist du mir nicht mehr böse.«
»Nein«, sagte sie, »deswegen nicht.«
Weswegen denn, wollte er fragen. Warum hast du dich nie bei mir gemeldet? Aber dann ließ er es lieber bleiben.
Sie hob das Glas.
»Auf unser Wiedersehen.«
Sie kosteten den Wein. Er nahm noch einen Schluck.
»Ist das nicht seltsam«, sagte sie in die Stille, »dass wir uns gerade heute treffen?«
Er schluckte. Er antwortete nicht. Er hatte gehofft, dass sie es vergessen habe.
»Heute ist doch ihr Geburtstag.«
Heute wäre ihr Geburtstag, korrigierte er sie in Gedanken. Er musste an Andrea denken, wie sie diesen Tag all die Jahre hindurch immer gefeiert hatte. Nein, nicht gefeiert, das war das falsche Wort. Sie hatte diesen Tag begangen als das, was er war, der Geburtstag ihrer verschwundenen Tochter. Sie buk keinen Kuchen mehr, Schokoladentorte mit Sahne überzogen und jedes Jahr ein buntes Kerzlein mehr darauf, aber sie stellte sich immer noch vor, dass sie es getan hätte. Sah ihr Kind heranwachsen, gehen lernen, sprechen lernen, zählen, rechnen. Sie hatte sich immer neu ausgemalt, wie Anouk aussah, mit drei, mit fünf, als sie in die Schule kam, als sie eine junge Frau wurde. Andrea glaubte fest, dass ihre Tochter irgendwo lebte. Seit zwanzig Jahren hielt sie daran fest, wider alle Vernunft, und ließ sich nicht davon abbringen.
Er nickte. »Heute wäre sie einundzwanzig geworden.«
»Einundzwanzig«, sagte Isabelle. »So alt war ich damals noch lange nicht.«
Er sah sie vor sich, das Mädchen Isabelle, das gerade sein Bac gemacht hatte. Hellhäutig, rothaarig, grünäugig, mit Sommersprossen und Stupsnase. Sie war noch keine 18 gewesen.
»Erinnerst du dich? Ich hatte mein Bac in der Tasche. Mein Name stand in der Zeitung.«
Ja, er erinnerte sich an die schier endlose Liste, die dort unten jeden Sommer in La Feuille, der regionalen Tageszeitung, veröffentlicht wurde. Les résultats du baccalauréat, die Resultate der Abiturprüfungen. Von A bis Z wurden zuerst alle aufgelistet, die bestanden hatten. Dann auch die, die nochmals antreten mussten. Weit oben, unter der Überschrift admis, bestanden, Bernasconi Isabelle.
Sie hatte es geschafft. Trotz Systemwechsel und Fremdsprache.
»Alle waren stolz auf dich, deine Mutter, Armand. Auch wir.«
Sie nickte. Ein wenig bitter, wie ihm schien.
»Später haben sie sich geschämt, wenn mein Name in der Zeitung stand. Und er stand ja oft dort. Am Anfang jeden Tag.«
Ein Kellner kam, ein schüchterner junger Mann, der Lehrling vermutlich, und brachte zwei Schüsseln mit buntem Salat und gebratenen Shrimps.
»Sieht schön aus«, sagte Luc mit Blick auf den Teller, »richtig verlockend. Scheint ein gutes Lokal zu sein.«
Er wollte über etwas anderes sprechen, egal über was, seinetwegen über das Anrichten und Verzieren von Vorspeisen auf überdimensionierten Tellern, nur nicht über jene Geschichte. Es war so lange her und er hatte so viel gekämpft und gelitten, bis er wieder arbeiten konnte, ein normales Leben führen, sogar Bücher schreiben. Er wollte nicht, dass das alles wieder aufgerührt würde. Es würde ihm nicht guttun.
»Bist du öfter hier?«
Sie nickte. »Das Bildungshaus hier oben ist für unsere Zwecke sehr geeignet. Und die Leute mögen den Schwarzwald. Die Hochschule führt hier jedes Jahr Veranstaltungen durch.«
»Und du bist die Direktorin?«
Sie lachte. »Nicht ganz. Ich leite den Fachbereich Deutsch.«
»Dann hast du mich angestellt?«
Nein. Sie schüttelte die dunkle Lockenfrisur. Sie stand ihr gut.
»Das war die Dozentin, die diese Autorenworkshops organisiert. Sie war sehr stolz, dass es ihr gelungen ist, Luc Dubois zu engagieren.«
»Und du kommst jedes Mal her, wenn ein Kurs stattfindet?«
»Nein«, sagte sie. »Ich mache selten Besuche in den Kurswochen.«
»Und warum bist du jetzt hier?«
Die Frage war unpassend, das wurde ihm gleich bewusst, aber da war sie schon gestellt.
»Mein Team, die Dozentinnen, sie wollten unbedingt, dass ich herkomme und dich begrüße. Sie hoffen, dass ich dich auch für die anderen Workshops verpflichten kann.«
»Wie viele gibt es denn außer diesem?«
Für seine Verhältnisse war das Honorar, das er hier bekam, außergewöhnlich attraktiv. Ein paar solche Veranstaltungen mehr könnte er weißgott gebrauchen.
»In der Regel sind es jedes Jahr vier Intensivwochen. Sie sind meist ausgebucht. Wenn wir Luc Dubois fest im Angebot hätten, könnte es sogar eine mehr werden.«
Sie lächelte ihn an.
Er blies anerkennend die Backen auf. Er konnte leben, von dem was er als Lektor und Referent verdiente. Aber er wurde bald sechzig. Ein paar solche Aufträge jedes Jahr gäben ein angenehmes Polster für die Zeit, wenn er vielleicht nicht mehr so gefragt war.
»Und du bist gekommen, weil du dachtest, du könntest mich überreden?«
Es war eine Frage, aber er hörte selber den Zweifel darin, es klang wie ein Vorwurf. Warum um alles in der Welt war sie hergekommen? Ihr musste doch klar sein, dass ihn das verwirrte, dass es den Erfolg des Unterrichts gefährden konnte. Sie hatten sich fast zwanzig Jahre lang nicht mehr gesehen. Sie selber hatte ihm damals, als er zu ihr nach Hause gekommen war, um ihr den Lohn fürs Kinderhüten zu bringen, den Rücken zugewandt und gesagt, sie wolle nie mehr mit ihm zu tun haben. Er hatte das verstanden und respektiert. Auch er wollte nichts mehr zu tun haben mit dieser Geschichte.
»Zuerst wollte ich nicht. Aber dann haben sie mich überzeugt.«
Bildete sie sich wirklich ein, dass er noch einmal hierherkommen würde, jetzt, nachdem er wusste ...
»Ich bin sehr erschrocken«, sagte sie, »als ich deinen Namen hörte. Ich dachte, dass ich bestimmt nicht kommen würde. Dann fiel mir ein, dass heute Anouks Geburtstag ist. Das kam mir vor wie ein Zeichen. – Und dann habe ich deine Bedingungen gelesen ...«
Er sah auf. Was meinte sie? Sein Honorar? Die Spesen?
»Dass du außerhalb des Studienhauses wohnen und essen wolltest.« Sie lächelte. »Das halte ich auch immer so, wenn ich hier bin.«
Ausgerechnet, dachte Luc zornig. Ausgerechnet diese Vorsichtsmaßnahme hatte ihn in diese Situation gebracht. Er machte es immer zur Bedingung, dass er außerhalb des Unterrichts für sich sein konnte. Die Vorstellung, beim Essen zwischen interessierten Studentinnen zu sitzen und über das Schreiben zu sprechen, am Abend Konversation zu machen, witzig zu sein, vielleicht etwas Privates zu offenbaren, war ihm ein Gräuel.
»Deine Mitarbeiterin hat mir versichert, ich könne ein Zimmer im Hotel hier nehmen und auch hier essen, wenn es mir nichts ausmache, allein zu sein.«
Sie überhörte den Vorwurf. »Und du bist gerne allein?«
»Ja«, sagte er.
»Du bist nicht mehr mit Andrea zusammen.«
Es war eine Feststellung. Natürlich wusste sie das. Ihre Mutter und Andrea waren all die Jahre in Kontakt geblieben.
»Wir sind seit fünfzehn Jahren geschieden.«





























