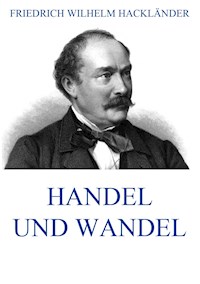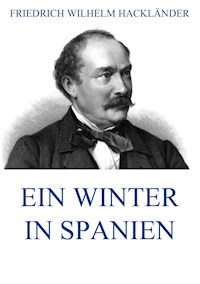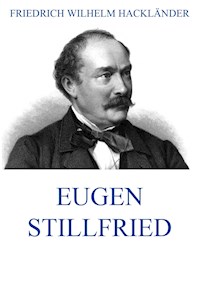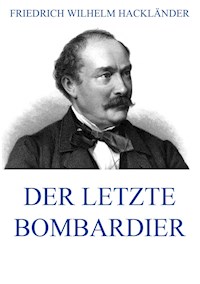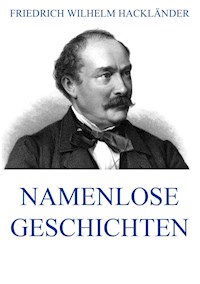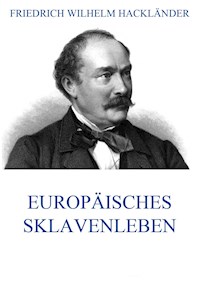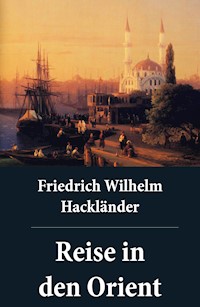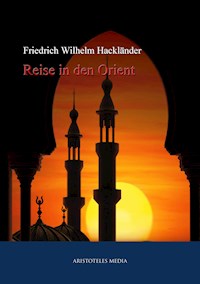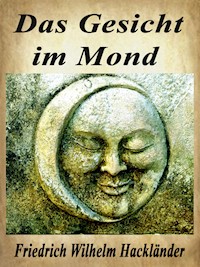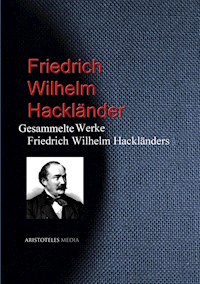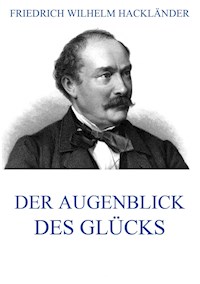
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Roman erzählt Hackländer aus dem Leben am Hofe einer großen Residenzstadt. Facettenreich und voller unterschiedlicher Charaktere entwickelt sich eine abwechslungsreiche Geschichte ....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Augenblick des Glücks
Friedrich Wilhelm Hackländer
Inhalt:
Friedrich Wilhelm Hackländer – Biografie und Bibliografie
Der Augenblick des Glücks
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Siebzehntes Kapitel.
Achtzehntes Kapitel
Der Augenblick des Glücks, F. W. Hackländer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849626846
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Wilhelm Hackländer – Biografie und Bibliografie
Roman- und Lustspieldichter, geb. 1. Nov. 1816 in Burtscheid bei Aachen, gest. 6. Juli 1877 in seiner Villa Leoni am Starnberger See, widmete sich, früh verwaist, 1830 dem Kaufmannsstand, trat nach zwei Jahren bei der preußischen Artillerie ein, kehrte aber, da ihm der Mangel an Vorkenntnissen die Aussicht auf Avancement verschloß, zum Handelsstand zurück. Das Glück lächelte ihm indes erst, als er sein frisches Erzählertalent mit »Vier Könige« und »Bilder aus dem Soldatenleben« (Stuttg. 1841) geltend zu machen begann. Die auf eignen Erlebnissen beruhende Wahrheit und der liebenswürdige Humor dieses Büchleins, dem später die weitern Skizzen »Das Soldatenleben im Frieden« (Stuttg. 1844, 9. Aufl. 1883) folgten, erregten allgemeine Aufmerksamkeit und verschafften H. insbes. die Zuneigung des Barons v. Taubenheim, der ihn zum Begleiter auf seiner Reise in den Orient (1840–41) wählte. Deren literarische Früchte waren: »Daguerreotypen« (Stuttg. 1842, 2 Bde.; 2. Aufl. als »Reise in dem Orient«, 1846) und der »Pilgerzug nach Mekka« (das. 1847, 3. Aufl. 1881), eine Sammlung orientalischer Märchen und Sagen. Durch den Grafen Neipperg dem König von Württemberg empfohlen, arbeitete H. einige Zeit auf der Hofkammer in Stuttgart und wurde im Herbst 1843 zum Sekretär des Kronprinzen ernannt, den er auf Reisen und 1846 auch zu seiner Vermählung nach Petersburg begleitete. Im Winter 1849 aus dieser Stellung entlassen, begab er sich nach Italien, wo er im Hauptquartier Radetzkys dem Feldzug in Piemont beiwohnte, war darauf im Hauptquartier des damaligen Prinzen von Preußen (spätern Kaisers Wilhelm I.) Zeuge der Okkupation von Baden und nahm dann in Stuttgart seine schriftstellerische Tätigkeit wieder auf. 1859 wurde er vom König Wilhelm von Württemberg zum Direktor der königlichen Bauten und Gärten ernannt, begab sich noch in demselben Jahr, bei Ausbruch des italienischen Krieges, auf Einladung des Kaisers Franz Joseph in das österreichische Hauptquartier nach Italien, wo er bis nach der Schlacht bei Solferino blieb, und wurde 1861 für sich und seine Nachkommen in den österreichischen Ritterstand erhoben. Beim Regierungsantritt des Königs Karl (1865) plötzlich seines Amtes enthoben, lebte er seitdem abwechselnd in Stuttgart und in seiner Villa Leoni am Starnberger See. Die literarische Tätigkeit hatte H. während seiner verschiedenen amtlichen Obliegenheiten und Reisen eifrig fortgesetzt; aus der Teilnahme am piemontesischen Feldzug Radetzkys und der Belagerung von Rastatt im Sommer 1849 erwuchsen die »Bilder aus dem Soldatenleben im Krieg« (Stuttg. 1849–50, 2 Bde.); den »Wachtstubenabenteuern« (das. 1845, 3 Bde.; 6. Aufl. 1879), den »Humoristischen Erzählungen« (das. 1847, 5. Aufl. 1883) und »Bildern aus dem Leben« (das. 1850, 5. Aufl. 1883) folgten größere humoristische Romane: »Handel und Wandel« (Berl. 1850, 2 Bde.; 3. Aufl., Stuttg. 1869), voll ergötzlicher Reminiszenzen aus seiner kaufmännischen Lehrzeit, »Namenlose Geschichten« (das. 1851, 3 Bde.) und »Eugen Stillfried« (das. 1852, 3 Bde.). Hackländers Lustspiel »Der geheime Agent«, bei der von Laube 1850 ausgeschriebenen Konkurrenz mit einem Preis gekrönt (3. Aufl., Stuttg. 1856), wurde auf allen deutschen Bühnen mit Erfolg ausgeführt, auch mehrfach übersetzt. Weniger Glück machten: »Magnetische Kuren« und die Possen: »Schuldig« (1851), »Zur Ruhe setzen« (1857) und »Der verlorne Sohn« (1865). Geteilten Beifall fand sein Roman »Europäisches Sklavenleben« (Stuttg. 1854, 4 Bde.; 4. Aufl. 1876). Mit den »Soldatengeschichten« (das. 1854, 4 Bde.) begann eine gewisse Vielproduktion, in der Wiederholungen unvermeidlich waren, und die zuletzt in manieristische Flüchtigkeit auslief. Wir nennen noch: »Ein Winter in Spanien« (Stuttg. 1855, 2 Bde.), das Resultat einer 1853 nach Spanien unternommenen Reise; »Erlebtes. Kleinere [595] Erzählungen« (das. 1856, 2 Bde.); »Der neue Don Quixote« (das. 1858, 5 Bde.); »Krieg und Frieden« (das. 1859, 2 Bde.); »Der Tannhäuser« (das. 1860, 2 Bde.); »Tag und Nacht« (2, Aufl., das. 1861, 2 Bde.); »Der Wechsel des Lebens« (das. 1861, 3 Bde.); »Tagebuchblätter« (das. 1861, 2 Bde.); »Fürst und Kavalier« (das. 1865); »Künstlerroman« (das. 1866); »Neue Geschichten« (das. 1867); »Hinter blauen Brillen«, Novellen (Wien 1869); »Der letzte Bombardier«, Roman (Stuttg. 1870, 4 Bde.); »Geschichten im Zickzack« (das. 1871, 4 Bde.); »Sorgenlose Stunden in heitern Geschichten« (das. 1871, 2 Bde.); »Der Sturmvogel«, Seeroman (das. 1872, 4 Bde.); »Nullen«, Roman (das. 1873, 3 Bde.); »Verbotene Früchte« (das. 1878, 2 Bde.); »Das Ende der Gräfin Patatzky« (das. 1877); »Reisenovellen« (das. 1877); »Residenzgeschichten« (das. 1877); »Letzte Novellen«, mit seinen ersten literarischen Versuchen (das. 1879) etc. Eine Gesamtausgabe seiner Werke erschien Stuttgart 1855 bis 1874, 60 Bde. (neuer Abdruck 1876); eine Auswahl in 20 Bänden 1881, seitdem auch in illustrierten Ausgaben. Auf journalistischem Gebiet begründete H. 1855 mit Edm. Höfer die »Hausblätter« und 1859 mit Edm. Zoller die illustrierte Wochenschrift »Über Land und Meer«. H. zeigte sich in seinen literarischen Produktionen als eine gesunde und frisch genießende Natur von großer Welt- und Menschenkenntnis, soweit es sich um die Beobachtung der äußerlichen Weltzustände und der äußerlichen Charaktere handelt. Unter seinen größern Romanen zeichnen sich besonders die »Namenlosen Geschichten« und »Eugen Stillfried« durch die Frische aller Farben, die seltene Lebendigkeit der Erzählung vorteilhaft aus. Der Humor Hackländers ist vorwiegend harmlos und gutmütig; nur in einzelnen Romanen, wie im »Europäischen Sklavenleben«, spitzt er sich tendenziös zu. Aus seinem Nachlaß erschien eine interessante Selbstbiographie: »Der Roman meines Lebens« (Stuttg. 1878, 2 Bde.). Vgl. H. Morning, Erinnerungen an Friedr. Wilh. H. (Stuttg. 1878).
Der Augenblick des Glücks
Erstes Kapitel
Beginnt langweilig.
Hat der geneigte und vielgeliebte Leser schon früher erfahren, was Langeweile ist? Es sollte uns freuen, wenn dem so wäre, aber außerordentlich schmerzen, wenn er die Bekanntschaft dieses fünften Elementes, wie jemand die Langeweile genannt, erst durch uns machen sollte. Wenn aber auch der geneigte Leser weiß, was Langeweile ist, so hat er sich doch vielleicht noch nie die Mühe gegeben, dieselbe gründlich zu studieren und in ihren Einzelheiten kennen zu lernen. O, es gibt unendlich viele Abarten von Langerweile! So haben wir die gewöhnliche hausbackene Langerweile, bei der man alt und dick werden kann; wir haben eine stille und sinnige Langeweile nach großen Diners zum Beispiel, die uns wohlthut und angenehm zur Siesta hinüberführt; – wir haben eine ungeduldige Langeweile, wenn wir zwischen vier kahlen Brandmauern auf jemand warten müssen; – wir haben eine beängstigende Langeweile, wenn uns das Krankenzimmer nicht losläßt, wenn draußen alles blüht und duftet, und wenn wir, wie der Bär in seinem Käfig, täglich vierhundertmal den Teppich von rechts nach links und dann wieder von links nachts rechts mit unseren Schritten messen; – wir haben eine tödliche Langeweile, eine ingrimmige, die mit den gefährlichsten Symptomen auftritt und sich vom krampfhaften Händeballen bis zu allerlei Schrecklichem steigern kann, die furchtbare Langeweile nämlich, die uns eine dicke, gemütliche, bekannte Dame verursacht, welcher wir auf der Straße begegnen, die uns aufhält und mit ihrem fetten, strahlenden Gesichte anlächelt, gerade an der Ecke, wo wenige Schritte vor uns die unbekannte Dame verschwand, der wir durch die halbe Stadt folgten. – Da stehen wir, angefesselt voll Kummer und Wut. – Es gibt eine sanfte Langeweile, wenn du in der Ecke des Wagens lehnst, halb schlummernd in den weichen Kissen, eine Langeweile, die mit leichte Fäden hinübergreift in das Reich der Träume, eine süße Langeweile, eine Langeweile, welche so geneigt ist, dir schöne Bilder längst entschwundener Tage lebendig vor die Seele zu zaubern. – Es gibt eine einfache, zweifache, dreifache und vielfache Langeweile. Du kannst dich mit einem Dutzend langweiliger Gesellen aufs gründlichste langweilen. Du kannst dich zu dreien langweilen, aber außerordentlich kannst du dich zu zweien langweilen, und eine solche Langeweile zu zweien kann unter Umständen die schrecklichste werden. – Jemand, der es wissen konnte, hat mir gesagt, es sei das Schrecklichste, wenn ein verliebtes Paar schon vor der Hochzeit anfange, sich gegenseitig zu langweilen; wenn er vom Wetter spricht, und sie das gewisse spitze Maul macht, wobei sich die Nase bedeutend aufbläht, und wodurch man das Gähnen zu verbergen sucht.
Wenn wir uns aber auch erlaubt haben, die vorliegende Geschichte mit Langerweile oder langweilig zu beginnen, so sei es doch fern von uns, gleich das erste Kapitel gerade mit der schrecklichsten Spezies dieser langsam tötenden Macht, einem langweiligen Liebespaare – ein solches mag vielleicht später wohl noch vorkommen –, anzufangen. Da sich aber ein Erzähler der Wahrheit befleißigen soll, und da er die traurige Notwendigkeit einsieht, daß die Geschichte, die er schreiben will, der Situation gemäß langweilig anfangen muß, so kann er nichts thun, als mit traurigem Herzen eben langweilig zu beginnen.
Ja, geneigter Leser, es ist das sehr traurig für einen gewissenhaften Erzähler, denn du hast keine Idee davon, wie wohl es einem Schriftstellergemüt thut, wenn er selbst so – mit gezogenem Säbel, auf kurbettierendem Roß, mit flatternder Feder und spritzender Tinte sein Geschäft vor das Publikum führen und sagen kann: Hier sind wir beide, die Geschichte und ich!
»Es war,« so könnten wir alsdann vielleicht anfangen, »an einem trüben Sommerabend, der Himmel, der eine helle Nacht versprach, hatte sich mit grauen Schleiern überzogen; es wetterleuchtete nicht nur fern am Horizonte, sondern auch auf dem Gesichte des jungen Freiherrn Kalb von Kalbsfell, der usw•, usw•« – Stand er nun am Fenster seines Schlosses, oder lehnte er an einer dicken Buche, wir wissen, daß es auf seinem Gesichte ebenfalls wetterleuchtete, und daß seine schöne Physiognomie der Beweglichkeit fähig und auch im stande war, fremde Eindrücke widerzuspiegeln.
Wohlthuend ist es auch, wenn es uns erlaubt ist, sagen zu dürfen: »Dem Morgen entgegen, der sich rosig ausbreitete über Berg und Thal, rollte ein eleganter Reisewagen, und der junge, schöne, blondgelockte Mann in demselben blies die Wolken seiner echten Havana mit einem unendlichen Behagen vor sich hin, die grauen kräuselnden Wolken, die, höher und höher aufsteigend, jetzt vom ersten Strahl der Sonne getroffen und vergoldet wurden.«
»Kreuztausend Schock Millionen Donnerwetter!« rief der Lieutenant von Sperberbach, als er morgens in der Frühe erwachte und zu seinem großen Schrecken entdeckte, daß er den Ausmarsch der Regiments verschlafen – das ist auch ein schöner Anfang!
Nicht minder:
»Mama,« sprach Luise.
»Mein Kind?« meinte die Mutter.
»Ich sah ihn wieder nicht im Theater.«
Die Mutter unterdrückte einen leichten Seufzer.
»Auch nicht auf der Promenade.«
»Du hast nicht recht gesehen.«
»Die Blicke der Liebe sind scharf, Mama.«
»Gott weiß es, mein armes Kind!«
»Auch ritt er nicht vorbei.«
»Gute Luise!«
»O, meine Mutter!«
Dann seufzten beide aus tiefem Herzen, und das Zimmer wäre mit einer unheimlichen Stille erfüllt gewesen, hätten sich nicht in diesem Augenblicke vor dem Hause die Töne einer Straßenorgel vernehmen lassen, kräftig, laut und feierlich:
Noch ist Polen nicht verloren – – – – –
Ein zweifacher Trost für das wunde Gemüt von Mutter und Tochter.
– – Das alles, wenigstens etwas Ähnliches, geneigter Leser, hätten wir zu Anfang dieser wahrhaftigen Geschichte auch sagen können. Aber es sei ferne von uns, dich auf solche Art bestechen zu wollen und unpassend zu beginnen.
Wir führen dich der Wahrheit gemäß in ein großes, elegantes Gemach, man könnte es einen kleinen Saal nennen, reich dekoriert, reich möbliert. Die Wände sind mit hellen, glänzenden Seidentapeten bedeckt und zeigen schwere, trotzige, goldene Bilderrahmen mit prachtvollen Landschaften, Schlacht- und Seestücken. Die Lambrien sind von feinen eingelegten Holzarten und laufen ringsumher bis zu einem riesenhaften Marmorkamin, in dem aber kein Feuer brannte, und über welchem ein ungeheurer Spiegel sich bis hoch an den vergoldeten Fries erstreckt, der unter dem Plafond dahinläuft. Dieser Plafond ist reich bemalt und in seiner Mitte hängt ein schwerer Bronzelüster mit unzähligen aufgesteckten Wachskerzen; der parkettierte Fußboden ist spiegelblank und das Ameublement, wie wir schon vorhin bemerkten, wenn auch reich, doch sehr einfach: es besteht aus einem Dutzend Stühlen, welche an den Wänden umherstehen, und einem großen Tische in der Mitte des Gemachs. – Richtig, dort in den beiden Fenstervertiefungen, welche die dicken Mauern des Schlosses bilden, stehen noch zwei Fauteuils und vor einem derselben ein kleines Tischchen mit Papier und Schreibzeug.
Wir sind im Schlosse des Regenten im Parterrestockwerke; die Fenster unseres Gemaches gehen auf einen umschlossenen Hof, und die Ruhe und Stille, welche dort, sowie in den hohem Korridoren und auf den breiten Treppen herrscht, lagert beängstigend vor Thür und Fenster; sie läßt sich nur ungern stören und unterbrechen, und wenn man von fernher Tritte eines menschlichen Fußes vernimmt oder jemand husten hört, so grollt die Stille darüber und äfft diese Töne mit lautem Echo nach
In dem weiten Gemache befinden sich zwei junge Männer, von denen der eine, ein Ordonnanzoffizier aus dem Leibdragonerregiment des Regenten, mit festgehaltenem Säbel an den Fenstern auf und ab spaziert, während der andere im goldgestickten Frack der Kammerherren dasselbe auf der Seite des Kamines thut. Beide sind vielleicht wenig über zwanzig Jahre alt, und wenn sich der eine so gut wie der andere entsetzlich zu langweilen scheint, so äußert sich das doch bei jedem auf verschiedene Art.
Der Kammerherr von Wenden, ein Mann von mittlerer Größe mit Anlage zur Beleibtheit, hatte blondes Haar, das er glatt an den Kopf gestrichen trug, und welches so zum sorgfältig glattrasierten Kinn und Wange sehr gut paßte, ja seinem Kopfe mit der spitzen Nase, dem feinen zusammengezogenen Munde und den lebhaften Augen etwas Schlaues, fast Lauerndes gab, welches aber durch ein wirklich liebenswürdiges Lächeln gemildert wurde, das sein Gesicht, mit außerordentlich feinem und weißem Teint, häufig erhellte. Er spazierte in dem Gemache auf und ab, den Hut unter dem Arm, die Hände auf dem Rücken vereinigt. Dabei ging er aber vollkommen ruhig und gleichmäßig, ja mit fast behaglichen, tänzelnden Schritten, ohne alle Zeichen von Ungeduld, als habe er sich zur Aufgabe gemacht, das Zimmer in jeder Viertelstunde so und so oft zu durchschreiten.
Der andere, Ordonnanzoffizier Herr von Fernow, war größer als sein Gefährte, dabei schlank, und wenn er ebenfalls auf und ab schritt, so that er dies mit allen möglichen Zeichen der Ungeduld. Er hatte ein ausdrucksvolles Gesicht, dessen Farbe fast zu dunkel gewesen, wenn nicht das schwarze glänzende Haar so vortrefflich dazu gepaßt hätte. Die Augen waren keck und lebhaft, und den Schnurrbart trug er wohl deshalb so außerordentlich stark emporgedreht, um seinen kleinen Mund zu zeigen, sowie die schneeweißen wohlgeformten Zähne.
Wie wir schon bemerkt, ging er ebenfalls, und zwar an der Seite der Fenster, auf und ab; doch war das kein gleichförmiges Dahinschreiten. Jetzt that er ein paar hastige Schritte, dann wandte er sein Gesicht, einen Augenblick stehen bleibend, nach dem Hofe zu, betrachtete hierauf seinen Gefährten, warf den Kopf heftig von einer auf die andere Seite, biß sich zuweilen auf die Lippen und strich den Schnurrbart in die Höhe, zuweilen summte oder pfiff er auch leise die Melodie irgend eines beliebigen Liedes, aber immer nur ein paar Takte, die mit einem laut ausgestoßenen A-a-a-ah! schlossen, und an welche gewöhnlich die Bemerkung angehängt war: »So ein Sonntagnachmittag hier in dem verwünschten Schlosse ist doch von einer bodenlosen Langenweile!«
Der Kammerherr lächelte dazu sanft in sich hinein und sagte vielleicht: »Ja, ja, ich habe auch schon Amüsanteres erlebt.«
»Wenn ich nur dein Temperament hätte,« fuhr Herr von Fernow nach einer Pause fort, wobei er so plötzlich stehen blieb, daß die Scheide seines Säbels mit den Schnallen seines Ledergehänges zusammenklirrte, »wahrhaftig ich wüßte nicht, was ich an solchen Diensttagen, wie der heutige, darum gäbe.«
»Auch an anderen könnte dir ein bißchen mehr Ruhe nicht schaden,« meinte Herr von Wenden; »du bist ein guter Kerl, aber das kocht und siedet und sprudelt immer, und, um in meinem Küchengleichnis fortzufahren, läuft es zuweilen über, nicht gerade zur Annehmlichkeit deiner Umgebung.«
»A-a-a-ah!« machte der Ordonnanzoffizier, und dabei dehnte er sich wie einer, der eben aus dem Schlafe erwacht.
»Du mußt dir angewöhnen,« fuhr der Kammerherr fort, »über die Langeweile Herr zu werden, du bist nun einmal bei Hof, und wenn du hier auf dem glatten Boden was werden willst, so darf man dir keine Langeweile anmerken, und wenn du einmal vier Wochen lang wie heute im Dienst wärest, eine Beschäftigung, die allerdings ihre langweiligen Seiten hat . . .«
»So lehre mich die Langeweile verjagen!« rief der andere ungeduldig; »entweder verstehst du in der That diese Kunst, oder du bist ein ausgemachter Heuchler; denn schon seit fast einer Stunde läufst du jetzt auf und ab, auf dem Gesicht inneres Vergnügen, ja mit einem Wohlbehagen, das mich zur Verzweiflung bringen kann. – – Gibt es in der That etwas Langweiligeres als der heutige Sonntagnachmittag? Liegt das Schloß nicht so still wie ein ausgestorbenes Kloster? Dort in dem verfluchten Hofe läßt sich keine Menschenseele sehen, ja, ich versichere dich, die Katzen fürchten vor Langerweile zu krepieren, deshalb bleiben sie auf ihren Dächern und keine wagt sich herunter. – – Sage mir, womit verbringst du deine Zeit?«
»Ich denke über dies oder jenes nach,« antwortete der Kammerherr, »und dabei verliere ich mich in Reflexionen und Kombinationen, daß mir die Zeit so ziemlich leidlich vergeht.«
Der Adjutant hatte in seinem Spaziergange innegehalten und sich mit allen Zeichen der Ungeduld in einen der Fauteuils geworfen, und beschäftigte sich, indem er mit den Fingern auf den vor ihm liegenden Papieren trommelte.
»So teile mir denn ums Himmels willen etwas von deinen Gedanken mit,« rief er nach einer Weile; »wenn sie nämlich für mich genießbar sind. Wahrhaftig, du bist beneidenswert um das Talent, dich so allein unterhalten zu können.«
»Und dabei profitiere ich; denn in solchen Stunden fasse ich oftmals die besten Entschlüsse, und wenn ich gerade dergleichen nicht vorhabe, so unterhalte ich mich mit meinen Phantasien, baue Luftschlösser und beratschlage mit mir selbst, was, wenn dieser oder jener Fall eintreten würde, wohl am besten zu thun sei.«
»Ja, das muß wahr sein,« sagte der andere mit einem tiefen Seufzer. »Du bist ein umsichtiger Mensch, du wirst es weit bringen. Nun, eins mußt du mir versprechen: Wenn du einmal Minister des Hauses bist, so laß mir irgend einen lumpigen Orden zukommen; denn wenn ich keinen Freund habe, der sich meiner speziell annimmt, so komme ich doch nicht zu einer Auszeichnung. Ich habe eben kein Glück.«
Der Kammerherr lächelte still in sich hinein, streichelte sanft seine Nase und blies alsdann ein Stäubchen fort, das sich auf der Goldstickerei seines Ärmelaufschlages angesetzt hatte. Darauf sagte er:
»Kein Glück haben, das ist so eine Redensart, die man hundertfältig und meistens mit großem Unrecht ausspricht.«
»Nun, du willst doch nicht sagen, daß ich vom Glück begünstigt bin, ich, Fernow, dessen Vater vor wenigen Jahren noch allmächtiger Minister an diesem Hofe war?«
»Fernow,« fuhr der Kammerherr kopfnickend fort, »ein Kavalier in der schönen Bedeutung des Wortes, jung – liebenswürdig – ohne dir Komplimente machen zu wollen,« setzte er lächelnd mit einem Seitenblick hinzu; »denn du kannst auch unausstehlich sein. – Dabei ein tüchtiger Offizier –«
»Meinetwegen alles das!« rief der andere ungeduldig dazwischen; »der jetzt schon eine halbe Ewigkeit dient und es kaum zum Ordonnanzoffizier gebracht hat, während jüngere Kameraden schon längst wirkliche Adjutanten sind. Hol der Teufel ein solches Glück!«
»Wenn du nicht gleich immer oben hinaus wärst,« entgegnete Herr von Wenden mit großer Ruhe, »so würde ich dir mit außerordentlichem Vergnügen meine Theorien von der Gestaltung des Glückes mitteilen; aber ich fürchte, dir ist das langweilig.«
»Wenn das ist,« sagte Herr von Fernow, »so wirkt es vielleicht homöopathisch, und wir schlagen die Langeweile mit der Langeweile.«
»Ich danke dir für die gütige Bemerkung.«
»Ohne Rancüne; ich bitte dich, laß mich deine Ansichten hören.«
Der Kammerherr war in der Nähe des Kamins stehen geblieben, hatte seinen Hut auf das Gesims desselben gelegt und sich mit dem Rücken daran gelehnt.
»Du sagtest vorhin,« begann er: »Ich habe kein Glück, und, wie schon bemerkt, ist das eine Äußerung, die man hundertfältig hört, die aber vollkommen unrichtig ist. So gut es allerdings bevorzugte Menschen gibt, denen das Glück sozusagen im Schlafe kommt . . .«
»Ja, denen die gebratenen Tauben ins Maul fliegen.«
»Ganz richtig, die selbst, wenn sie stürzen, wie die Katze immer auf ihre Füße fallen und, ausgleitend, die Treppe hinaufrollen; ebenso gibt es auch solche, die das Schicksal beständig gegen den Strich zu kämmen scheint, die sich alles mühsam erringen müssen, denen nichts gelingt ohne große Mühe und Arbeit, kurz, die, wie du zu sagen beliebst, kein Glück haben.«
»Ich kenne einen solchen,« sagte Fernow finster, »und das wirst du mir zugeben. Kommt einmal eine Gelegenheit, sich auszuzeichnen, so bin ich verhindert, dabei zu sein. Ist irgendwo in einem Regiment ein gutes Avancement, so kannst du hundert gegen eins wetten, daß es nicht das meinige ist. Haben wir Besuch von fürstlichen Personen, so kann ich nicht dazu kommandiert werden, weil ich gerade Dienst beim Allergnädigsten habe. Ebenso ist es mit Reisen an fremde Höfe; ich weiß wohl, man hat nichts gegen mich, aber das Schicksal will, daß ich immer übergangen werde. Andere bekommen Orden und sehen die Welt, ich bekomme gar nichts und darf mir dagegen die Wände des Stallhofes dort, und meistens dann betrachten, wenn irgendwo sonst draußen was Angenehmes los ist. Heute ist der Hof nach Eschenburg, und ich hatte mich darauf gefreut, ich versichere dir, ich hätte auf meinem Rappen gar nicht schlecht ausgesehen, – ach! und es hätte mich gerade jetzt glücklich gemacht, gut auszusehen!« fuhr er mit einem Seufzer fort. »Was geschieht? Seine Hoheit, der Regent, findet es angemessen, daß ihn die verjährte Wunde schmerzt, und ich – muß, hol mich der Teufel, zu Hause bleiben.«
»Und ich?« fragte lächelnd der Kammerherr.
»Allerdings, du auch. Aber dir macht es kein Vergnügen, mit irgend einer alten Hofdame im Wagen zu sitzen. O! ich sage dir,« fuhr er ergrimmt fort, »wenn ich daran denke, daß ich jetzt durchs duftige Grün reiten könnte, vielleicht an ihrer Seite, denn auch für die junge Herzogin und ihre Damen sind Pferde hinausbestellt, so möchte ich geradezu des Teufels werden!«
Bei diesen Worten sprang er in die Höhe und eilte sporenklirrend und säbelrasselnd mit heftigen Schritten auf und ab, daß es in dem weiten Gemach auf allen Seiten widerhallte. Nachdem er so einigemal bei dem Kammerherrn, der ihm lächelnd zuschaute, vorbeigerast war, blieb er wieder plötzlich vor ihm stehen, streckte ihm beide Hände entgegen und sagte mit einem bittern Lächeln:
»Und dann willst du mir noch verbieten, daß ich von mir als von jemand spreche, der gar kein Glück hat?«
»Allerdings,« entgegnete der andere hartnäckig, »von dir und von jedem anderen glaube ich das Gegenteil. Das Glück ist da; es umschwebt jeden Menschen ...«
»Wo, wo?« rief Herr von Fernow mit komischem Zorne; »ich will Tag und Nacht mit beiden Händen um mich fassen, um es endlich einmal zu ergreifen.«
»Das wäre vielleicht so ein Mittel,« meinte lächelnd Herr von Wenden; »aber glaube mir, meine Theorie ist richtig; das Glück umschwebt, umtanzt, umgaukelt uns, den einen freilich mehr, den anderen weniger, und wenn ich dir von deiner Bemerkung, indem du von Leuten sprachst, die kein Glück haben, etwas zugeben will, so ist es das, daß leider die meisten Menschen so unglücklich sind, den rechten Augenblick zu verpassen, wo sie zulangen müßten.«
»Nun, das kommt am Ende auf eins heraus,« sagte kopfschüttelnd der Ordonnanzoffizier, worauf er, nach einem Blicke in den Spiegel, einige Verschönerungsversuche bei sich anstellte, den Schnurrbart in die Höhe drehte und seiner ohnedies langen und schlanken Taille noch dadurch nachhalf, daß er Schärpe und Säbelkoppel, soviel als irgend möglich war, auf die Hüften hinabdrückte.
An dem Kammerherrn war unfehlbar ein Professor zu Grunde gegangen, denn er lehnte, um seine Theorie weiter auszuführen, so behaglich am Kamine, wie jener am Katheder, und blickte so aufmerksam in das fast leere Gemach hinein, als habe er ein Auditorium von vielleicht hundert Personen vor sich. Auch hob er seine Hände empor und legte den Zeigefinger der rechten bedeutsam an den Daumen der linken, um die Beweisgründe für seine Theorie vermittelst der fünf Finger numerieren zu können.
»Also wir waren beim Zugreifen,« sagte er.
»Nur nicht blöde! Das ist allerdings bei Hofe eine wichtige Regel.«
»Die Zeit, wo uns Fortuna lächelt, und sie lächelt jedem Menschen, würde ich mir also erlauben den Augenblick des Glückes zu nennen, denn leider verweilt es gewöhnlich nicht lange bei uns, es huscht rechts, links, oben, unten bei uns vorbei. Deshalb im richtigem Moment zugreifen!«
»Ja, zugreifen!« wiederholte lachend der Ordonnanzoffizier, indem er mit der Rechten in der Luft eine Bewegung machte, als wollte er eine Fliege fangen. »Fang einer die unsichtbare Göttin!«
»Allerdings will es das Mißgeschick,« fuhr der dozierende Kammerherr ruhig fort, »daß man, um in meinem Vortrage zu Punkt zwei zu kommen, daneben tappt,« bei diesen Worten hatten sich beide Zeigefinger seiner Hände vereinigt; »und es ist wahrhaftig oft gerade, als ob es Menschen gebe, die ein Talent dazu hätten, dem Glück auf die geschickteste Art auszuweichen. Es erscheint dir links ...«
»Und ich wende mich rechts,« sagte Herr von Fernow.
»Richtig. Es erscheint dir rechts ...«
»Und ich greife nach links; o, wir kennen das!«
»Vollkommen richtig. – Es stellt sich dir gerade in den Weg, und, weiß der Himmel, in demselben Augenblick fällt es dir ein, dich umzudrehen, zurückzutreten und so dem Glücke, das mit ausgebreiteten Armen auf deinem Pfade steht, den Rücken zuzuwenden. Ja, es legt sich dir vor die Füße; aber anstatt es aufzuheben, wähnst du vor dir einen tiefen Graben zu sehen und schreitest mit einem ungeheuren Schritte darüber hinweg.«
»Das ist leider Gottes nicht ganz unrichtig!« rief der andere; »doch ist deine Theorie offenbar darauf eingerichtet, die Leute verrückt zu machen. Geh mir mit deinem Philosophieren; es ist mir ein viel behaglicheres Gefühl, zu wissen: ich habe einmal kein Glück, als zu glauben, es gaukle um mich her unsichtbar, unerreichbar, wobei ich mir jeden Augenblick den Vorwurf machen muß: Hättest du statt rechts – links gegriffen, hättest du dies gethan oder jenes unterlassen, so würdest du jetzt das Glück in deiner Hand haben. Ah! das ist ein unerträglicher Gedanke und könnte einen Menschen wirbelig machen.«
Der Kammerherr war eben im Begriff mit dem Zeigefinger der Rechten auf den Mittelfinger der Linken überzugehen, als sich eine der Flügelthüren geräuschlos, fast gespensterhaft, von selbst zu öffnen schien, so daß sich erst, als beide Flügel weit offen standen, der dienstthuende Kammerdiener zeigte, ein großer, gutgewachsener Mann, auf dem Gesicht ein ewiges Lächeln, mit sanft gespitztem Munde, und Augen, die, solange er sich im Dienste befand, in Glück und Freude zu schwimmen schienen. Er blickte nach der Uhr, welche über der Thür angebracht war, und sagte unter einem sanften Lächeln:
»Seine Hoheit, der Regent, machen soeben einen kleinen Gang in den Park, werden auch vor der Tafel nicht zurückkehren, was ich mir hiermit erlaube anzuzeigen und die ganz gehorsame Bemerkung hinzuzufügen, daß es vielleicht für die Herrschaften angenehmer wäre, jetzt schon in den Speisesaal zu treten, als hier im Hinterzimmer vergeblich zu warten.«
Indem er das sagte, machte er eine demütige, lang andauernde, tiefe Verbeugung, wobei er sich schüchtern die Hände rieb, damit eine scheinbare Verlegenheit affektierend.
»Das ist ein guter Rat, Herr Kindermann,« sprach der Ordonnanzoffizier, indem er seinen Federhut ergriff; »vom Speisesaal hat man doch eine Aussicht auf den Schloßplatz, man sieht Sonne und Menschen, grüne Bäume und die fernen Berge, an denen Eschenburg liegt.«
Das letztere sagte er leise und mit einem gelinden Seufzer.
»Es ist doch fabelhaft,« lachte der Kammerherr, »wie dich ein einigermaßen ernstes Gespräch ennuyiert! Und ich versichere dir, du hättest etwas aus meinem Vortrage lernen können.«
»Das will ich auch noch thun, gewiß und wahrhaftig,« sagte der Ordonnanzoffizier; »aber jetzt komm aus diesem stillen, trübseligen Zimmer in den Speisesaal, da werde ich viel empfänglicher sein für die tiefen Gedanken, die du mir so großmütig preisgibst.«
Lächelnd, aber doch achselzuckend nahm der Kammerherr seinen Hut von dem Kamingesims, und der Kammerdiener Kindermann, der zuerst verstohlen eine Prise genommen und sich dann, wie selbst erschrocken über dies große Vergehen, eilfertig die Nase gewischt, ging mit sehr erhobenem Kopfe auf die Ausgangsthür zu, öffnete dieselbe weit und machte eine tiefe Verbeugung, als die Herren in das Vestibül hinaustraten.
Hier saß auf einem Bankett in der Ecke ein einsamer Lakai, der, niedergedrückt von Stille und Langerweile, sanft entschlummert war, jetzt aber, beim Hören der herannahenden Schritte, so eilfertig aufsprang und ein so grinsendes Gesicht machte, als habe er sich aufs lebhafteste mit den interessantesten Dingen der Welt unterhalten, und als sei es ihm gar nicht eingefallen, das Auge zum Schlafe zu schließen. Als ihn aber die beiden Herren hinter sich gelassen hatten, gähnte er stark, dehnte und reckte sich und brummte mißmutig in sich hinein:
»Nicht einen Augenblick Ruhe hat man in dem Schloß!«
Darauf sank er wieder auf das Bankett zurück und setzte unter tiefen, schnarchenden Tönen seine Betrachtungen von vorhin fort.
Am Ende des Vestibüls trafen die beiden Herren auf einen einzelnen Kavallerieposten, der ebenfalls schläfrig auf und ab spazierte und nicht einmal mit der gewöhnlichen Energie seinen Säbel anzog.
Es lag aber auch eine wahrhaft drückende Ruhe auf dem Schlosse; die Stille und die Langeweile tönten ordentlich. In den weiten Gängen und auf den breiten Treppen entdeckte man selten ein lebendes Wesen, und wo sich in weiter Entfernung vielleicht ein Tier, eine Katze, oder vor den Fenstern ein Vogel blicken ließ, da ruhte der erstere jedenfalls mit aufgestütztem Kopf an der Fensterbank, die Katze lag schlafend in einem kleinen Fleckchen Sonnenschein, und der sonst so muntere Vogel saß draußen auf dem zackigen Gesims still, fast unbeweglich, mit gesenktem Kopfe, als finde selbst er es hier unerträglich langweilig. Die einzige Spur von Leben ließ hier und da die Katze bemerken, denn zuweilen öffnete sie träge ihr blinzelndes Auge und schmachtete, vielleicht mit unterschiedlichen Gedanken an eine fette Beute, nach dem Vogel hin. Wenn aber auch beide nicht durch die Glasscheibe getrennt gewesen wären, hätte die Katze wahrscheinlich doch nicht ihre Siesta unterbrochen, um einen Sprung nach der sicheren Beute zu thun. Sie dehnte sich schnurrend und schien dann wieder in festen Schlaf zu fallen.
Wenn auch die Teppichstreifen in den Korridoren den Klang der Schritte der beiden dämpften, so tönten doch der klirrende Säbel des einen und das gelinde Husten des anderen so laut und nachhaltig, daß es in der That erschreckend war. Aus diesem Korridor traten sie in weite Säle, wo von den Wänden aus schweren Goldrahmen nachgedunkelte, fast schwarze Landschaften herabblickten, wo in den Ecken uralte, ernsthafte Vasen standen, und wo es ebenfalls so still und feierlich war, daß das Lächeln einer marmornen Venus in dieser Umgebung völlig unnatürlich erschien.
Endlich erreichten die beiden Gänge und Zimmer, auf der westlichen Seite des Schlosses gelegen, wo es schon ungleich freundlicher und behaglicher aussah; hier drang zu den großen Fenstern die Nachmittagssonne herein, vergoldete und belebte alles und munterte selbst den schweren Staub in den Zimmern zur Lustigkeit auf; denn wo ein dünner Sonnenstrahl schief zu einer Öffnung hereinfiel, da tanzten Millionen von Staubatomen vergnügt durcheinander. Hier hingen auch in einer langen Galerie die Ahnen des Herrscherhauses, und die glänzenden Streiflichter machten sich ein Vergnügen daraus, die alten, ernsten Herren auf eigentümliche Art zu karikieren. Dort brannte ein heller Fleck auf den dunklen Wangen des Kriegsmanns, hier war ein Gesicht zur Hälfte scharf beleuchtet und schien dadurch auf einer Seite zu lächeln. Dort sah man nur einen glänzenden Kopf, wie in dunklem Beiwerk schwebend, und in einer Ecke gegenüber bemerkte man einen hellen, funkelnden Harnisch. Das Haupt aber lag so im Schatten, daß der alte, ehrwürdige Fürst völlig kopflos erschien.
Die beiden dienstthuenden Herren näherten sich jetzt der Thür des Speisesaals, welche sich trotz ihrer geräuschlosen Schritte und wie von selbst ihnen öffnete. Doch muß der geneigte Leser nicht an Zauberei glauben; wie anderswo überall, befinden sich auch hier in den Thüren Schlüssellöcher, welche von den betreffenden Lakaien aufs emsigste benutzt werden, um die Annäherung irgend einer wichtigen Person zu erspähen. Es ist das namentlich in bedeutsamen Augenblicken wie ein gut eingerichteter Telegraphendienst; an beiden Seiten des betreffenden Saales wird mit Thürspalt und Schlüsselloch gearbeitet; ein leiser, bezeichnender Husten oder irgend eine Handbewegung unterrichtet die im Saale Befindlichen von der Ankunft dieser und jener Person, und wenn diese nun selbst durch die weitgeöffnete Thür eintritt, so stehen ein gut geschulter Kammerdiener und brauchbare Lakaien scheinbar unbefangen, und wie von den Ankommenden völlig überrascht, in den verschiedenen Ecken.
Zweites Kapitel.
Ein kleiner Papierstreifen.
Der Speisesaal, ein großes, einfach nur mit Gold und Weiß dekoriertes Gemach, lag an dem großen Platze, der sich vor dem Schlosse ausbreitete, und von seinen hohen Fenstern hatte man, da das Schloß auf einer kleinen Anhöhe lag, eine weite Aussicht auf die Stadt, sowie auf die Gegend ringsumher bis zu den malerisch geformten Bergen, die den Horizont begrenzten. Herr von Fernow trat sogleich an eines der Fenster und schmachtete, wie sich der Kammerherr auszudrücken beliebte, nach dem Gebirgszuge hin, ohne vorderhand dem regen Treiben auf dem Schloßplatz und in den angrenzenden Straßen, dem Gewühle von Menschen und Equipagen irgend eine Aufmerksamkeit zu widmen. Im Saale waren Tafeldecker, Kammerdiener und Lakaien beschäftigt, der reichen Tafel die letzte Vollendung zu geben. Der große vergoldete Aufsatz, der bei bedeutenden Diners erschien, wurde mit frischen Blumenbouquets bedeckt, und als das geschehen war, bot die Tafel mit ihren Massen funkelnden Silbers und glänzenden Krystallbatterien, auf den schneeweißen Damast gestellt, einen wahrhaft reichen und erfreulichen Anblick dar.
Herr von Wenden war zu dem Ordonnanzoffizier getreten und sagte ihm: »Mir ist das Durcheinanderlaufen der Dienerschaft, überhaupt die Zurüstung zur Tafel unangenehm, und da du, teuerster junger Mann, auch Kavallerieoffizier, die Berge vom Nebensaale aus ebensogut betrachten kannst, so laß uns dorthin, mein Geliebter, ziehen. Es ist da in der That behaglicher und auch unser Platz, wenn sich später der Hof versammelt.«
»Ich weiß wohl,« entgegnete lächelnd der Ordonnanzoffizier, »weshalb es dir um den Saal da nebenan zu thun ist; du willst mir wahrscheinlich deine Theorie vom Augenblicke des Glücks noch näher entwickeln. Wenn ich nicht irre, so wurden wir am dritten Punkt unterbrochen.«
Der Kammerherr zog scheinbar ernsthaft seine Augenbrauen in die Höhe, spitzte den Mund und erwiderte:
»Du bist in der That ein undankbares Geschöpf; sei doch empfänglich für gute Lehren. Danke es mir, wenn ich dir die Augen öffne.«
»Damit ich mich, wenn ich deinem Rat folge, wie eine Wetterfahne bald rechts, bald links drehe, bald hierher, bald dorthin greife, um das Glück zu erhaschen?« sagte Herr von Fernow; »aber meinetwegen komm, du hast recht, wir befinden uns da nebenan viel behaglicher.«
Damit schob er seinen Arm unter den des Kammerherrn und beide wandten sich zum Weggehen. Bei dieser Bewegung glitten ein paar der Lakaien wie auf Schlittschuhen gegen die großen Flügelthüren des Nebenzimmers; diese öffneten sich geräuschlos vor ihnen und schlossen sich ebenso wieder. Das Gemach, in welchem sie sich nun befanden, war in der That ein reicher und herrlicher Salon; die Wände waren mit grauem Seidenzeug bezogen, auf welchem Meisterwerke der Malerei hingen; in den zwei Ecken gegenüber dem Fenster standen zwischen grünen Pflanzen und duftenden Blüten kleine herrliche Marmorstatuen, und vor dem Kamine aus weißem karrarischen Marmor befand sich eine Art kleiner, niedlicher spanischer Wand, das Gestell von Palisander und die Felder ebenfalls aus schwerem grünen Seidenzeuge, auf welche Flächen eine kunstreiche Hand zierliche Arabesken gestickt hatte. Auf dem Boden breitete sich ein dicker Smyrnateppich aus, in den der Fuß des darauf Wandelnden ordentlich einsank. – Das Ameublement bestand ebenfalls aus dem gleichen Holz wie die spanische Wand, und hier sah man Tische, Etageren mit kostbar eingebundenen Büchern und Albums, Sessel und Fauteuils der verschiedensten Größe und Gestalt. In allem aber, was sich hier befand, herrschte ein so feiner und zarter Geschmack, ein so sinniges Arrangement, daß unverkennbar der Geist und die Hand einer Dame hier thätig sein mußten.
Und so war es auch. Dieses Gemach verband den Speisesaal mit dem Appartement der Prinzessin Elise, der Schwägerin des kürzlich verstorbenen regierenden Herzogs. Die verwitwete Herzogin bewohnte den südlichen Flügel des Schlosses, und im Parterrestocke, wo unsere Geschichte beginnt, waren die Gemächer des Regenten, der, ein Onkel des verstorbenen Herzogs, im jetzigen Augenblicke das Haupt der Familie und der Herrscher des Landes war. Wir sagen: im jetzigen Augenblicke; denn die verwitwete Herzogin befand sich in interessanten Umständen, und die wichtige Frage war, ob die arme, unglückliche Frau einem Prinzen oder einer Prinzessin das Leben geben würde; im ersten Fall war ein rechtmäßiger Thronerbe da, im anderen dagegen wurde der Regent, dem salischen Gesetz zufolge, regierender Herzog des Landes.
Daß unter diesen Verhältnissen der Hof in zwei große Parteien gespalten war, ja, daß diese erbittert und feindlich einander gegenüberstanden, brauchen wir eigentlich ebensowenig zu sagen, als mit welch namenloser Spannung Land und Hof der Niederkunft der verwitweten Herzogin entgegensah.
Während der Ordonnanzoffizier ans Fenster trat, um jetzt auch dem Gewühl auf dem Schloßplatz einen Blick zu schenken, blieb der Kammerherr an der geschlossenen Thür stehen, stemmte beide Arme in die Seiten und sagte, bedeutsam mit dem Kopfe nickend:
»So oft ich dieses Zimmer in der jetzigen schweren Zeit betrete, sehe ich immer Ihre Durchlaucht, die Prinzessin Elise, vor mir, wie sie auf und ab wandelt und in ihrem kleinen, aber sehr gescheiten Kopfe Pläne und Entwürfe ausbrütet. Es ist ein Jammer, daß sie eine Dame und kein Mann ist, ich sage dir, Felix, das ist jammerschade. An ihr hätten wir einen ganz prachtvollen Herzog.«
»Ja, ja, das wäre dir schon erwünscht,« entgegnete der Ordonnanzoffizier, »und dann brauchst du nicht mehr lange nach dem Glück zu greifen. Die Prinzessin will dir außerordentlich wohl.«
»Nicht außerordentlich; doch kennt sie meine Anhänglichkeit.«
»Das ist auch eine von den bösen Geschichten an diesem Hofe. Man weiß in der That nicht, zu wem man halten soll. Ist man dort zu freundlich, macht man sich hier mißliebig oder umgekehrt. Weißt du auch,« fuhr Herr von Fernow fort, indem er sich rasch umwandte, »was ich davon habe, daß ich als Ordonnanzoffizier im Vorzimmer Seiner Hoheit stehen darf?«
»Nun, was wirst du davon haben?«
»Davon habe ich, daß mich Ihre Durchlaucht, die Prinzessin Elise, nicht allzu freundlich behandelt. – Nun, das wechselt und ließe sich am Ende noch ertragen; aber glaubst du wohl, Eduard, daß das auch auf mein Verhältnis zur – « der Kammerherr sah fragend und mit einem eigentümlichen Lächeln in die Höhe. – »Nun ja, Verhältnis sollte ich eigentlich nicht sagen; ich meine daß diese Ungnade auf meine Liebe zu Fräulein von Ripperda bedeutend influiert. – Schüttle nicht deinen blonden Kopf; – alle Teufel! ich weiß, was ich fühle und sehe. – Nicht wahr, der Oberstjägermeister wurde eigens zur Partie nach Eschenburg eingeladen, obgleich er nichts dabei verloren hätte. Ich habe eigentlich nicht nötig, es dir zu sagen, umsichtiger Kammerherr. Wenn man einen armen Ordonnanzoffizier protegieren will, so braucht man nur nach dem Frühstück ungefähr so zu sprechen: Sie werden doch auch mit uns reiten? – Hätte das die Prinzessin Elise gesagt, so wäre ich vor den Regenten hingetreten und hätte ihm zu verstehen gegeben, ich sei zur Partie befohlen worden.«
»Daran ist was Wahres; doch warst du vielleicht gegen die Prinzessin nicht liebenswürdig genug, oder hast dem Oberstjägermeister boudiert, oder gar zu süße Augen gegen Fräulein von Ripperda gemacht, das war vielleicht ein Augenblick des Glücks, den du versäumt.«
»Hol dich der Teufel mit deinen Augenblicken des Glücks!« entgegnete unmutig der Offizier; »wenn es so schwer ist, dasselbe zu fassen – so werde ich es niemals erlangen,« setzte er seufzend hinzu.
Der Kammerherr wackelte mit dem Kopfe hin und her, wie eine indische Pagode. »Hm, hm,« machte er, »ja, ja, freilich, freilich. Ich sage dir, Felix, in den merkwürdigen Verhältnissen, in denen wir uns gerade befinden, könnte das Glück wohl geneigt sein, sich diesem oder jenem völlig zudringlich zu nähern. Man muß nur klug sein und keine Fehltritte thun.«
»Was die Klugheit anbelangt, – da stehe ich dir allerdings nach.«
»O, du verstehst ja auch deinen Vorteil.«
»Nicht besonders. Soll ich dir wiederholen, was ich meinem Stande, meinen Jahren nach sein könnte, und was ich bin?«
Der andere zuckte mit den Achseln.
»Allerdings,« sagte er nach einer Pause, »aber warum,« setzte er mit leiser Stimme hinzu, »bist du nicht schon längst meinem Winke gefolgt und hast deine volle Ergebenheit der Herzogin zu Füßen gelegt?«
»Vor allen Dingen bin ich Soldat und Offizier,« antwortete Herr von Fernow verdrießlich, »und als solcher kann ich nur einen Herrn anerkennen.«
»Gott bewahre uns auch vor zweien!«
»Seine Hoheit, den Regenten, meinen Fürsten und General. – Wenn du aber deshalb glaubst,« fuhr der Offizier fort, indem er auf etwas verächtliche Art den Kopf zurückwarf, »ich mische mich aus diesem Grunde in eure Intriguen und sei zu diesem Zwecke bereit, für eine oder die andere Partei zu arbeiten, so irrst du dich ganz gewaltig. Ich thue meinen Dienst und lasse an mich kommen, was kommt.«
»Wenn ich als Freund zu dir sprechen darf, so wählst du auf diese Art die gefährlichste Stellung. Das Getreibe an einem Hofe gleicht einem Mühlwerke. Willst du nicht zerrieben werden, so mußt du selbst mitreiben. Um über den Parteien zu stehen, dazu sind wir zu unbedeutend; der Platz zwischen den Parteien ist, wie gesagt, zu gefährlich, also müssen wir uns selbst für eine Partei entscheiden.«
»In deinen Worten liegt ein Körnchen Wahrheit; aber wozu soll ich mich entscheiden? Wie ich dir schon gesagt, bin ich der Offizier des Regenten, und was die allerdings mächtige Partei der Prinzessin anbelangt, so – «
»Bietet sie dir nichts Lockendes?« fragte der Kammerherr mit einem lauernden Blicke.
»O, davon schweige mir!« rief heftig der junge Offizier; »um sie zu gewinnen, könnte ich mich am allerwenigsten dazu entschließen, ein Parteimann zu werden. Wenn auch die Liebe gern im Verborgenen wächst und blüht, so haßt sie doch alle Winkelzüge, nach meiner Ansicht nämlich. Ich werde nun noch eine kurze Zeit geduldig abwarten und dann schon erfahren, wie die Freundlichkeit, mit der Fräulein von Ripperda meine kleinen Bewerbungen aufnahm, gemeint war. Spricht ihr Herz nicht für mich, nun gut, was kann ich thun? – Ich muß vergessen. – – Etwas anderes wäre es freilich,« setzte er lebhafter hinzu, »wenn man von seiten Ihrer Durchlaucht, wie ich fast fürchte, gegen mich in dieser Angelegenheit zu wirken beschlösse. – Ist man mir sonst nicht gnädig gesinnt, was thut's? Ich diene, solange ich kann, und gehe – dann auf meine Güter.«
»Auf deine Güter?« fragte der Kammerherr mit einem eigentümlichen Lächeln.
»Kennst du denn nicht mein Landhaus auf Bergeshöhe mit den fruchtbaren Ländereien und prachtvollen Waldungen, die ich ringsumher, so weit das Auge reicht, übersehen kann? – Will man aber, um ernstlich zu reden, Gott weiß zu welchem Zwecke, das junge Mädchen bestimmen oder überreden, sich von mir abzuwenden, dann freilich – dann ...«
»Dann wärst du vielleicht doch im stande, dich einer Partei anzuschließen,« sagte der Kammerherr, und wenn auch in diesem Augenblicke das uns bekannte freundliche Lächeln seine Lippen umspielte, so warfen doch seine Augen einen so lauernden Blick herüber, der jedem anderen, welcher minder unbefangen gewesen als der junge Offizier, aufgefallen wäre.
»In dem Falle freilich,« entgegnete fest und bestimmt Herr von Fernow. »Ich sehe dein Lächeln und weiß, was es sagen will. Aber glaube mir, teuerster Kammerherr, habe ich einmal Partei ergriffen, so halte ich fest dazu, siege mit ihr oder gehe mit ihr zu Grunde.«
Nach diesen Worten warf er den Säbel in den Arm und ging einmal im Zimmer auf und ab. Als er wieder zu seinem Gefährten kam, faßte er leicht dessen Arm, nötigte ihn so, den Spaziergang mit ihm zu wiederholen, und sagte während des Auf- und Abschreitens in seinem gewöhnlichen freundlichen Tone:
»Siehst du, es taugt nicht einmal, über Parteiangelegenheiten zu reden. Da hätte bald unser Gespräch eine unverhoffte ernste Wendung genommen. Laß mich lieber noch einiges hören von deinen Ansichten über das Glück, das ist amüsanter, und man lernt vielleicht etwas dabei.«
Während beide so dahinschritten, kamen sie an einem kleinen Tischchen vorbei, das mitten im Zimmer stand, und auf welchem sich in einer reichen Vase ein überaus prachtvolles Bouquet von frischen, lebenden Blumen zeigte. So oft sie bei dem Tischchen vorüberkamen, neigte sich Herr von Fernow darüber hin, um etwas von dem köstlichen Dufte einzuatmen.
»Was hilft es mir, wenn ich dir auch meine Theorien vom Augenblicke des Glücks wiederhole? Du bist ein Ungläubiger, dem in diesem Punkte nicht zu helfen ist.«
»Möchte mich aber gar zu gern belehren lassen,« entgegnete Herr von Fernow lachend; »ich versichere dich, Eduard, du hast einen mächtigen Drang in mir erweckt, das umherschwebende Glück zu erhaschen. Ich werde jetzt rastlos um mich schauen und selbst im allergewöhnlichsten Gedränge meine zehn Finger immer zum unverhofften Händedruck parat halten, ich werde den Worten alter Staatsräte und noch älterer Hofdamen lauschen, ich werde Gräfinnen aus dem vorigen Jahrhundert zum Tanz auffordern, ich werde – –«
»Du willst über mich spotten,« sagte der Kammerherr mit seinem unvergleichlichen Lächeln, »und doch habe ich recht. Thue, wie du gesagt; ein würdiger Staatsrat, dem du vielleicht durch deine liebenswürdige Unterhaltung eine Viertelstunde tödlicher Langeweile verjagst, kann dich als einen der gebildetsten und geistreichsten Kavaliere dem Kriegsminister empfehlen; eine alte Gräfin, der du in ihren vorgerückten Jahren noch das Vergnügen eines Walzers verschaffst, kann mit dem Regenten, Gott weiß wie, zusammenhängen und ihm eines Tages sagen, es sei eine wahre Schande, daß man dich noch nicht zum Major habe anvancieren lassen. – In der That, was du im Scherz sagtest, glaube ich im Ernst. Die Hauptsache ist: nur den richtigen Augenblick nicht verpaßt, und du hast das Glück in deiner Hand. Es naht uns oft in gar sonderbaren Verkleidungen; ich habe einen Freund, der viel auf meine Theorien hielt, und der keine Gelegenheit vorübergehen ließ, das Glück zu erfassen. Eines Tages sieht er vor irgend einer Kirche eine alte, schäbige Landkutsche in strömendem Regen stehen und bemerkte eine kleine Damenhand, die sich unter dem Leder hervor vergeblich bemüht, den Schlag zu öffnen. Er eilt hinzu, reißt die Wagenthür auf, eine junge Dame steigt aus, er begleitet sie unter seinem Regenschirm bis in die Kirche und nachher wieder an ihre alte Kalesche. Siehst du, Felix, in dem Augenblick, da er den Schlag öffnete, hatte er das Glück erfaßt. Das Mädchen war eine immense reiche Erbin und ist jetzt seine Frau.«
»Das ist allerdings ein schönes und lehrreiches Beispiel.«
»O, ich weiß noch viel interessantere, wahrhaft erschreckende. In dem königlichen Schlosse zu C. stand gegen das Ende eines Balles ein junger Kammerjunker, der sehr viel getanzt hatte und müde war, ausruhend in einer Fenstervertiefung. Er wäre gern nach Hause gefahren, eigene Equipage hatte er keine, und ich kann dir auch wohl gestehen, daß es ihn einigermaßen in Verlegenheit gebracht hätte, sich eine Voiture de remise anzuschaffen, ja es wäre ihm das im damaligen Augenblicke fast unmöglich gewesen. Da die Fensternische, in der er stand, sehr tief, auch niemand von Bedeutung in der Nähe war, so öffnete er behutsam eine bewegliche Scheibe in dem großen Fensterflügel und streckte die Hand hinaus, um sich zu überzeugen, ob es noch regne. Allerdings fühlte er auch schwere Tropfen auf seine Hand fallen, als er aber diese eben wieder hereinziehen wollte, fühlte er noch etwas ganz anderes; ein Stückchen kalten Metalls berührte seine Finger, und als er diese schloß, hielt er einen Schlüssel, an den mit einem kleinen seidenen Bande ein Papier gebunden war. – Wie gefällt dir das?«
Bei diesen Worten blieb der Kammerherr stehen, schmunzelte vergnügt und stieß mit dem ausgestreckten Zeigefinger den jungen Offizier leicht auf die Brust.
»Nicht so übel,« sagte dieser.
»Was du in dem Falle gethan hättest, weiß ich nicht,« fuhr Herr von Wenden fort; »der Kammerjunker, der ein entschlossener junger Mann war, bedachte sich nur eine Sekunde, zog den Schlüssel sachte an sich, löste die Schnur und bemerkte noch, wie diese alsdann langsam in die Höhe gezogen wurde.«
»Ein Augenblick des Glücks!« meinte lachend der Ordonnanzoffizier.
»Ein kolossaler Augenblick! Was auf dem Papier, das den Schlüssel umgab, eigentlich stand, hat man nicht recht erfahren; genug, der Kammerjunker wurde in kurzer Zeit Kammerherr, kam in die diplomatische Karriere, heiratete nicht lange darauf eine vornehme, wenn auch etwas ältere Dame und ist jetzt, Gott weiß wo, Gesandter. Verstehst du die Moral meiner Geschichte?«
»O, ich verstehe die Moral vollkommen und werde jetzt nach Beendigung jedes Hofballs, oder wo es nur sonst passend erscheint, meine Hand zu irgend einem Fenster hinausstrecken.«
Er hatte das mit einem leichte Anflug von Ironie gesagt, den der andere wohl verstand, und als sie gerade bei dem kleinen Tischchen waren, auf dem der kostbare Blumenstrauß stand, blieb der Kammerherr stehen, schüttelte leicht den Kopf und sagte:
»Trotz aller meiner schönen Lehren bist du unverbesserlich.«
»Nein, nein, in der That!« antwortete der Ordonnanzoffizier, »du thust mir Unrecht. Ich fange an, deinen Theorien zu glauben. Nur hast du mir ja schon früher zugegeben, daß Glück dazu gehört, das Glück zu erfassen. Ich glaube, ich könnte meine Hände ausstrecken nach den Wagenthüren aller schäbigen Landkutschen, zum Fenster hinaus, so oft ich wollte, mir würde nichts in die Hand fallen.«
»Bis der richtige Augenblick des Glücks erscheint,« entgegnete der Kammerherr mit aufgehobener Hand. »Ist der aber gekommen, so genügt dem Glück der allerunschuldigste Gegenstand, um dir, wenn auch verborgen, entgegenzutreten. Ich gestehe dir, es liegt was Ängstliches, etwas geisterhaft Unheimliches in dem Glauben an meine Theorie; aber ich halte ihn fest und unerschütterlich und hege die vollkommenste Überzeugung, daß ich, wenn einmal der richtige Augenblick gekommen ist, das Glück erfassen werde, sei es bei einer alten Landkutsche, sei es, daß ich meine Hand zum Fenster hinausstrecke, sei es, indem ich mit meinen Fingern, wie ich jetzt thue, in dieses Blumenbouquet fasse, – – Wie gesagt, ist der rechte Moment gekommen, so ist dort mein Glück verborgen, und – – ich – halte – es.« – –
Der Ordonnanzoffizier hatte seinen Gefährten lächelnd angeschaut, als dieser in einer wahren Ekstase den eben erwähnten Satz sprach bis zu den letzten Worten. Als er aber das »Ich halte es« mit so plötzlich verändertem Tone sagte, langsam, kaum vernehmlich, da konnte Fernow nicht umhin, jenem verwundert in das Gesicht zu blicken, denn die ohnedies blassen Wangen des Kammerherrn wurden fast erschreckend bleich, als er die Hand in das Blumenbouquet hineindrückte, und darauf flammte eine tiefe Röte bis zu seinen Augen empor.
»Zum Teufel, was gibt es denn?« fragte bei diesem Anblick Herr von Fernow. »Hast du dich beim Ausüben deiner Theorie an einem Dorn geritzt, oder was ist geschehen?«
Herr von Wenden hatte unterdessen die Hand aus dem Bouquet wieder hervorgezogen und sagte, indem er mühsam lächelte: »Wer weiß, ob ich nicht im stande bin, diese meine Theorie an mir selbst zu beweisen!«
»So hast du das Glück erfaßt?« rief lachend der Offizier.
»Wer weiß? Vorderhand nur ein kleines Papier, sorgfältig zusammengerollt, und nicht ohne Absicht am Stiele einer Rose verborgen.«
»Bah! Ein Papier! Ich fürchte, du wirst mir deinen Beweis schuldig bleiben. Das ist wahrscheinlich ganz absichtslos da hineingekommen.«
»Bei Hofe geschieht dergleichen nie absichtslos,« entgegnete der Kammerherr, indem er sich bemühte, den Streifen aufzuwickeln. »Sehen wir erst, ob etwas darauf geschrieben ist.«
»Natürlich! Das ist die Hauptsache. – Nun?«
»– – – – Keine Silbe!«
»Das ist ein schönes Glück!«
Das Papier, ein kleiner, kaum fingerlanger und ebenso breiter Streifen, war in der That unbeschrieben. Herr von Fernow und vielleicht mancher andere hätte ihn für eine Phantasie des Gärtners gehalten und unbeachtet auf die Seite geworfen; der umsichtige Kammerherr aber gab das vermeintliche Glück nicht so leicht aus der Hand. Er drehte den Papierstreifen nach allen Seiten, betrachtete seine Ränder, ob sich dort nicht vielleicht Einschnitte befänden, die etwas zu bedeuten hätten, und als sich gar nichts dergleichen zeigte, hielt er ihn zum letzten Versuch ausgespannt gegen das Tageslicht.
»Nun, findest du nichts?« fragte der Ordonnanzoffizier, und da er in diesem Augenblick an dem Fenster stand, so betrachtete er von seiner Seite den kleinen Papierstreifen ebenso genau. Hätte er seine Augen nicht so fest darauf gerichtet gehabt, so würde er vielleicht bemerkt haben, wie über die Züge seines Gefährten etwas wie ein helles Licht fuhr, etwas wie ein Blitz, wie ein freudiger Glanz, das aber ebenso schnell verschwand, wie es gekommen, und nur eine, wenn auch affektierte Gleichgültigkeit auf den Zügen zurückließ.
»Wie gesagt, nicht die Spur,« sagte der Kammerherr nach einem augenblicklichen Stillschweigen; »es ist in der That möglich, daß ich mich geirrt habe.«
»In dem Papier?«
»Ich glaube wahrhaftig, du hattest recht. Irgend eine Spielerei des Gärtners.«
Darauf nahm er das Papier leicht zwischen die Finger und rollte es sorgfältiger wieder zusammen, als – die Spielerei eines Gärtnerburschen vielleicht verdient hätte. Das mochte auch der Ordonnanzoffizier denken; doch hielt er es mit einmal für besser, er wußte selbst nicht warum, diesem Gedanken keine Worte zu leihen, sondern warf nur leicht hin:
»Und willst du es wieder an seinem früheren Platz zwischen die Blumen verbergen?«
»Warum nicht?« sagte der Kammerherr mit einem leichten Achselzucken; »entweder ist es, wie schon gesagt, die Spielerei eines Gärtnerburschen, oder es ist vielleicht auch ein unschuldiges Zeichen für jemand anders, das uns durchaus nichts angeht. Man muß niemand seine Freude verderben.«
»Ja, man muß niemand seine Freude verderben,« wiederholte Herr von Fernow, und dabei sah er lächelnd und anscheinend ganz gleichgültig zu, wie der Kammerherr aufs sorgfältigste das zusammengerollte Papier wieder an den früheren Platz brachte.
Mochte nun der Ordonnanzoffizier seinen Freund als einen schlauen, berechnenden und verschwiegenen Menschen kennen, oder hatte er doch etwas von dem leuchtenden Blick bemerkt, der den Augen des Kammerherrn entstrahlte, als dieser den Papierstreifen gegen das Licht hielt, oder, was auch wahrscheinlich ist, war ihm die Sorgfalt, mit welcher Herr von Wenden das – ganz gewöhnliche Stückchen Papier wieder an seinen Platz brachte, verdächtig vorgekommen: genug, er stützte sich mit der Hand auf das Tischchen, sein Gesicht nahm einen ernsten, nachdenkenden Ausdruck an, aber nur eine Sekunde lang, – dann sang er zwei Takte eines bekannten Liedes leise vor sich hin, strich den schwarzen Bart leicht zu beiden Seiten hinaus und sagte mit einem scheinbar freundlichen, aber sehr forschenden Blick auf seinen Gefährten:
»Du bist gewöhnlich ein umsichtiger Mensch, Eduard; aber entweder du verschweigst mir deine Gedanken, oder du hast in der That nicht daran gedacht, daß das Papierchen doch vielleicht etwas bedeuten könnte, was zu erfahren, wenn es auch kein großes Glück für uns wäre, uns doch einen guten Spaß machen könnte.«
Der Kammerherr zog seine Augenbrauen in die Höhe und neigte wie abwehrend seinen Kopf auf die rechte Seite, wie jemand, der einen Vorschlag unbedingt verwerfen will.
»Nein, nein,« meinte er alsdann; »wenn irgendwo ein Spaß damit bezweckt ist, was geht das uns an? Man muß niemand seine Freude verderben. Auch,« setzte er nach einer Pause hinzu, »möchte ich in der That wissen, wie wir erfahren sollten, wer mit dem Papierstreifen gemeint ist?«
Dies letztere sprach er mit einem seltsam lauernden Blicke.
Herr von Fernow hatte diesen wohl bemerkt; doch mochte es in seiner Absicht liegen, ganz unverhohlen seine Gedanken auszusprechen, denn er entgegnete, ohne irgend welche Bewegung auf seinem offenen und ehrlichen Gesichte:
»Nun, wenn dir das nicht einfällt, so laß dir dein Lehrgeld zurückbezahlen, welches dich deine Karriere bei Hof gekostet.«
»Ich weiß in der That nicht – –« sprach der Kammerherr; doch ging sein lauernder Blick in einen fast ängstlichen über.
»Nun, so einfach, wie mir je im Leben etwas vorgekommen! Dort in dem Blumenbouquet steckt das fragliche Papierchen, welches, wie du gesagt, weder Schrift noch Zeichen enthält.«
»Weder Schrift noch Zeichen.«
»Gut, aber es kann an und für sich ein Zeichen sein, ein Zeichen, das einer dort versteckt hat, damit ein anderer es finde. Wenn der es aber finden will, muß er es suchen. Also haben wir beide nichts Einfacheres zu thun, als Achtung zu geben, wer sich mit dem Blumenbouquet auf eine auffallende Art beschäftigt, – enfin, wer das Papierchen an sich nimmt.«
»Bei Gott! da hast du recht!« rief der Kammerherr mit erkünsteltem Erstaunen; doch biß er sich gleich darauf in die Lippen, und es war ihm offenbar unangenehm, daß der andere einen Gedanken aussprach, den er schon lange gefaßt.
In diesem Augenblicke trat der dienstthuende Kammerherr aus den inneren Gemächern der Herzogin und meldete dem Herr von Wenden, daß die Wagen Ihrer Hoheit soeben an der hinteren Seite des Schlosses angefahren seien. Dieser zog seine Uhr hervor und warf einen Blick darauf.
»Halb sechs,« sagte er; »eine halbe Stunde Toilette; wir werden um sechs Uhr speisen.«
Drittes Kapitel.
Diner bei Hofe.
Das herzogliche Schloß, welches noch vor kurzem wie träumend in der feierlichen Stille eines Sonntagsnachmittags dalag, hatte sich seit der Anfahrt der Wagen der Prinzessin, die von Eschenburg zurückkehrten, außerordentlich belebt. Mit ihrem Eintritt und dem ihres zahlreichen Gefolges schien die schläfrige Langeweile, welche bisher in den Korridoren und Sälen herrschte, mit einmal verschwunden. Die Lakaien in den Vorzimmern saßen nicht mehr träumend auf den Banketts, sondern gingen mit erhobenem Kopfe aufmerksam umher, strichen sich ihre Haarfrisuren zurecht, zupften an ihren weißen Halsbinden und waren ganz andere Menschen geworden. Der Vogel vor dem Fenster war davongeflogen, die schlummernde Katze hatte das Weite gesucht, und der Dragoner im Vestibül vor den Zimmern seiner Hoheit schritt so energisch auf und ab, daß Säbel und Sporen klirrten. Im vorderen Schloßhofe fuhr ein Wagen nach dem anderen an, auf den Treppen hörte man leise Schritte, auch klirrende Sporen, einen respektvollen Husten und das halbunterdrückte Lachen verschiedener Hoffräulein. Neben dem Salon, in welchem sich der bemerkenswerte Blumenstrauß befand, war von dem Kammerdiener geräuschlos noch ein weiteres Gemach, gegen das Appartement der Herzogin zu, geöffnet worden, und diese beiden Zimmer füllten sich nach und nach mit denen, welche heute das außerordentliche Glück hatten, zur Tafel geladen zu sein.
Da sah man zahlreiche und schöne Damen, deren weißer Teint noch besonders hervorgehoben wurde durch die schwarzen Kleider, welche die Trauer um den verstorbenen Herzog vorschrieb; wenige der Jüngsten hatten es gewagt, in ihrem Haar oder an ihrem Schmucke freundlichere Nüancen anzubringen und die einfachen Trauerkleider irgendwie auszuschmücken. Was aber die älteren Damen anbetraf oder die Angehörigen des Hofes, so sah man an ihnen nur Schwarz und Weiß; ja, einige alte Hofdamen, die in den langen Jahren ihrer Dienstzeit schon manche Trauer mitgemacht hatten und in diesem, sowie in vielen anderen Fällen mehr zu thun pflegten als der strengste Obersthofmeister vorschreiben konnte, ließen nicht die Spur von Glanz und Weiß sehen, selbst ihre Augen hatten eine melancholisch gelbe Farbe, ihre Wimpern waren beständig niedergeschlagen, der Mund fest verschlossen, und sie trugen deshalb kein Taschentuch, weil eines von schwarzer Farbe leider noch nie dagewesen war. – Mit vieler Indiskretion versicherten dagegen ein paar naseweise Kammerjunker, die alte Obersthofmeisterin bediene sich bei dergleichen Veranlassungen sogar eines Trauerkorsetts. – Bei den Herren sah man die allgemeine Trauer nur an den schwarzen Handschuhen und einem leichten Flor um den Arm, denn der schwarze Frack erleidet ja keine Veränderung und ist beständig eher ein Gewand der Trauer als der Freude zu nennen. Wohlthuend waren die zahlreichen glänzenden Uniformen zwischen den vielen schwarzgekleideten Herren und Damen.