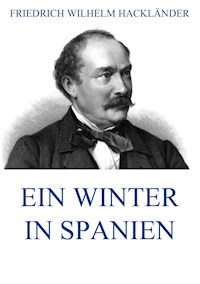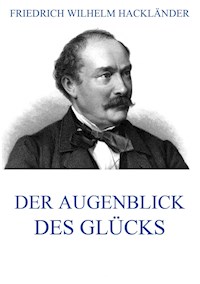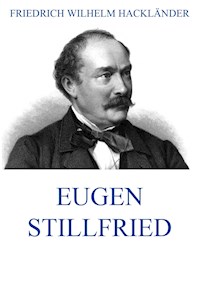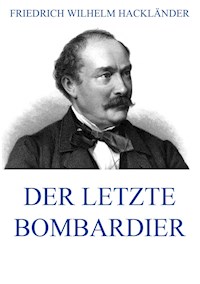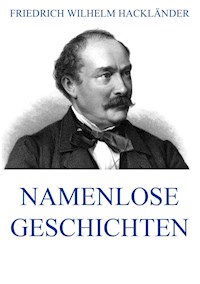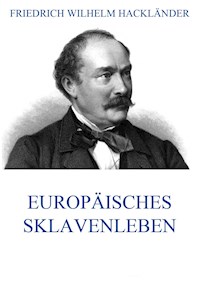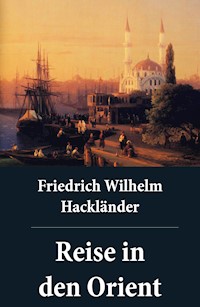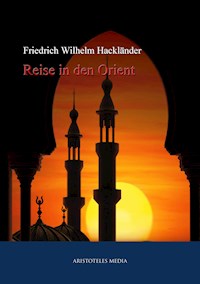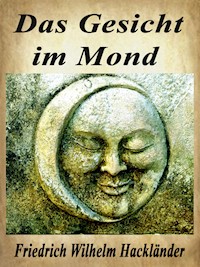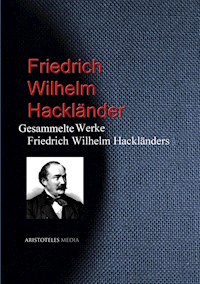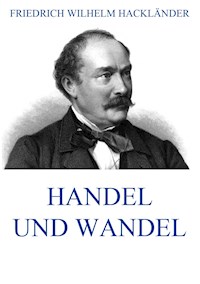
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In dieser Autobiographie beschreibt der Schriftsteller seine Jugend in Elberfeldt, seine Lehre und sein Studium und wie er schließlich das wurde, als was er in die Geschichte einging.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Handel und Wandel
Friedrich Wilhelm Hackländer
Inhalt:
Friedrich Wilhelm Hackländer – Biografie und Bibliografie
Handel und Wandel
Erstes Kapitel - Der Beruf.
Zweites Kapitel - Herr Reißmehl.
Drittes Kapitel - Philipp.
Viertes Kapitel - Ein Nachbar.
Fünftes Kapitel - Die Schreibstube.
Sechstes Kapitel - Herr Doktor Burbus.
Siebentes Kapitel - Jammer.
Achtes Kapitel - Krampfstillende Tropfen.
Neuntes Kapitel - Rache.
Zehntes Kapitel - Familienrat.
Elftes Kapitel - Das heimliche Gericht.
Zwölftes Kapitel - Fanny in der Laterne.
Dreizehntes Kapitel - Bisse des Gewissens.
Vierzehntes Kapitel - Heimkehr. O weh!
Fünfzehntes Kapitel - Geheimnisse.
Sechzehntes Kapitel - Krankheit.
Siebzehntes Kapitel - Verlobung und Edelmut.
Achtzehntes Kapitel - Genesung.
Neunzehntes Kapitel - Kleine Reiseabenteuer.
Zwanzigstes Kapitel - In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad.
Einundzwanzigstes Kapitel - Kontorist und Hilfsarbeiter.
Zweiundzwanzigstes Kapitel - Vergnügungen auf der Mühle.
Dreiundzwanzigstes Kapitel - Doktor Burbus!! Abschied.
Vierundzwanzigstes Kapitel - Hinaus in die Welt.
Fünfundzwanzigstes Kapitel - Der Vetter Professor.
Sechsundzwanzigstes Kapitel - Die Einführung ins neue Geschäft.
Siebenundzwanzigstes Kapitel - Das Warenmagazin. Etiketten.
Achtundzwanzigstes Kapitel - Prinzipalin und Prinzipal.
Neunundzwanzigstes Kapitel - Bekehrungsversuche des Herrn Specht.
Dreißigstes Kapitel - Das Bild meiner Andacht.
Einunddreißigstes Kapitel - Die Betstunde.
Zweiunddreißigstes Kapitel - Ein Stern in dunkler Nacht.
Dreiunddreißigstes Kapitel - Ruhe sanft!
Vierunddreißigstes Kapitel - Auf der Wiegkammer.
Fünfunddreißigstes Kapitel - Veränderungen.
Sechsunddreißigstes Kapitel - Emma.
Siebenunddreißigstes Kapitel - Der Flegeljahre zweite und vermehrte Auflage.
Achtunddreißigstes Kapitel - Das letzte Souper.
Neununddreißigstes Kapitel - Ein Verhör – Ein Rendez-vous.
Vierzigstes Kapitel - Ein zweites Verhör und Ende des Buches.
Handel und Wandel, F. W. Hackländer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849626792
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Wilhelm Hackländer – Biografie und Bibliografie
Roman- und Lustspieldichter, geb. 1. Nov. 1816 in Burtscheid bei Aachen, gest. 6. Juli 1877 in seiner Villa Leoni am Starnberger See, widmete sich, früh verwaist, 1830 dem Kaufmannsstand, trat nach zwei Jahren bei der preußischen Artillerie ein, kehrte aber, da ihm der Mangel an Vorkenntnissen die Aussicht auf Avancement verschloss, zum Handelsstand zurück. Das Glück lächelte ihm indes erst, als er sein frisches Erzählertalent mit »Vier Könige« und »Bilder aus dem Soldatenleben« (Stuttg. 1841) geltend zu machen begann. Die auf eignen Erlebnissen beruhende Wahrheit und der liebenswürdige Humor dieses Büchleins, dem später die weitern Skizzen »Das Soldatenleben im Frieden« (Stuttg. 1844, 9. Aufl. 1883) folgten, erregten allgemeine Aufmerksamkeit und verschafften H. insbes. die Zuneigung des Barons v. Taubenheim, der ihn zum Begleiter auf seiner Reise in den Orient (1840–41) wählte. Deren literarische Früchte waren: »Daguerreotypen« (Stuttg. 1842, 2 Bde.; 2. Aufl. als »Reise in dem Orient«, 1846) und der »Pilgerzug nach Mekka« (das. 1847, 3. Aufl. 1881), eine Sammlung orientalischer Märchen und Sagen. Durch den Grafen Neipperg dem König von Württemberg empfohlen, arbeitete H. einige Zeit auf der Hofkammer in Stuttgart und wurde im Herbst 1843 zum Sekretär des Kronprinzen ernannt, den er auf Reisen und 1846 auch zu seiner Vermählung nach Petersburg begleitete. Im Winter 1849 aus dieser Stellung entlassen, begab er sich nach Italien, wo er im Hauptquartier Radetzkys dem Feldzug in Piemont beiwohnte, war darauf im Hauptquartier des damaligen Prinzen von Preußen (späteren Kaisers Wilhelm I.) Zeuge der Okkupation von Baden und nahm dann in Stuttgart seine schriftstellerische Tätigkeit wieder auf. 1859 wurde er vom König Wilhelm von Württemberg zum Direktor der königlichen Bauten und Gärten ernannt, begab sich noch in demselben Jahr, bei Ausbruch des italienischen Krieges, auf Einladung des Kaisers Franz Joseph in das österreichische Hauptquartier nach Italien, wo er bis nach der Schlacht bei Solferino blieb, und wurde 1861 für sich und seine Nachkommen in den österreichischen Ritterstand erhoben. Beim Regierungsantritt des Königs Karl (1865) plötzlich seines Amtes enthoben, lebte er seitdem abwechselnd in Stuttgart und in seiner Villa Leoni am Starnberger See. Die literarische Tätigkeit hatte H. während seiner verschiedenen amtlichen Obliegenheiten und Reisen eifrig fortgesetzt; aus der Teilnahme am piemontesischen Feldzug Radetzkys und der Belagerung von Rastatt im Sommer 1849 erwuchsen die »Bilder aus dem Soldatenleben im Krieg« (Stuttg. 1849–50, 2 Bde.); den »Wachtstubenabenteuern« (das. 1845, 3 Bde.; 6. Aufl. 1879), den »Humoristischen Erzählungen« (das. 1847, 5. Aufl. 1883) und »Bildern aus dem Leben« (das. 1850, 5. Aufl. 1883) folgten größere humoristische Romane: »Handel und Wandel« (Berl. 1850, 2 Bde.; 3. Aufl., Stuttg. 1869), voll ergötzlicher Reminiszenzen aus seiner kaufmännischen Lehrzeit, »Namenlose Geschichten« (das. 1851, 3 Bde.) und »Eugen Stillfried« (das. 1852, 3 Bde.). Hackländers Lustspiel »Der geheime Agent«, bei der von Laube 1850 ausgeschriebenen Konkurrenz mit einem Preis gekrönt (3. Aufl., Stuttg. 1856), wurde auf allen deutschen Bühnen mit Erfolg ausgeführt, auch mehrfach übersetzt. Weniger Glück machten: »Magnetische Kuren« und die Possen: »Schuldig« (1851), »Zur Ruhe setzen« (1857) und »Der verlorne Sohn« (1865). Geteilten Beifall fand sein Roman »Europäisches Sklavenleben« (Stuttg. 1854, 4 Bde.; 4. Aufl. 1876). Mit den »Soldatengeschichten« (das. 1854, 4 Bde.) begann eine gewisse Vielproduktion, in der Wiederholungen unvermeidlich waren, und die zuletzt in manieristische Flüchtigkeit auslief. Wir nennen noch: »Ein Winter in Spanien« (Stuttg. 1855, 2 Bde.), das Resultat einer 1853 nach Spanien unternommenen Reise; »Erlebtes. Kleinere [595] Erzählungen« (das. 1856, 2 Bde.); »Der neue Don Quixote« (das. 1858, 5 Bde.); »Krieg und Frieden« (das. 1859, 2 Bde.); »Der Tannhäuser« (das. 1860, 2 Bde.); »Tag und Nacht« (2, Aufl., das. 1861, 2 Bde.); »Der Wechsel des Lebens« (das. 1861, 3 Bde.); »Tagebuchblätter« (das. 1861, 2 Bde.); »Fürst und Kavalier« (das. 1865); »Künstlerroman« (das. 1866); »Neue Geschichten« (das. 1867); »Hinter blauen Brillen«, Novellen (Wien 1869); »Der letzte Bombardier«, Roman (Stuttg. 1870, 4 Bde.); »Geschichten im Zickzack« (das. 1871, 4 Bde.); »Sorgenlose Stunden in heitern Geschichten« (das. 1871, 2 Bde.); »Der Sturmvogel«, Seeroman (das. 1872, 4 Bde.); »Nullen«, Roman (das. 1873, 3 Bde.); »Verbotene Früchte« (das. 1878, 2 Bde.); »Das Ende der Gräfin Patatzky« (das. 1877); »Reisenovellen« (das. 1877); »Residenzgeschichten« (das. 1877); »Letzte Novellen«, mit seinen ersten literarischen Versuchen (das. 1879) etc. Eine Gesamtausgabe seiner Werke erschien Stuttgart 1855 bis 1874, 60 Bde. (neuer Abdruck 1876); eine Auswahl in 20 Bänden 1881, seitdem auch in illustrierten Ausgaben. Auf journalistischem Gebiet begründete H. 1855 mit Edm. Höfer die »Hausblätter« und 1859 mit Edm. Zoller die illustrierte Wochenschrift »Über Land und Meer«. H. zeigte sich in seinen literarischen Produktionen als eine gesunde und frisch genießende Natur von großer Welt- und Menschenkenntnis, soweit es sich um die Beobachtung der äußerlichen Weltzustände und der äußerlichen Charaktere handelt. Unter seinen größern Romanen zeichnen sich besonders die »Namenlosen Geschichten« und »Eugen Stillfried« durch die Frische aller Farben, die seltene Lebendigkeit der Erzählung vorteilhaft aus. Der Humor Hackländers ist vorwiegend harmlos und gutmütig; nur in einzelnen Romanen, wie im »Europäischen Sklavenleben«, spitzt er sich tendenziös zu. Aus seinem Nachlaß erschien eine interessante Selbstbiographie: »Der Roman meines Lebens« (Stuttg. 1878, 2 Bde.). Vgl. H. Morning, Erinnerungen an Friedr. Wilh. H. (Stuttg. 1878).
Handel und Wandel
Erstes Kapitel - Der Beruf.
In den für mich so denkwürdigen Tagen, wo ich Schulbank und Spielplatz verlassen mußte, um als Glied in die Kette einzutreten, an der unter dem Namen Geschäftsleben die ganze Welt zappelt und vergebens nach der verlorenen Freiheit ringt, in jener Zeit war noch viel weniger als jetzt von einer Kunst die Rede, in der man es freilich bis auf diesen Tag noch nicht weit gebracht hat. Ich meine die Kunst, den Kopf eines Menschen mit einigen gewandten Griffen zu betasten und ihm genau zu sagen, welche Anlagen er besitzt, welche Fähigkeiten er auszubilden hat und welches Geschäft er ergreifen muß, damit er später nicht, gleich so vielen, über verfehlten Beruf zu klagen haben möge. Wäre es aber auch damals möglich gewesen, mir nach den Auswüchsen meines Kopfes genau zu sagen, wozu ich befähigt sei, so hätten es mir doch die Verhältnisse nicht erlaubt, ein anderes Geschäft zu ergreifen, als wozu mich die Vorsehung und einiger Geldmangel bestimmt hatten.
Ich hatte keine Eltern mehr und befand mich im Hause und unter der Aufsicht einer Tante, die Witwe war und einen kleinen Laden führte, wo ich ihr in meinen Freistunden hilfreiche Hand leistete. Ich fertigte ausgezeichnete Papiertüten und hatte es schon so weit gebracht, daß ich ein Pfund Zucker oder Kaffee abwiegen konnte, als die Zeit herankam, wo ich ins Leben treten sollte.
Meine Großmutter hatte damals ihren Wohnort im Hause meiner Tante aufgeschlagen. Es war eine gute alte Frau, mit der ich aber nie im besten Einverständnis lebte. Noch sehe ich sie auf ihrem großen, geschnitzten Lehnstuhle sitzen, auf einem Kissen von gestreiftem Kattunzeug, das sie alle Sonnabend zu einer bestimmten Stunde mit einem frischen Ueberzuge versah. Neben ihr auf dem Tische lagen mehrere Sammlungen alter Predigten, die sie Gott weiß wie oft schon durchgelesen hatte. Auf dem obersten dieser Bücher lag eine silberne Brille, die sie beim Lesen gebrauchte. Ihr Anzug stammte aus der Zeit ihrer Jugend und wurde zum Teil aus einer kleinen Eitelkeit beibehalten; sie behauptete, die jetzigen Trachten seien geschmacklos und häßlich, und wenn sie auf dieses Kapitel zu sprechen kam und gut gelaunt war, vertraute sie mir oftmals, was für ein schönes Mädchen sie gewesen sei und welches Aufsehen sie in ihren dermaligen Kleidern gemacht. Man konnte das wohl glauben, wenn man sah, wie in ihrem jetzigen Alter von siebzig Jahren ihr Gesicht noch immer einen edlen, schönen Ausdruck bewahrte und ihre hohe Gestalt fortwährend ansehnlich und ungebeugt war. Nach uralter Mode trug sie eine Haube, unter welcher um die Schläfe und über die Stirn kleine Löckchen hervorsahen.
Alle Sachen, die sie täglich gebrauchte, hatten ihre eigenen, oft höchst interessanten Geschichten, die ich so oft angehört hatte, daß ich sie auswendig wußte. Der Stuhl, auf dem sie saß, war in der Familie erblich und stammte wer weiß von welchem Urgroßvater her. Die silberne Brille hatte einem französischen General gehört, der in den Kriegen der Revolution eines Abends zum Tode verwundet in die Pfarrwohnung gebracht wurde, wo er nach einigen Wochen starb. Der Franzose muß ein arger Heide gewesen sein; meine gute Großmutter erzählte, wie entsetzlich er anfangs über alles geflucht habe; sie setzte aber nicht ohne Stolz hinzu, daß in ihrer stillen, christlichen Wohnung sein Herz sich bald beruhigt habe und er sanft und selig verschieden sei. Besonders große Stücke hielt sie auf eine kleine goldene Tabakdose, die sie ebenfalls in Kriegszeiten von einer Gräfin erhalten hatte, welcher ihr Eheherr einen wesentlichen Dienst geleistet.
Wie gesagt, stand ich mit der Großmutter nicht immer auf dem besten Fuße. Ihr war der Lärm und der Spektakel, den ich oft im Hause anstiftete, unerträglich; hauptsächlich konnte sie nicht leiden, wenn ich mich mit Knaben meines Alters auf Straßen und Feldern umhertrieb, und dies trug mir oft gewaltige Strafpredigten ein, die sie mir in einer Reihe von Sprichwörtern hielt. »Da kommt er,« sagte sie, »einer der eifrigsten in der Rotte Korah! Willst du dir denn nie merken, daß böses Beispiel gute Sitten verderbt? Ja, ich habe es dir immer gesagt, wer sich grün macht, den fressen die Ziegen; der Krug geht solange zum Wasser, bis er bricht; mit gefangen, mit gehangen.« – Ich war damals ein junger Mensch von schmächtigstem Körperbau, kleiner als alle Knaben meines Alters, und hatte ein blasses, eingefallenes Gesicht, kurz, ein ganz erbärmliches Aussehen, was meiner Großmutter ein Dorn im Auge war. Sie behauptete, das komme von meinem immerwährenden Springen und Klettern und weil ich ohne Mütze im Regen herumlaufe und es mir eine wahre Freude sei, nasse Füße zu haben. Sie hatte mir den Namen »Schattenkopf« geschaffen und jammerte viel darüber, daß sie einen so schlecht aussehenden Enkel habe. »Ach,« sagte sie, »es steht wohl geschrieben: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, aber meine Tochter, die Luise, deine Mutter, Gott habe sie selig! das war, wie ich, eine schöne, starke Frau, und du kommst mir nicht anders vor wie Spreu unter dem Weizen.«
So lebte ich nach der Konfirmation noch ein halbes Jahr bei der Tante, und es war mitten im Winter an einem Sonntagnachmittag, als im Zimmer meiner Großmutter ein Familienrat gehalten wurde, um zu beschließen, was eigentlich aus mir werden sollte. Meine Großmutter, der ich am selben Morgen eine ihrer schönsten Tassen zerbrochen hatte, meinte zwar, es sei vorauszusehen, daß aus mir ein Taugenichts werde; doch müsse man das Seinige tun, damit man seine Hände in Unschuld waschen könne. Ich war an diesem Tage in der trübsten Stimmung von der Welt. Draußen waren Bäche und Teiche zugefroren, und meine Kameraden trieben sich dort umher. Auch ich war mit einem Paar sehr defekter Eisschuhe hinausgegangen, mußte aber unverrichteter Sache wieder umkehren; in der vergangenen Nacht war tiefer Schnee gefallen, alle Teiche, bis auf einen, waren damit bedeckt, und bei diesem einzigen standen einige Männer, die ihn vom Schnee gereinigt hatten und für diese Dienstleistung von jedem zwei Pfennige forderten, eine Summe, die ich in meinen damaligen Verhältnissen nicht erschwingen konnte. Mißmutig kehrte ich nach Hause zurück und nahm mir fest vor, jetzt bald etwas Tüchtiges zu lernen, damit ich mir mein eigen Geld verdienen könne.
So trat ich in das Zimmer meiner Großmutter, wo ich denn bald zu meiner großen Verwunderung hörte, daß man sich eifrig mit meinem Schicksal beschäftigte. Außer der Tante, bei der ich wohnte, war eine ihrer Schwestern zu Besuch gekommen, und auf dem Tische lag ein Brief meines Vormunds, in dem dieser seinen Willen in betreff meiner schriftlich kund tat, so daß ein vollständiger Familienrat beisammen war. Ein anderes stimmführendes Mitglied bei dieser Verhandlung war eine gute alte Person, die in meinem väterlichen Hause Wirtschafterin gewesen war und mich sehr verhätschelt hatte. Sie trug noch beständig eine große Liebe zu mir, und wenn sie mich irgendwo auf der Straße oder sonstwo erblickte, brach sie in Tränen aus und jammerte über meinen seligen Vater, daß er so früh gestorben und ich dadurch ihrer trefflichen Leitung entzogen worden sei. Auch jetzt hatte ich mich kaum in dem Zimmer blicken lassen und Platz hinter dem Ofen genommen, als sie mich wehmütig ansah, Nase und Mund heftig verzog und ihr Schnupftuch hervorsuchte, um einige herabrollende Tränen abzutrocknen.
Meine Großmutter, die viel festerer Natur war, sagte ihr dagegen verweisend: »Weine Sie doch nicht, Jungfer Schmiedin; dem Jungen wird nichts Leides geschehen: Unkraut verdirbt nicht.« – »Ach,« schluchzte die Schmiedin dagegen, »wenn doch der selige Herr noch lebte! da müßte der Junge studieren und ein Pfarrer werden wie der selige Großvater. So hat der selige Herr immer gesagt. Aber jetzt soll er in dem Laden stehen und Kaufmann werden! Gott, er soll Kaufmann werden!« Obgleich meine beiden Tanten, so lieb sie mich hatten, über mein künftiges Schicksal nicht so sehr beunruhigt waren, mochte dieser Augenblick doch auch ihnen wichtig genug vorkommen, um ihm eine stille Zähre zu weihen; sie holten zu gleicher Zeit ihre Schnupftücher hervor und brachten selbst meine Großmutter in Bewegung, die das ihrige ebenfalls unter ihrem gestreiften Ruhekissen hervorholte. Man wird mir verzeihen, daß ich im selben Augenblick desgleichen tat. Erst die verdorbene Schlittschuhpartie und dann die Ungewißheit des Loses, das über mich geworfen wurde, lösten mein Herz in Wehmut auf; dazu kam das Heulen der Schmiedin und die Tränen meiner Verwandten, und ehe ich's mir versah, rollten mir ein paar große Tränen über die Wangen auf den heißen Ofen, der sie zischend verzehrte.
Meine Großmutter war die erste, die aus diesem Meer von Tränen und Seufzern wieder als festes Land auftauchte; sie nahm eine Prise aus ihrer gräflichen Dose, setzte die Brille des verstorbenen Generals auf und ermahnte mich, ihr mit größter Aufmerksamkeit zuzuhören. Darauf hielt sie mir eine Rede, die mit Sprichwörtern aller Art gespickt war und in welcher sie nach einer Masse von guten Lehren und Ermahnungen darauf zu sprechen kam, daß der Mensch neben dem allgemeinen Beruf, sich zum Himmel heranzubilden, auch noch die Pflicht habe, sich einem speziellen Beruf zu ergeben, auf daß er sein tägliches Brot verdiene. – »Die Wahl eines Berufs hat dir Gott der Herr nicht schwer gemacht,« fuhr sie fort; »denn aus Mangel an einer gewissen Materie, die man Geld nennt, ist dir nur der Handelsstand geblieben, unter dessen verschiedenen Zweigen du aber wählen kannst, welcher am meisten nach deinem Geschmack ist.« – »Ja,« nahm meine älteste Tante das Wort, »du kannst dich in dem Punkte entscheiden, wofür du den meisten Beruf hast.«
Ich sollte mich entscheiden, wozu ich den meisten Beruf habe, und ich fühlte doch gar nichts von dergleichen in mir. Wenn ich einen Maler sah, so spürte ich in mir den Künstler und glaubte, es müßte mir gar nicht schwer werden, in diesem Fache Glänzendes zu leisten. Sah ich dagegen einen Studenten mit kurzem Samtrock, weißer Mütze und langen, buntfarbigen Troddeln an der Pfeife, so war ich überzeugt, daß ich alles das mit eben dem Anstand führen würde, also einstens einen trefflichen Studenten abgeben könnte. Ebenso erging es mir, wenn ich in den öffentlichen Gerichtssälen die Advokaten plaidieren hörte, oder wenn ich Sonntags auf der Wachtparade die Offiziere geschniegelt und gebügelt einherspazieren sah. Und glücklicherweise hatte auch der Handelsstand einen Platz in diesem Ideenkreise. Das Kontorsitzen kam mir freilich nicht eben angenehm vor, und das Stehen hinter dem Ladentisch schien mir sogar unerträglich; aber in meinen kindischen Träumen war der Handelsstand in unsern Städten nur eine der niedrigsten Stufen des Gewerbes, über die man sich auf einen höheren Standpunkt zu schwingen habe, wo man den Handel in ganz anderem Lichte erblickte. Dabei schwebte mir immer der Kommerz in den Seeplätzen vor, von dem ich aus meiner Grammatik etwas hatte kennen lernen. Da sah ich mich denn mit meinem Pult dicht am Ufer des Meeres, um Schiff und Ladung aus der ersten Hand zu empfangen, und ließ mir gleich von den Matrosen schöne Geschichten erzählen, wie es drüben aussehe unter den Wilden und Hottentotten.
Meine Großmutter ging nun die verschiedenen Arten des Handelsstandes mit mir durch, und meine älteste Tante beleuchtete mir dieselben von allen Seiten. Zuerst kam der Fabrikant; diesen verwarf ich von vornherein, weil er nicht in die Welt hinauskommt, sondern immer hinter seinen Maschinen kleben bleibt. Dann wurde mir der Engroshändler vorgeführt, gegen den ich mich ebenfalls entschied, da er beständig über den Büchern liegt und mit den Waren selbst, die mit ihrem eigentümlichen Duft und ihrer seltsamen Verpackung so schön an die fernen Länder erinnern, wo sie herkommen, fast gar nicht in Berührung kommt. Wechselgeschäfte waren mir von jeher in den Tod zuwider und zwar wegen eines eigenen Vorfalls. Ich hatte einst mit dem Sohne eines Bankiers innige Freundschaft geschlossen, war aber von ihm einem andern Jungen meines Alters, der einen bessern Rock trug, überhaupt reicher und vornehmer war als ich, aufgeopfert worden. – Meine Großmutter, der ich dies traurige Ereignis damals erzählte, entgegnete mir darauf in ihrer Weise: »Wer viel Geld im Beutel hat, dessen Herz ist kalt und matt.« Ich merkte mir das Sprichwort und nahm mir vor, nie ein Bankier zu werden und viel Geld zu bekommen, damit mein Herz nicht matt und kalt werde.
So war denn nach Beleuchtung dieser verschiedenen Handelsarten noch eine einzige übrig, für welche sich meine Verwandten einstimmig erklärten, hauptsächlich, weil die Erlernung derselben am wenigsten kostete. Es war dies das Handelsgeschäft in seinen kleinsten Anfängen, der Spezereiladen. Ich ließ mir den Vorschlag gefallen, und der ganze Familienrat freute sich darüber, mit Ausnahme der Schmiedin, deren Tränen während der ganzen Verhandlung sachte herabgeträufelt waren und jetzt wieder mit erneuter Gewalt flossen.
»Ach,« jammerte die Schmiedin, »jetzt soll das Kind ein Krämer werden und nicht ein Pfarrer, wie der selige Herr gewollt hat! Ach, Frau Pastorin,« wandte sie sich an meine Großmutter, »ich habe während seiner ganzen Kindheit seine Neigungen beobachtet und laß es mir nicht ausreden, daß er ganz zu einem Pfarrer geboren ist. Sie hätten ihn sehen sollen am Sonntagnachmittag, wenn es draußen regnete und er mit andern Kindern in der Stube spielen mußte. Denken Sie sich, Frau Pastorin, da nahm er sich eine schwarze seidene Schürze von mir, und ich mußte ihm von weißem Papier einen Kragen machen, wie ihn die geistlichen Herren tragen – so lang – und dann stellte er sich auf ein paar Stühle und hielt den andern Kindern eine Predigt, ganz wie in der Kirche. Sie bestand just wie dort aus zwei Teilen. Ach, das war gar zu schön!«
Fast hätte mich die Schmiedin verführt, aufs neue ein Duett mit ihr zu weinen, aber meine Großmutter sagte ziemlich ernst: »Sei Sie doch klug, Jungfer Schmiedin; man muß einem Kinde nie dergleichen vorsagen, was es doch nie erreichen kann. Sag' Sie ihm lieber etwas Gutes über den Kaufmannsstand. Freilich,« setzte die alte Frau mit einem Seufzer hinzu, »säh' ich meinen Enkel auch lieber auf der Kanzel als hinter dem Ladentisch. Aber der Wille des Herrn geschehe!«
Die Schmiedin, die eigentlich eine sehr kluge Person war, fügte sich mit großem Takt, und es dauerte nicht lange, so versicherte sie den anwesenden Damen, ich sei ein äußerst kluges Kind und habe eigentlich zu allem Talent. »Ach,« sagte sie, unter Tränen hervorlächelnd, wie die Sonne an einem Apriltage, »wenn er einmal Kaufmann ist, so wird er gewiß ein guter Korrespondent werden. Denken Sie sich, Frau Pastorin, da war der alte Fritz, der Briefträger – Gott hab' ihn selig! er ist lange tot und begraben – der brachte dem seligen Herr die Briefe, und da wollte der Junge auch seine Briefe haben und nahm immer Papierstreifen und machte Briefe daraus, ja, und gab sie dem alten Fritz, der sollte sie wegtragen, und da hätten Sie die Freude sehen sollen, wenn der am andern Tage dem Kinde dieselben Briefe als Antwort zurückbrachte. Dann nahm er meine Brille, setzte sie auf und las in den Papieren umher, ganz wie der selige Herr, kopfschüttelnd und lachend. O ott, o ott!«
So war es denn im Familienrat beschlossen und von mir genehmigt, daß ich meine kaufmännische Laufbahn in einer Spezereihandlung beginnen sollte. Ich hatte die Anfangsgründe dieses Geschäfts einigermaßen schon bei meiner Tante studiert und bildete mir ein, daß es nicht schwer sein würde, mich zu einem tüchtigen Kaufmann heranzubilden. Was meine Familie bewog, mich diesem Geschäftszweige zu widmen, war neben dem Geldpunkte die Rücksicht, daß ich, um eine derartige Stelle zu finden, wahrscheinlich die Stadt nicht zu verlassen brauchte. – Meine Großmutter nahm daher die neuesten Lokalblätter vor, um unter den Anzeigen nach einem Anerbieten zu suchen. Es fanden sich auch mehrere, doch führten sie alle eine Bedingung mit sich, die sich mit meinen Verhältnissen nicht vertrug. So hieß es: »Der Lehrling erhält Kost und Wohnung bei seinem Prinzipal, wofür eine angemessene Vergütung bezahlt wird.« Ein andermal war mit andern Worten dasselbe gesagt: man forderte vom eintretenden jungen Menschen jährlich ein gewisses Lehrgeld, wofür er Kost und Logis erhalten sollte.
Der Familienrat suchte lange vergeblich, um etwas zu finden, das ohne dergleichen unangenehme Bedingungen wäre, aber vergeblich, und so wurde einstimmig der Beschluß gefaßt, eine Anzeige für die Zeitung zu entwerfen, in der ich dem christlichen Mitleid empfohlen und als Lehrling angetragen würde. Meine Großmutter nahm zu diesem Zweck einen Bogen Papier vor sich, spitzte die Feder und fing an zu schreiben, während ihr die Schmiedin über die Achsel sah, wobei sie ihr Schnupftuch bereit hielt; ihr ahnendes Herz sagte ihr, daß sie bald wieder in den Fall kommen würde, einige bittere Tränen über mein Wohl zu vergießen. – Wirklich hatte auch die Großmutter kaum ein paar Worte geschrieben, so begann die Schmiedin ihr Gesicht zu verziehen, schüttelte den Kopf und sagte, die Augen voll Wasser: »Aber, Frau Pastorin, das Kind ist ja kein Subjekt.« – Ich horchte hoch auf, und selbst meine Tanten sahen bei dieser Aeußerung meine Großmutter fragend an; diese aber schrieb weiter, ohne sich irre machen zu lassen, und als sie geendet hatte, hob sie das Papier empor und las: »Ein junges Subjekt von guter Familie, ohne Vermögen, aber mit den nötigen Vorkenntnissen versehen, sucht eine Stelle in einem Spezereiladen, um dieses Geschäft zu erlernen, kann aber für Kost und Logis, die es im Hause haben müßte, nur eine sehr mäßige Vergütung bezahlen.«
Ich hörte dies ruhig zu Ende lesen, dann aber mischte ich mich auch einmal ins Gespräch und sagte zu meiner Großmutter ziemlich ernst: wie es mir vorkomme, sei ich doch eigentlich kein Subjekt, und ich habe eine solche Bezeichnung nie anders brauchen hören, als von Schullehrergehilfen, die eine Stelle suchen. wo es immer heiße, zu der und der Stelle mögen sich taugliche Subjekte melden. – Die Schmiedin, ohne ein Wort hervorbringen zu können, stimmte mir kopfnickend bei und selbst meine Tanten nahmen an dem Worte Subjekt Anstoß und brachten meine Großmutter endlich dahin, daß sie es abänderte und setzte: »Ein junger Mensch von guter Familie usw.« – Diesen Aufsatz mußte ich eigenhändig abschreiben, worauf ich beordert wurde, ihn auf die Zeitungsexpedition zu bringen, weshalb ich mein Mützchen von der Wand nahm und mich zum Fortgehen anschickte.
Die Schmiedin, deren tieffühlendes Herz wohl einsah, daß jetzt der entscheidende Augenblick gekommen sei, wo sich mein Leben zum Guten oder Bösen wenden müsse, eilte mir nach, um mich noch einmal weinend an ihr Herz zu drücken, wobei sie mir zugleich einen Silbergroschen in die Hand schob, den ich dankbar einsteckte und dazu eine Grimasse schnitt, als sei mir ebenfalls das Weinen näher als das Lachen. Sie wurde dadurch tief gerührt, und noch auf der Treppe hörte ich, wie sie schluchzend versicherte, ich sei das beste Kind von der Welt, und bei dem Talent, das ich zu allem besitze, würde ich selbst im Kramladen etwas Außerordentliches werden.
Zweites Kapitel - Herr Reißmehl.
Am Morgen nach diesem höchst merkwürdigen Tage war es mein erstes Geschäft, die Zeitung zu holen, um darin nachzusehen, ob die von meiner Großmutter verfaßte Urkunde über mich schon abgedruckt sei. Wirklich, da stand sie, schön und leserlich, und war im Viereck mit einem saubern, schwarzen Striche eingefaßt. Ich fühlte mich nicht wenig davon erbaut, daß etwas über mich gedruckt worden. Es dauerte auch nur wenige Tage, so begann die Anzeige zu wirken, und die Expedition der Zeitung schickte mehrere Briefe, die unter der bezeichneten Chiffre eingelaufen waren.
Meine Großmutter, die sichtlich darüber erfreut war, öffnete einen Brief nach dem andern, sah sich aber nach Durchlesung derselben sehr in ihren Erwartungen getäuscht; in allen diesen Briefen waren Bedingungen gestellt, die man nicht erfüllen konnte oder wollte. So hieß es in einem: »Auf die unterm 10. currentis in hiesiger Zeitung Nr. 20 unter Chiffre H. . eingerückte Anzeige fragt Unterzeichneter an, ob der ausgebotene junge Mensch auch von kräftigem Körperbau ist, da ihm bei uns unter anderm die Verpflichtung obliegen würde, die Gewölbe reinigen zu helfen.« Eine andere Epistel besagte nach ähnlichem Eingang: »Da ich mit meinem Spezerei- und Gewürzwarengeschäft den Verlag unseres vielgelesenen Lokalblattes »Der Verbreiter« verbunden habe, so gehört es zu den Obliegenheiten des fraglichen jungen Mannes, wöchentlich zweimal die Blätter dieses Journals den betreffenden Abonnenten zuzutragen.« Ein dritter, der zu meiner Person Lust trug, stellte die Anfrage, ob ich auch mit Kindern umzugehen wisse, da bei seiner zahlreichen Familie der Lehrling in seinen Mußestunden abends nach acht Uhr Lust und Liebe dazu haben müsse, seine älteren Kinder zu hüten und allerlei vernünftige und gefahrlose Spiele mit ihnen zu treiben. Ein Vierter, der sich mit salbungsvollen Worten danach erkundigte, ob der offerierte junge Mensch sich auch vor Gott eines wahrhaft christlichen Gemüts zu rühmen habe, würde meiner Großmutter schon angestanden haben, wenn dieser Fromme nicht eine unmäßig hohe Vergütung für Kost und Wohnung gefordert hätte.
So fand sich denn nichts Passendes für mich, und obgleich sich meine Großmutter damit zu trösten suchte, daß aller Anfang schwer sei und kein Baum auf den ersten Hieb falle, so war sie doch sichtlich über die schlechten Aussichten verdrießlich und behauptete fester als je, ich sei ein junger Taugenichts, auf dem der Segen des Herrn nicht ruhe. – Dieser schlechte Erfolg war mir um so verdrießlicher, da ich mich von meinen bisherigen Schulkameraden bereits mit einem gewissen Stolz abgesondert hatte und anfing, sie etwas von oben herab zu behandeln, wie es einem angehenden Geschäftsmann zukommt, der die Kinderschuhe abgetreten hat. Da lief noch spät ein Brief ein, den meine Großmutter hastig öffnete und mit vieler Zufriedenheit durchlas. Er war von Herrn Reißmehl, dem Inhaber einer mittelgroßen Spezereihandlung, der meine Familie persönlich kannte und ausnehmend annehmbare Bedingungen für mich stellte. Freilich sollte meine Lehrzeit fünf Jahre dauern, aber ich dafür alles unentgeltlich im Hause haben. Auch versicherte er in seinem Briefe, daß die Lehrlinge bei ihm nur zu den Geschäften des Ladens gebraucht werden und nicht, wie in so manchen andern Häusern, Dienste zu verrichten haben, die nicht für sie passen.
Ich kannte den Herrn Reißmehl sehr gut und hatte eigentlich diese annehmbaren Bedingungen nicht um ihn verdient. Das Haus, das er bewohnte, lag neben unserem Schulgebäude, und sein Garten stieß an unsern Spielplatz. Sie waren durch eine ziemlich hohe Mauer geschieden, was uns jedoch so wenig wie die Ermahnungen des Lehrers davon abhalten konnte, dem alten Nachbar allen möglichen Schabernack zu spielen. Sah man aber seine Figur an, so konnte man es uns jungen Leuten nicht verübeln, wenn das Ergötzen, das uns dieselbe verursachte, manchmal ausartete und uns zu allerlei abgeschmackten Spaßen antrieb.
Unsere Schule fing im Sommer um sieben Uhr an; wir fanden uns aber gewöhnlich schon eine halbe Stunde früher ein und erwarteten die Erscheinung unseres Nachbars, der regelmäßig eine Viertelstunde vor sieben Uhr in seinen Garten trat, um nachzusehen, wie viel seine Pflanzen und Gemüse über Nacht gewachsen waren. Er war dann bereits in vollem Staat und seine kleine, magere Figur aufs seltsamste geschmückt. Sein spitziges Gesicht war von einer braunen, fuchsigen Perücke gekrönt, auf welche er den kleinen runden Hut so stark vornüber gesetzt trug, daß die obere Kante desselben genau mit den Spitzen seiner Schuhe korrespondierte. Sein übriger Körper stak in einem braunen Rock, einer dito Weste und schwarzen, kurzen Beinkleidern mit weißen Strümpfen.
Kaum war er in den Garten getreten, so ging er mit ruhigen, gleichmäßigen Schritten auf eine alte Sonnenuhr los, die in einem Winkel desselben stand, und zerrte mit einigen gewaltigen Zügen an der stählernen Kette eine kleine, unförmlich dicke Taschenuhr heraus, um diese, wenn gerade Sonnenschein war, nach dem alten Gnomon zu richten. Nach diesem Geschäft zog er seine Schnupftabakdose hervor, klopfte bedächtig auf den Deckel und nahm eine Prise, während er sich wohlgefällig umsah. So weit war für uns, die aufmerksam zuschauende Schuljugend, die Sache nicht besonders auffallend und bemerkenswert. Nachdem nun aber der Herr Reißmehl seine Prise genommen hatte, begann er seine Runde im Garten, der wir mit der gespanntesten Aufmerksamkeit folgten, obgleich, oder vielmehr, weil wir alles, was kommen sollte, bis auf die kleinsten Einzelheiten voraus wußten; der Zeiger einer Uhr kann Tag für Tag nicht regelmäßiger über das Zifferblatt laufen als unser Nachbar durch seinen Garten.
Neben der Sonnenuhr stand ein großer Birnbaum; der alte Herr blieb davor stehen, blinzelte erst hinauf und versetzte dann dem Stamm mit der flachen Hand drei leichte Hiebe. Dann ging er gradeaus zu einer Reihe junger Obstbäume, von denen jeder nur ein einziges Mal von seiner Hand berührt wurde. Hatte er aber zufällig einmal einen übersprungen, so kehrte er sicher um und der arme Vergessene bekam dafür einen desto herzlicheren Handschlag. Dies letztere war es besonders, auf was wir in unserm Versteck an der Schulmauer lauerten, und, so oft der alte Herr einen der Bäume oder ein Stück des Geländers, das er jeden Morgen gleichfalls zu berühren pflegte, vergessen hatte, riefen wir ihm, laut lachend und spottend zu, er möchte doch gefälligst umkehren.
Diese Promenade durch den Garten dauerte ungefähr eine Viertelstunde, während welcher Zeit er, wie schon gesagt, jeden Tag regelmäßig dieselben Schritte machte, bei denselben Beeten und Bäumen stehen blieb, und immer die gleichen Stellen des Treppengeländers sowie des Gartenzaunes mit der Hand berührte. Der alte Herr war weit entfernt, sich durch unsern Spott und unser Geschrei gekränkt zu fühlen, vielmehr wandte er sich bei solchen Ausbrüchen unserer Freude nicht selten lachend gegen uns um und nickte uns mit seinem hagern, blassen Gesicht freundlich zu, ein Lächeln, das aber etwas so Sonderbares hatte, daß die kleineren Knaben darob in Angst gerieten und jedesmal unter die Mauer des Spielplatzes sprangen, wenn der alte Reißmehl uns so starr und mit so seltsamer Freundlichkeit ansah.
Gegen sieben Uhr hatte er seinen Spaziergang beendigt und wandte sich gegen das Haus zurück, wo sich unterdessen neben der Tür ein Fensterladen geöffnet hatte, aus welchem die Schwester unseres alten Nachbars, die Jungfer Reißmehl, herausschaute. Sie beschäftigte sich damit, eine flanellene Nachtjacke an die Sonne zu hängen, darauf warf sie einen prüfenden Blick über den Garten, zog sich dann in das Haus zurück, um die Gartentür von innen zu öffnen, und ließ einen kleinen, dicken Mops heraus, der alsbald mit großer Mühe in den Garten hinkte, um dort durch ein schwaches Knurren und Bellen seinem Herrn den Morgengruß zu bringen. – Um diese Zeit läutete droben unsere Schulglocke; wir hatten nun aber auch alles gesehen, was im nachbarlichen Garten vorfiel, denn nachdem der alte Mops einige Züge frischer Morgenluft geschöpft sowie ein anderes Geschäft verrichtet, watschelte er ins Haus zurück, gefolgt von Herrn Reißmehl, der nun zu seinem Kaffee ging. Im Vorbeigehen berührte er noch seine Flanelljacke an vier Stellen mit der Hand, drückte die Türklinke jedesmal mit zwei Händen auf und verschwand im Hause, nachdem er vorher regelmäßig ein paarmal gehustet hatte.
Dieser Herr Reißmehl war es also, der auf die Anzeige in der Zeitung sich unter so annehmbaren Bedingungen bereit erklärt hatte, mich praktisch und theoretisch zum Kaufmann ausbilden zu helfen. Meine Großmutter, die zur Erörterung dieser wichtigen Frage einen zweiten Familienrat zusammenberufen, war sehr für unsern Schulnachbar, ebenso meine Tante, und ich selbst hatte für meine Person auch nichts gegen Herr Reißmehl. So große Ursache er hatte, über mich und meine Kameraden ungehalten zu sein, so war er doch weit entfernt davon; er gab uns vielmehr, wenn wir die Schule verließen und er unter der Tür seines Ladens stand, zahlreiche Beweise seiner Freundlichkeit und seines Wohlwollens, bestehend in ganzen Händen voll Rosinen, Mandeln und getrockneten Pflaumen. Wem aber das Ding gar nicht einleuchtete, das war die Jungfer Schmiedin. Obgleich sie aufs kräftigste nach Fassung rang, so konnte sie dennoch einigen Tränen nicht verbieten, über die Wangen hinabzurollen. Sie schüttelte lange wehmütig den Kopf, als meine Großmutter das vorteilhafte Anerbieten des Herrn Reißmehl auseinandersetzte, doch wagte sie es nicht, die alte Frau zu unterbrechen, und erst als diese geendigt und der ganze Familienrat halb und halb seine Zustimmung gegeben, versuchte sie es mit einigen schwachen Worten, dem Projekt entgegenzuarbeiten.
»Ach, Frau Pastorin,« sagte sie, »Gott soll mich bewahren, daß ich mir je einfallen ließe, über einen Mitmenschen etwas Böses zu sagen, aber vom alten Reißmehl munkelt man doch so allerlei, so seltsame Sachen, ja –« – »Nun, was denn?« fiel ihr meine Großmutter etwas barsch in die Rede. – »Ach, Frau Pastorin, Sie glauben freilich so etwas nicht, und ich für mein Teil, nun ja, ich will es auch eigentlich nicht beschwören, aber man behauptet, der alte Reißmehl müsse etwas auf dem Herzen haben, denn er steige beständig ohne Ruhe in seinem Hause umher, fasse überall mit der Hand hin, als suche er etwas; kurz, Frau Pastorin, es ist nicht richtig.« – »Ja, Großmutter,« fiel ich der Schmiedin altklug in die Rede, »daß er überall herumtappt und alles angreift, das habe ich auch schon oft gesehen.«
Aber meine Großmutter erklärte alles das für dummes Zeug und schrieb ohne Verzug einen eigenhändigen christlichen Brief, wie sie es nannte, an Herrn Reißmehl, in dem sie mit ihm noch einiges über meine Lehrzeit besprach, und als der alte Herr noch an demselben Tage befriedigend geantwortet hatte, war ich Reißmehlscher Lehrling und mußte tags darauf meine Funktion antreten. Meine Tante packte mein bißchen Wäsche und meine Kleider in einen kleinen Koffer, die Großmutter schenkte mir ein Exemplar der Bibel, ein paar Gesangbücher und eine mehrbändige Predigtsammlung, und im Augenblick, da ich das Haus verlassen wollte, um meinen ersten Schritt ins Geschäftsleben zu tun, erschien die Schmiedin in der Haustür und übergab mir mit abgewandtem Gesicht ein Paar Ueberärmel von dunklem Kattun, die sie für mich genäht, wobei sie mich bat, ihrer nicht zu vergessen.
Ich schritt allein und nachdenklich durch die Straßen und stand bald vor dem Reißmehlschen Hause, wo ich mit einem tiefen Seufzer stehen blieb, um am Schulgebäude nebenan hinaufzublinzeln, wo ich so manche süße und schmerzliche Stunde verlebt. Diese beiden Häuser sahen mir, obgleich ich mit großen Hoffnungen in den Kaufmannsstand trat, wie die Bilder der Vergangenheit und Zukunft aus. Die niedrige, aber freundliche, neugebaute Schule mit ihren hellen, großen Fenstern war mir nie so heimisch erschienen, wie gerade am heutigen Morgen, da ich an der offenen Tür vorbei mußte, um in das Nebenhaus zu treten, das ein so ganz anderes, ernstes und gebietendes Aussehen hatte. Es war eines jener Gebäude, wie es deren in alten Städten noch so viele gibt, hoch, schmal, mit kleinen, unregelmäßigen Fenstern, die so wirr durcheinander standen, daß es von außen schwer zu bestimmen war, wie viele Stockwerke das Haus eigentlich habe. Der Giebel war der Straße zugekehrt und seine Pyramide mit einer alten, hölzernen Figur gekrönt, der aber der Kopf fehlte. Im untern Stock war das Ladengewölbe, und vor demselben, am Eingang, stand eine alte, steinerne Figur, roh ausgehauen, die einen mittelalterlichen reisigen Knecht vorstellte, der seltsamerweise mit einer ungeheuer langen Nase versehen war. Die Nase dieses steinernen Kerls hatte uns von jeher nicht wenig ergötzt. Wie oft war sie von einigen der mutigsten unter uns mit roter, grüner oder gelber Farbe angestrichen worden; wie oft hatten wir eine Tonkugel an sie geklebt und dergleichen mehr getrieben! Sie war vom ewigen Anfassen und Betasten so glatt wie ein Spiegel geworden und glänzte weithin.
Es war mir ganz bange ums Herz, als ich so vor den beiden Häusern stand, und so oft ich einen Schritt machen wollte gegen das Reißmehlsche Haus, hielt mich das Summen und Lärmen in den Schulzimmern fast gewaltsam zurück, und ich hörte mit Lust meinen Kameraden zu, die jetzt ihre Singestunde anfingen. Ich sah sie von den Bänken aufstehen, sah, wie sie die kleinen Bücher zur Hand nahmen, aus denen auch ich hundertmal gesungen, und als sie ein altes, bekanntes Lied anstimmten:Der Winter ist gekommen, Der Winter mit seinem Schnee usw.
da überfiel mich die Wehmut, und es ging mir wie der Schmiedin. Da stand ich zwischen den beiden Häusern, ein armes, verlassenes Kind: dort die Schule, aber sie mit ihrem lieben Spielplatz – für mich war sie nicht mehr da, und hier das Leben, es winkte mir so ernst und düster. Der steinerne Soldat schien mir zum erstenmal ein recht spöttisches Gesicht zu machen; auf seiner glänzenden Nase funkelte und lachte die Wintersonne. Und doch war ich froh, daß es nur die Wintersonne war, die zwischen Schneewolken hindurch meinem Lebenswechsel zusah. Ja, ich war herzlich froh darüber; denn hätten meine Kameraden dort oben etwa gesungen:Der Mai, er ist gekommen Mit Blüten und Sonnenschein usw.
wie viel schwerer wäre mir das Herz geworden, und wer weiß, ich wäre wohl gar zu meiner Großmutter zurückgelaufen und hätte ihr weinend erklärt, ich wolle nun und nimmermehr in das finstere Haus zum Herrn Reißmehl. In der Angst hätte ich vielleicht gelogen und versichert: »Ja, Großmutter, der steinerne Kerl an der Haustür mit der langen Nase hat mir erzählt, die Jungfer Schmiedin habe recht, es sei in dem Hause recht finster und unheimlich.«
Doch jetzt verhallte der Gesang in der Schule, ich hörte die Stimme des Lehrers, der laut ermahnte, hübsch still und ordentlich nach Hause zu gehen; die Bücher schlugen zu, die Rechentafeln klapperten, und ich, um von meinen ehemaligen Kameraden nicht beim Eintritt ins bürgerliche Leben überrascht zu werden, trat schnell in den Laden des Herrn Reißmehl.
Drittes Kapitel - Philipp.
Ich trat in den Laden des Herrn Reißmehl.
Wem schweben nicht aus seiner Kindheit die Gewölbe vor, in welchen Zucker, Rosinen, Mandeln und dergleichen Herrlichkeiten verkauft werden? Wer gedenkt nicht der Zeiten, wo er mit einigen eroberten Pfennigen vor den Ladentisch trat, seinen Gelüsten den Zügel schießen ließ und Kandiszucker und getrocknete Pflaumen verlangte? Mit welch gierigen, neidischen Augen sah man damals in die Kästen, in welchen diese Artikel aufbewahrt wurden, und wünschte nichts sehnlicher, als im vertrauten Umgang mit diesen Schubladen leben zu können, um ihres Inhalts zu genießen, so oft es einem einfiele! Törichte Wünsche! sie ändern sich wohl mit den Jahren, aber sie verlassen uns nie! Als ich aber an jenem Morgen in den Laden meines künftigen Herrn trat, dachte ich nicht an den süßen Inhalt der Fächer, nein, ich wünschte mit Sehnsucht den Augenblick herbei, wo ich, ein gelernter Kaufmann, dieses Gewölbe verließ, um in das Leben hinauszutreten, wo ich der Seestadt zueilte mit ihrem unendlichen Wasserspiegel und ihrem Mastenwald.
Ich konnte diesen Träumen nicht lange nachhängen; Herr Reißmehl, der meiner bereits ansichtig geworden war, trat aus einer kleinen Glastür, über welcher mit goldenen Buchstaben das Wort Schreibstube zu lesen war. Sein hageres Gesicht hatte ganz denselben freundlich lächelnden Ausdruck, mit dem er im Garten unsere Spöttereien hinnahm; nur trug er auf dem Kopfe statt des Hutes eine weiße Nachtmütze, und statt des braunen Rocks hatte er eine rund abgeschnittene Jacke an. Vom Handgelenk bis zum Ellbogen reichten ein Paar dunkelfarbige Ueberärmel, die auf der untern Seite ganz glänzend waren. Auch hatte der gute Mann eine Brille auf der Nase, die er beim Eintritt in den Laden fester gegen die Augen drückte. Wie es einem so gehen kann, ich hatte den Herrn Reißmehl in meinem Leben viele hundertmal gesehen, aber ihn noch nie ein Wort sprechen hören, so daß mir nicht anders war, als besitze er diese edle Gabe gar nicht, und ich ihn mir nur stumm dachte. Auch an diesem Morgen wurde ich nicht sogleich aus meiner Täuschung gerissen, denn er sah mich durch seine Brille an, nickte ein paarmal freundlich mit dem Kopfe und blickte alsdann auf dem Ladentisch umher, wo seine Augen auf einer kleinen feuchten Stelle haften blieben. Er trat hinzu, wischte etwas mit dem Finger davon auf und brachte es an seine Nase, um sich durch den Geruch zu überzeugen, was es eigentlich sei; zugleich fixierte er es so scharf mit seinen Blicken, daß ihm die Augen ganz schief standen; dennoch aber mußte er den Sinn des Geschmacks zu Hilfe nehmen.
»Ei, ei, so, so!« murmelte er vor sich hin, und ich war ordentlich überrascht, ihn sprechen zu hören; »hm, hm, 's ist Kornbranntwein, doppelter, vom sechsundzwanziggrädigen; sollte nicht so leichtsinnig verschüttet werden! He, Philipp!« – Darauf wandte er sich an mich und begrüßte mich mit den Worten: »Aha! mein lieber junger Mann! scharmant, scharmant, daß Sie heute kommen! aber Ihre Frau Großmutter, die gute Frau, hat Ihnen wahrscheinlich nicht die Stunde angegeben. Ich hatte sie gebeten, die Frau Pastorin, Sie um zwölf Uhr zu schicken. Es sind aber auf meiner –« mit diesen Worten haspelte er die lange Stahlkette und an derselben den dicken Uhrkasten hervor – »es sind aber auf meiner Uhr schon fünf Minuten drüber, fünf Minuten! ei! ei! – He, Philipp!« rief er jetzt abermals ins Haus hinein. »Wo steckt Ihr?«
Der Gerufene erschien langsamen Schrittes und zeigte eine solche Figur und stellte sich mit so ernstem, feierlichem Blick unter die Tür, daß, wenn es nicht heller Mittag gewesen wäre, ich auf alle Fälle geglaubt hätte, Herr Reißmehl habe einen Geist zitiert. Philipp, so hieß die Erscheinung, war ein ziemlich langer Bursche, der wegen übergroßer Magerkeit noch länger aussah, als er wirklich war. Er hatte hellblondes, fast gelbes Haar, das von beiden Seiten des Scheitels, den er mitten auf seinem Schädel angebracht, borstig und straff herabhing und so von weitem einem kleinen Strohdache nicht unähnlich sah. Mochte es diese Frisur sein, die zum Gesicht gar nicht paßte, oder war es der feierliche, gravitätische Ausdruck in Philipps Gesicht, das seinesteils mit den langen, schlottrigen Gliedmaßen gar nicht übereinstimmte, genug, die ganze Figur hatte etwas überaus Komisches. Philipp also, mein kollegialischer Vorgesetzter, erschien unter der Tür und hatte, beiläufig gesagt, so lange Arme, daß er, ohne sich zu bücken, bequem seine Knieschnallen hätte lösen können, wenn er welche gehabt hätte.
»Philipp,« fragte der alte Herr, »warum wird denn immer der Ladentisch voll Branntwein geschüttet? Ich kann das nicht leiden! Habe ich doch alle möglichen Lappen und Schwämme angeschafft. Ei, ei! das Holz wird schmutzig und der gute sechsundzwanziggrädige Branntwein vergeudet.« – Philipp wandte den Kopf stark auf die linke Seite, wahrscheinlich aus Demut, und um, da er größer als der Prinzipal war, diesem nicht von oben herab ins Gesicht sehen zu müssen. Dann öffnete er seinen breiten Mund und sagte mit leiser Stimme und einer Langsamkeit, wie ich in meinem Leben nichts Aehnliches gehört: »Herr Prinzipal, 's ist nur ein Versehen. Als ich den Branntwein hier gemessen hatte, fing drinnen das Möpschen so an zu heulen, daß ich eilig hineinging, um nachzusehen.« – »Ei, ei, so, so!« fiel ihm der Alte in die Rede. »Was ist der armen Fanny geschehen?« – »O, nichts, Herr Prinzipal,« antwortete Philipp; »sie lag nur am Fenster in der Sonne, ja, und da kam eine Wolke und machte Schatten, und das mißfiel dem armen Hunde.« – »Nun, nun,« entgegnete Herr Reißmehl, »laßt nur gut sein, die Sonne wird schon wiederkommen. Hier ist unser neuer Lehrling,« fuhr er fort, indem er auf mich zeigte. – »Ich hoffe, Philipp, Ihr werdet Euch seiner aufs beste annehmen und ihn nach und nach mit allem bekannt machen.«
Philipp hob jetzt seinen Kopf einen Augenblick in die Höhe, um mich etwas von oben herab anzusehen; dann aber ließ er ihn auf die rechte Seite sinken und versicherte dem Prinzipal, er werde sein möglichstes tun, mich aufs beste heranzubilden. Darauf zog sich Herr Reißmehl in seine Schreibstube zurück, und ich folgte meinem neuen Lehrer in das Ladenstübchen, wo er gleich seinen Unterricht begann. Ich mußte die Ueberärmel anziehen, die mir die Jungfer Schmiedin genäht hatte, und als mir darauf Philipp eine grüne Schürze gab, welche ich um meine Lenden gürtete, gedachte ich lebhaft der guten Person, und was sie wohl sagen würde, wenn sie mich in diesem Aufzug sähe.
Das erste, wozu mir Philipp Anleitung gab, war das edle und notwendige Geschäft des Tütenmachens, und da ich die Anfangsgründe desselben bereits bei meiner Tante erlernt hatte, so ging die Arbeit rasch von der Hand. Ich merkte mir schnell die verschiedenen Größen und Formen, die im Reißmehlschen Geschäft gang und gäbe waren, und als der Prinzipal um ein Uhr in das Ladenstübchen trat, um uns zum Mittagessen zu rufen, war er sichtlich erfreut über meine reißenden Fortschritte und versicherte, ich würde mich bald in das Praktische eingeschossen haben.
Bei der Mittagstafel wurde ich der dritten Person des Hauses, der Schwester unseres Prinzipals, der Jungfer Barbara Reißmehl, vorgestellt, die ich schon von ihrem täglichen Erscheinen am Gartenfenster her kannte. Diese gute Person war über die Blüte ihres Lebens hinaus, und von der Frische und Regsamkeit der Jugend war ihr nichts geblieben als eine Lebendigkeit der Sprachorgane, die in Erstaunen setzen konnte. Sie war äußerst liebenswürdig gegen mich, und während sie ihre Suppe verzehrte, erzählte sie mir von meiner Großmutter, von allen meinen Tanten und von einer Menge anderer Personen, die als Staffage dieser Geschichte dienten. Der Prinzipal dagegen war bei Tische äußerst schweigsam, was mir keinen übeln Begriff von seinem Verstand gab oder von seiner Güte gegen uns. Hätte er auch erzählt, wie Jungfer Barbara, so würden wir schwerlich einen Bissen hinunterbekommen haben; denn der Anstand erforderte es doch, wenn sie in ihrer Erzählung an einen wichtigen Moment kam, was leider gar zu oft geschah, daß wir Messer und Gabel ruhen ließen, um aufzuhorchen. Philipp machte es wenigstens so und saß fast das halbe Mittagessen über aufmerksam lauschend, mit offenem Maule da; ein Benehmen, wodurch er sich offenbar in der Gunst Barbaras festgesetzt hatte. Ich bin aber noch heutigen Tages des Glaubens, daß eben hierdurch seine Magerkeit täglich zunahm.
Nach dem Essen wünschte Philipp dem Prinzipal und Jungfer Barbara eine gesegnete Mahlzeit, ich tat desgleichen, und wir zogen uns zurück. Der Nachmittag wurde dazu angewendet, mich noch ferner ins Praktische einzuschießen, und ich lernte allerhand schöne und nützliche Dinge, als: Oel und Essig ausmessen, wobei mir aber ein kühner und geschickter Handgriff Philipps, um die vom Maß abträufelnde Flüssigkeit wieder in den Trog zu streifen, nicht gleich gelingen wollte. Auch lehrte er mich, wie man Kaffee, Zucker usw. abzuwiegen habe, ohne die Kunden zu beeinträchtigen und dem Prinzipal zu schaden. Während dieser Lektion verschwand einmal mein junger Vorgesetzter in das Nebenzimmer, wo wir gespeist hatten. Dann hörte ich zuweilen die Stimme der Jungfer Barbara leise sprechen, und mein feines, geübtes Ohr vernahm deutlich das Geklapper von Tassen, ein Geräusch, das zu süßen Hoffnungen berechtigte, die aber wenigstens für mich nicht in Erfüllung gingen. Philipp dagegen schien der Jungfer Barbara eine Kaffeevisite gemacht zu haben, denn obgleich er sich bei der Zurückkunft mit dem oberen reinlichen Teile seines Ueberärmels das Gesicht tüchtig wischte, konnte er doch einige braune Flecken nicht vertilgen, die sich in seinem langen, faltigen Mundwinkel festgesetzt hatten. Natürlich verdroß mich diese Vernachlässigung meiner Person, da ich obendrein heute noch als Gast betrachtet werden konnte. Da bemerkte ich aber zu meiner großen Verwunderung, daß der gute Prinzipal ebensowenig zum Kaffee geladen wurde, oder überhaupt welchen erhielt wie ich; vielmehr erklärte ihm später Jungfer Barbara auf seine Frage ins Nebenzimmer hinein, ob heute Kaffee bereitet würde, sie habe keine Zeit. O eh! in mir stiegen ganz sonderbare Ideen auf, und wenn ich in Jungfer Barbara alsbald eine mächtige Person erkannt hatte, so konnte ich nach diesem Vorfalle nicht umhin, erstaunt an Philipp hinaufzusehen. Welche enormen Talente und Kenntnisse muß er besitzen, um sogar vor dem Prinzipal einen Vorzug zu erhalten!
Als es Abend wurde, gegen acht Uhr, zog der Herr Reißmehl seine Schreibärmel und seine Jacke aus, die er hinter seinem Pult an einen großen Nagel hing; seine Nachtmütze setzte er einem kleinen steinernen Ungeheuer auf, das auf dem Ofen stand, und dem er dabei freundlich auf die Backen klopfte, dann schloß er die Schreibstube ab, warf sich in das Kostüm, in dem er seine Gartenvisiten machte, setzte den Hut ebenso vornüber und vervollständigte diesen Anzug durch ein langes spanisches Rohr mit silbernem Knopfe, worauf er sich bei Jungfer Barbara beurlaubte, einen prüfenden Blick im Laden umherwarf, hier und da eine Schublade zudrückte, die etwas geöffnet war, oder ein Gefäß vorzog, das zu weit nach hinten stand. Als er bei mir vorbeikam, sah er mich einen Augenblick durch seine Brille an, nickte mit dem Kopfe und fragte, wie mir das Geschäft gefalle. Darauf blieb er unter der Ladentür stehen und rief den Mops, die kleine Fanny, heraus, die auch herbeigewatschelt kam und den Prinzipal bis vor das Haus begleitete, dann aber eilends zurückkehrte.
Philipp gab mir einige blecherne Oelmaße zu putzen, und während ich dies Geschäft besorgte, verschwand er ins Nebenzimmer, von wo er erst gegen neun Uhr wiederkehrte, um mir Anleitung zu geben, wie die Läden des Gewölbes zu schließen seien. Darauf holte er eine große kupferne Lampe, zündete sie an, und wir stiegen die Treppen hinauf, nachdem mir vorher im Laden ein frugales Abendbrot, aus einem Butterbrot und einem Glase Bier bestehend, vorgesetzt worden war.
Viertes Kapitel - Ein Nachbar.
Das Reißmehlsche Haus war im Innern ebenso unheimlich und finster, wie es auf der Straße erschien. Fast kein Zimmer lag mit dem andern in gleicher Höhe; die Gemächer waren durch eine Menge kleiner Treppen, die bald auf, bald ab führten, miteinander verbunden. Diese Treppen waren alt, von braunem Holz, mit geschnitzten Lehnen, und krachten bei jedem Tritt. An jeder Wendung derselben waren überdies seltsam geformte hölzerne Figuren zu sehen, die einen so unerwartet bald anlachten, bald angrinsten, daß es mir, als ich zum erstenmal hinaufstieg, nicht übel zu nehmen war, wenn ich vor diesen Gestalten zurückfuhr, die beim flackernden Lampenlicht zu leben und sich zu bewegen schienen. Was das Unheimliche noch vermehrte, waren kleine runde oder eckige Fenster, die fast aus allen Zimmern auf die Treppe gingen und beim Schein des Lichts wie dunkelglänzende Augen aussahen. Ich muß gestehen, ich fürchtete mich ein wenig; ich mußte immer an den steinernen Kerl mit der langen Nase draußen vor dem Hause denken, und ich weiß nicht, wie mir die tolle Idee kam, die mich die ganze Nacht im Traume verfolgte, als haben die hölzernen Figuren mit jenem steinernen Soldaten, der früher im Hause selbst placiert gewesen, in der Mitternacht Streit bekommen und ihn vor die Tür gesetzt.
Ueber die Treppen des ersten Stocks eilte Philipp rasch hinweg und sagte mir auf meine Frage leichthin, er sei unbewohnt. Im zweiten Stock ging er langsamer und zeigte mir die Schlafzimmer des Prinzipals und der Jungfer Barbara. Dann ging es eine alte Wendeltreppe hinauf in den dritten Stock, wo unsere Kammer lag. Dieses Gemach war durch eine dünne Bretterwand in zwei Teile geschieden, in deren jedem ein Bett stand, meines an der äußern Mauer, so daß sich das Dach liebend darüber hinbeugte. Der Baumeister mußte große Vorliebe für das Schnitzwerk gehabt haben, denn selbst die Balken des Daches waren verziert und bemalt; wo sie auf der Mauer auflagen, sah man groteske Köpfe von Menschen und allerhand Untieren, die mein Bett lachend und grinsend umstanden. Am Fußende desselben war ein Fenster, welches auf den Zwischenraum ging, der uns vom Nachbarhause trennte, ein Zwischenraum, keine drei Fuß breit, aber desto tiefer, denn beide Gebäude hatten eine ansehnliche Höhe. Diesem Fenster gegenüber befand sich im Nachbarhause ein anderes, das etwas tiefer, aber uns so nahe lag, daß man leicht mit der Hand hinüberreichen konnte. Im ersten Gemach, wo Philipp schlief, stand ein kleiner Ofen, und mein Kollege bemühte sich, ein kleines Feuer anzuzünden, das aber bei der Größe des Raumes ungefähr dieselbe Wirkung hervorbrachte, wie respektive das Butterbrot vorhin in meinem Magen, weshalb wir ein paar Stühle so nahe wie möglich an den Ofen rückten und eine Unterhaltung begannen, in welcher Philipp mir die allgemeinen Begriffe vom Handel beizubringen suchte. Er sprach vom Verkauf überhaupt, kam dann aufs Kreditgeben im speziellen, und versicherte mir, es sei äußerst schwierig, eines ohne das andere zu treiben, und doppelt schwierig, die rechte Mitte zwischen beiden zu beobachten.
Mitten in diesem interessanten Gespräch wurden wir plötzlich durch sonderbare Töne unterbrochen, die draußen vor unserem Fenster erklangen. Man konnte es für eine Art Gesang halten, es glich aber auch dem Geheul eines großen Hundes. Ich horchte und sah meinen Kollegen fragend an, der aber ein unruhiges, verdrießliches Gesicht machte und mit seiner traurigen Stimme sagte: »Ach, es ist unser Nachbar, der Herr Burbus, der eben nach Hause kommt.« – »Der Herr Burbus?« fragte ich. »Wer ist das?« – »O,« entgegnen Philipp ängstlich, »Sie werden ihn schon noch kennen lernen, werden ihn gewiß noch kennen lernen – hören Sie?«
Es wurde an unser Fenster gepocht, und gleich darauf vernahm man eine tiefe Baßstimme, die mit großer Jovialität rief: »He, Herr Philipp! – junges, langbeiniges Individuum! kaufmännisches Genie!« Es pochte stärker, und nicht lange, so schrie es deutlicher: »Oeffnen Sie doch Ihre langen Ohren, Sie Ritter von der traurigen Gestalt!« – Philipp war indessen bereits aufgestanden, zog auf meine leise Frage, was denn das bedeute, seine spitzen Schultern so hoch empor, daß sie fast seine lang herabhängenden Ohrlappen berührten, und ging ins Nebenzimmer, wo er stillschweigend das Fenster an meinem Bett öffnete. – »Guten Abend, Herr Burbus!« – »Herr Doktor Burbus! Ich habe Ihnen das schon tausendmal gesagt.« – »Was wünschen Sie, Herr Doktor Burbus?« – »Liebster Jüngling,« entgegnete die Baßstimme freundlicher, »Sie würden mich durch ein kleines Anlehen von etlichem Holz und Kohlen sehr glücklich machen. Es ist verdammt kalt, und ich vergaß heute morgen, der Magd zu befehlen – ich gab ihr vielmehr Geld zum Einkauf dieser Gegenstände, und die Person hat's vergessen. – Da, hier ist mein Nachtsack; füllen Sie gefälligst etwas hinein.«
Bei diesen Worten fiel etwas in meinem Zimmer auf den Boden, und Philipp kehrte gleich darauf zu mir zurück, in der Hand einen Nachtsack, der so schmutzig war, daß man ihm ansah, er habe schon verschiedene Male denselben Dienst wie heute versehen. Mein Kollege bückte sich seufzend zum Ofen nieder, schaufelte eine Partie Kohlen hinein, nahm ein Scheit Holz unter den Arm und trug beides ins Nebenzimmer. Darauf sprach die Baßstimme: » Merci, Jüngling!« Das Fenster wurde geschlossen, und der heulende Gesang tönte, nur gedämpfter, noch eine gute Weile fort.
Ich sah Philipp fragend an; so neugierig ich war, warum mein Vorgesetzter jenes unbescheidene Verlangen alsbald erfüllt hatte, so mochte ich doch das tiefe, melancholische Nachdenken, in welches er versunken war, nicht unterbrechen, sowie das Selbstgespräch, das er dazu hielt. »Ja,« murmelte er vor sich hin, »es ist noch mein Tod! er soll, er muß mich in Ruhe lassen! ich will alles, alles sagen – alles?« setzte er fragend hinzu und seufzte tief auf: »Nein, nein, ich kann nicht. – O Barbar –« Hier unterbrach er sich, und ich blieb im Zweifel, ob er Barbar sagen wollte oder eine verhängnisvolle Endsilbe verschluckte. Mit trübem Blick schaute er darauf ins Feuer und war sichtlich tief ergriffen. Es mochte ihm wohltun, seine Brust in etwas zu erleichtern; nach einem tiefen Seufzer und ohne auf eine ausdrückliche Frage von meiner Seite zu warten, hob er an zu erzählen:
»Als ich vor drei Jahren hier ins Haus kam, wohnte ich gleich in diesem Zimmer hier und es gefiel mir ganz wohl. Ich lebte den Tag über meinem Geschäft, denn damals schwärmte ich für den Spezereihandel noch mehr als jetzt. Ich liebte meine Tüten und konnte stundenlang den Kaffee und Reis durch die Finger gleiten lassen, mich freuen über ihre Güte. Das Zimmer im Nachbarhause drüben war noch leer; es diente als Rumpelkammer. Da sah ich, wie man eines Tages die Fenster öffnete, wie die alten Möbel hinausgeschafft wurden und man den Boden fegte. Ich erfuhr, die Stube sei an einen medizinischen Studenten vermietet, der frisch von der Universität komme und hier eine Zeitlang still für sich leben wolle, um sich auf das Examen vorzubereiten. Ich freute mich ordentlich auf diesen Herrn; da unsere Fenster so nahe beisammen liegen, hoffte ich auf manche geistreiche Unterhaltung mit dem jungen Doktor drüben und dachte dabei namentlich, meine Kräuterkenntnis zu vermehren, denn wir machen auch in Kräutern. – Aber, akuter Gott! Er zog ein, denken Sie sich, er zog ein, mit drei Büchern – ein Student mit drei Büchern! aber mit einem Dutzend Pfeifen, mit einem ungeheuren Bierglase und etlichen Mordwaffen und, was glauben Sie? – mit – dem Gerippe eines Menschen! Die Magd drüben hat mir erzählt, ihre Madame sei beim Anblick dieses scheußlichen Dinges in Ohnmacht gefallen und habe verlangt, der Student solle sogleich wieder ausziehen, worauf dieser sie ausgelacht habe und dageblieben sei. Er ließ sich nicht vertreiben, und die Polizei, an die man sich wendete, sagte, man könne nichts tun. Als man drauf dem Herrn Burbus gleich wieder aufkündigte, versicherte er lachend, er wolle gern das Mäuseloch räumen, aber sein Skelett habe eine solche Neigung zum düstern Zimmerchen gefaßt, daß es jedenfalls in Person der Frau vom Hause seine Aufwartung machen und um Verlängerung des Mietkontraktes anhalten würde. Ich bitte Sie! fassen Sie den gräßlichen Gedanken? Auch bekam unsere Nachbarin die allerbedenklichsten Zufälle, und ich hatte einen ganzen Tag fast nichts zu tun, als Kampfer und Hirschhorngeist für sie abzuwiegen. Herr Burbus aber blieb, und denken Sie sich, er erwarb sich die Freundschaft der Madame drüben, aber durch einen für uns sehr betrübten Vorfall.