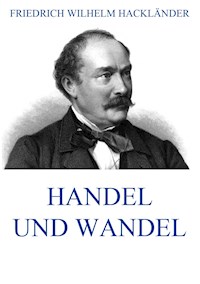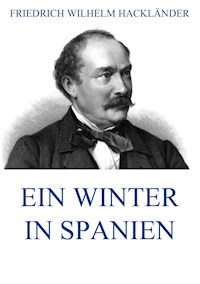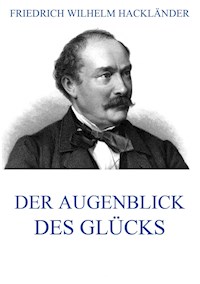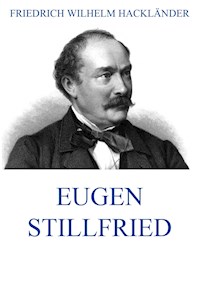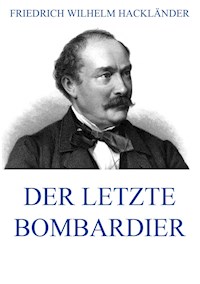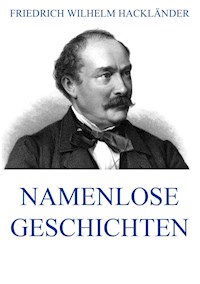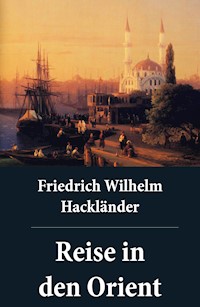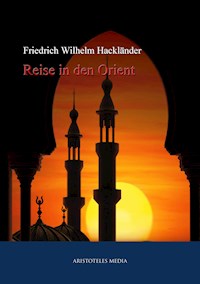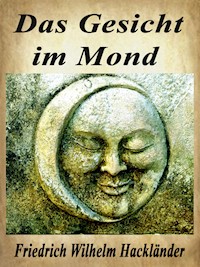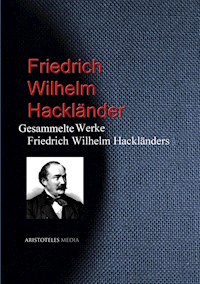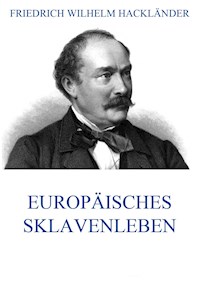
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bis heute gilt dieses Werk als das erfolgreichste Hackländers. Seine Schilderungen der sozialen Notstände der handelnden Personen aus sehr unterschiedlichen Gesellschaftskritiken und deren Eingebundenheit in ihre ureigenen Probleme und Pflichten bleiben lange im Gedächtnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1832
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Europäisches Sklavenleben
Friedrich Wilhelm Hackländer
Inhalt:
Friedrich Wilhelm Hackländer – Biografie und Bibliografie
Europäisches Sklavenleben
Erster Band
Erstes Kapitel. Der Theaterwagen.
Zweites Kapitel. Schwarze und rothe Schleifen.
Drittes Kapitel. Sclavinnen.
Viertes Kapitel. Ein Loch im Vorhange.
Fünftes Kapitel. Clara.
Sechstes Kapitel. Die Familie Wundel.
Siebentes Kapitel. Sklavenleben.
Achtes Kapitel. Arthur.
Neuntes Kapitel. Coeur de Rose.
Zehntes Kapitel. Herr von Dankwart.
Eilftes Kapitel. Zwei Begräbnisse.
Zwölftes Kapitel. Johann Christian Blaffer und Comp.
Dreizehntes Kapitel. Uebesetzungs-Angelegenheiten.
Vierzehntes Kapitel. Häusliche Scenen.
Fünfzehntes Kapitel. Lebende Bilder.
Sechszehntes Kapitel. Eine Mutter und ihr Kind.
Siebenzehntes Kapitel. Falsches Zeugniß.
Achtzehntes Kapitel. Hinter der achten Coulisse.
Neunzehntes Kapitel. Richard und Marie.
Zwanzigstes Kapitel. Toiletten-Geheimnisse.
Zweiter Band
Einundzwanzigstes Kapitel. Jäger und Kammerjungfer.
Zweiundzwanzigstes Kapitel. Auf der Polizeidirektion.
Dreiundzwanzigstes Kapitel. Räubergeschichten.
Vierundzwanzigstes Kapitel. Papier und Schlüssel.
Fünfundzwanzigstes Kapitel. Das Siegel des Herrn von Brand.
Sechsundzwanzigstes Kapitel. Illustrationen.
Siebenundzwanzigstes Kapitel. Ein einfaches Mittagessen.
Achtundzwanzigstes Kapitel. Betrachtungen.
Neunundzwanzigstes Kapitel. Eine Probe lebender Bilder.
Dreißigstes Kapitel. Gesellschaftliche Correspondenzen.
Einunddreißigstes Kapitel. Winterhalter's Decamerone.
Zweiunddreißigstes Kapitel. Im Fuchsbau.
Dreiunddreißigstes Kapitel. Sklavengeschichten.
Vierunddreißigstes Kapitel. Er! –
Fünfunddreißigstes Kapitel. Ein geheimes Gericht.
Sechsunddreißigstes Kapitel. Jäger und Kammerjungfer.
Siebenunddreißigstes Kapitel. Ueber das Husten bei Hofe.
Achtunddreißigstes Kapitel. Goldene Fesseln.
Neununddreißigstes Kapitel. Unter dem Dache.
Vierzigstes Kapitel. Ein Abschied.
Einundvierzigstes Kapitel. Am Kanal.
Zweiundvierzigstes Kapitel. Spaziergänge des Herrn Sträuber.
Dreiundvierzigstes Kapitel. Hehlerei.
Dritter Band
Vierundvierzigstes Kapitel. Eine Kleinkinderbewahranstalt.
Fünfundvierzigstes Kapitel. Sklavenhandel.
Sechsundvierzigstes Kapitel. Weihnachtsfreuden.
Siebenundvierzigstes Kapitel. Weihnachtsleiden.
Achtundvierzigstes Kapitel. Eine Mutter und ihr Kind.
Neunundvierzigstes Kapitel. Reiche und arme Leute.
Fünfzigstes Kapitel. Verschämte Hausarme.
Einundfünfzigstes Kapitel. Eine Bescheerung.
Zweiundfünfzigstes Kapitel. Ein nächtlicher Gast.
Dreiundfünfzigstes Kapitel. Im Atelier.
Vierundfünfzigstes Kapitel. Am Neujahrstage.
Fünfundfünfzigstes Kapitel. Einladungen zu Hofe.
Sechsundfünfzigstes Kapitel. Vor, während und nach dem Hofdiner.
Siebenundfünfzigstes Kapitel. Die Spielmarken des Herzogs.
Achtundfünfzigstes Kapitel. Ein Bericht.
Vierter Band
Neunundfünfzigstes Kapitel. Vorbereitungen zum Gefecht.
Sechzigstes Kapitel. Er!
Einundsechzigstes Kapitel. Die Soirée des Kriegsministers.
Zweiundsechzigstes Kapitel. Eine einfache Geschichte.
Dreiundsechzigstes Kapitel. Sklavenloos.
Vierundsechzigstes Kapitel. Ein wildes Leben.
Fünfundsechzigstes Kapitel. Ein gefährliches Papier.
Sechsundsechzigstes Kapitel. Unter dem Podium.
Siebenundsechzigstes Kapitel. Im Fuchsbau.
Achtundsechzigstes Kapitel. Achselbänder und Karrikaturen.
Neunundsechzigstes Kapitel. Das Siegel des Herrn von Brand.
Siebenzigstes Kapitel. Marie und Clara.
Einundsiebenzigstes Kapitel. Alles verloren.
Fünfter Band
Zweiundsiebenzigstes Kapitel. Mademoiselle Therese.
Dreiundsiebenzigstes Kapitel. Johann Christian Blaffer und Compagnie.
Vierundsiebenzigstes Kapitel. Johann Christian Blaffer allein.
Fünfundsiebenzigstes Kapitel. General und Präsident.
Sechsundsiebenzigstes Kapitel. Achselbänder.
Siebenundsiebenzigstes Kapitel. Im Fuchsbau.
Achtundsiebenzigstes Kapitel. Auf der Polizeidirektion.
Neunundsiebenzigstes Kapitel. Maskenball bei Hof.
Achtzigstes Kapitel. Gnade und Ungnade.
Einundachtzigstes Kapitel. Gesellschaftliches.
Zweiundachtzigstes Kapitel. Die Familie Wundel.
Dreiundachtzigstes Kapitel. Clara.
Vierundachtzigstes Kapitel. Whist mit dem todten Mann.
Fünfundachtzigstes Kapitel. Des Jägers Bericht.
Sechsundachtzigstes Kapitel. Schluß.
Europäisches Sklavenleben, F. W. Hackländer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638467
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Wilhelm Hackländer – Biografie und Bibliografie
Roman- und Lustspieldichter, geb. 1. Nov. 1816 in Burtscheid bei Aachen, gest. 6. Juli 1877 in seiner Villa Leoni am Starnberger See, widmete sich, früh verwaist, 1830 dem Kaufmannsstand, trat nach zwei Jahren bei der preußischen Artillerie ein, kehrte aber, da ihm der Mangel an Vorkenntnissen die Aussicht auf Avancement verschloss, zum Handelsstand zurück. Das Glück lächelte ihm indes erst, als er sein frisches Erzählertalent mit »Vier Könige« und »Bilder aus dem Soldatenleben« (Stuttg. 1841) geltend zu machen begann. Die auf eignen Erlebnissen beruhende Wahrheit und der liebenswürdige Humor dieses Büchleins, dem später die weitern Skizzen »Das Soldatenleben im Frieden« (Stuttg. 1844, 9. Aufl. 1883) folgten, erregten allgemeine Aufmerksamkeit und verschafften H. insbes. die Zuneigung des Barons v. Taubenheim, der ihn zum Begleiter auf seiner Reise in den Orient (1840–41) wählte. Deren literarische Früchte waren: »Daguerreotypen« (Stuttg. 1842, 2 Bde.; 2. Aufl. als »Reise in dem Orient«, 1846) und der »Pilgerzug nach Mekka« (das. 1847, 3. Aufl. 1881), eine Sammlung orientalischer Märchen und Sagen. Durch den Grafen Neipperg dem König von Württemberg empfohlen, arbeitete H. einige Zeit auf der Hofkammer in Stuttgart und wurde im Herbst 1843 zum Sekretär des Kronprinzen ernannt, den er auf Reisen und 1846 auch zu seiner Vermählung nach Petersburg begleitete. Im Winter 1849 aus dieser Stellung entlassen, begab er sich nach Italien, wo er im Hauptquartier Radetzkys dem Feldzug in Piemont beiwohnte, war darauf im Hauptquartier des damaligen Prinzen von Preußen (späteren Kaisers Wilhelm I.) Zeuge der Okkupation von Baden und nahm dann in Stuttgart seine schriftstellerische Tätigkeit wieder auf. 1859 wurde er vom König Wilhelm von Württemberg zum Direktor der königlichen Bauten und Gärten ernannt, begab sich noch in demselben Jahr, bei Ausbruch des italienischen Krieges, auf Einladung des Kaisers Franz Joseph in das österreichische Hauptquartier nach Italien, wo er bis nach der Schlacht bei Solferino blieb, und wurde 1861 für sich und seine Nachkommen in den österreichischen Ritterstand erhoben. Beim Regierungsantritt des Königs Karl (1865) plötzlich seines Amtes enthoben, lebte er seitdem abwechselnd in Stuttgart und in seiner Villa Leoni am Starnberger See. Die literarische Tätigkeit hatte H. während seiner verschiedenen amtlichen Obliegenheiten und Reisen eifrig fortgesetzt; aus der Teilnahme am piemontesischen Feldzug Radetzkys und der Belagerung von Rastatt im Sommer 1849 erwuchsen die »Bilder aus dem Soldatenleben im Krieg« (Stuttg. 1849–50, 2 Bde.); den »Wachtstubenabenteuern« (das. 1845, 3 Bde.; 6. Aufl. 1879), den »Humoristischen Erzählungen« (das. 1847, 5. Aufl. 1883) und »Bildern aus dem Leben« (das. 1850, 5. Aufl. 1883) folgten größere humoristische Romane: »Handel und Wandel« (Berl. 1850, 2 Bde.; 3. Aufl., Stuttg. 1869), voll ergötzlicher Reminiszenzen aus seiner kaufmännischen Lehrzeit, »Namenlose Geschichten« (das. 1851, 3 Bde.) und »Eugen Stillfried« (das. 1852, 3 Bde.). Hackländers Lustspiel »Der geheime Agent«, bei der von Laube 1850 ausgeschriebenen Konkurrenz mit einem Preis gekrönt (3. Aufl., Stuttg. 1856), wurde auf allen deutschen Bühnen mit Erfolg ausgeführt, auch mehrfach übersetzt. Weniger Glück machten: »Magnetische Kuren« und die Possen: »Schuldig« (1851), »Zur Ruhe setzen« (1857) und »Der verlorne Sohn« (1865). Geteilten Beifall fand sein Roman »Europäisches Sklavenleben« (Stuttg. 1854, 4 Bde.; 4. Aufl. 1876). Mit den »Soldatengeschichten« (das. 1854, 4 Bde.) begann eine gewisse Vielproduktion, in der Wiederholungen unvermeidlich waren, und die zuletzt in manieristische Flüchtigkeit auslief. Wir nennen noch: »Ein Winter in Spanien« (Stuttg. 1855, 2 Bde.), das Resultat einer 1853 nach Spanien unternommenen Reise; »Erlebtes. Kleinere [595] Erzählungen« (das. 1856, 2 Bde.); »Der neue Don Quixote« (das. 1858, 5 Bde.); »Krieg und Frieden« (das. 1859, 2 Bde.); »Der Tannhäuser« (das. 1860, 2 Bde.); »Tag und Nacht« (2, Aufl., das. 1861, 2 Bde.); »Der Wechsel des Lebens« (das. 1861, 3 Bde.); »Tagebuchblätter« (das. 1861, 2 Bde.); »Fürst und Kavalier« (das. 1865); »Künstlerroman« (das. 1866); »Neue Geschichten« (das. 1867); »Hinter blauen Brillen«, Novellen (Wien 1869); »Der letzte Bombardier«, Roman (Stuttg. 1870, 4 Bde.); »Geschichten im Zickzack« (das. 1871, 4 Bde.); »Sorgenlose Stunden in heitern Geschichten« (das. 1871, 2 Bde.); »Der Sturmvogel«, Seeroman (das. 1872, 4 Bde.); »Nullen«, Roman (das. 1873, 3 Bde.); »Verbotene Früchte« (das. 1878, 2 Bde.); »Das Ende der Gräfin Patatzky« (das. 1877); »Reisenovellen« (das. 1877); »Residenzgeschichten« (das. 1877); »Letzte Novellen«, mit seinen ersten literarischen Versuchen (das. 1879) etc. Eine Gesamtausgabe seiner Werke erschien Stuttgart 1855 bis 1874, 60 Bde. (neuer Abdruck 1876); eine Auswahl in 20 Bänden 1881, seitdem auch in illustrierten Ausgaben. Auf journalistischem Gebiet begründete H. 1855 mit Edm. Höfer die »Hausblätter« und 1859 mit Edm. Zoller die illustrierte Wochenschrift »Über Land und Meer«. H. zeigte sich in seinen literarischen Produktionen als eine gesunde und frisch genießende Natur von großer Welt- und Menschenkenntnis, soweit es sich um die Beobachtung der äußerlichen Weltzustände und der äußerlichen Charaktere handelt. Unter seinen größern Romanen zeichnen sich besonders die »Namenlosen Geschichten« und »Eugen Stillfried« durch die Frische aller Farben, die seltene Lebendigkeit der Erzählung vorteilhaft aus. Der Humor Hackländers ist vorwiegend harmlos und gutmütig; nur in einzelnen Romanen, wie im »Europäischen Sklavenleben«, spitzt er sich tendenziös zu. Aus seinem Nachlaß erschien eine interessante Selbstbiographie: »Der Roman meines Lebens« (Stuttg. 1878, 2 Bde.). Vgl. H. Morning, Erinnerungen an Friedr. Wilh. H. (Stuttg. 1878).
Europäisches Sklavenleben
Erster Band
Erstes Kapitel. Der Theaterwagen.
Es ist eigenthümlich, theurer und geneigter Leser, daß man beim Beginn einer Geschichte so gern Betrachtungen über das Wetter anstellt, – eigenthümlich, aber durchaus nothwendig. Was wollte man zum Beispiel von einem Gemälde halten, wo sich die Figuren – und wären sie auch noch so interessant – in einer Staffage bewegten, von der man nicht sagen könnte, von welcher der vier Jahreszeiten sie gerade beherrscht werde. Es bringt den Leser nichts so in eine angenehme Stimmung, als wenn er beim Beginn eines Kapitels erfährt, die Sonne habe mit voller Gluth geschienen, der Wind habe gesaust oder der Regen in schweren Tropfen an die Fensterscheiben geklatscht. Bei uns findet er aber von diesen drei ebengenannten Dingen nichts; unsere einfache und dieses Mal vorzugsweise sehr wahrhaftige Geschichte beginnt im Winter, – jener Jahreszeit, wo man die Natur als erstorben betrachtet, ihr als unschön so gern den Rücken kehrt, um in glänzende, durchwärmte Säle einzutreten und sich an künstlichen Blumen und Freuden zu ergötzen, da man lebendige und natürliche so wenige gefunden.
Aber man thut Unrecht, geneigter Leser; es gibt Wintertage, deren eigenthümliche Schönheit wir nicht vertauschen möchten für den blüthenreichsten Frühlingsmorgen, für den glänzendsten Sommerabend. Wir meinen nämlich einen Wintertag, wo die Erde nach einem Thauwetter oder nach einem gelinden Regen mit schweren Nebeln bedeckt war, wo alsdann diese Nebel durch eine plötzliche Kälte zu dichtem Reif erstarrten, wo sich der Boden mit einem Male weiß bezog, ohne aber verhüllt zu sein durch eine langweilige einförmige Schneedecke, die in ihrem kalten Gleichheitsprinzip Berg und Thal zudeckt und ohne Unterschied begräbt und verbirgt endlose Wiesen und Moorgründe, stille Thäler, kleine Seen und allerliebste Gärten. – Gewiß, jener so plötzlich angesetzte Reif ist wunderbar schön; jene Verhüllung, wo doch Alles in seiner ursprünglichen Gestalt erscheint, nur mit weißem, feinem Pelze bedeckt. Die dunkle Erde schimmert leicht durch den Flaum, es ist kein Thal, keine Schlucht verdeckt: Alles behält die ihm eigene Gestalt. Dort auf der Wiese scheint weißes Gras zu wachsen; die kleinen Sträucher sind mit den feinsten Kristallen bedeckt; wenn man einen Baum ansieht, so möchte man darauf schwören, seine Zweige seien von Zucker und er erwarte nur, wie er da ist, auf irgend eine Weihnachtstafel gesetzt zu werden.
Dabei ist die Luft klar und scharf, und wenn du einen Berg hinansteigst, so zieht dein Athem in einer bläulichen Wolke dir voraus; während du aber durch den Hohlweg gehst, um zu dem Plateau zu gelangen, wo die alte Straße mit der neuen Chaussee zusammentrifft, und wo du die weite, große Stadt übersehen kannst, versäume es ja nicht, rechts und links zu blicken und dir genau zu betrachten einen Stein, einen Strauch, ja jeden Gegenstand, den du willst; denn wenn du am heutigen glückseligen Tage irgend etwas genau untersuchst, so entdeckst du Zaubereien ohne Ende, ganze Eiswelten in jedem Maßstabe. Hier von der Wand des Hohlwegs herab hingen gestern noch die kahlen erstorbenen Zweige einer Brombeerstaude, naß, fast triefend von dem angesetzten Nebel, heute ist daraus ein Brillantschmuck geworden, würdig, den Hut einer Fürstin zu zieren, ein Schmuck von Tausenden von Diamantblumen in der phantastischsten Gestalt, und jetzt, wo ein Strahl der Sonne darüber hingleitet, glänzend wie eine ganze Million von Lichtbergen. Ja, so ein Tag verschönert mehr als Frühlingsluft und Sommerhitze; bemerken wir nicht hier neben uns einen Erdhaufen, gestern noch kahl, mit einigen mageren Grashalmen und zerstreutem Stroh, der heute mit einem Mal eine ganze Eisresidenz geworden! Weiße Steine bilden eine förmliche Stadt, die rings von Zaubergärten eingeschlossen ist; man muß nur genau hinsehen und das Ding nicht oberflächlich betrachten. Es sind da Straßen und Plätze mit den regelmäßigsten Alleen von weißbereiften Grashalmen, auch imposante Waldungen; nur Alles, was im Sommer grün erscheint, ist jetzt weiß und hat eine fabelhafte Form. – Ah! es ist schade, daß unsere Illusion durch einen Sperling gestört wird, der jetzt plötzlich in die Stadt hineinfliegt und den größten Platz mit seinen beiden Füßen bedeckt. Aber auch er gehört zur Zauberwelt, denn wie er jetzt nach einem Regenwurme pickt, den Kopf in den Reif steckt, ihn wieder empor hebt, und ihn dann mit der Beute hin und her schlenkert, stieben von allen Seiten funkelnde Brillanten davon. Doch gehen wir weiter.
Wenn wir uns auch nicht mehr so in's Detail einlassen wollen, so erblicken wir doch Sachen, die nicht minder merkwürdig sind. Auf der Spitze des Berges steht eine kleine Laube, vom Ende eines Gehölzes blickt sie in's Thal; ihre Mauern haben eine röthliche Farbe, zwei Fenster funkeln wie Augen. Ueber das Dach schlingen sich wilde Reben, vielleicht auch Geisblatt, und hängen an den Seiten herab, Alles mit Reif überzogen; sie verleihen der Front des Häuschens, das in der Entfernung wie ein colossales Riesenhaupt aussieht, schneeweißes Haar und silberfarbenen Bart. Es ist täuschend, dies Riesenhaupt, und wenn man es so über den Berg herüberlugen sieht, so wendet man unwillkürlich seinen Blick, um zu sehen, was es da unten Merkwürdiges gebe.
Ah! es ist die große Stadt, die vor uns weit ausgestreckt im Thale liegt; in allen Farben zeigen sich die Häuser, ein wahres Chaos von Grau, Grün, Roth, Blau, Schwarz mit ebenso vielen Schattirungen und unbeschreiblichen Tönen. Dazwischen heben sich die riesenhaften Thürme zahlreicher Kirchen hervor, sind aber trotz ihrer ausgezeichneten Gestalt nicht deutlich zu erkennen, denn der Nebel von gestern und vorgestern erscheint plötzlich wieder und zieht graue Schleier über die Stadt; dazu dampfen Tausende von Schornsteinen und Alles das bildet in weniger als einer halben Stunde eine ziemlich dichte Decke, durch welche man nur noch in einzelnen Umrissen die Häusermassen ahnet. Doch wird der Nebel nicht oben bleiben: er sinkt zusehends tiefer und tiefer und gibt uns jetzt einen neuen unbeschreiblich schönen Anblick. Gänzlich verschwunden ist die Stadt und es ist gerade, als ständen wir am Rande eines ungeheuren See's – jenes verzauberten See's, dessen wir uns aus unserer Kindheit erinnern, in welchem die versunkene Stadt liegt, die wir, wenn wir sie auch nicht sehen, doch hören. An unser Ohr schlägt dumpfes Murmeln und Rasseln, zuweilen rollt es deutlich auf dem Pflaster, und wenn wir noch nicht überzeugt waren, so sind wir es im nächsten Augenblicke, denn viele Uhren schlagen hell und deutlich die vierte Nachmittagsstunde.
Da nun aber die vierte Nachmittagsstunde an einem Tage im Monat Dezember nicht weit von der Nacht entfernt ist, so wollen wir unsere Zauberlandschaft verlassen und uns zur Stadt hinab begeben. Fürchte sich der geneigte Leser nicht vor dem Nebel: er scheint artig gegen uns zu sein und sinkt schneller hinab als wir gehen. Schon treten die höheren Gebäude wieder aus der scheinbaren Wasserfluth empor, und jetzt, da wir das Thor erreichen, sind die grauen Schleier mit Hülfe eines leichten Abendwindes zerrissen und wehen nur noch in einzelnen Stücken um unser Gesicht, während sie eilig gen Süden fliehen. Auch die Sonne berührt uns mit einem letzten Blick und färbt die Landschaft rosig und violett.
Das Ende einer langen Straße, in der wir wandeln, führt in's Freie und zeigt, wie holdselig die Sonne der Erde gute Nacht sagt. In unnennbar süße beruhigende Farben hüllt sich die Landschaft ein, bevor sie in Schlummer sinkt, und wie ein liebendes »Gute Nacht!« zittert der letzte Strahl der sinkenden Sonne über sie dahin. – Die stattlichen Gebäude zu unserer Rechten empfangen diesen letzten Gruß schon kälter und gesetzter; es fallen tiefe, scharf ausgeprägte Schatten der gegenüberliegenden Häuser schon auf ihre oberen Stockwerke; nur Fries und Dach ist noch hell beleuchtet. Diese Schatten steigen langsam empor, wie eine Schlafdecke; denn wenn sie das ganze Haus eingehüllt haben, kommt die Nacht, und es schließt seine müden Augen. – – Daß die Sonne nun endlich hinter den Bergen niedersinkt, bemerkt man an einer Gaslaterne, die draußen einsam vor dem Thore steht, denn auf ihren Scheiben blitzte noch vor wenig Augenblicken ein helles Licht, ein Licht, das darauf tief röthlich niederstrahlte und plötzlich ganz verschwand.
Um vier Uhr Nachmittags und auch noch etwas später sind um diese Jahreszeit die Straßen einer großen Stadt ziemlich belebt; man besorgt noch seine Gänge vor der einbrechenden Nacht, man schließt viele Gewölbe und Läden, und dann haben auch alle Schulen ihre Thore geöffnet und ausgespieen eine Legion kleiner Vagabunden, die nun in gewisser Beziehung Straßen und Plätze ziemlich unsicher machen. Da werden Trottoirs benützt zu Schleifbahnen, die kleinen Bursche fassen Posto hinter einander, ihre Tornister auf dem Rücken, und wer zufällig mitten zwischen sie hinein und auf das glatte Eis geräth, wird ohne alle Barmherzigkeit niedergerannt. Was die Schneeballen anbelangt, so hat der Himmel bis jetzt ein Einsehen gehabt und gönnte der Jugend noch nicht dieses Vergnügen zum Schaden ihrer Nebenmenschen. In der Nähe der Schule, wenn auch nicht unmittelbar vor dem Hause selbst, ist der Lärmen nun eine Zeit lang am stärksten. Wenn so der ganze Strom aus dem Thore stürzt, so scheint jeden nur die Lust zu treiben, endlich in's Freie zu kommen; sind sie aber draußen, so finden sie sich gleich wieder in einzelnen Gruppen zusammen, einer der Schlimmsten gibt den Ton an, und dann ziehen sie, wie es heißt, nach Hause, in Wahrheit aber auf so großen Umwegen, daß die Glocken schon alle Fünf geschlagen haben, bis die letzten und wildesten mit blauen Nasen und krumm gefrorenen Fingern in das warme Zimmer treten, wo Mama ihnen den Kaffee aufgehoben hat.
Auf den Straßen und Plätzen ist es nunmehr wieder ruhiger geworden; wer draußen nichts zu thun hat, bleibt im geheizten Zimmer; zum Spazierengehen und Fahren ist es zu spät, und die Zeit, wo man Gesellschaften besucht, noch nicht herangerückt. Es dämmert bereits; der Laternenanzünder mit seinem langen Stocke, an welchem oben ein kleines Lichtchen sich befindet, läuft eilig durch die Straßen, und selbst ernsthafte Vorübergehende unterbrechen zuweilen einen Augenblick ihren Gang, um zuzusehen, wie die Flamme so plötzlich emporstrahlt. Auch die Läden erleuchten sich nach und nach, und helles Licht zeigt die ausgelegten Stoffe in doppelt schönen Farben und verlockt allenfallsige Käufer.
Um diese Zeit, geneigter Leser, rollt ein Wagen über die Straßen der Stadt, meistens durch jene Viertel, wo sonst nicht viele Equipagen zu sehen sind. Dieser Wagen, eine breite Glascalesche, kommt aus den königlichen Marstallsgebäuden und ist gewöhnlich bespannt mit zwei Rappen; auf dem Bock sitzt ein alter Kutscher mit weißen Haaren in einen dicken blauen Mantel gehüllt und mit ziemlich mürrischem Gesicht. Als dieser Würdige am heutigen Tage die Zügel in die Hand nahm, fragte er einen Bedienten im blauen Ueberrock, der im Begriff war, hinten aufzuklettern: »Wird Alles geholt?« worauf dieser erwiderte: »Alles.« –
So rollt der Wagen dahin, und der Bediente hintenauf hält sich bequem an den Riemen desselben fest und schlenkert sanft hin und her; er hat im Gegensatz zum Kutscher ein freundliches, stets lächelndes Gesicht, und er würde seinem Collegen gern ein Wort mittheilen, doch weiß er wohl, daß er von dem da vornen keine Antwort bekommt.
In den entlegeneren Straßen, wohin der Wagen fährt, hält er meistens vor den kleinsten, unscheinbarsten Häusern. Dort springt der Bediente vom Tritt herab, zieht heftig an einer Klingel, die außen am Hause angebracht ist und wartet alsdann, während der alte Kutscher seine Zügel nachläßt, noch ein paar Zoll mehr zusammensinkt und die Peitsche auf den Schenkel aufstützt. Nachdem die Klingel ertönt, öffnet sich irgendwo im Haus ein Fenster, ein Kopf sieht heraus und es wird herabgerufen: »Gleich, gleich, Schwindelmann! Ich will nur meinen Kaffee austrinken;« oder: »Ich packe gerade meinen Korb zusammen.« Darauf brummt der Kutscher etwas in den Bart, Schwindelmann aber pfeift eine Melodie und hüpft von einem Fuß auf den andern, um sich warm zu machen. Bald nachher hört man Tritte auf der Treppe des kleinen Hauses; die Thüre öffnet sich und ein junges Mädchen erscheint in derselben, fest in ein großes Tuch oder einen Mantel gewickelt, während hinter ihr eine Schwester oder eine Mutter ein großes Paket, einen Korb oder dergleichen im Arme hat, welchen Schwindelmann sogleich übernimmt und in den Wagen befördert. Dann läßt er den Tritt herunter, und wenn der Wagen dicht am Hause vorgefahren oder die Straße gerade trocken ist, so hüpft die junge Dame, die unter der Hausthüre steht, gewöhnlich mit einem einzigen Sprung in den Wagen. Ist es aber schmutzig oder die Calesche hat nicht recht herangekonnt, so sagt das Mädchen auf der Hausschwelle: »Schwindelmann, sei artig«, und dann lacht Schwindelmann, hebt sie so leicht auf, wie vorhin das Paket und befördert sie mit einer schwingenden Bewegung in den Wagen, schließt den Schlag und läßt sogleich weiter fahren.
Das geschieht so an vier bis fünf Häusern nach einander, und da hiebei der Wagen durch eben soviel junge Damen angefüllt wird, so tritt Schwindelmann an den Schlag und fragt: »Haben wir noch Platz zu Einer oder Zwei, oder müssen wir heimfahren?« Er jetzt auch wohl hinzu: »Es wird kalt heute Abend und der alte Andreas möchte früh nach Haus! Ihr könnt wohl ein Bischen zusammenrücken.« Und dann lachen die drinnen meistens laut auf, es kreischt auch hie und da Eine, die ein wenig an ihre Füße gestoßen wurde; da aber die Calesche breit ist und die Mädchen den alten Andreas gut leiden können, so drücken sie sich zusammen und machen noch Platz für Zwei, Drei, so daß der Wagen oft mit Acht dahinrollt, nicht mitgerechnet ein paar kleine Kinder, die unterwegs ebenfalls noch mitgenommen werden, die sich aber sehr dünn machen und rechts und links am Schlage stehen bleiben müssen. Die Pakete und Körbe allein verursachen dem ehrlichen Schwindelmann einige Verlegenheiten. Wenn es gutes Wetter ist, weiß er sich zu helfen; er bepackt alsdann die ganze Decke der Calesche, schiebt dem brummenden Andreas auch zuweilen eines der Passagierstücke auf den Sitz, er selbst nimmt nicht selten einen großen Korb auf den Kopf, das heißt, wenn es unterdessen dunkel geworden ist, und so rollt der Wagen dahin, die Pferde langsam trabend, Andreas mürrisch und verdrießlich, und die junge weibliche Welt im Innern meistens lustig und heiter und tausend gute und schlechte Witze machend.
Diese Equipage aber, geneigter Leser, die du in der Residenz wöchentlich mehrere Male zwischen vier und fünf Uhr Nachmittags bei dir vorüberrollen siehst, ist der Theaterwagen, von Leuten mit wenig Witz und viel Behagen auch der Thespiskarren genannt, seiner Abstammung nach eine geborene Hofcalesche, die so lange für die Ehrendamen und Ehrenfräulein benützt wurde, bis diese kostbaren Wesen behaupteten, nicht länger mit Ehren darin fahren zu können.
An dem Nachmittage nun, wo unsere Geschichte beginnt, fuhr der Theaterwagen abermals und ziemlich früh durch die Straßen. Es wurde an diesem Abend ein neues Ballet gegeben, und das ganze große tanzende Personal mußte zusammengeholt werden. Der Wagen war schon ziemlich besetzt und Schwindelmann trat an den Schlag, um sich zu überzeugen, daß noch für Jemand Platz da sei, oder genugsam guter Wille, um zusammenzurücken.
»Wen holen wir noch?« fragte eine Stimme aus dem Wagen.
»Mamsell Clara,« antwortete der Theaterdiener.
»Ah! die Prinzessin!« lachte eine andere Tänzerin aus dem Wagen. »Die vornehmen Plätze sind besetzt; sie wird sich mit einem Rücksitz bequemen müssen.«
Und eine Dritte fügte hinzu: »Ich fürchte, Mamsell Clara wird es übel nehmen, wenn wir sie einladen, als Sechste bei uns zu sitzen.«
Schwindelmann konnte unter Umständen grob werden, bevor aber dies geschah, zupfte er sich selbst an einem seiner Ohren, als wenn er sagen wollte: »Mäßige dich.« Heute that er auch also, mäßigte sich aber nicht, sondern entgegnete mit ziemlich lauter Stimme: »Spart doch euer Geschwätz; wenn Jede von euch auch nur halb so zufrieden wäre wie die Clara, so brauchte man in der Garderobe ein paar Ankleiderinnen weniger, und wir würden in der halben Zeit fertig. Pfui Teufel! so ein Aufheben zu machen! – Wollt ihr oder wollt ihr nicht?«
»Ich habe im Grunde nichts dagegen,« sagte lachend eine Stimme aus dem Wagen.
Zwei Andere erwiderten: »Ich auch nicht, wenn sie sich behelfen will.«
Und eine Vierte rief: »Ich weiß was Neues: die Clara hat ein Verhältniß mit dem Schwindelmann; die wird protegirt,« – ein schlechter Witz, über den aber alle Fünf in Ermangelung eines bessern laut hinaus lachten.
Unterdessen schlug Schwindelmann brummend und murrend den Schlag zu, und der Wagen rollte durch ein paar Straßen, um endlich vor einem alten, aber ziemlich großen Hause zu halten. Dies Gebäude mit hohem, spitzem und ausgezacktem Giebeldach hatte vier Stockwerke, rechnete man aber die Wohnungen in benanntem hohem Giebel dazu, sechs Etagen, in welchen jedoch wenigstens fünfzehn Familien wohnten. Abends, wenn die Fenster beleuchtet waren, sah dies Haus aus wie eine Kaserne oder eine Fabrik, hatte auch sonst mit diesen beiden einige Aehnlichkeit, denn hier hörte man ein ewiges Summen und Rauschen, und den ganzen Tag lief Groß und Klein geschäftig die alten, ausgetretenen Treppen auf und ab.
Schwindelmann sprang von seinem Tritt herab, zog an einer Glocke, die außen angebracht war, und kaum ertönte der Klang, als sich auch schon oben hoch im Giebelfelde ein Fenster öffnete und eine schwache, zitternde Stimme herabrief: »Gleich, gleich – sie kommt schon.«
»Sie wird sich wieder recht abhetzen,« sagte nachdenkend Schwindelmann, worauf die Fünf in dem Wagen ein abermaliges Gelächter erhoben, welches ihnen aber von dem Theaterdiener die Bemerkung eintrug, daß sie sammt und sonders keine Schwäne seien.
Jetzt öffnete sich die Hausthüre und zwei Gestalten wurden sichtbar, eine größere und eine kleinere. Die größere war Clara, die kleinere ihre sechsjährige Schwester, die ein Paketchen unter dem Arm hatte, während die Tänzerin selbst ein größeres trug, das auch Schwindelmann sogleich mit außerordentlicher Sorgfalt abnahm.
»Hast du die Näherei?« fragte Clara darauf ihre kleine Schwester. »Gib sie her, mein Herz, und geh' hinauf, es ist kalt.« Darauf beugte sie sich zu dem Kinde nieder, nahm das Paketchen aus ihrer kleinen Hand und strich ihr leicht über das Haar, ehe sie in den Wagen stieg.
Schwindelmann drückte den Schlag zu und sagte zu dem Kutscher: »In's Theater!« worauf der Wagen davonrasselte.
Clara hatte sich leicht in eine Ecke gedrückt und sprach mit einer ruhigen und sanften Stimme: »Ich kann in der Dunkelheit nicht sehen, wer von euch da ist, ich sage euch aber insgesammt guten Abend, und es thut mir wahrhaftig leid, daß ihr meinetwegen so eng zusammenrücken müßt.«
»O, wir sind das schon gewöhnt,« entgegnete die Tänzerin ihr gegenüber. Und eine Andere versetzte: »Wenn du nur nicht immer so furchtbar viel Gepäck mitbrächtest. Was thust du denn heute wieder mit den zwei Paketen?«
»In dem großen sind meine Tanzröcke,« erwiderte schüchtern das Mädchen, »und in dem kleinen – – ja, darin habe ich eine Arbeit.«
»Eine Arbeit?« lachte eine Stimme aus der andern Ecke. »Bei deinem Fleiße mußt du am Ende noch reich werden.«
Clara antwortete nur mit einem tiefen Seufzer, und da der Wagen, der bis jetzt auf einer chaussirten Straße gefahren war, das Pflaster erreichte, so wurde die Conversation plötzlich abgeschnitten. Wenige Minuten nachher fuhr Andreas bei einem großen Gebäude vor und hielt dicht an einer erleuchteten Treppe.
Das Aussteigen ging wie das Einsteigen vor sich, nur in umgekehrter Ordnung; zuerst empfing Schwindelmann die Pakete und Körbe, dann half er den Eigenthümerinnen aussteigen. Clara, die zuletzt kam, wurde auch hier von dem Theaterdiener wieder einigermaßen begünstigt. »Da Sie zwei Pakete haben,« sprach Schwindelmann, »so will ich Ihnen eins hinauftragen.« Hierauf schloß er den Wagen, sagte dem Kutscher, er müsse um neun Uhr wieder kommen und erstieg hinter den Tänzerinnen die Treppen.
Zweites Kapitel. Schwarze und rothe Schleifen.
Wenige unserer geneigten Leserinnen werden schon in einer Theatergarderobe gewesen sein. Von den Lesern gar nicht zu reden; denn für sie sind die Ankleidezimmer, namentlich die des Ballets, vor, während und nach einer Vorstellung vollkommen verschlossene und unzugängliche Orte, wir wollen nicht sagen ein verbotenes Paradies, obgleich sich auch hier wie dort ein Hüter befindet: vor der Balletgarderobe freilich nicht mit flammendem Schwerte, wohl aber mit großem Stock, angehörend einem alten invaliden Portier von ziemlich mürrischem Gemüthe, und auf die Privilegien der Theaterankleidezimmer eifersüchtig wachend wie ein alter Türke. An ihm scheitert alle Bestechung, und nur wir vermögen es vermittelst der Macht, die uns verliehen, den geneigten Leser unsichtbar einzuschwärzen.
Diese Balletgarderobe besteht aus drei ineinandergehenden großen Zimmern; in jedem befinden sich mehrere Ankleidespiegel, rechts und links mit Armleuchtern versehen, die aus der Wand heraustreten und aus welchen Gasflammen brennen. Diese Armleuchter sind zum Drehen eingerichtet, um dem Spiegelglas eine größere oder kleinere Helle zu verleihen; an den Wänden dieser Zimmer befinden sich kleine, weiß angestrichene Kästen, die wie eben soviele Kommoden aussehen, nur daß sie statt der Schubladen Doppelthüren haben. Jedes dieser Schränkchen ist mit dem Namen der Tänzerin versehen, der es angehört, und hier verwahrt sie die nothwendigen Gegenstände zum täglichen Gebrauch, die sie nicht jedesmal mit nach Hause nehmen will. Es ist das wie der feldkriegsmäßig verpackte Tornister eines guten Soldaten, und enthält alle Mittel für unvorhergesehene Fälle. Da befinden sich neuere und ältere, engere und weitere Tanzschuhe, sowie Vorrathsbänder zu denselben, ein paar Tricots zum Auswechseln, falls irgend ein Unglück geschähe, kleine Lappen und Flecken von verschiedenen Sorten, Nadeln und Faden von allen möglichen Größen und Farben. Auch die Theatertoilettegegenstände sind hier verwahrt: rothe und weiße Schminke, Pomade, Kämme, Haarnadeln, eine Schachtel voll Magnesia zum Pudern und die nothwendige Pfote eines verstorbenen Hasen, um die weiße Schminke auf dem Gesicht gleichmäßig zu vertheilen.
Es mag ungefähr fünf Uhr sein, und der letzte Wagen, den wir begleitet, hat mit seinem Inhalte das weibliche Balletpersonal vollständig zusammengebracht. In den drei Zimmern befinden sich vielleicht vierundzwanzig junge Mädchen, die lachend und plaudernd durcheinander rennen, sich ihrer Mäntel und Halstücher entledigen, ihre verschiedenen Anzüge ordnen und nun mit Hülfe der Ankleiderinnen daran gehen, sich von unten herauf anzuziehen. Sonderbar ist es, daß die Gespräche, namentlich aber Scherzen und Lachen, so lange nicht zum rechten Durchbruch kommen wollen, bis die Kleider und Unterröcke den Tricots und enganliegenden Leibchen nicht Platz gemacht haben. Ist aber erst die ganze leichtfüßige Schaar unten vollständig gerüstet und bis zur Taille mit den enganliegenden Tricots versehen, so scheint ein anderer Geist in sie gefahren zu sein, und Spässe, eigenthümliche Attitüden und unaussprechliche Pas wechseln so drollig ab und werden mit so schallendem Gelächter begleitet, daß sich oftmals die Oberanzieherin veranlaßt sieht, die Hauptschuldigen durch ihre Brille fest anzusehen und ernstlich um Aufhören des Spektakels zu ersuchen. Hierauf wird aber das leise Gekicher und die anscheinend harmlosen Spässe doppelt eifrig fortgesetzt. Ein lauter Schrei erhebt sich dazwischen, denn es wurde heftig an eine der Thüren geklopft; es ist Monsieur Fritz, der Theaterfriseur, der sich von außen erkundigt, ob er eintreten dürfe. Alsbald setzen sich die Damen des ersten Zimmers durch umgeworfene Mantillen oder Tücher, sowie durch Tanzröcke, die provisorisch über den Schooß gelegt werden, in gehörige Verfassung, um den eintretenden jungen unglücklichen Mann gehörig empfangen zu können, was übrigens nicht ohne einiges Gekreisch abgeht. Wir sagen: unglücklichen jungen Mann, und zwar aus doppelten Gründen, denn einmal ist es keine Kleinigkeit, vierundzwanzig junge Mädchen zur Zufriedenheit zu frisiren, und anderentheils hat Monsieur Fritz den Versuch gemacht, gegen die eine oder die andere der hübschen Tänzerinnen gelegentlich zu avanciren, was ihm nun bei jeder Veranlassung auf's Schonungsloseste vorgehalten wird.
Der Theaterfriseur und Schneider werden seltsamer Weise von den Tänzerinnen meistens für Wesen gehalten, welche der Liebe unfähig sind, für geschlechtslose Geschöpfe, und es ist eigentlich sehr gut, daß diese Ansicht besteht, denn sonst wäre des Zierens und Genirens kein Ende.
Monsieur Fritz ist also eingetreten; die Thüre zum zweiten Zimmer wird geschlossen, weil man dort noch nicht so weit angezogen ist, und das Frisiren nimmt unter Scherzen und Lachen seinen Anfang.
Aber man muß nicht glauben, daß Alle in diesen lustigen Ton mit einstimmen, daß es Allen gleichgültig ist, wenn die umgeworfene Mantille zufällig von den Schultern herabrutscht, wenn der Friseur das Haar lockt oder ein Diadem aufsetzt. Nein, diese Stunde des Anziehens und später des Heraustretens vor die Lampen, vor das versammelte Publikum, sind für manche dieser armen Mädchen Stunden der bittersten Qual, ja tiefen Herzeleids. Man wird sagen: warum brauchen sie Tänzerinnen zu bleiben? Sie sind es ja aus freiem Willen geworden. – Doch ist diese Ansicht eine vollkommen falsche; ihr Wille wurde und wird nicht gefragt. Da ist eine Mutter in dürftigen Verhältnissen, die hat zwei kleine hübsche Mädchen; da sie aber für das tägliche Brod zu Haus arbeiten muß und keine Magd anschaffen kann, um ihre armen Kinder, wie so viele Reiche und Glückliche, zu beaufsichtigen und zu verpflegen, so betrachtet sie die Balletschule als eine gute Gelegenheit, die Kinder zu versorgen und bedenkt nicht, wie theuer dieselben dieser erste Schritt meistens zu stehen kommt Die kleinen Mädchen werden untersucht, ob sie gerade Glieder haben, auch hübsche Augen und gesunde Zähne, und dann werden sie eingeschrieben zu einem äußerlich oft glänzenden, aber innerlich meistens erbärmlichen Leben. Anfangs betrachtet man Alles mit dem glücklichen Leichtsinn der Jugend; die kleinen Wesen freuen sich, wenn sie in den engen Tricots mit einem goldenen Gürtel hinaus dürfen, und ahnen nicht, daß all' dieses glänzende Schmuckwerk goldene Ketten sind, die sie zu Sclavinnen machen und an ein bewegtes, ja wildes Leben fesseln. Dies Bewußtsein kommt erst nach einigen Jahren und meistens wenn es zu spät ist, wenn die Tänzerin nichts Anderes gelernt hat und allein auf den Balletsaal und die Bühne angewiesen ist, um von der geringen Gage sich und oft noch Eltern und Geschwister zu erhalten.
Es ist dies ein Leben, in vielen Fällen schlimmer als das einer wirklichen Sclavin; ist diese traurig, ist ihr Herz von Kummer und Schmerz zerrissen, so ist es doch ihrem Herrn gleichgültig, ob sie die Lippen zusammenbeißt, ob eine Thräne über ihre Wange herabträufelt; aber die Tänzerin muß lachen, muß vor den Lampen eine Glückseligkeit heucheln, wenn auch ihr Herz darüber brechen möchte. – Es ist wahr, eine Sclavin wird wie eine Waare untersucht, ihre Gestalt, ihr Wuchs, ihre Augen, ihre Zähne, aber das geschieht nur einige Mal in ihrem Leben; die Tänzerin dagegen muß sich allabendlich von dem gesammten Publikum untersuchen lassen: jedes Glas richtet sich scharf auf sie und jedes Auge prüft genau die Formen ihres Körpers, um dem Nachbar sagen zu können: »Sie ist schöner geworden, sie blüht auf,« oder: »Sie nimmt ab, es geht zu Ende mit ihr.« –
Und das setzt sich auch hinter den Coulissen fort und spielt in's gewöhnliche Leben hinüber. Wem es nur irgend möglich ist und wer hiezu ein Recht zu haben glaubt, macht sich ein Vergnügen daraus, zu untersuchen, ob eine Tänzerin fest geschnürt sei, und jeder Geck glaubt eine Verpflichtung zu haben, diesem armen Mädchen nachzulaufen, eben weil es eine Tänzerin ist. – – Und da bei hat sie nicht einmal das Mitleid ihres Geschlechtes für sich. Was ist eine Tänzerin? – Ein Geschöpf, über welches die Nase zu rümpfen man berechtigt ist, der es ja ein Vergnügen macht, sich so und so vor dem Publikum zu präsentiren. – Nein, ihr Damen vom ersten und zweiten Rang, es macht ihnen in den meisten Fällen kein Vergnügen und es ist nur ein Beweis, daß es auch bei uns Sclaven und freie Menschen gibt, ein Beweis, auf welch' traurige Weise auch bei uns die Glücksgüter vertheilt sind; denn wenn immer nach der Reinheit der Gesinnung und den Gefühlen des Anstandes die Stellen des gesellschaftlichen Lebens vertheilt wären, so säße manche Tänzerin in eurer Loge, nachlässig zurückgelehnt mit verächtlich zugedrücktem Auge, und Manche von euch zeigte sich da unten dem lachenden Publikum. Das heißt, wenn an ihr irgend etwas zu zeigen ist. – – – –
Im dritten Zimmer ist dasselbe Treiben, dieselbe Geschäftigkeit wie in den beiden anderen. Hieher entlud sich der Inhalt des letzten Wagens, den wir begleitet, und da diese Tänzerinnen später kamen als ihre Colleginnen, so ist man hier auch noch weiter im Anzuge zurück. Doch ist jede Tänzerin eifrig beschäftigt; die Ankleiderinnen helfen ihnen angelegentlichst und bald schält sich aus dem Chaos von Tricots, Weißzeug, gestickten Kleidern, falschen Blumen und dergleichen mehr etwas Solides und Fertiges heraus, und das stellt sich nun vor die Spiegel, probirt vorläufig die neue Frisur, schminkt sich nach der Lancaster'schen Methode, oder läßt sich von einer der Schneiderinnen noch hie und da etwas am Anzuge ändern.
Vor einen der Spiegel tritt gerade eine als Nymphe des Waldes gekleidete Tänzerin; fleischfarbene Tricots sind oben mit einem äußerst kurzen Rock bedeckt, der Oberkörper steckt in einem Leibchen von hellgrünem Atlas, das bei jeder Bewegung des Körpers kracht und sich dehnt. Neben ihr auf einem Stuhl sitzt eine andere Tänzerin, die Arme über einander geschlagen, die Füße weit, von sich abgestreckt, so daß der Tanzrock mehr als eine Spanne über dem Knie bleibt. Beide sind sehr schöne Mädchen, die vor dem Spiegel hat dunkle Haare, blitzende Augen und ist tadellos gewachsen. Die Andere, eine Blondine, hat ein sanftes Gesicht und ruhige, weniger leidenschaftliche Bewegungen.
»Hast du bemerkt,« sagte Letztere, »daß die Marie dort in der Ecke wieder eine Thräne um die andere fallen läßt? Warum nimmt das Mädchen auch keine Vernunft an!«
»Wird schon kommen,« erwiderte die vor dem Spiegel, indem sie sich übermäßig stark zurückbog, um zu sehen, ob die Verbindung zwischen Rock und Leibchen nichts zu wünschen übrig ließe. »Wem ist es am Ende nicht so ergangen? Wer von uns hat ein Verhältniß ganz vollkommen nach seiner Neigung anfangen können?«
»Ich,« versetzte die Blonde; »und deßhalb dauert mich die Marie.«
»Nun, du hast was Rechtes,« entgegnete die Andere lachend und hob mit einem gelinden Ausdruck der Verachtung ihre Oberlippe, während sie mit den Händen ihre Hüfte umspannte und sich selbstzufrieden in dem Spiegel besah.
»Aber er wird mich heirathen,« fuhr die Blonde fort.
»Und dann bist du fertig! Nein, nein, Elise, da macht's unsereins ganz anders. Und wenn die Marie nun einmal nicht will, wer kann sie zwingen?«
»Du weißt, daß sie keine Eltern mehr hat und bei ihrer Tanze wohnt.«
»Bei dem Drachen am Kanal! Oeffentlich hat sie Aepfel feil und verkauft Singvögel; was sie aber im Geheimen treibt, wissen wir. – Pfui Teufel! Nun, zwingen soll sie sich nicht lassen; man muß mit ihr sprechen.«
»Thu' das, Therese,« sagte die Blondine. »Du weißt, die Marie ist ein gutes Geschöpf, ruhig und sanft, sie ist keines großen Widerstandes fähig und eine intime Freundin hat sie auch nicht.«
»Man muß mit ihr sprechen,« wiederholte stolz Therese. »Laß mich nur machen.« Mit diesen Worten trat sie noch einmal fest vor den Spiegel hin, hob den Kopf hochmüthig in die Höhe, besah sich rechts und links, griff nochmals sich lang streckend um ihre Taille und wandte sich dann höchlich zufrieden mit einer halben Pirouette vom Spiegel, worauf sie stolz wie eine Kaiserin nach der vorhin angedeuteten Ecke schritt.
Hier war der unvortheilhafteste Platz des ganzen Gemaches; er war neben einem Fenster, wo wenig Licht hinfiel und sich nur ein kleiner Wandschrank befand. Hier mußten sich die Jüngsten begnügen, bis sie endlich älter und erfahrener wurden und durch den Abgang einer Collegin oder durch irgend eine Protektion an einen bessern Platz vorrückten.
Die zwei Mädchen, die sich hier angezogen, waren beide jung, beide schön, sie hatten beide dunkles Haar und dunkle Augen und waren doch unendlich von einander verschieden.
Wir kennen Beide bereits; von der Einen sprachen eben die beiden Tänzerinnen an dem großen Spiegel; die andere war Mamsell Clara, welche zuletzt in den Wagen gestiegen.
Die Erstere war ein Bild der Frische und Ueppigkeit, dabei hatte sie eine gute Taille, starke Arme, ein rundes, blühendes Gesicht, und die Röthe ihrer Wangen drang so stark hervor, daß sie mit keiner anderen Schminke zu bewältigen war; von Nothauflegen war gar keine Rede, und schon nach den ersten Schritten des Tanzes glühte sie so, daß man ihr vorwarf, sie sei ungeschickt und übermäßig geschminkt. Ihre Augen waren dunkel und glänzend, der Gesichtsausdruck aber nicht sehr geistvoll; Hände und Füße ließen auch etwas zu wünschen übrig, woher es denn auch wohl kam, daß es ihr schwer wurde, eine graziöse Stellung anzunehmen, und sie, obgleich wie gesagt ein sehr schönes Mädchen, doch nie in die ersten Reihen gestellt wurde.
Clara war von einer mittleren Größe und mit einer Zierlichkeit und Eleganz gewachsen, die Jedermann in Erstaunen setzte. Dabei hatte sie den kleinsten Fuß, die kleinste Hand, und ihre Taille, nicht unverhältnißmäßig schmal, stand zu dem langen und vollen Oberkörper in so richtigem Verhältniß, daß das schärfste Kennerauge in diesem Körper nur die vollkommenste Harmonie entdecken mußte. Auch Hals und Kopf paßten vortrefflich zu dem Ganzen; ihr Gesicht war lang, doch nicht schmal, die Farbe desselben etwas blaß; dabei hatte sie große Augen und zwischen frischen Lippen glänzend weiße Zähne. Ihr fast schwarzes Haar war wegen seiner Fülle der Kummer des Friseurs, denn Monsieur Fritz war, wie er sagte, nicht im Stande, irgend eine correcte Frisur damit herzustellen. Wenn wir dabei versichern, daß dieses Mädchen mit einer außerordentlichen natürlichen Grazie begabt war, daß keine ihrer Bewegungen etwas Eckiges hatte, daß ihr Körper und ihre Füße schmiegsam und biegsam wie bei keiner Anderen waren, daß sie den größten Pas mit Leichtigkeit lernte und nach dem ersten Jahr vor allen ihren Colleginnen während des Tanzes auffallend hervortrat, so wird man sich wundern, weßhalb sie bei dem Corps de Ballet blieb und nicht zur Solotänzerin ausgebildet wurde. Doch hatte das seine guten Gründe, und Clara, die, wie wir später sehen werden, fast schutzlos in der Welt stand, dagegen viel Schutz zu verleihen hatte, fand nicht die Zeit, täglich die langwierigen Exercitien zu machen, die nothwendig sind, wenn man es in der Tanzkunst zu Etwas bringen will. Dabei fürchtete sie sich auch vor dem ersten Tänzer, der sich ihr anfänglich auffallend genähert hatte, dem sie aber mit ihrem richtigen Gefühl schaudernd auswich. Ueberhaupt konnte sie sich nie mit dem wilden Treiben vieler der anderen Tänzerinnen befreunden und nahm deßhalb eine isolirte Stellung ein, die häufig Veranlassung war, daß sie Spott und Neckereien aller Art ertragen mußte. Mamsell Marie war die Einzige, welche mit großer Anhänglichkeit an Clara hing, sie wahrhaft verehrte und fast unterthänig gegen sie war, wie gegen eine Gebieterin.
Die beiden Mädchen waren stillschweigend übereingekommen, Monsieur Fritz so wenig als möglich in Anspruch zu nehmen, und da sie sich schon seit längerer Zeit so gegenseitig bedienten und, namentlich Clara, eine große Fertigkeit erlangt hatten, so wurde es ihnen nicht schwer, sich gegenseitig die kunstvollsten und schwierigsten Frisuren zu machen. Dadurch waren sie meistens vor allen Uebrigen fertig, so auch heute, und als in allen Zimmern und vor allen Schränken noch große Bewegung herrschte, hatten sie ihre gewöhnlichen Kleider schon aufgeräumt und beschäftigten sich, völlig angezogen, mit etwas Anderem.
Diese Beschäftigung war aber sehr verschiedener Art: Clara hatte sich vor ihr Schränkchen gesetzt, das zweite Paketchen ihrer Näherei geöffnet und fing an zu arbeiten, während Marie an dem Fenster lehnte und mit gefalteten Händen in die dunkle Nacht hinaussah. Uebereinstimmend aber waren die Gesichtszüge beider Mädchen; auf beiden lag ein tiefer Schmerz und die etwas gerötheten Augen zeigten Spuren von häufigem Weinen. Clara hatte stark roth auftragen müssen, um die durchdringende Blässe ihres Gesichts zu bewältigen. Weßhalb die am Fenster geweint, haben wir bereits erfahren, und wenn wir einen Blick auf die Arbeit der Anderen werfen, sind wir auch hier über die Ursache des Schmerzes nicht mehr im Zweifel: Clara nähte an einem Kinderkleidchen und war eben im Begriff, dasselbe mit schwarzen Schleifen zu besetzen.
In diesem Augenblick kam Mamsell Therese von ihrem Spiegel und trat mit erhobenem Kopfe vor die Beiden hin. »So, ihr seid schon fertig?« sagte sie. »Und Clara ist schon wieder am Arbeiten? – Was machst du denn da?«
»Mir ist heute Nacht meine kleine Schwester gestorben,« antwortete das Mädchen. Und als sie ihren Kopf aufhob, um die Tänzerin anzuschauen, standen ihre großen Augen voll Thränen.
»So, so,« entgegnete Therese mitleidig, »deine arme kleine Schwester ist gestorben? Ei, ich habe nichts davon gewußt. Und da machst du ihr das letzte Kleidchen?«
Clara nickte stillschweigend mit dem Kopfe.
»Wie alt war denn das Kind?«
»Sie war zwei Jahre – aber so lieb – so lieb –«
»Nun ihr ist wohl,« versetzte die Andere; »aber es thut mir leid für dich, du hast das Kind gewiß sehr gern gehabt.«
»Wie ihr eigenes,« sagte Marie am Fenster, und unter dem Dunkel des Vorhanges glänzten ihre feuchten Augen hervor.
Einige andere Tänzerinnen in der Nähe, namentlich die blonde Elise, welche ihrer Freundin gefolgt war, hatten diese Unterredung theilweise gehört und traten nun mitleidsvoll näher. Bald war Clara von allen Damen umringt, die sich im Zimmer befanden, und es war ein eigener Anblick, wie die vorhin noch so lachenden Gesichter der jungen lustigen Tänzerinnen auf das dürftige Todtenhemdchen niederschauten. Um dasselbe herum stand nun so plötzlich ein lautloser Kreis, glänzend in Spitzen, Atlas, Silberstoffen und falschen Brillanten. Dabei contrastirte die Stille hier im Zimmer auffallend mit dem Lärmen in den andern; dort wurde geplaudert, gelacht, auch wohl ein lustiges Lied gesungen und zwischen hinein blätterten die Castagnetten und hörte man hin und wieder das taktmäßige Auftreten der Füße, wenn die Eine oder die Andere irgend einen Pas versuchte.
»Aber warum nähst du schwarze Schleifen auf das Kleid?« fragte nach einer längeren Pause Therese, indem sie sich niederbeugte und das Kleidchen mit der Hand berührte. »Man nimmt ja gewöhnlich Rosaband; auch sind die hier von Baumwollenzeug.«
Clara blickte in die Höhe und versuchte zu lächeln, aber es wollte ihr nicht recht gelingen. »Schwarz ist ja die Farbe der Trauer,« sagte sie, »und dann hatte ich diese Bänder schon; Roth ist so theuer.«
»Du hast sie von einem Kleid heruntergetrennt,« fuhr die Andere fort, nachdem sie genauer hingesehen. – – »Ich will das nicht leiden.« Dabei richtete sie sich stolz in die Höhe. »Dein Schwesterchen soll nichts Schlechteres haben, als die anderen Kinder. – Allons!« wandte sie sich an die Andern, »sucht rothes Atlasband zusammen, aber eilt euch. – Wie viel Schleifen brauchst du ungefähr?«
»Laß nur gut sein, Therese,« bat Clara, »meine Liebe zu dem armen Kind ist nicht geringer, wenn ich auch schwarze Schleifen hinnähe.«
»Aber es muß einmal so sein,« entgegnete Therese eigensinnig, »du hast ja kaum mit deinem schwarzen Band angefangen. Macht, daß wir rothe Schleifen bekommen!«
Schon auf den ersten Ruf hin waren mehrere der Tänzerinnen zu ihren Schränken geeilt, und eine brachte das Verlangte herbei.
Therese durchschritt alle Zimmer und rief nach rothem Atlasband.
»Wozu?« fragten mehrere Stimmen. »Zu welchem Zweck?«
Und kaum hatte die Tänzerin erklärt, um was es sich handle, so wurden bereitwillig Schränke und Schachteln geöffnet und jede der glänzenden Nymphen, der strahlenden Göttinnen und edlen Ritterfräuleins beeilte sich, ihre rothe Schleife zu bringen, so daß Clara kaum mit dem Annähen fertig werden konnte.
Wie wohl that ihr übrigens diese Theilnahme und wie erfreut war sie, als nun das Kleidchen fertig war und nicht mehr so düster in Schwarz und Weiß aussah, sondern freundlich und rosig, wie es für das liebliche Gesichtchen des verstorbenen Kindes paßte.
»Wann wird dein Schwesterchen begraben?« fragte die blonde Tänzerin, die jetzt in den Kreis trat, in ihrer Hand einen kleinen Kranz haltend von künstlichen Orangenblüthen, fast ihr einziges und bestes Eigenthum, das sie aber gerne hingab, um das Köpfchen der Verstorbenen damit zu zieren. »Wann wird es begraben?« wiederholte sie. »Denn es versteht sich von selbst, daß wir Alle mitgehen.«
»Natürlich,« sagte Therese, »da wird gewiß keine fehlen. Und an Blumen bringen wir mit, was wir auftreiben können; die jetzt gewachsenen und blühenden sind freilich theuer, aber es thut nichts, sollte es auch ein gemachter Strauß sein. Es hat die gleiche Wirkung, wenn es nur vom Herzen kommt.«
»Es soll mich freuen,« erwiderte Clara, »wenn ihr auf den Kirchhof kommen wollt; das Begräbniß ist übermorgen um zehn Uhr.«
»Verlaß' dich darauf, es fehlt keine,« versetzte Therese bestimmt. Und damit nahm sie das fertig gewordene Kleidchen in die Höhe und Alle betrachteten die wohlgelungene Arbeit.
In diesem Augenblicke ertönte eine Klingel dreimal und heftig; es war das Zeichen für die Tänzerinnen, auf die Bühne zu kommen, weßhalb die Schränke eilfertig zugeschlossen wurden. Jede trat noch einen Augenblick vor den Spiegel, streckte den Oberkörper so weit als möglich in die Höhe, zog den Tanzrock herab, betrachtete prüfend die Schuhe, ob nirgendwo ein Fehler zu entdecken sei, und darauf flatterte die leichte Schaar die Treppen hinab und rauschte auf die Bühne, wie ein anderes wildes Heer.
Drittes Kapitel. Sclavinnen.
Wie meistens vor einem größeren Ballet ein kleines Lustspiel gegeben wird, so auch am heutigen Abend. Es geschieht das, um den ersten Hunger des Publikums zu stillen, um den Zuspätkommenden genügende Zeit zu lassen, ihre Plätze einzunehmen, und um Alle, oftmals durch einige Langeweile, empfänglicher zu machen für den nun folgenden Spektakel, für Decorationen, Costüme, Tänzer und Tänzerinnen. Hiezu wird meistens ein harmloses Lustspiel gewählt, an dem man nicht viel verliert, wenn man auch erst in der Mitte desselben in's Theater kommt; es hat gewöhnlich eine einfache Decoration, damit man hinten genugsam Platz hat für die Zurüstungen, sowie eine Stelle, wo sich das Corps de Ballet aufhält und wo die Solotänzerinnen die verzweifeltsten Anstrengungen machen, damit ihre Glieder nachher im höchsten Glanze der Gelenkigkeit erscheinen.
Es ist heute Abend ein Ballet in vier Aufzügen, zwölf Tableaux, mit viel Tyrannei, viel Liebesschmerz und ungeheurem Gefühl. Eine Scene, wo viel des Letzteren vorkommt, muß als sehr schwierig noch probirt werden. Der Herzog, ein gutmüthiger Kerl, – so scheint er wenigstens im ersten Aufzug, obgleich der emporgewichste Schnurrbart und der lange drohende Knebelbart deutliche Vorzeichen sind, daß später einiges Zähneknirschen und Augenverdrehen stattfinden wird, – der Herzog also kommt, wie es in Balleten meistens der Fall ist, unglücklicher Weise in dem Augenblick zu seiner Braut, wo deren eigentlicher Liebhaber, der junge Ritter Astolfo, ebenfalls bei ihr ist. Das gibt eine furchtbare Scene; der Herzog bleibt wie angewurzelt stehen und gleitet dann mit einem fürchterlichen Blick, fast ohne die Füße zu bewegen, bis auf die andere Seite der Bühne. Ritter Astolfo zieht sein Schwert; einige zwanzig Tänzerinnen, die Begleitung der Braut, schaudern im Chor, die Cavaliere des Herzogs schlagen ein Pantomimisches Hohngelächter auf, und die Braut reißt sich endlich aus ihrer Erstarrung in die Höhe, faßt ihren verzweifelnden Liebhaber an der Hand und tanzt vor den Augen des erstaunten Herzogs ein Pas de deux, worin sie ihm deutlich zu verstehen gibt, hier, Astolfo, sei ihr Jugendfreund und schon seit erster Kindheit von ihr geliebt worden, sie könne und werde ihn nie verlassen, sie scheere sich den Henker um den Herzog und sein ganzes Reich, und werde eher sterben, als ihm angehören.
Diese Scene wurde, wie gesagt, nochmals in der Geschwindigkeit durchgemacht, worauf der erste Tänzer in Abwesenheit des Balletmeisters das Corps de Ballet eine kleine Revue passiren ließ. Er schaute nach, ob die Frisuren übereinstimmend mit der Vorschrift waren, ob die Schuhe in gutem Zustande, ob die Tricots fest und sorgfältig angezogen seien. Die meisten der jungen Damen ließen sich diese Untersuchung lachend gefallen, namentlich wenn der Tänzer, ein hagerer junger Mann mit sehr lebhaften Augen, gerade nicht in's Detail einging. Andere, um geschwind fertig zu sein, drehten sich vor seinen Augen lachend mit einer Pirouette, um sich von allen Seiten zu präsentiren und machten darauf ein übermäßiges Battiment, um so Tricots und Schuhe im besten Glanz vorzuzeigen und sprangen dann in die Coulisse zurück. Einige der Tänzerinnen beantworteten die Aufforderung ihres Collegen, näher zu treten, mit einem unbeschreiblichen Blick, drehten ihm ganz einfach den Rücken oder ließen sich auch, die Hände auf den Hüften, nicht im Mindesten in ihrer Unterhaltung stören.
»Wo ist Mamsell Clara?« rief der Tänzer, nachdem er das Mädchen vergebens gesucht, obgleich sie nicht weit von ihm hinter einem gemalten Baume stand. – »Wo ist Demoiselle Clara?« wiederholte er mit lauter Stimme. »Ich muß sie bitten, augenblicklich vorzutreten.«
Diesem zweiten Ruf mußte Folge geleistet werden, und das Mädchen trat, obgleich widerstrebend, aus die halbdunkle Bühne, in deren Mitte der lange Tänzer allein stand.
»Es ist doch sonderbar,« sagte er mit einem häßlichen Lächeln, »daß man Sie immer zweimal rufen muß. – Es wäre wahrhaftig für Ihr Fortkommen besser,« setzte er leise hinzu, »wenn Sie meinen Aufforderungen gleich auf das erste Mal Gehör gäben.«
»Was wollen Sie von mir?« fragte die Tänzerin mit unsicherer Stimme.
»O, für jetzt nicht viel,« entgegnete ihr College. »Sie tanzen in der vordersten Reihe, Sie tanzen zu sechs mit mir, ich möchte nach Ihrem Anzuge sehen; dann könnten wir auch geschwind die letzte Stellung probiren.«
»Mein Anzug ist in Ordnung,« versetzte das Mädchen, indem es einen Schritt zurücktrat.
»Ihre Schuhe nicht zu weit?«
»Ein wenig, aber ich habe sie eingenäht.«
»Ihre Tricots fest angezogen? Ich will keine Falten bemerken. – Lassen Sie sehen.«
Das Mädchen rührte sich nicht. Doch wenn es auf der Bühne nicht so dunkel gewesen wäre, hätte man deutlich bemerken können, wie selbst unter der Schminke eine glühende Röthe ihr Gesicht überfuhr.
»Seien Sie nicht kindisch,« sagte der Tänzer, »und lassen Sie sehen. Sie wissen, Clara, daß ich mit mir nicht spassen lasse und daß Sie auf eine Zulage nächsten Monat durchaus nicht zu rechnen haben, wenn ich Sie immerwährend wegen Ungehorsams und Widersetzlichkeit anzeigen muß. – Nun!«
Das arme Mädchen knitterte mit der rechten Hand ihren seidenen Tanzrock zu tausend Falten zusammen, dann erhob sie ihn ein paar Zoll hoch, so daß ihr Knie sichtbar wurde.
Der Tänzer wollte sich genauer überzeugen, doch trat Demoiselle Clara abermals einen Schritt zurück.
»Sie sind ein kindisches Mädchen,« sprach der Vorgesetzte: »Sie werden noch viel lernen müssen oder Sie bringen es zu gar nichts. – Sind Sie nicht zu fest geschnürt?«
»Ich schnüre mich nie fest,« entgegnete Clara kurz abgebrochen und wollte sich entfernen.
Der erste Tänzer aber faßte ihren Arm und hielt sie fest. »Ich glaube,« sagte er mit leiser Stimme, »die Schneiderinnen behandeln Sie mit gar keiner Aufmerksamkeit; für Ihre unvergleichliche Taille findet sich gar nichts Passendes in der Garderobe; man müßte Ihnen eigentlich immer neue Sachen machen. Und wenn Sie wollen, Clara –«
Das Mädchen versuchte ihre Hand zwischen den feuchten Fingern des dürren Tänzers hervorzuziehen; es durchschauerte sie eisig. Doch hielt er sie fest.
»Es scheint mir,« fuhr er stockend fort, während er sich auf sie herabbeugte, »die Garderobière will Ihnen nicht wohl; sie gibt Ihnen immer alte zu stark wattirte Leibchen. – Ah! ich muß das untersuchen! – –«
Doch wurde dem diensteifrigen Collegen zum Glücke des jungen Mädchens für jetzt keine Zeit zu dieser Untersuchung gelassen, denn als er sie beginnen wollte, kamen aus der Seitencoulisse zwei der Tänzerinnen in einem so rasenden Walzer dahergeflogen, daß sie kein Hinderniß beachten konnten und mit solcher Gewalt gegen den ersten Tänzer anprallten, daß dieser weithin auf die Bühne flog und nur durch eine Säule, die er krampfhaft ergriff, vor einem gänzlichen Falle errettet wurde.
Clara, die hocherfreut aber erstaunt war, sich so plötzlich befreit zu sehen, fühlte sich von den beiden Colleginnen ergriffen und mußte den tollen Wirbel mitmachen, der in einem weiten Bogen über die Bühne ging und nicht eher endigte, bis alle Drei wieder hinter den Coulissen angekommen waren. Dort hielt die Eine, die Kräftigste von Allen, – es war Demoiselle Therese, – das Terzett mit einem plötzlichen Rucke fest, löste ihre Arme aus denen der beiden Anderen und ließ sich laut lachend auf eine gepolsterte Rasenbank niederfallen. Clara schöpfte einen Augenblick tief Athem, dann sagte sie: »Wie danke ich dir, Therese; du hast mir da aus einer sehr unangenehmen und schmerzlichen Scene weggeholfen.«
»Die aber morgen wiederkehren wird, mein Schatz,« lachte die Andere.
»O mein Gott, ich weiß das; aber was kann ich dagegen thun? Ich, ohne Schutz, hülflos und allein dastehend!«
»Dagegen kannst du zweierlei thun,« entgegnete Demoiselle Therese, indem sie ihren rechten Fuß auf das linke Knie hinaufzog, um ihren Schuh anzusehen, ob er bei dem raschen Walzer keinen Schaden genommen. »Wie ich gesagt habe, zweierlei, entweder du läßt dir die Narrheiten gefallen, du läßt dem lächerlichen Kerl seine Grille –«
»Nie! nie!« rief Clara entrüstet.
»Nun wohl,« sagte gleichmüthig die Andere, so schaffst du dir einen Liebhaber an, der unserm ersten und zweiten Tänzer und allen Denen, die das Recht zu haben glauben, deine Taille untersuchen zu dürfen, an einem schönen Morgen zwei Worte sagt, ungefähr des Inhalts: »Mein lieber Freund! Wenn Sie sich nochmals unterstehen, der Demoiselle Clara mit der Spitze Ihres Fingers zu nahe zu kommen, so mache ich mir dagegen das Privatvergnügen, Sie dreimal nacheinander auszischen zu lassen.«
»Oder,« setzte die blonde Tänzerin, welche die Dritte im Bunde gewesen war, hinzu, »dein Liebhaber macht sich das Vergnügen, Abends in einer dunklen Straße dem ersten Tänzer oder sonst Jemand ein paar freundliche Worte zu sagen.«
»Darnach der Liebhaber ist,« antwortete Therese mit etwas verächtlichem Tone, »kann das auch geschehen; doch ist es nicht sehr nobel.«
»Aber ich will keinen Liebhaber,« versetzte schüchtern das junge Mädchen, dem diese Rathschläge gegeben wurden. »O mein Gott, ich bin eine Tänzerin, das ist wahr, aber ich habe mich doch zu sonst nichts verkauft.«
»Aber verkauft hast du dich,« entgegnete Demoiselle Therese, und umspannte mit ihren beiden Händen ihre schlanke Taille. »Verkauft haben wir uns Alle mit Leib und Seele.«
»Das wäre ja schrecklich!« meinte die blonde Tänzerin. »Nein, Therese, du übertreibst; ich habe mich nicht verkauft.«
»Du hast dich nicht verkauft?« fragte Therese hochmüthig, indem sie sich stolz aufrichtete und ihre blitzenden Augen so fest auf die Collegin richtete, daß diese die ihrigen scheu zu Boden niederschlug. »Wir sind hier unter uns, und ich für meine Person will mich wahrhaftig nicht besser machen als ich bin. Erinnerst du dich noch – es sind jetzt drei Jahre, wir Beide waren damals Sechszehn alt – weißt du noch, Schatz, wie man dir eine Zulage versprochen und wie dich der Balletmeister da hinten in's blaue Zimmer bestellte, in das blaue Zimmer mit dem gelben Sopha? – Ja, mein Kind, du bekamst eine Zulage, das heißt, du erhieltest sie später, aber – sprechen wir nicht mehr davon. – Hat man dir noch keine Zulage versprochen, meine schöne Clara?«
»Nein, nein,« entgegnete diese finster, »wenn man mir sie auch verspricht, so gehe ich doch nicht in's blaue Zimmer.«
»Das wird man dir schon sagen, mein Lieb,« erwiderte finster lachend Therese. »Man bestellt dich und du kommst. Damit ist die Sache abgemacht.«
»Ich bin keine Sclavin,« versetzte stolz die junge Tänzerin. Und dabei warf sie ihre Lippen auf und ihr Auge blitzte.
Therese lächelte still vor sich hin, dann blickte sie in die Höhe zu einem gemalten Palmbaume, der seine riesige Blätterkrone über die drei Mädchen ausstreckte und sagte: »wir stehen gerade unter dem rechten Symbol; du meinst, wir seien keine Sclavinnen, das heißt Sclavinnen, was die Leute so darunter verstehen. Sclavinnen, die in jenen Ländern wohnen unter einem freundlich lachenden und sonnigen Himmel, von Blumen umgeben und schönen Früchten, die nicht Kälte und Hunger kennen. Nein, du hast Recht, solche Sclavinnen sind wir nicht. – Aber unsere Sclaverei ist viel härter, viel dauernder, viel grausamer. Diejenigen, welche mit einem dunkeln Gesichte auf die Welt kommen, wissen ganz genau, daß einmal eine Abstufung zwischen ihnen und ihren weißen Schwestern besteht; warum hat Gott die beiden Racen geschaffen? Er hat wohl seine Gründe dazu gehabt. Aber wir, Sclavinnen durch Geburt und Verhältnisse, obgleich unser Gesicht nicht eine Idee dunkler ist, als das der Anderen, die mit Verachtung auf uns herabschauen – übrigens bin ich mit meinem Gesichte wohl zufrieden, – wir haben das volle Recht, unseren Zustand bitterer zu empfinden, als jene Anderen. Und welch Herzeleid thut man ihnen, das uns nicht doppelt geschieht?«
»Weil wir Tänzerinnen sind,« seufzte Clara mit gefalteten Händen.
»Nicht blos weil wir Tänzerinnen sind,« fuhr die Andere fort. Und bei jedem Worte, das sie sprach, blitzten ihre weißen Zähne. »Seht unter all' euren Bekannten nach der ganzen Classe, der wir angehören, alle wir, die wir keine Schuld daran haben, daß wir nicht vornehm geboren wurden, wir alle sind Sclavinnen und haben ein härteres Loos als Jene, die wirklich so heißen.«
»Da ist ein neues Buch geschrieben worden,« sagte Clara; »habt Ihr davon gelesen? Mein Vater übersetzt es zu Hause für einen Buchhändler und ich lese die Correcturbogen.«
»Freilich habe ich es gelesen,« erwiderte die andere Tänzerin. »Und die Absicht der Verfasserin ist gewiß lobenswerth; aber lächerlich ist es, wie man bei uns dafür schwärmt, wie man sich an fremdem, vielfach eingebildetem und übertriebenem Elend wollüstig erlabt, während man dicht vor der Nase dasselbe in noch viel größerem Maßstabe hat.«