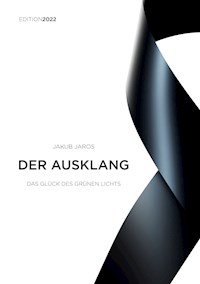
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit dem epochalen Urteil vom 26. Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht das Recht auf selbstbestimmte Lebensbeendigung zum Grundrecht erklärt. Bis zu diesem Urteil hat der Verein Sterbehilfe Pionierarbeit geleistet, denn der Verein war der einzige, der in Deutschland Suizidassistenz leistete – trotz der vielen Politiker und Staatsanwälte, die diese Tätigkeit für moralisch verwerflich oder gar strafbar hielten. Das Urteil aus Karlsruhe hat dem Verein Recht gegeben: Seine Tätigkeit war nie in einer rechtlichen Grauzone. Die Unterstützung der Vereinsmitglieder bei der Verwirklichung ihres Grundrechts auf selbstbestimmte Lebensbeendigung war also schon vor diesem Urteil legitim. Im Buch werden alle 470 Fälle geschildert, in denen der Verein Sterbehilfe in den letzten 12 Jahren seinen Mitgliedern beim Suizid half. So erfährt der Leser und die Leserin, was das Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben im Alltag bedeutet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verein Sterbehilfe
Kuttelgasse 4
8001 Zürich
Tel. 0041 43 542 6326
www.sterbehilfe.de
Deutschlandbüro
Schanzenstraße 36
20357 Hamburg
Tel. 0049 40 2351 9100
In der Schriftenreihe des Vereins Sterbehilfe sind bisher erschienen:
Band 1 Kusch/Spittler: Weißbuch 2011
Band 2 Spittler: Ärztliches Ethos und Suizid-Beihilfe (2011)
Band 3 Kusch: Sterbehilfe aus christlicher Nächstenliebe (2011)
Band 4 Kusch/Spittler: Weißbuch 2012
Band 5 Kusch/Spittler: Der Ausklang Edition 2013
Band 6 Kusch/Spittler: Der Ausklang Edition 2014
Band 7 Benzin: Der Ausklang Edition 2015
Band 8 Saliger: Selbstbestimmung bis zuletzt (2015)
Band 9 Kusch: Der Ausklang Edition 2016
Band 10 Kusch/Hecker: Handbuch der Sterbehilfe, 1. Auflage 2020
Band 11 Kusch/Hecker: Handbuch der Sterbehilfe, 2. Auflage 2021
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abschiedsbrief posthum
1.
Glück – von Roger Kusch
Ludwig Marcuse
A. Paul Weber
Macht Geld glücklich?
Zu viel Geld macht unglücklich
Die Linien des Glücks
Das Grüne Licht als Glück
2.
Suizidbegleitung nach
GL
Erläuterungen zu den Kapiteln 2 und 3
18 – 24 Jahre
25 – 29 Jahre
30 – 34 Jahre
35 – 39 Jahre
40 – 44 Jahre
45 – 49 Jahre
50 – 54 Jahre
55 – 59 Jahre
60 – 64 Jahre
65 – 69 Jahre
70 – 74 Jahre
75 – 79 Jahre
80 – 84 Jahre
85 – 89 Jahre
90 – 94 Jahre
95 – 99 Jahre
100 – 104 Jahre
3.
GL
ohne Suizidbegleitung
18 – 24 Jahre
30 – 34 Jahre
35 – 39 Jahre
40 – 44 Jahre
45 – 49 Jahre
50 – 54 Jahre
55 – 59 Jahre
60 – 64 Jahre
65 – 69 Jahre
70 – 74 Jahre
75 – 79 Jahre
80 – 84 Jahre
85 – 89 Jahre
90 – 94 Jahre
95 – 99 Jahre
4.
Kein
GL
30 – 34 Jahre
35 – 39 Jahre
40 – 44 Jahre
45 – 49 Jahre
50 – 54 Jahre
55 – 59 Jahre
60 – 64 Jahre
65 – 69 Jahre
70 – 74 Jahre
75 – 79 Jahre
80 – 84 Jahre
85 – 89 Jahre
90 – 94 Jahre
5.
Zahlen, Analysen, Bewertungen
5.1 Historie
5.2 Mitglieder und Suizidbegleitungen
5.3 Männer / Frauen
5.4 Altersverteilung
5.5
GL
5.5.1 Bedeutung für das Mitglied
5.5.2 Herausforderung für den Verein
5.5.3 Die Zeit nach GL
5.6 Suizidwünsche in drei Kategorien
5.7 Die drei Suizidmethoden
5.7.1 oral / Mitarbeitende
5.7.2 oral / Angehörige
5.7.3 intravenös / Arzt oder Ärztin
5.8 Die Sicherheit der Durchführung
5.8.1 Natrium-Pentobarbital
5.8.2 Intravenöse Suizidbegleitung
5.8.3 Orale Suizidbegleitung
5.9 Finanzielles
6.
Politik – von Roger Kusch
Wir wollen mehr Demokratie wagen
Mehr Fortschritt wagen
Der neue Bundestag ist teilweise der alte
Selbst-Test
Gesetzentwurf Heil/Stark-Watzinger
Bundesverfassungsgericht als Hoffnung
7.
Statuten
8.
Ethische Grundsätze
9.
Abkürzungen, Links und Literatur
Vorwort
Am 21. Januar 2010 half unser Verein erstmals einem Mitglied beim Suizid, S•027 → S. →. Bis Ende 2021 kamen weitere 469 Suizidbegleitungen hinzu, die alle einzeln im Kapitel 2 dargestellt werden. Mag die Lektüre auch etwas spröde sein, ist es mir doch ein gesellschaftspolitisches Anliegen, die Tätigkeit unseres Vereins so transparent wie möglich zu machen.
Mit dem epochalen Urteil vom 26. Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht das Recht auf selbstbestimmte Lebensbeendigung zum Grundrecht erklärt. Bis zu diesem Urteil haben wir Pionierarbeit geleistet, denn unser Verein war der einzige, der in Deutschland Suizidassistenz leistete – trotz der vielen Politiker und Staatsanwälte, die unsere Tätigkeit für moralisch verwerflich oder gar strafbar hielten. All die Hausdurchsuchungen und Ermittlungsverfahren, bis hin zum Polizeigewahrsam von Roger Kusch, waren für uns schwere Belastungen.
Das Urteil aus Karlsruhe hat unserem Verein Recht gegeben: Wir arbeiten nicht in einer rechtlichen Grauzone. Die Unterstützung unserer Mitglieder bei der Verwirklichung ihres Grundrechts auf selbstbestimmte Lebensbeendigung war also schon vor diesem Urteil legitim. Möge durch dieses Buch anschaulich werden, was das Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben im Alltag bedeutet.
Zürich, den 1. Februar 2022
Jakub Jaros
Geschäftsführer des Vereins Sterbehilfe
Abschiedsbrief posthum
Liebe Beate,
heute vor neun Jahren hast du mich zum ersten Mal angerufen. Du hast lange von deinem Leben erzählt, über dein Leid berichtet, über deine Absicht, dein Leben zu beenden.
Als du das Grüne Licht vom Verein bekamst, warst du erleichtert, und als ich dir die Idee vorgestellt habe, für den Verein als Sterbebegleiterin zu arbeiten, warst du einverstanden. Ich konnte mit der Vorstellung, dass eine so junge und sympathische Frau „nur“ aufgrund von psychischem Leid aus dem Leben scheiden möchte, nicht zurechtkommen.
Ich habe unsere gemeinsame Zeit genossen, denn wir waren ein starkes Team. Du hast für den Verein großartige Arbeit geleistet. Nach sechs Monaten gewann dein Leid wieder die Oberhand. Schweren Herzens haben wir deinen Wunsch erfüllt.
Ich denke oft an dich. Du hast mir gezeigt, wieviel Kraft es kostet, sich gegen psychisches Leid anzustemmen. Danke für alles!
Dein Jakub
Zürich, den 10. Januar 2022
1. Glück – von Roger Kusch
Nach meinem Abitur 1973 in Esslingen absolvierte ich den – damals obligatorischen – Wehrdienst in Böblingen, Calw und wieder Esslingen. Ab 1974 studierte ich drei Semester lang Jura in Tübingen. Erst danach, mit 21 Jahren, fand ich den Mut, mich aus dem familiär vorgegebenen Großraum Stuttgart zu lösen und das Jurastudium in Hamburg fortzusetzen.
Üblicherweise war mit dem Wehrdienst die Abnabelung vom Elternhaus verbunden. Mir jedoch gelang es, vom Fallschirmjägerbataillon Calw zum Sanitätsbataillon Esslingen versetzen zu werden – von den Rambo-Einzelkämpfern zurück in die Nähe des Elternhauses.
Ludwig Marcuse
In einer Esslinger Buchhandlung sah ich ein Diogenes-Taschenbuch von Marcuse und wunderte mich, dass der marxistische Philosoph sich mit dem unpolitisch-individualistischen Thema „Glück“ beschäftigt hatte. Der Buchhändler klärte mich auf, dass die beiden deutschen Philosophen Herbert und Ludwig Marcuse außer dem Nachnamen und biographischen Parallelen – insbesondere der Emigration in die USA – nichts miteinander zu tun haben.
So kaufte ich das Taschenbuch „Philosophie des Glücks“ von Ludwig Marcuse und schenkte es meinen Eltern. Mit Datum 17.1.1974 schrieb ich die Widmung: „Auf daß meinen lieben Eltern in ihrer häufiger werdenden Zweisamkeit die Glücksphilosophie nicht ausgehe.“ Ob das Buch meinen Eltern dabei half, den allmählichen, aber unvermeidlichen Auszug ihres jüngsten Kindes besser zu verkraften, weiß ich nicht. Vermutlich nicht. Geschenkte Bücher stellt man ins Regal. Sie ersparen dem Empfänger, Lese-Glück vorgaukeln zu müssen – es sei denn, der Schenker stellt nach einiger Zeit die taktlose Frage, ob die Lektüre Freude gemacht habe.
Das Buch von Ludwig Marcuse habe ich wahrscheinlich mir selber geschenkt. Beim Blättern im elterlichen Wohnzimmer stieß ich im dritten Kapitel auf ein Idol meiner Märchen-Kindheit und las dann die „Philosophie des Glücks“ von Anfang bis Ende – mit großer Freude.
Mein Lieblingsheld in Grimms Märchen war nicht ein Prinz, ein Stadtmusikant oder Hänsel. Diese und viele andere haben mich verzaubert, aber sie blieben mir doch fern. Ich wollte sein wie Hans im Glück, glücklich sein wie er. Und ahnte doch schon als kleiner Junge, dass mir sein Glück zeitlebens verwehrt bleiben würde. 60 Jahre später weiß ich einigermaßen, warum.
Hans hat das Talent zum Glück, das mir fehlt, so wie ich auch kein Talent zum Geigenspielen habe. Hans ruht in sich, ich nicht in mir. Sein Glück kommt aus ihm selbst. Mein Glück hängt vom Zuspruch, der Anerkennung, der Zuneigung und Unterstützung anderer Menschen ab. Hans zog allein durch die Welt. Ich reise nicht allein in fremde Länder. Sein Glück ist seines. Für mich ist Glück, wenn ich es mit jemandem teilen kann. Das Feuerwerk in der Silvesternacht 2019/2020 an der Copacabana war das schönste, das ich je sah. Ich war nicht allein.
Immerhin gibt es zwischen Hans und mir eine tröstliche Parallele: Er verdankt sein Lebens-Glück dem Zufall, genauso wie ich meine glücklichen Momente dem Zufall verdanke. Bei Hans kommt immer, wenn ihn sein Glück zu verlassen droht, zur rechten Zeit der rechte Glücksbringer. Nachdem ihn ein störrisches Pferd abwirft, trifft er auf einen Bauern mit freundlicher Kuh. Vielleicht war es Hans, der mir die Augen geöffnet hat: Erfolg, Zufriedenheit und auch das Glück sind nie verdient und nie erarbeitet, sondern immer Zufall. Der Zufall fängt früh an im Leben: bei der Mixtur der mütterlichen und väterlichen Gene. Ich empfand die Mixtur, der ich mein Leben verdanke, immer als Glück, sah aber nie Anlass, meinen Eltern dafür zu danken. Sie hatten keine Leistung vollbracht, sondern den Zeitpunkt der Mixtur dem Zufall überlassen, wie das in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts so üblich war.
A. Paul Weber
Im Studium blieb das Verhältnis zu meinen Eltern eng. Selbst aus Hamburg besuchte ich sie regelmäßig. In der kalten Jahreszeit kam es bei jedem Besuch zum selben Konflikt mit meiner Mutter. Sie war die sparsamste, bisweilen knauserigste Person, die ich je kennengelernt habe. Im ganzen Haus war es so kalt, dass ich fror. Meine Mutter rechtfertigte die Temperatur mit den hohen Heizkosten und vermutete als Ergänzung, dass ich verweichlicht sei. Als ich mit der Drohung konterte, meine Besuche auf die warme Jahreszeit zu beschränken, lenkte meine Mutter ein und versprach, künftig einige Stunden vor meinem Besuch die Thermostatventile von 2,5 auf 3 hochzustellen.
Bald nach meiner Ankunft in Hamburg entdeckte ich in der Nähe der Universität das Libresso als mein Lieblingscafé. Verteilt über mehrere Räume waren tausende antiquarische Bücher unordentlich in Regalen gestapelt. Neben dem Kaffeetrinken konnte man in diesen Büchern blättern. Außerdem gab es eine Kommode, in der hunderte Drucke verschiedener Künstler lagen. Eine Lithographie des politisch-satirischen Zeichners A. Paul Weber hatte es mir besonders angetan: Die Maske eines Richters samt Robe, aus der ein Krokodil herausschaut. Ich hielt das Blatt für eine Rarität, weil die bei Lithographien übliche Nummer fehlte.
Die Robe hatte Bezug zu meinem Vater, der Richter war, ich hatte genug Geld, die seltene Graphik des berühmten Künstlers zu kaufen, und schenkte sie meinen Eltern zu Weihnachten. Es war das teuerste Geschenk, das meine Eltern je von mir bekamen. Sie freuten sich sehr und hängten das Bild an einem prominenten Platz im Wohnzimmer auf.
Ein Jahr später war ich mal wieder zu Besuch, saß im wohltemperierten Wohnzimmer, meine Mutter bereitete in der Küche das Mittagessen vor, als ich plötzlich stutze: A. Paul Weber war verschwunden und durch ein drittklassiges Aquarell ersetzt. Ich brauchte nicht lange zu suchen. Das Krokodil in Richterrobe hing in einem winzigen, düsteren Verbindungsflur, weit entfernt vom Gäste-WC. Ich stürmte in die Küche und stellte meine Mutter zur Rede. Ihr fiel der Kochlöffel aus der Hand. „O je! Hab ich vergessen, ihn umzuhängen!“
Ich erfuhr, dass meine Eltern die Graphik von Anfang an nicht gemocht hatten. Vermutlich sah mein Vater in der Richter-Maskerade eine Kritik an seinem Beruf oder an seiner NS-Vergangenheit oder an beidem. Vor jedem Besuch musste meine arme Mutter das Bild umhängen und im Winter auch noch die Heizung aufdrehen. Ich schlug meinen Eltern vor, das Bild zurückzunehmen – sie brauchten sich nicht mehr zu verstellen, und ich freue mich bis heute an dem künstlerischen Highlight meiner Wohnung. Am Heizungs-Problem allerdings änderte sich nichts.
Kann man Glück schenken? Jedenfalls nicht mit einer Lithographie von A. Paul Weber und erst recht nicht mit Überraschungsgeschenken, es sei denn, es sind vergängliche Kleinigkeiten wie Pralinen, Blumen oder Likör. Die Übergabe eines Geldgeschenks kann zwar peinlich sein, wird den Empfänger aber doch glücklich machen, wenn der Betrag hoch genug ist. Falls Geld nicht in Betracht kommt, sollte man beim Kauf eines Geschenks den Empfänger gleich mitnehmen.
Macht Geld glücklich?
In meinen viereinhalb Jahren als Justizsenator wurde ich von den besseren Kreisen Hamburgs hofiert und bekam Einladungen zu vielen Anlässen. Bei solch einem Anlass, es war Anfang 2006, als ich wegen meines öffentlichen Sterbehilfe-Engagements bereits täglich mit meiner Entlassung rechnete, traf ich auf ein bedeutendes Ehepaar. Er war ein Hamburger Nachkriegs-Selfmade-Millionär (oder -Milliardär), der sich neben allerlei sozialen Wohltaten auch den Professoren-Titel hatte leisten können.
Seine Gattin sprach mich auf Sterbehilfe an und sagte, dass sie davon gar nichts halte. Sie habe ihre Mutter bis zu deren Tod jahrelang im eigenen Haus gepflegt. Sie und ihr Mann hätten sich auf Parterre und ersten Stock beschränkt und der Mutter den zweiten Stock überlassen. Die Pflegekräfte, die dort ihre Zimmer hatten, hätten die Mutter rund um die Uhr liebevoll betreut. So stelle sie sich ein würdiges Lebensende vor.
Ein halbes Jahr zuvor, an einem sonnigen Nachmittag, ging ich zur Gartenparty eines in der Hamburger CDU gut vernetzten Managers. Ich stand auf der Terrasse seines Hauses mit Blick auf den Garten, als hinter mir ein älteres Ehepaar auftauchte. Sie sagte zu ihrem Gatten (ebenfalls Selfmade, aber noch reicher als der zuvor erwähnte Wohltäter und selbstverständlich auch Professor): „Schau mal, Butzi, was man aus einem so kleinen Garten Entzückendes machen kann!“ Ich schaute auf einen Garten in Größe eines Fußballfeldes.
Ich missgönne niemandem seine Millionen, Milliarden oder privaten Fußballfelder. Aber dass der Hamburger Senat den Professoren-Titel an reiche oder politisch genehme Nicht-Wissenschaftler verleiht, ist skurril. Das Highlight dabei ist Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, dem weder Hamburg noch die Wissenschaft irgendetwas zu verdanken haben. SPD-Mitglied Montgomery trat aus der Partei aus, nachdem ihm sein SPD-Parteifreund und Erster Bürgermeister Olaf Scholz den Professorentitel verliehen hatte.
Dass ich in meiner Zeit als Mitglied des Senats derartigen gekauften oder parteiopportunen Verleihungen zugestimmt hatte, ist mir bis heute peinlich. Ich hatte Justizsenator werden wollen, war es nun, und wollte diesen beruflichen Zenit eine Zeitlang genießen. Den Traum hamburgischer Parvenüs von pseudoakademischem Glanz zu zerstören, war mir nicht wichtig genug, meinen eigenen Traum – Hamburger Justizsenator zu sein – in Gefahr zu bringen. So habe auch ich, jedenfalls in moralischem Sinne, den Erhalt meines Senatorentitels erkauft.
Beide Gattinnen, eine der beiden durfte sich selbst mit dem Professorinnen-Titel schmücken, machten auf mich einen zufriedenen Eindruck.
Vielleicht waren sie sogar glücklich mit ihren Tellerwäscher-Ehemännern, denen sie nach dem Krieg den Rücken freigehalten hatten, und an deren gesellschaftlichem Ansehen sie nunmehr teilhaben durften.
Kürzlich las ich, dass Rolls-Royce im Corona-Jahr 2021 so viele Autos verkauft hat wie nie zuvor. Reiche Menschen wollen sich von Corona ihr Glück nicht verderben lassen. Ob man Glück mit Geld kaufen kann, weiß ich nicht. Aber die Suggestion von Glück scheint man kaufen zu können.
Wer will sich sicher sein, echtes Gefühl von Suggestion unterscheiden zu können?
Zu viel Geld macht unglücklich
In jüngeren Jahren habe ich darunter gelitten, in keiner Disziplin der Erste zu sein. Ob Schule, Studium, Liebesleben oder Beruf – immer gab es andere, die besser waren. Es hat Jahre gedauert, bis ich die Segnungen des Mittelmaßes erkannte. Das gilt auch fürs Geld. Meine materiellen Träume orientierten sich auf wundersame Weise an meinen materiellen Möglichkeiten. Ich scheine die Knausrigkeitsgene meiner Mutter in günstiger Dosierung geerbt zu haben. Nie hatte ich Geldmangel, war nie reich und hatte nie die Sehnsucht, reich zu sein – eine zufällige Glücks-Disposition, die mich mein ganzes bisheriges Leben begleitet.
Während ich im Mittelmaß verharrte, wurden Freunde und Bekannte von mir reich und reicher, bei ähnlicher Ausgangslage. Das machte mich neugierig. Zweierlei kann ich festhalten.
Ich habe nie eine Aktie besessen. Der tägliche Blick auf die schwankenden Kurse hätte mir den Schlaf geraubt. Wer robustere Nerven hat als ich, konnte in den letzten Jahrzehnten mit Aktienspekulationen viel Geld verdienen.
Immobiliengeschäfte hingegen traute ich mir in geringem Umfang zu, weil die Gefahr des Wertverlusts kleiner ist als bei Aktien. Große Gewinne machte ich aber auch da nicht, weil mir die Geduld fehlte, mit dem Verkauf zu warten, bis die Preise gestiegen waren.
Bei denjenigen, die wirtschaftlich erfolgreicher waren als ich, fiel mir auf, dass sich das Anhäufen von Geld zur Sucht entwickeln kann, nicht anders als bei Zigaretten, Alkohol und Drogen. Manifest wird die Geld-Sucht dann, wenn der Süchtige so viel anhäuft, dass er nicht mehr weiß, wofür er sein vieles Geld noch ausgeben könnte. Verzweifelte Drogensüchtige nehmen Methadon, verzweifelte Geldsüchtige gründen eine gemeinnützige Stiftung.
Dass die beiden Nachkriegs-Tellerwäscher des vorigen Abschnitts Stiftungen gegründet hatten, für die sie das Bundesverdienstkreuz und andere Ehrungen erhielten, versteht sich von selbst.
Die Krux ist die Gewöhnung. Wer sich das ganze Leben lang alles kaufen kann, verlernt Selbstkritik und Zurückhaltung, ohne die es gerade am Lebensende keine Gelassenheit gibt. Das eindrücklichste Beispiel liefert Ehemann G•236 → S. →, der den Verein mit viel Geld bewegen wollte, seine demente Ehefrau K•086 → S. → zeitgleich zum eigenen Suizid zu ermorden. Sechs Monate später starb er eines natürlichen Todes. Möge er in dieser Zeit nicht mehr zu sehr unter seiner Geldsucht gelitten haben. Vielleicht hatte er in seinem langen Leben ja auch irgendetwas Gutes für andere Menschen getan.
Die Linien des Glücks
Wer sich für Politik interessiert, muss sich auch für Demoskopie interessieren. Wie will man Wahlkampf machen, wenn man nicht genau weiß, wie die Volksseele tickt, welche Sehnsüchte in ihr brodeln und welche Ressentiments zu berücksichtigen sind? Die westdeutsche Nachkriegs-Demokratie ist untrennbar verbunden mit Elisabeth Noelle-Neumann, der Gründerin des Instituts für Demoskopie in Allensbach. Sie wurde – huldvoll und keineswegs spöttisch – die „Pythia vom Bodensee“ genannt. Mit schiefem Kopf, stets lächelnd und immer mit derselben Föhnwelle in der Stirn orakelte sie über das, was die Deutschen schon immer über sich wissen wollten. Adenauer war ihr prominentester Jünger.
Zu ihrem neunzigsten Geburtstag stifteten die Gemeinde Allensbach und die Bezirkssparkasse Reichenau den Prof.-Dr.-Elisabeth-Noelle-Preis. Er ist mit 5.000 Euro dotiert und wird alle drei Jahre an Nachwuchswissenschaftler:innen der Universität Konstanz vergeben in Anerkennung herausragender Leistungen auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften. Die NS-Verstrickung der Pythia trübt heute ein wenig ihren Nachruhm, spielte in der Adenauer-Zeit aber keine Rolle.
Das Großartige an der Demoskopie ist ihre Bandbreite. Sie steht Boulevard-Medien genauso zu Diensten wie der hehren Wissenschaft. Es gibt die ungeheuerliche, durch keinerlei demoskopische Umfragen belegte Behauptung, jedes demoskopische Ergebnis hänge vom Auftraggeber und der Honorierung ab.
Fiebern Sie stets genauso wie ich der jährlichen Ranking-Liste „Die glücklichsten Länder“ entgegen? Jahr für Jahr werden in 177 Ländern jeweils 177 repräsentativ ausgewählte Telefonnummern angerufen und der oder die Angerufene gefragt, ob er oder sie glücklich sei. Die skandinavischen Länder haben immer die Nase vorn. Dort scheint sich ein Volkssport entwickelt zu haben, dass beim Klingeln des Telefons mit unbekannter Nummer nur glückliche eloquente Erwachsene das Gespräch annehmen dürfen.
Am 25.12.2021 erschien in der Zürcher SonntagsZeitung ein Artikel mit der Überschrift: „Acht Erkenntnisse: Was uns wirklich glücklich macht.“ Kulturredaktorin Alexandra Kedves präsentiert als eine der Erkenntnisse die Bedeutung des Alters.
Zunächst skizziert sie die U-Kurve des Glücks. Prominentester U-Kurven-Protagonist ist der Ökonom David G. Blanchflower, der in einer Veröffentlichung von 2007 die Daten von 132 Ländern vergleicht, darunter 95 Entwicklungsländer. Er stellt fest, dass jedes Land eine U-förmige Glückskurve habe, die in Industrienationen mit 47,2 Jahren und in Entwicklungsländern mit 48,2 Jahren ihren Tiefpunkt erreicht.
Als ich zum Justizsenator ernannt wurde, meinem beruflichen Zenit, war ich 47,2 Jahre alt. Irgendetwas kann an der U-Kurve nicht stimmen. Diese Skepsis vermittelt Frau Kedves auch den Lesenden der SonntagsZeitung und präsentiert als ultimative Erkenntnis wissenschaftlicher Forschung die abfallende Glücks-Linie, die von den Münchner Sozialwissenschaftlern Fabian Kratz und Josef Brüderl entdeckt wurde: Mit 20 Jahren ist die Lebenszufriedenheit am höchsten und beginnt dann leicht zu sinken. Mit 60 kommt der Sinkflug zu einem Halt und mündet dann ab 65 in einen Sturzflug.
Das sind für mich mit meinen nunmehr 67 Jahren keine schönen Aussichten. Was tun? Ich könnte im Internet schauen, ob die Herren Kratz und Brüderl (vermutlich gegen hohe Kursgebühren) Glücks-Seminare in den bayerischen Alpen anbieten. Ich könnte behaupten, ich sei erst 57 und diese Lüge so oft wiederholen, bis ich selbst daran glaube.
Seminare habe ich noch nie gemocht, und lügen kann ich auch nicht gut. So habe ich mir meine eigene, preisgünstige Doppel-Glücks-Strategie ausgedacht:
Unsinn nicht zur Kenntnis nehmen.
Freundschaften nicht übereilt beenden.
Das Grüne Licht als Glück
Mitglieder unseres Vereins entscheiden sich oft für eine andere Strategie. Sie bitten um GL und sind glücklich, wenn der Verein ihren Wunsch erfüllt. Viele dieser Mitglieder sind unheilbar krank. Kann man einen unheilbar Kranken glücklich machen? Ja. Indem man ihn von einem Teil seines Unglücks befreit. GL öffnet einen Notausgang, der zuvor verschlossen war. Wer darauf vertrauen kann und weiß, dass eine Tür dauerhaft offen ist, braucht nicht mehr am Türgriff zu rütteln.
Unser Verein folgt keinen Glücks-Rezepten, -Linien oder -Theorien. Wir sagen unseren Mitgliedern nicht, wie sie glücklich werden können oder sollen. Wir mischen uns nicht in deren Leben ein, sondern bleiben an der Seite – als Partner, auf den stets Verlass ist. Wir versprechen immer nur das, was wir halten können. Mit dieser Zuverlässigkeit haben wir schon viele Mitglieder glücklich gemacht, wie Fall S•043 → S. →, Fall S•068 → S. → und die Beispiele des Kapitels 3 → S. → ff. zeigen.
Mitglied G•002 → S. → bekam im Juli 2013 GL. Es macht die Mitarbeitenden des Vereins glücklich, dass dieses Mitglied wie viele andere bis heute vom GL keinen Gebrauch gemacht hat.
Zuverlässigkeit verbindet das Glück der Mitglieder mit dem der Mitarbeitenden des Vereins.
2. Suizidbegleitung nach GL
In den zwölf Jahren seines Bestehens, von 2010 bis 2021, hat der Verein Sterbehilfe 470 Mitgliedern beim Suizid geholfen. In diesem Kapitel 2 werden alle 470 Fälle dargestellt. Darunter sind 17 Doppelsuizide: das heißt, dass 34 Mitglieder gemeinsam mit Ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin aus dem Leben scheiden wollten. Hinzu kommen 236 Fälle, in denen Mitglieder GL bekamen, es aber nicht in Anspruch nahmen (Kapitel 3), sowie 88 Fälle, in denen der Verein GL ablehnte (Kapitel 4).
Zusammenfassend heißt das: Der Verein hat in den zwölf Jahren seines Bestehens 794 Mal eine GL-Entscheidung gefällt. 706 Mitgliedern hat er GL gegeben (89 %), 88 Mitgliedern hat er GL nicht gegeben (11 %).
Erläuterungen zu den Kapiteln 2 und 3
Bei den Falldarstellungen bemühen wir uns, einerseits den Lesenden eine plastische Vorstellung des individuellen Schicksals zu vermitteln, andererseits die Anonymität der Mitglieder und ihrer Angehörigen zu wahren. Das exakte Alter eines Mitglieds spielt für das Verständnis seines Suizidwunsches in der Regel keine Rolle, deshalb fassen wir Altersgruppen in 5-Jahres-Schritten zusammen.
Die Ausführlichkeit der Darstellung hängt davon ab, ob über das Mitglied in früheren Büchern unserer Schriftenreihe schon berichtet wurde oder nicht. Wenn sich ein Fall beispielsweise auf die kurze Mitteilung „Mitglied hat MS“ beschränkt, dann verweist die Fußnote auf eine ausführliche Darstellung in einem früheren Buch. Enthält die Fußnote zwei Verweise, dann führt der erste Verweis zur ausführlicheren Darstellung als der zweite.
In allen 706 Fällen, die in den Kapiteln 2 und 3 dargestellt werden, liegt ein ärztliches Gutachten vor, das die Freiverantwortlichkeit des sterbewilligen Mitglieds bejaht, in schwierigen Fällen auch zwei Gutachten, in Einzelfällen sogar drei. Zur besseren Lesbarkeit werden diese Gutachten in den Falldarstellungen meist nicht erwähnt.
Wir wissen, dass das Wort „Fall“ sehr nüchtern klingt angesichts der Schicksale, die sich dahinter verbergen. Ein Buch wie dieses ist jedoch nicht geeignet, Anteilnahme, Mitleid, Verbundenheit und andere Emotionen in angemessene Worte zu fassen. Allerdings schließen wir nicht aus, dass bisweilen in den Falldarstellungen doch Emotionen erkennbar werden, beispielsweise gleich im ersten Fall S•001.
18 – 24 Jahre
S•001 Das Mitgliedsformular trägt das Datum 7. Oktober 2020. Einen Tag nach seinem 18. Geburtstag am 6. Oktober 2020 tritt Mitglied dem Verein bei. Am 26. Februar 2020 hatte er die Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichts im Fernsehen verfolgt und seine Eltern gebeten, vorbereitenden Kontakt mit dem Verein aufzunehmen. Seit seinem 14. Lebensjahr leidet Mitglied an progredienten ALS-Symptomen. Beim Begutachtungsgespräch zur Feststellung der Freiverantwortlichkeit stellt die Ärztin fest, dass Mitglied bei 1,83 m Größe 31 kg wiegt, nur noch die Hände ab dem Ellenbogen langsam bewegen und den Kopf mühsam drehen kann, bei ansonsten vollständiger Lähmung. Sauerstoffzufuhr ist notwendig, weil die Atemmuskulatur zu schwach ist, um den Körper ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Der Todeswunsch besteht seit 2019 und ist mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden vielfach besprochen worden. Trotz eigener Beklemmung wegen des bevorstehenden endgültigen Verlusts unterstützen sie alle den Wunsch des Mitglieds, sein Leid zu beenden. Suizidbegleitung durch Angehörige im Januar 2021, sechs Tage nach GL. Das junge Mitglied ist erst nach einer halben Stunde vollständig eingeschlafen. Der Tod trat eine Stunde später ein. Die Familie versucht nun, jeder auf eigene Art, mit dem Verlust zurechtzukommen.
S•002 Mitglied ist Jurastudentin mit Vorliebe fürs Öffentliche Recht. Im Jahre 2018, im fünften Semester, hat sie einen grippalen Infekt, von dem sie sich in den folgenden Monaten nicht richtig erholt. Sie bemerkt Konzentrationsschwierigkeiten bei Vorlesungen und anderen Uni-Veranstaltungen. Sie geht zu mehreren Ärzten, die allesamt keine eindeutige Diagnose stellen können. Nach weiterem Fortschreiten der Erschöpfung wird im Ausschlussverfahren die Diagnose CFS gestellt – in der Schulmedizin umstritten, weil es weder nachweisbar spezifische Befunde, noch ein pathophysiologisches Modell, noch allgemein anerkannte Therapieansätze gibt. Jedenfalls sind die Symptome unzweifelhaft vorhanden. Mitglied erprobt alle Behandlungsansätze, die aktuell diskutiert werden, einschließlich des Versuchs mentaler Beeinflussung. Diese Bemühungen führen nicht zur Linderung, sondern zur Verstärkung des Erschöpfungszustandes. Mitglied ist mittlerweile konstant bettlägerig und sagt, ihr Dasein bestehe nur noch aus Atmen, Essen, Erholung von den Anstrengungen des Essens und Nachdenken über sich und das Leben. Im ärztlichen Gutachten wird die Freiverantwortlichkeit bejaht. In einer Nachbegutachtung zwei Monate später wird die innere Festigkeit des Suizidentschlusses – als eine Voraussetzung der Freiverantwortlichkeit – abermals bejaht. Diese vom Verein bestimmte zweimonatige Wartezeit wird vom Mitglied und auch von seinen Eltern als unerträglich lange wahrgenommen. Suizidbegleitung im Mai 2021, drei Wochen nach GL.
25 – 29 Jahre
S•003 Mitglied leidet an einer Persönlichkeitsstörung, die ihn arbeitsunfähig macht. Suizidbegleitung durch Angehörige im Januar 2012, zehn Monate nach GL.1
1 Ausklang 2013, S. 10, Fall 1; Ausklang 2016, S. 22, Fall 3.
30 – 34 Jahre
S•004 Mitglied hat einen Hirntumor, epileptische Anfälle und unerträgliche Kopfschmerzen. Suizidbegleitung durch Angehörige im Oktober 2015, fünf Wochen nach GL.2
S•005 Mitglied hat wegen fortgeschrittener Rosacea brennende Schmerzen im Gesicht. Suizidbegleitung im April 2020, zwölf Tage nach GL.3
S•006 Mitglied leidet an einem unbehandelbaren und als unerträglich empfundenen Post-Finasterid-Syndrom. Suizidbegleitung – in Anwesenheit der Eltern – im Juni 2020, fünf Monate nach GL.4
S•007 Mitglied war seit seiner Kindheit sportlich aktiv. Schwimmen, Handball, BMX-Fahren, Karate, später Bodybuilding waren seine täglichen Begleiter. 2018, mit 30 Jahren, wiegt er bei 185 cm Körpergröße durchtrainierte 90 kg. Am 16. Oktober 2018 unternimmt er mit Freunden eine Motoradtour. In einer Kurve verliert er die Kontrolle, fährt geradeaus und kollidiert mit einem Rennradfahrer, der stirbt. Mitglied erleidet ein Polytrauma. Neben dem kompletten Ausriss des Plexus Brachialis links kommt es zu Schulterfraktur links, Rippenserienfrakturen, Milzentfernung, Leberteilentfernung und einem Schädel-Hirn-Trauma. Nach vielen Krankenhausaufenthalten mit komplizierten operativen Eingriffen, diversen Heilverfahren, Psychotherapie und anderen Behandlungsmaßnahmen ist mittlerweile ein therapeutischer Endzustand erreicht. Wochen nach dem Unfall stellen sich immer gravierendere Schmerzen ein, die auch durch eine Amputation des linken Arms in Oberarmhöhe nicht besser werden. Zusätzlich wird laborchemisch ein sehr niedriger Testosteronspiegel festgestellt. Das Körpergewicht ist auf 70 kg zurückgegangen. Vor dem Unfall war Mitglied in Gruppen Gleichaltriger integriert. Heute hat er nur noch Kontakt zu Familienangehörigen. Mitglied weiß, dass er dauerhaft Hilfe beim täglichen Leben braucht. Suizidbegleitung im August 2021, zehn Wochen nach GL.
S•008 Mitglied ist gesund, fit und sehr sportlich. Nach einem Studium der Elektrotechnik an der RWTH Aachen arbeitet er zunächst als Mechatroniker und beginnt im August 2017 eine Weiterbildung im Fach Maschinenbautechnik. Am 10. September 2017 unternimmt er mit vier Freunden einen Motorradausflug von Mönchengladbach in die Eifel. Auf der Rückfahrt wird er in einer Kurve wegen zu hoher Geschwindigkeit ins freie Feld geschleudert. Er erleidet eine Querschnittlähmung ab dem 6. Halswirbelkörper mit Harn- und Stuhlinkontinenz. Nach Abschluss neunmonatiger Rehabilitationsmaßnahmen lebt Mitglied in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Mitglied kann sich im Rollstuhl bewegen und teilweise selbst versorgen, ist aber in Bezug auf Körperpflege, An- und Ausziehen sowie Haushaltsführung auf einen regelmäßigen ambulanten Pflegedienst angewiesen. Er leidet unter Dysästhesien mit Brennen ganzer Hautbereiche und unerträglichen Juckreizanfällen. Aufgrund rezidivierender Nebenhodenentzündungen wird der rechte Hoden samt Nebenhoden operativ entfernt, was die Schmerzen kaum lindert. Wegen der Inkontinenz und anfallsweise auftretender schmerzhafter Spastik des gesamten Körpers braucht Mitglied zusätzlich, oft mehrfach täglich, eine Notfallbetreuung. Die Suizidbegleitung im November 2021, zwei Wochen nach GL, scheitert wegen Erbrechens. Sodann erfolgt einen Tag später intravenöse Suizidbegleitung durch Arzt/Ärztin.
2 Ausklang 2016, S. 22, Fall 2.
3 Handbuch 2. Aufl., S. 509, Fall 272.
4 Handbuch 2. Aufl., S. 509 f., Fall 273.
35 – 39 Jahre
S•009 Im Jahre 2010 erhält Mitglied die Diagnose MS. Fünf Jahre später kann er noch in einer eigenen Wohnung leben, ist da aber schon auf 24-Stunden-Hilfe angewiesen. Seit drei Jahren lebt er in einem Pflegeheim. Dorthin wird der Vereinsmitarbeiter zum Videogespräch (Ziff. 7 der Ethischen Grundsätze) von der Stationsleitung begleitet, mit der Begründung, einige Bewohner des Heims seien aggressiv. Mitglied sitzt im elektrischen Rollstuhl, den er nur mit der linken Hand steuern kann. Er kann sich kaum artikulieren, spricht sehr leise, langsam und etwas verschwommen. Mitglied hat zwei Schwestern, die ihm nicht nur helfen, den Mitgliedsantrag an den Verein zu schicken, sondern auch für die Entbindung einer Betreuerin sorgen, die sich weigert, den Suizidentschluss des Mitglieds zu akzeptieren. Auch dass die Heimleitung die Suizidbegleitung toleriert, erfordert erhebliche Überzeugungsarbeit. Beim ärztlichen Begutachtungsgespräch im April 2021 sagt Mitglied, er wolle nicht sofort sterben, es sei für ihn jedoch eine enorme Entlastung, zu wissen, dass er dies jederzeit könne, wenn er GL habe. Mitglied verschluckt sich häufig. Intravenöse Suizidbegleitung durch Arzt/Ärztin im September 2021, viereinhalb Monate nach GL.
40 – 44 Jahre
S•010 Mitglied hat MS. Suizidbegleitung durch Angehörige im September 2012, zwei Monate nach GL.5
S•011 Mitglied leidet an langjährigen unbehandelbaren Depressionen mit Panikattacken. Suizidbegleitung durch Angehörige im Oktober 2013, sechs Wochen nach GL.6
S•012 Mitglied leidet an quälendem Tinnitus. Suizidbegleitung im März 2014, drei Monate nach GL.7
S•013 Mitglied hat ALS. Intravenöse Suizidbegleitung durch Arzt/Ärztin im Juli 2014, fünf Wochen nach GL.8
S•014 Mitglied erhält im Jahre 2018 die Diagnose ALS und ist schon kurz danach bei der Bewältigung des Alltags auf umfassende Hilfe angewiesen. Sie bleibt trotz ihrer Krankheit sozial gut eingebunden, wird oft von Freundinnen, Eltern und Geschwistern besucht. Das Angebot der Eltern, die Pflege zu übernehmen, lehnt Mitglied jedoch ab: Auch das sei „Gefangenschaft“. Im Fragebogen (Ziff. 4 der Ethischen Grundsätze) äußert Mitglied im Juli 2020, sie wolle so bald wie möglich sterben. Suizidbegleitung erst im Februar 2021, sechs Monate nach GL.
5 Ausklang 2013, S. 12, Fall 4; Ausklang 2016, S. 23, Fall 4.
6 Ausklang 2014, S. 10, Fall 1; Ausklang 2016, S. 23, Fall 6.
7 Ausklang 2015, S. 12 f., Fall 2; Ausklang 2016, S. 23, Fall 5.
8 Ausklang 2015, S. 11 f., Fall 1; Ausklang 2016, S. 22, Fall 1 (falsche Alterszuordnung).
45 – 49 Jahre
S•015 Mitglied leidet unter Depressionen und unerträglichen Schmerzen im Gesicht. Suizidbegleitung durch Angehörige im Februar 2011, zwei Wochen nach GL.9
S•016 Mitglied leidet unter einer Persönlichkeitsstörung. Suizidbegleitung im April 2011, sechs Wochen nach GL.10
S•017 Mitglied leidet an Ataxie (Störung der Bewegungskoordination) bei fortschreitender Hirnatrophie (Verlust von Hirnsubstanz). Suizidbegleitung im März 2012, einen Monat nach GL.11
S•018 Mitglied leidet an einem Gehirntumor. Suizidbegleitung durch Angehörige im Dezember 2012, einen Monat nach GL.12
S•019 Mitglied hat MS. Suizidbegleitung durch Angehörige im Februar 2013, wenige Tage nach GL.13
S•020 Mitglied leidet an wiederkehrenden Ängsten, Panikattacken und Depressionen. Suizidbegleitung durch Angehörige im August 2013, vier Monate nach GL.14
S•021 Mitglied leidet an einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung und unter Migräne. Suizidbegleitung im Dezember 2013, acht Monate nach GL.15
S•022 Mitglied hat eine komplexe Persönlichkeitsstörung und leidet unter den Spätfolgen früheren Heroin-, Kokain- und Alkoholmissbrauchs. Suizidbegleitung im Dezember 2013, fünf Wochen nach GL.16
S•023 Mitglied leidet an andauernder Persönlichkeitsänderung nach jahrelangem sexuellen Missbrauch im Kindes- und Jugendalter. Suizidbegleitung im Februar 2014, eine Woche nach GL.17
S•024 Mitglied hat ALS. Suizidbegleitung im Oktober 2014, fünfzehn Monate nach GL.18
S•025 Mitglied hat MSA-C. Suizidbegleitung im November 2015, drei Monate nach GL.19
S•026 Mitglied leidet an der erblichen Machado-Joseph-Krankheit, ist auf einen Rollstuhl angewiesen und hat starke Artikulationsstörungen. Suizidbegleitung durch Angehörige im April 2019, einen Monat nach GL.20
9 Ausführlich: Weißbuch 2012, S. 11 ff. (Herr B); Ausklang 2016, S. 24, Fall 10.
10 Ausführlich: Spittler 2011, S. 88 ff., Fall 3; Weißbuch 2012, S. 11 (Frau A); Ausklang 2016, S. 35, Fall 68 (falsche Alterszuordnung).
11 Ausklang 2013, S. 10 f., Fall 2; Ausklang 2016, S. 25, Fall 14.
12 Ausklang 2013, S. 11 f., Fall 3; Ausklang 2016, S. 24, Fall 9.
13 Ausklang 2014, S. 12 f., Fall 3; Ausklang 2016, S.24, Fall 8.
14 Ausklang 2014, S. 15 ff., Fall 5; Ausklang 2016, S. 25, Fall 16.
15 Ausklang 2014, S. 13 ff., Fall 4; Ausklang 2016, S. 25, Fall 13.
16 Ausklang 2014, S. 11 f., Fall 2; Ausklang 2016, S. 23, Fall 7.
17 Ausklang 2015, S. 13 f., Fall 4; Ausklang 2016, S. 24, Fall 12.
18 Ausklang 2015, S. 13, Fall 3; Ausklang 2016, S. 24, Fall 11.
19 Ausklang 2016, S. 25, Fall 15.
20 Handbuch 2. Aufl., S. 503, Fall 255.
50 – 54 Jahre
S•027 Mitglied hat MS. Suizidbegleitung im Januar 2010, sechs Monate nach GL.21
S•028 Mitglied leidet an einer Persönlichkeitsstörung. Suizidbegleitung im November 2011, wenige Tage nach GL.22
S•029 Mitglied ist nach Fahrradsturz querschnittgelähmt. Suizidbegleitung durch Angehörige im Januar 2012, wenige Tage nach GL.23
S•030 Mitglied leidet an einem Karzinom des rechten Oberkiefers, das bis ins Gehirn eingewachsen ist. Suizidbegleitung im Mai 2012, drei Wochen nach GL.24
S•031 Mitglied leidet an einem metastasierten Karzinom. Suizidbegleitung durch Angehörige im Januar 2014, fünf Monate nach GL.25
S•032 Mitglied hat MS. Suizidbegleitung durch Angehörige im Januar 2014, sechs Wochen nach GL.26
S•033 Mitglied leidet an einem metastasierten Karzinom. Suizidbegleitung durch Angehörige im April 2014, wenige Tage nach GL.27
S•034 Als Folge eines Schlaganfalls leidet Mitglied unter starken Schmerzen, besonders bei Sonnenlicht. Intravenöse Suizidbegleitung durch Arzt/ Ärztin im November 2014, sechs Wochen nach GL.28
S•035 Mitglied hat ALS. Suizidbegleitung im Februar 2015, fünf Tage nach GL.29
S•036 Mitglied hat eine Persönlichkeitsstörung infolge sexuellen Missbrauchs im Kindes- und Jugendalter. Suizidbegleitung im Februar 2015, zweieinhalb Monate nach GL.
S•037 Mitglied leidet an einem metastasierten Karzinom. Intravenöse Suizidbegleitung durch Arzt/Ärztin im März 2015, sechs Monate nach GL.30
S•038 Mitglied hat COPD. Suizidbegleitung durch Angehörige im August 2015, zweieinhalb Monate nach GL.31
S•039 Mitglied hat MS. Suizidbegleitung durch Angehörige im September 2015, drei Wochen nach GL.32
S•040 Mitglied ist psychisch krank. Im ärztlichen Gutachten wird die Freiverantwortlichkeit bejaht. Suizidbegleitung im Juni 2020, einen Monat nach GL.33
S•041 Mitglied hat MS. Suizidbegleitung im September 2020, fünf Tage nach GL.34
S•042 Mitglied sagt beim ärztlichen Begutachtungsgespräch: „Ursprünglich wollte ich mich nur absichern, dass alle Formalien geregelt sind, wenn ich die Hilfe brauche und dann nicht monatelang drauf warten muss. Dadurch, dass ich jetzt seit einem halben Jahr diese starke Cervicobrachialgie [in den Arm ausstrahlende Schmerzen bei Degenerierung der Halswirbelsäule] habe, kann ich praktisch nichts mehr machen. Ich bin zwar nicht wirklich gelähmt, aber es fällt mir alles aus der Hand, und ich habe so starke Schmerzen, dass ich wie gelähmt bin. Alles, was das Leben ausgemacht hat, kann ich praktisch nicht mehr machen! Konservativ ist alles ausgeschöpft, und es lässt sich nicht operieren. Ich weiß nicht, wie lang ich hier noch selbständig leben kann.“ Mitglied leidet immer wieder unter starkem Erbrechen. Intravenöse Suizidbegleitung durch Arzt/Ärztin im Januar 2021, sechs Wochen nach GL.
S•043





























