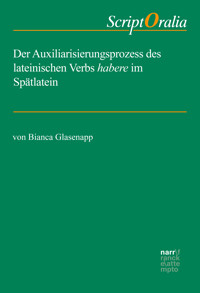
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ScriptOralia
- Sprache: Deutsch
Dieser Band untersucht Sprachwandelprozesse im Bereich der Verben, die sich über Jahrhunderte von der lateinischen zu den romanischen Sprachen vollzogen. Speziell werden zwei Entwicklungen des klassischen lateinischen Verbs habere in den Blick genommen: die Zusammensetzung einer Form von habere + PPP und habere + Infinitiv, aus denen sich in einigen romanischen Sprachen das Perfekt bzw. das Futur herausbildeten. Die Untersuchung füllt insofern eine Forschungslücke, als sie akribisch ein großes Datenkorpus analysiert, dabei unbekanntere lateinische Originaltexte heranzieht, die ermittelten Textstellen kategorisiert und einzelne Textstellen analysiert. Sie liefert dadurch neue Ergebnisse zur Grammatikalisierungsforschung, die bisher nicht im Fokus standen, aber bedeutsame Ansätze für weitere Forschungen bieten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[1]Der Auxiliarisierungsprozess des lateinischen Verbs habere im Spätlatein
ScriptOralia
[2]Herausgegeben von
Barbara Frank-Job und Ulrich Eigler
Bianca Glasenapp
[3]Der Auxiliarisierungsprozess des lateinischen Verbs habere im Spätlatein
[4]DOI: https://doi.org/10.24053/9783381102822
© 2024 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Satz: typoscript GmbH, WalddorfhäslachCPI books GmbH, Leck
ISSN 0940-0303ISBN 978-3-381-10282-2 (ePDF)ISBN 978-3-381-10283-9 (ePub)
[5]Inhalt
1
Einleitung
2
Forschungsstand
3
Theoretischer Hintergrund
3.1
Sprachwandel
3.2
Grammatikalisierung
3.2.1
Begriffsbestimmung
3.2.2
Parameter der Grammatikalisierung
3.2.3
Semantic bleaching
3.2.4
Grammatikalisierung vs. Reanalyse
3.3
Grammatikalisierung von
habere
3.3.1
habere
+ PPP
3.3.2
habere
+ Infinitiv
3.4
Diskurstraditionen
3.4.1
Das Nähe/Distanz-Modell von Koch/Oesterreicher
3.4.2
Auswahl der Diskurstraditionen
4
Die Korpora
4.1
Auswahl der Korpora
4.2
Die Urkunden-Korpora
4.2.1
Französische Urkunden (TELMA)
4.2.2
Burgundische Urkunden (CBMA)
4.2.3
Langobardische Urkunden (CDL)
4.3
Das Predigtenkorpus
4.3.1
eHumanities Desktop
5
Methodischer Hintergrund
5.1
Lateinische Korpuslinguistik
5.2
Methodisches Vorgehen dieser Untersuchung
6
Die Auxiliarisierung von
habere
in unterschiedlichen Diskurstraditionen
6.1
Spurensuche der Ausbreitung der
habere
-Konstruktionen
6.1.1
Französische Urkunden (TELMA)
6.1.2
Burgundische Urkunden (CBMA)
6.1.3
Langobardische Urkunden (CDL)
6.1.4
Predigten (eHumanities Desktop)
6.2
Kategorisierung und Analyse der Textstellen
6.2.1
habere
+ PPP
6.2.1.1
Französische Urkunden (TELMA)
6.2.1.2
Burgundische Urkunden (CBMA)
6.2.1.3
Langobardische Urkunden (CDL)
6.2.1.4
Predigten (eHumanities Desktop)
6.2.2
habere
+ Infinitiv
6.2.2.1
Französische Urkunden (TELMA)
6.2.2.2
Burgundische Urkunden (CBMA)
6.2.2.3
Langobardische Urkunden (CDL)
6.2.2.4
Predigten (eHumanities Desktop)
7
Zusammenfassung der Analyseergebnisse und Ausblick
7.1
habere
+ PPP
7.2
habere
+ Infinitiv
7.3
Abschließendes Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang: Ergebnisse der Häufigkeiten von
habere
1.
Französische Urkunden (TELMA)
2.
Burgundische Urkunden (CBMA)
3.
Langobardische Urkunden (CDL)
4.
Predigten (eHumanities Desktop)
Verzeichnis der Textstellen von
habere
+ PPP
Verzeichnis der Textstellen von
habere
+ Infinitiv
[7]1Einleitung
Das Latein der Spätantike und des Mittelalters und seine Neuerungen sowie seine Entwicklung hin zu den romanischen Sprachen wurden vielfach untersucht und standen schon seit dem frühen 19. Jahrhundert im Mittelpunkt zahlreicher Forschungsarbeiten. Als Spätlatein kann die lateinische Sprache ab etwa 200 n. Chr. bis zu den romanischen Sprachen bezeichnet werden. Es ist allerdings schwierig, in dieser Zeit von einer einheitlichen Sprache zu sprechen, da das Spätlatein verschiedene Dialekte repräsentiert, die sowohl im lexikalischen als auch im grammatischen oder syntaktischen Bereich allerhand Veränderungen hineinbringen, die nicht in allen Regionen und nicht zu allen Zeiten vorhanden sein müssen. Für das Latein dieser Zeit, das besondere Nähe zum Romanischen aufweist, hat sich der Begriff ‚Vulgärlatein‘ etabliert, was aufgrund der heutigen Bedeutung von ‚vulgär‘ irreführend sein kann. „Das sogenannte Vulgärlatein“ (Coseriu 1978) bezeichnet, abgeleitet vom lateinischen Wort vulgus (‚Volk, Leute, der gemeine Mann‘), vielmehr die Sprache des Volkes oder die alltägliche Sprache bzw. ein Stück weit allgemein die gesprochene Sprache, in der der Ursprung der Neuerungen im Lateinischen vermutet wird. Wenngleich selbstverständlich keine direkten Belege für die gesprochene lateinische Sprache der Spätantike und des Mittelalters existieren, wie z.B. Tonaufnahmen, sind dennoch Dokumente vorhanden, die gewissermaßen Einblicke in die gesprochene Sprache geben, wie beispielsweise Grammatiken, Glossare oder Inschriften (vgl. Kiesler 2018: 37–45). In vielen anderen Texten können Spuren der gesprochenen Sprache vorhanden sein, wenn sie zum Beispiel viele nähesprachliche Elemente beinhalten (vgl. Coseriu 1978; Väänänen 1981: 3–26; Coseriu 2008).
Das Spektrum der Innovationen im Spätlatein, die sich in den romanischen Sprachen fortsetzen, ist breit gefächert. Im lexikalischen Bereich wurden Worte verändert, setzten sich gegen Synonyme durch oder kamen gänzlich neu hinzu und sind noch heute in den romanischen Sprachen oder in Teilen davon gebräuchlich und auf das späte Latein zurückzuführen. So findet sich beispielsweise das klassische lateinische Adjektiv pulcher, ra, rum (‚schön‘) in der ursprünglichen Bedeutung in keiner romanischen Sprache wieder, stattdessen wurden das Adjektiv bellus, a, um (‚hübsch‘), das schon von Plautus als Diminutiv von bonus, a, um gebraucht wird, und das Adjektiv formosus, a, um (‚ansehnlich‘) in mehrere romanischen Sprachen übernommen, z.B. ital. bello, bella; frz. beau, belle; span. hermoso, hermosa (vgl. Coseriu 1978: 263 f.; [8]Vincent 1988: 74). Auch die Phonologie betreffend erscheinen zahlreiche Neuerungen, die teilweise bereits in den spätlateinischen Texten zu beobachten sind. Die Konsonanten ‚b‘ und ‚v‘ wurden beispielsweise im gesprochenen Latein bereits verwechselt, da sie ähnlich ausgesprochen wurden, wie z.B. in Pompeij entdeckt werden konnte (vgl. Kiesler 2018: 54). Im Übergang zu den romanischen Sprachen hat sich überwiegend ‚v‘ durchgesetzt,1 z.B. ital. dovere (‚müssen‘) vom Lateinischen debere (‚müssen‘) oder frz. avoir (‚haben‘) vom Lateinischen habere (‚haben‘) (vgl. Väänänen 1981: 57 f.; Seidl 2003: 520). Auf morphologischer Ebene lassen sich ebenfalls zahlreiche Veränderungen feststellen, die vielfach diskutiert wurden. Ein Beispiel dafür ist das umfangreiche flektierte Kasussystem des klassischen Lateins, das zwischen fünf verschiedenen Deklinationen und sechs verschiedenen Kasus unterscheidet. In den meisten romanischen Sprachen hat sich dieses System nicht fortgeführt, sondern wurde reduziert, regularisiert und vereinfacht (vgl. Kiesler 2018: 57–60). Beispielsweise werden der Genitiv oder Dativ mit Hilfe einer Präposition angezeigt, wie es schon im Vulgärlatein beobachtet werden konnte (vgl. ebd.: 82; Müller-Lancé 2020: 227), z.B. span. para el padre (‚für den Vater‘) oder portug. do pai (‚des Vaters‘). Der Kasus Ablativ konnte sich in keiner romanischen Sprache erhalten (vgl. Väänänen 1981: 110–127; Vincent 1988: 41–44; Herman 1997: 133).2 Im Bereich der Syntax existieren ebenfalls viele Neuerungen, die oftmals thematisiert und eingehend betrachtet wurden. Hier ist beispielsweise grundlegend die Änderung der Satzstruktur zu nennen. Das Lateinische war eine SOV-Sprache (Subjekt – Objekt – Verb), die den Sprechenden zudem viele Freiheiten beim Satzaufbau ließ (vgl. Szantyr/Hofmann 1965: 403; Pinkster 1988: 255; Herman 1997: 103). Die romanischen Sprachen gelten hingegen allgemein als SVO-Sprachen (Subjekt – Verb – Objekt), die nur in bestimmten Konstruktionen von dieser Stellung abweichen, z.B. bei dem Gebrauch eines Pronomens im Französischen, welches dem Verb direkt vorangestellt wird: frz. nous les voyons (SOV, ‚wir sehen sie‘) (vgl. Pinkster 1988: 245–283; Raible 1992). Diese kurzen Beispiele aus verschiedenen Bereichen sind nur ein Bruchteil der zahlreichen Entwicklungen der lateinischen Sprache als Vorläufer der romanischen Sprachen.
Neben diesen kurz erwähnten sowie zahlreichen weiteren Veränderungen haben sich zwei Entwicklungen durchgesetzt, die das ursprüngliche lateinische [9]Vollverb habere betreffen und die laut Jacob als die „markantesten gemeinromanischen Entwicklungen im Bereich der Morphosyntax“ (Jacob 1994: 1) bezeichnet werden können. In spätlateinischen Schriftstücken lässt sich beobachten, dass das Verb zunehmend seinen Vollverbstatus verliert und einen Auxiliarisierungsprozess durchläuft und dadurch grammatikalisiert wird. Zum einen erscheint immer öfter3 die analytische Konstruktion habere + Partizip Perfekt Passiv (PPP), die als Vorläufer des späteren romanischen Perfekts gilt. Während im klassischen Latein das Perfekt als synthetische Form aus Wortstamm, Perfektzeichen und Perfektendung besteht (z.B. voca-v-i, 1.Sg.Perf., ‚ich habe gerufen‘), setzt sich das Perfekt der romanischen Sprachen aus einem von habere abgeleiteten Hilfsverb und einem Partizip zusammen (z.B. span. he llamado oder ital. ho chiamato, ‚ich habe gerufen‘).4 Zum anderen tritt eine Zusammensetzung aus habere + Infinitiv in Erscheinung, aus der sich im Übergang vom Lateinischen zu den romanischen Sprachen ein synthetisches Futur entwickelte. Im klassischen Latein war eine synthetische Futurform gebräuchlich, die wie das Perfekt aus Wortstamm, Futurzeichen und Personalendung bestand (z.B. voca-b-o, 1.Sg.Fut., ‚ich werde rufen‘). Im Spätlatein trat nebenher die Konstruktion aus habere + Infinitiv auf, die in der Form keinen nachweislichen Eingang in einer romanischen Sprache fand. In frühen romanischen Texten begegnet uns stattdessen eine aus Infinitiv + habere verschmolzene Futurform.5
Seit vielen Jahrzehnten und schon mehr als ein Jahrhundert wurden diesbezüglich lateinische Textstücke vorwiegend bekannter, klassischer oder nachklassischer Autoren6, die diese Zusammensetzungen in ihren Werken verwendeten, auf ihren Gebrauch hin analysiert. Es wurde erforscht, ob und inwiefern diese Kollokationen bereits einen Bedeutungswandel durchlaufen haben. Auch im Rahmen der Grammatikalisierungstheorie wurde die Auxiliarisierung von habere oftmals thematisiert und diskutiert. Diese Dissertation hat ihren Ursprung im Rahmen des Forschungsprojektes ‚Computational Historical [10]Semantics‘, welches drei romanistisch-linguistische, ein historisches und ein texttechnologisch/informatisches Teilprojekt vereint.7 In einem Aufsatz mit dem Titel „Diskurstraditionelles im Sprachwandel: Korpuslinguistische Untersuchungen zum Spätlatein“ (2015) wurden erste Forschungsergebnisse von Barbara Frank-Job und mir präsentiert. In dieser Arbeit wird korpuslinguistisch die Ausbreitung nicht-klassischer Zusammensetzungen des lateinischen Verbs habere mit einem PPP oder mit einem Infinitiv in spätlateinischen Diskurstraditionen untersucht. Dabei stehen für mich als Latinistin und Historikerin in erster Linie die lateinischen Textquellen im Vordergrund, die vor dem Hintergrund der Sprachwandel- sowie der Grammatikalisierungstheorie und der Korpuslinguistik die Basis dieser Untersuchung darstellen. Nach einer systematischen Suche nach Hinweisen auf die Ausbreitung der neuen habere-Konstruktionen innerhalb verschiedener Diskurstraditionen liegt der Fokus auf den ermittelten Kollokationen sowie ihrer Kontexte. Als Grundlage dient ein zusammengestelltes Korpus aus Diskurstraditionen der Spätantike und des Mittelalters, die sich in Bezug auf die Nähe- und Distanzsprache (vgl. Koch/Oesterreicher 1985; 2011) unterschiedlich gestalten: zum einen wurden Urkunden aus dem 8. bis 12. Jahrhundert untersucht, zum anderen Predigten aus dem 3. bis 14. Jahrhundert. Schriftstücke der beiden genannten Diskurstraditionen, insbesondere die Urkunden, wurden in den bisherigen Untersuchungen zum Auxiliarisierungsprozess von habere kaum berücksichtigt. Somit stellen die vorwiegend unbekannten lateinischen Textquellen, von denen unzählige bisher kaum oder gar nicht eingehend wissenschaftlich betrachtet oder überhaupt digitalisiert und dadurch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, eine interessante Grundlage für die Untersuchung der Ausbreitung und Verwendung der Kollokationen mit habere in lateinischen Schriften während der Entwicklung der romanischen Sprachen dar. Eine große Anzahl an Rechtstexten ist daher in das Korpus dieser Arbeit aufgenommen worden, darunter Urkunden aus Frankreich und Norditalien. Neben den Urkunden sind Predigten dem Korpus zugefügt, von denen viele bekannter sind und zum Teil bereits in Hinblick auf die Auxiliarisierung von habere untersucht wurden (vgl. Tara 2014). Diese sollen als eher nähesprachlich eingestufte Diskurstradition einen Kontrast zu den als distanzsprachlich geltenden Urkunden darstellen. Um Grammatikalisierungsprozesse über mehrere Jahrhunderte beurteilen zu können, muss nicht nur eine große Anzahl an Texten, sondern müssen Dokumente verschiedener Diskurstraditionen be[11]trachtet werden. Denn Sprache unterliegt einem ständigen Wandel, der alle Äußerungsbereiche umfasst, aber vor allem in der Nähesprache seinen Ursprung hat. Von dort aus breitet er sich auf andere Diskursbereiche aus. Historisch dokumentiert ist nur seine Ausbreitung über verschiedene Diskurstraditionen hinweg, aber sprachliche Ausdrücke, z.B. Formeln, können an einzelne Diskurstraditionen gebunden sein. Dadurch können verschiedene Textsorten unterschiedliche Beiträge zum Sprachwandel liefern, weshalb die Berücksichtigung mehrerer Diskurstraditionen unbedingt erforderlich ist (vgl. Oesterreicher 2001; Frank-Job 2005).
In dieser Untersuchung wird versucht, sämtliche in den Texten vorhandene Zusammensetzungen mit habere zu ermitteln, die den Entwicklungen von habere + PPP und habere + Infinitiv zugeordnet werden können. Kollokationen, die eindeutig klassisch zu verstehen sind und keine engere grammatische Verbindung aufweisen, werden im Voraus aussortiert und nicht in die Untersuchung aufgenommen. Die übrigen Kollokationen werden kategorisiert. Jeweils ein Beispiel der Kategorien wird in Abgrenzung zu den anderen eingehend analysiert. Der Blick soll dabei auf der Frage liegen, wie die Grammatikalisierung von habere in den beiden Diskurstraditionen zu bewerten ist, inwiefern die beiden Diskurstraditionen zum Auxiliarisierungsprozess von habere beigetragen haben und welche Unterschiede diesbezüglich bestehen. Nach einem groben Überblick über die bisherige Forschung zur Entwicklung von habere + PPP und habere + Infinitiv in Kapitel 2 folgen einige Erläuterungen zu den Prozessen des Sprachwandels und der Grammatikalisierung von habere, die für diese Untersuchung relevant sind (Kap. 3). Im Anschluss werden die vier Korpora vorgestellt, aus denen sich das Gesamtkorpus dieser Untersuchung zusammensetzt (Kap. 4). Alle Texte sind in Online-Datenbanken zu finden, die lateinische Originaltexte aufbereitet zur Verfügung stellen und die größtenteils frei nutzbar sind. Nach der Vorstellung der Korpora wird ein kurzer methodischer Einblick in die Analysemöglichkeiten lateinischer Textkorpora gegeben und das eigene Vorgehen anschaulich erläutert (Kap. 5). Um abschätzen zu können, welche Befunde die verschiedenen Korpora für die folgende Analyse bieten, mussten in einem ersten Schritt zunächst alle Textstellen mit dem Lemma habere ermittelt und in einem zweiten Schritt Kookkurrenzanalysen durchgeführt werden. Dazu wird die Umgebung der Treffer des lateinischen Verbs habere nach Formen untersucht, die in Verbindung mit habere dem Auxiliarisierungsprozess zugeordnet werden können. Diese Ergebnisse der Häufigkeiten werden im Kapitel 6.1 präsentiert. In einem weiteren Schritt erfolgt eine qualitative Analyse ausgewählter Kollokationen zu jedem einzelnen Korpus, die sich in ihrem Gebrauch und ihrem Entwicklungsstadium voneinander unterscheiden (Kap. 6.2). Abschließend werden die gesamten [12]Ergebnisse des Analysekapitels zusammengefasst dargelegt und eine Einschätzung für die Bedeutung des Auxiliarisierungsprozesses von habere gegeben (Kap. 7).
Korpuslinguistische Forschungsarbeiten, die sich der Grammatikalisierung von habere im Speziellen widmen, sind rar, obwohl die Thematik vielfach behandelt wurde. Daher soll diese Untersuchung neue Anstöße zur Erforschung des Gebietes sowie weiterer Forschungsansätze bieten. Vor allem die analysierten Urkundenkorpora können diesbezüglich als Ausgangspunkt dienen, wie im Verlauf der Arbeit aufgezeigt wird.
Müller-Lancé merkt dazu an, dass im Altspanischen die Form <aver> (‚haben‘) auftaucht und diese im modernen Spanisch relatinisiert erscheint (vgl. Müller-Lancé 2020: 110; Cano Aguilar 2002: 93).
Eine Ausnahme stellt das Rumänische dar, das „wohl unter slavischem Einfluss“ (Müller-Lancé 2020: 170) teilweise Endungen erhalten hat, wie den Vokativ auf -e oder den Dativ der a-Dekl. und 3. Dekl. (vgl. ebd.; Tagliavini 1998: 297).
Auch in klassischen Texten tritt die Konstruktion bereits in Erscheinung, z.B. bei Cicero (vgl. Thielmann 1885b).
Eine Ausnahme stellt das Portugiesische dar, das das lateinische Verb tenere grammatikalisiert hat.
Der erste Beleg für eine solche frühromanische Futurform ist die Form „prindrai“ (‚ich werde nehmen‘) in den Straßburger Eiden (842), die zweisprachig in Althochdeutsch und Altfranzösisch verfasst wurden. Zuvor tauchte in der Fredegar-Chronik die umstrittene Form „daras“ auf, die möglicherweise als ‚ich werde geben‘ verstanden werden kann (vgl. Fruyt 2011: 806–808).
Da in den meisten Fällen davon ausgegangen werden kann, dass die lateinischen Texte vorwiegend von männlichen Personen verfasst wurden, wird in diesen Fällen auf die weibliche Form verzichtet.
Die dargestellten Untersuchungen entsprangen dem Teilprojekt 2.1 ‚Identifying and describing phenomena of linguistic change: Possession / obligation‘. Zur Projektbeschreibung, vgl. https://comphistsem.org/project.html.
[13]2Forschungsstand
Eine korpuslinguistische Forschungsarbeit, in der Sprachwandelprozesse im Lateinischen hin zum Romanischen untersucht werden, umfasst natürlicherweise mehrere Forschungsbereiche, die an dieser Stelle nicht alle ausführlich und explizit geschildert werden können und sollen. Der Fokus wird hier auf die Erforschung des Vulgär- und Spätlateins mit seinen Veränderungen und Innovationen gelegt, insbesondere auf die Entwicklungen von habere + PPP und habere + Infinitiv. Aufsätze und Monographien, die speziell diesem Thema gewidmet sind, sind spärlich, sodass teilweise lediglich auf Forschungsarbeiten verwiesen werden kann, die diese beiden Entwicklungen nur in Ansätzen behandeln.
Das Latein der Spätantike und des Mittelalters, das besondere Nähe zum Romanischen aufweist, „[d]as sogenannte Vulgärlatein“ (Coseriu 1978; vgl. Kap. 1), wurde vielfach untersucht. Der Begriff geht auf Friedrich Diez zurück, der ihn in seiner ersten vergleichenden „Grammatik der romanischen Sprachen“ (1836–38) bestimmte. Dabei griff er auf eine bereits lange bestehende Tradition zurück, die zwischen dem literarischen und dem umgangssprachlichen Latein unterschied (vgl. Coseriu 1978: 258). Die Forschung auf diesem Gebiet setzte im Anschluss an Diez im 19. Jahrhundert ein, in dem mehrere bedeutsame und teilweise immer noch viel zitierte Werke erschienen. Den Anfang markiert Hugo Schuchardts dreiteiliges Werk „Der Vokalismus des Vulgärlateins“ (1866–1868), welches er bereits 1864 in lateinischer Sprache als Dissertation veröffentlichte und welches von Carlo Tagliavini als „immer noch grundlegend[…]“ (1998: 446) sowie von Johann Sofer als „teilweise überholt, doch keineswegs überflüssig“ (1963: 7) bezeichnet wird. Mit dieser umfangreichen Arbeit, die überwiegend auf Inschriften beruht und die Vokalveränderungen untersucht, legt er die Grundlage für die Erforschung der protoromanischen Sprachen.
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichte Philipp Thielmann zwei umfangreiche Aufsätze, die sich nicht in die übliche vulgärlateinische Forschung einreihten, da sie eine einzelne, dennoch bedeutsame Entwicklung thematisieren. Für die Vulgärlatinisten, die sich vor allem der Wortkunde und den Lautveränderungen verschrieben hatten, stand dies zunächst weniger im Vordergrund.1 Unter den Titeln „Habere mit dem Infinitiv und die Entstehung des [14]romanischen Futurums“ (1885a) und „Habere mit dem Part. Perf. Pass.“ (1885b) untersucht Thielmann jeweils in zwei Teilen die Kollokationen von habere mit dem Infinitiv und habere mit dem PPP. Dabei versucht er, möglichst umfassend sämtliche Vorkommnisse2 in den Texten lateinischer Autoren seit Cicero3 zu analysieren und ihren Gebrauch in Bezug auf den Zusammenhang zum romanischen Perfekt bzw. Futur zu kategorisieren. Er beschränkt sich in seiner Analyse auf die bekannten Schriftsteller, was seinerzeit bereits einen enormen Arbeitsaufwand bedeutet haben muss. Dass er nicht sämtliche, in lateinischer Sprache verfasste Schriftstücke analysieren konnte, versteht sich von selbst. Dennoch bietet er mit seinen Ausführungen über die beiden auftretenden Phänomene eine bedeutende Grundlage, die in aktuellen Forschungen immer noch herangezogen wird und auch für diese vorliegende Untersuchung eine wichtige Basis darstellt. So stellte er bereits vor mehr als 130 Jahren in seiner Einleitung zu den Ausführungen über die Zusammensetzung von habere mit dem PPP fest, dass „es häufig lediglich dem subjektiven Ermessen überlassen bleibt, ob man in einer Verbindung von habere mit Part. Perf. Pass. ein wirkliches Perfekt finden oder dem habere seine selbständige Bedeutung belassen will“ (Thielmann 1885b: 373). Ähnliches beschreibt er zu den Kollokationen von habere mit dem Infinitiv. Dennoch untersucht er akribisch sämtliche Vorkommnisse und stellt Überlegungen an, welche Arten von Zusammensetzungen eher einen perfektivischen bzw. futurischen Sinn beschreiben und aus welchen dieser Arten sich schließlich die neuen romanischen Formen gebildet haben könnten. Zudem sieht er in den Urkunden eine bedeutende Rolle.
Nach den Aufsätzen von Thielmann entstand lange Zeit keine weitere Forschungsarbeit, die die Grammatikalisierung von habere ausführlich untersucht. Dennoch wird die Thematik in den Untersuchungen zu lateinischen Sprachwandelerscheinungen immer wieder aufgegriffen, wenngleich sie nicht den Hauptgegenstand der Arbeiten darstellt. Unter zahlreichen weiteren Forschungsarbeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts4 sind für diese Arbeit ins[15]besondere zwei nennenswert, in denen lateinische Originaltexte auf ihren Sprachgebrauch hin analysiert werden, die auch im Korpus dieser Untersuchung aufgenommen und auf die Auxiliarisierung von habere analysiert wurden. Die französische Philologin Jeanne Vielliard (1927) und der amerikanische Romanist und Linguist Mario Pei (1932) betrachten in ihren Forschungsarbeiten die Sprache französischer Originalurkunden aus dem siebten bzw. achten Jahrhundert.5 Für die übliche vulgärlateinische Forschung sind sie ebenfalls weniger bedeutsam, auch wenn B. Löfstedt feststellt, dass „[u]nter Texten, die sowohl von Latinisten wie Romanisten bearbeitet werden sollten, […] vielleicht in erster Linie die mittelalterlichen Urkunden zu erwähnen“ (1983: 463) seien. Er beschränkt sich dennoch auf die Wortkunde und Lautveränderung.6 Vielliard und Pei stellen hingegen zahlreiche Auffälligkeiten und Merkmale in Bezug auf die Phonetik, Morphologie und Syntax zusammen. Die Auxiliarisierung von habere erhält jedoch bei beiden keine eingehendere Betrachtung. Zu diesem Thema notieren sie lediglich in wenigen Zeilen die wichtigsten Textstellen der von ihnen untersuchten Urkunden. Zu den Zusammensetzungen aus Infinitiv und habere als Vorläufer des Futurs bemerkt Pei, dass diese in den von ihm untersuchten Urkunden nicht erscheinen, mit Ausnahme einer Kollokation, die noch keinen futurischen Charakter besitze. Gleiches beschreibt Vielliard (vgl. Pei 1932: 183 f., 279; Vielliard 1927: 166). Die wenigen auftretenden Zusammensetzungen aus PPP und habere in den Urkunden des achten Jahrhunderts bewertet Pei als „for the most part semi-classical, with the meaning ‚to have something in a certain state‘“ (Pei 1932: 288). Vielliard hingegen behauptet, dass einige, obgleich wenige Kollokationen von habere mit einem Partizip Perfekt Passiv „avec la valeur d’un parfait“ (Vielliard 1927: 238) gebraucht werden. Die Charakteristischsten dieser Zusammensetzungen listet sie kurz auf und fügt hinzu, dass habere in den meisten Kollokationen noch den Vollverbstatus behalte, wofür sie ebenfalls Beispiele anführt (vgl. ebd.: 239).
[16]Bis zu den 1960er Jahren wurden viele weitere vulgärlateinische Untersuchungen veröffentlicht,7 die laut B. Löfstedt spärlicher wurden und oftmals nur noch wenig Neuerungen brachten. Die Latinist:innen mussten inzwischen mehr erbringen, als sich einen Text rauszusuchen und diesen „einfach durchzukommentieren“ (B. Löfstedt 1982: 202), wie es ihre Vorgänger:innen am Anfang des Jahrhunderts taten. Vielfach seien die wichtigsten Texte bereits größtenteils ausgeschöpft gewesen (vgl.B. Löfstedt 1970/71; 1982; 1983). Gerhard Rohlfs veröffentlichte 1951 [²1956, ³1969] unter dem Titel „Sermo vulgaris Latinus“ eine Auswahl an Textabschnitten aus allen literarischen Bereichen, die Entwicklungen hin zu den romanischen Sprachen in lateinischen Schriften enthielten, und beschränkte sich dadurch nicht auf einen einzelnen Autor. Diese Zusammenstellung ist seinerzeit mit einem beachtlichen Arbeitsaufwand verbunden gewesen. Im ‚Index verborum‘ hält er die vulgärlateinischen Wendungen fest, ohne sie zu kommentieren. Dort verweist er auch auf einige Textstellen von habere mit einem Partizip Perfekt Passiv oder mit einem Infinitiv. Tara (2014) schaut sich die von Rohlfs vermerkten Textstellen, insbesondere zu den Infinitivkonstruktionen, genauer an und schreibt ihnen zum Teil bereits einen temporalen Sinn zu (vgl. ebd.: 53–55).
Eine bedeutsame neue Arbeit veröffentlichte 1963 (²1967 erweitert um eine kommentierte Textauswahl im Anhang; ³1981) der finnische Latinist und Romanist Veikko Väänänen, der „als der führende Kenner auf diesem Gebiet gilt“ (B. Löfstedt 1990: 448) und dessen Arbeit als Zusammenfassung der bisherigen Forschung dienen kann (vgl.B. Löfstedt 1983: 453 f.). Unter dem Titel „Introduction au latin vulgaire“ schaffte er es, eine Verbindung zwischen latinistischer und romanistischer Forschung herzustellen, welche in der Vergangenheit oftmals getrennt voneinander an demselben Untersuchungsgegenstand arbeiteten. Während auf latinistischer Seite der Blick eher auf das Lateinische im Vergleich zum klassischen Latein oder anderen spät- oder mittellateinischen Schriften gerichtet wurde, betrachteten die romanistischen Sprachwissenschaftler:innen vielmehr die Entwicklung des Lateins hin zu den romanischen Sprachen. Väänänen überwand diese Trennung, indem er zum einen die Entwicklung vom archaischen Latein zum Spätlatein darstellt und die Umstände der lateinischen Sprachentwicklung und Überlieferung, speziell des Vulgärlateins, genauer erläutert; zum anderen behandelt er ausführlich die sprachlichen Veränderungen sowohl unter Berücksichtigung lateinischer Textbelege als auch in Hinblick auf die verschiedenen Entwicklungen in den romanischen Sprachen. Er betrachtet dazu den lautlichen und lexikalischen [17]Wandel, die Veränderung der grammatischen Formfunktionszuordnungen und Veränderungen auf syntaktischer Ebene. Auch die Entwicklungen von habere fehlen nicht in seinen Ausführungen, wenngleich sie in dieser umfassenden Zusammenfassung sprachlicher Entwicklungen nur einen sehr kleinen Teil einnehmen (vgl. Väänänen 1981: 139–141).
In den 1980er Jahren sind mehrere bedeutende Untersuchungen veröffentlicht worden, die die Entwicklungen von habere in Zusammensetzung mit einem Partizip Perfekt Passiv und/oder mit einem Infinitiv von ihrem lateinischen Ursprung bis hin zu den romanischen Sprachen erforschen. In seinem Aufsatz „The ‚Past Simple‘ and the ‚Present Perfect‘ in Romance“ (1982) untersucht Martin Harris vergleichend den semantischen Wandel von feci und habeo factum vom Vulgärlatein bis in die heutigen romanischen Sprachen. Nach einer Einführung in die Funktionen der Vergangenheit unterteilt er die Entwicklung in vier Stufen, in denen er feci und habeo factum jeweils Funktionen der Vergangenheit zuordnet. Während er zu Beginn feci alle Funktionen der Vergangenheit zuschreibt, übernehme habeo factum diese schrittweise und im gleichen Zug verliere feci von Stufe zu Stufe verschiedene Funktionen. Laut Harris sind die beiden Ausdrücke der Vergangenheit somit niemals bedeutungsgleich und haben über lange Zeit nebeneinander existiert. Er wendet sein Modell im Anschluss auf die Vergangenheitsformen der verschiedenen romanischen Sprachen an.
In demselben Band erschien ein Aufsatz von Nigel Vincent, der zusammen mit Martin Harris als Herausgeber fungierte. Vincent untersucht unter dem Titel „The Development of the Auxiliaries ‚habere‘ and ‚esse‘ in Romance“ (1982) die Entwicklung von habere + PPP mit Hilfe der ‚Case Grammar‘, welche seiner Meinung nach passendere Begriffe biete, um die Zusammengehörigkeit von habere und dem PPP als feste Konstruktion zu beurteilen und zu klassifizieren. Er beschreibt mit Hilfe dieser Begriffe, in welchen Zusammensetzungen habere + PPP zu Beginn auftraten und wie sich die weitere Entwicklung vollzog. Das untersucht er vergleichend zur Konstruktion esse + PPP, die im klassischen Latein das Perfekt Passiv darstellte. Anschließend betrachtet er die Verwendung von habere und esse in den heutigen romanischen Sprachen.
Einen weiteren Artikel veröffentlichte Harm Pinkster 1987 unter dem Titel „The Strategy and Chronology of the Development of Future and Perfect Tense Auxiliaries in Latin“. Er vermutet, dass der Ursprung der neuen Perfekt- und Futurformen in der Konstruktion habere + Objekt + Praedikativum liegt, die zunehmend einen temporalen Sinn bekam, bei der schließlich Subjekt und Agens nicht mehr zu trennen waren. An lateinischen Beispielen erläutert er, wie aus habere + (Objekt + Partizip) die Konstruktion (habere + Partizip) + Objekt entstand und welche Zusammensetzungen diese Entwicklung begüns[18]tigten. Für die Konstruktion habere + Infinitiv stellt er ebenfalls Vermutungen an und erklärt die Entwicklung an Beispielen. Als Ergänzung greift er zum Schluss außerdem die Entwicklungen von tenere und stare auf, die sich teilweise in den romanischen Sprachen ebenfalls als Auxiliare durchgesetzt haben.
Zu der Entwicklung von habere mit dem Infinitiv als Vorläufer des romanischen Futurs hat Suzanne Fleischman eine bedeutsame Forschungsarbeit mit dem Titel „The Future in Thought and Language“ (1982) veröffentlicht, die immer noch maßgebend ist und wichtige Erläuterungen liefert, die für das entsprechende Analysekapitel dieser Arbeit grundlegend sind. Darin beschäftigt sie sich ausführlich mit den Besonderheiten des Futurs und den Problematiken, die diese Zeitform im Unterschied zu den Zeitformen ‚Vergangenheit‘ und ‚Gegenwart‘ in sich birgt. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Arten der Futurbildung und des -ausdrucks in verschiedenen und nicht ausschließlich romanischen Sprachen analysiert sie eingehend das lateinische Futur und die Futurformen romanischer Sprachen in ihren Entwicklungen über mehrere Jahrhunderte hinweg. Daraus ableitend hält sie Ergebnisse zur Synthese vs. Analyse und den Möglichkeiten der Futurentstehung fest. Fleischman stellt außerdem vier Entwicklungsstufen der habeo-Konstruktionen jeweils anhand eines englischen und französischen Beispiels heraus, ähnlich wie es Harris (1982) für die Vergangenheitsformen vorschlägt.
In den 1990er Jahren veröffentlichte Daniel Jacob mit seiner Habilitationsschrift mit dem Titel „Die Auxiliarisierung von habere und die Entstehung des romanischen periphrastischen Perfekts, dargestellt an der Entwicklung vom Latein zum Spanischen“ (1994) erstmals eine systematische Untersuchung der Konstruktion habere + PPP von ihrem Ursprung über ihre Anfänge im Altspanischen hin zu ihrer Verwendung im modernen Spanisch. Dabei betont er, dass es sich nicht um die „Darstellung einer sprachlichen Entwicklung“ (Jacob 1994: 344) handele, sondern um „ausgewählte Stationen“ (ebd.). Neben Überlegungen zur Wahl von habere als zukünftigen Bestandteil des Perfekts betrachtet er die lateinische Ausgangslage und kategorisiert drei Phasen der Entwicklung unter Berücksichtigung bestehender Annahmen sowie Kritikpunkten an diesen, indem er sie neu definiert. Dabei betont er, dass „es sich bei diesen ‚Phasen‘ nicht um drei zeitlich hintereinandergeordnete Stadien handelt, sondern dass es zunächst um rein systematische Klassen von Gebrauchsweisen unserer Konstruktion geht“ (Jacob 1994: 140). Diese nutzt er für seine Analyse der haben-Konstruktionen. Neben der Untersuchung des haben-Perfekts in altspanischen Texten berücksichtigt er in Ansätzen die sein-Periphrase sowie kurz tenere + PPP und eröffnet dadurch weitere Forschungsansätze, die es zu untersuchen gilt. In einem zeitgleich erschienenen Aufsatz, der als Verschriftlichung eines Vortrags zum Vulgär- und Spätlatein entstand, mit dem Titel „A [19]propos de la périphrase habeo + participe parfait passif“ (1995) präsentiert er ebenfalls in knapper Zusammenfassung seine Kritikpunkte an der bestehenden Erläuterung der Entwicklung der habere-Konstruktionen mit einem Partizip Perfekt Passiv. An einigen ausgewählten Beispielen, die bereits vielfach untersucht wurden, präsentiert er seine in der Habilitationsschrift detaillierter vorgestellten Entwicklungsphasen.
In der aktuelleren Forschung sind zwei Veröffentlichungen aus Frankreich zu erwähnen, die sich mit der Grammatikalisierung von habere beschäftigen. Michelle Fruyt veröffentlichte im Jahr 2011 einen umfangreichen Aufsatz mit dem Titel „Grammaticalization in Latin“, in dem sie nach einigen grundlegenden Ausführungen und Überlegungen zur Grammatikalisierung zunächst auf zahlreiche andere Formen der Grammatikalisierung im Lateinischen eingeht und schließlich die Auxiliarisierung, genauer das ‚semantic weakening‘, des Verbs habere behandelt. Nach kurzer Einleitung zu verschiedenen Formen der Auxiliarisierung von habere, wie der unpersönliche Gebrauch im Sinne des französischen ‚il y a‘, thematisiert sie die Kollokationen des Verbs mit dem Partizip Perfekt Passiv. Sie stellt gleich zu Beginn heraus, dass „[t]hese two constructions were not grammaticalized in Latin“ (Fruyt 2011: 788), räumt dabei allerdings ein, dass „Latin does show some enlightening antecedents of the grammaticalization process and it allows us to reconstitute the intermediate stages of a progressive tendency toward grammaticalization“ (ebd.). Diese Stadien beschreibt sie genauer, ordnet ihnen romanische Beispiele sowie lateinische Zitate zu. Sie zieht dabei vor allem die klassischen Autoren Cicero, Livius und Caesar heran, aber auch Plautus und Augustinus sowie Gregor von Tours und Fredegar. Ähnlich geht Fruyt bei den Konstruktionen von habere mit einem Infinitiv vor. Nach kurzer Betrachtung der romanischen Futurbildungen untersucht sie wenige Verwendungen der Zusammensetzung im ‚Itinerarium Egeriae‘ und bei den christlichen Autoren. Außerdem analysiert sie die von Fredegar gebrauchte Form daras und frühe romanische Texte. Zu diesem Phänomen hält sie in Bezug auf die von ihr untersuchten Textstellen fest, dass „the construction has not yet been fully grammaticalized as a temporal periphrasis“ (ebd.: 801).
Fruyt verweist in ihrem Aufsatz auf eine zu der Zeit noch unveröffentlichte Dissertation ihres Lehrstuhls an der Pariser Universität, die eine korpuslinguistische Analyse der Verwendung der Konstruktionen von habere + Partizip Perfekt Passiv und habere + Infinitiv im Lateinischen darstellt. Drei Jahre später veröffentlichte George Bogdan Tara diese unter dem Titel „Les périphrases verbales avec ‚habeo‘ en latin tardif“ (2014). Darin untersucht er im Anschluss an die Untersuchungen von Thielmann (1885a; 1885b) bekannte Textstellen mit habere + PPP und habere + Infinitiv verschiedener lateinischer Autoren vom [20]klassischen Latein bis zum Ende des Spätlateins. Seit der Arbeit von Thielmann ist eine solch umfassende Analyse lateinischer Textstellen zum Auxiliarisierungsprozess von habere nicht erneut erfolgt. Tara zieht für die Untersuchung das Korpus CLCLT-5 heran, das archaische, klassische, nachklassische und spätlateinische Schriften des 8. Jahrhunderts enthält. Außerdem nimmt er die Texte von Gregor von Tours und Fredegar (7. Jahrhundert) hinzu, welche das Korpus nicht einschließt. Tara analysiert sämtliche Vorkommnisse der Kollokationen von habere + PPP oder habere + Infinitiv8 in den herangezogenen Werken auf ihren Grammatikalisierungsgrad und kommt zu dem Schluss, dass sich, entgegen vielfacher Annahme, die Grammatikalisierung von habere noch nicht in den lateinischen Texten vollzog (vgl. Tara 2014).
In etwa zeitgleich veröffentlichte Adam Ledgeway 2012 eine vergleichende Untersuchung mit dem Titel „From Latin to Romance“ zur morphosyntaktischen Entwicklung und Typologie der romanischen Sprachen. Darin widerspricht er der gängigen Theorie, dass der grundlegende Unterschied zwischen dem Lateinischen und den romanischen Sprachen rein in den synthetischen und analytischen Strukturen liegt, indem er in seinem Ansatz verschiedene Strukturen der lateinischen Sprache und der romanischen Sprachen berücksichtigt. Dabei versucht er, unterschiedliche frühere Ansätze zu vereinen und zu ergänzen. Diese Überlegungen wendet er anschließend auf die morphosyntaktischen Entwicklungen vom Lateinischen zum Romanischen an. In seinen Ausführungen greift er auch das Auftreten der Konstruktionen mit habere auf. Die Kollokationen mit PPP betrachtet er, im Gegensatz zu gängigen Ansätzen, die den Ursprung in resultativen Periphrasen sehen, als „integrated change in the verb system within a more general active/stative realignment already underway in classical Latin“ (Adam 2012: 317).
Zuletzt ist ein Beitrag von Lieven Danckaert und Gerhard Schaden zu nennen, der bisher nur als Vortragsmanuskript mit dem Titel „Syntax and Semantics of Latin HAVE-statives“ (2021) veröffentlicht wurde. Danckaert und Schaden untersuchen die Ausgangslage von Syntax und Semantik der lateinischen habere-Konstruktion mit einem PPP. Dazu betrachten sie verschiedene Grundbedeutungen und -strukturen des Verbs habere, auf deren Grundlage sie die ursprünglichen Konstruktionen analysieren und den Beginn des Wandels nachzeichnen. Sie kommen zu dem Schluss, dass „the Latin construction ‚HABERE + NP.ACC. + PaPa.ACC‘ is not yet a full-fledged perfect, but rather a grammatically passive structure whose main verb is habere“ (Danckaert/Schaden 2021: 26).
[21]Der grobe Überblick relevanter Forschungsarbeiten zeigt, dass die Entwicklungen von habere im Lateinischen und Spätlateinischen zwar verstärkt Beachtung gefunden haben, aber nur in wenigen Fällen vorliegende Textstellen untersucht wurden. In diesen wenigen Fällen wurden zudem oftmals nur vielfach zitierte Textstellen zur Analyse herangezogen. Ein Großteil der Forschungsarbeiten wirft den Blick eher auf die theoretischen Hintergründe als auf die konkrete Entwicklung. Diesen soll diese Arbeit einerseits entgegenstehen, indem sie den Fokus auf die vorhandenen lateinischen Konstruktionen legt, und diese andererseits ergänzen, indem sie die theoretischen Grundlagen bestätigt bzw. widerlegt.
B. Löfstedt bemerkt in einem kurzen Forschungsüberblick dazu knapp 100 Jahre nach Erscheinen von Thielmanns Aufsätzen, dass bei den Vulgärlatinisten Verbalsyntax und spätlateinische Tempuslehre „im Hintergrund geblieben ist“ (B. Löfstedt 1982: 203) und noch viel zu tun sei (vgl. ebd.: 203 f.).
Ausgeschlossen seien im Falle der PPP-Kollokationen Verwendungen, in denen das PPP eindeutig als Attribut verwendet wird und somit keine engere Verbindung zu habere aufweist; eingeschlossen werden hingegen teilweise Adjektive, die gleichermaßen ein PPP sein können.
Auch die schon bei Plautus vorkommenden Kollokationen lässt Thielmann nicht außer Acht, wenngleich er sie nicht in seine Analyse einbezieht, sondern nur am Rande erwähnt.
Für die vulgärlateinische Forschung ist speziell Einar Löfstedts Peregrinatio-Kommentar (1911) „ein Meilenstein und ein Neubeginn“ (B. Löfstedt 1982: 200). Auch Benno Linderbauer (1922) liefert mit seiner Untersuchung der Benediktinerregel in diesem Forschungsbereich bedeutende Ergebnisse (vgl.B. Löfstedt 1983: 454 ff.).
Aufgrund der zeitlichen Begrenzung auf das 7. Jh. (Vielliard) und 8. Jh. (Pei) beschränken sie sich auf wenige Urkunden aus Frankreich. Vielliard zieht 60 Urkunden heran und Pei nur 47. Zudem erscheinen 13 Urkunden in beiden Untersuchungen, da Vielliard einige Dokumente in ihre Arbeit aufgenommen hat, die nicht mehr im siebten Jahrhundert verfasst wurden.
Dazu hebt er beispielsweise zwei hervor, die sich mit bestimmten Begrifflichkeiten bzw. dem Vokabular französischer Urkunden befasst haben, nämlich Kurt Baldinger (1960) und Manfred Bambeck (1968).
Einen Überblick gibt Tagliavini (1998) in seinen bibliographischen Anmerkungen, vgl. ebd.: 445–448.
Tara berücksichtigt auch die Entwicklungen von habeo als Ersatz für mihi est und necesse habeo (vgl. Tara: 239–248).
[22]3Theoretischer Hintergrund
3.1Sprachwandel
„Es gehört zu den grundlegenden Eigenschaften natürlicher Sprachen, daß sie in sich variabel und daß sie in beständigem Wandel begriffen sind.“ (Frank-Job 2005: 171)
Sprache unterliegt einem ständigen Wandel. Sie ist zwar einerseits Resultat, „[i]n dem Maße aber, wie eine Sprache als solche weiterfunktioniert, ist das Ergebnis nie endgültig“ (Coseriu 1974: 24), denn „[i]st das Ergebnis ‚endgültig‘, dann sprechen wir gerade von einer ‚toten Sprache‘“ (ebd.). In der Vergangenheit wurde Sprache oftmals als statisch betrachtet, gegen deren Natur der Sprachwandel spräche. Vielmehr muss Sprache als „unaufhörliches Schaffen“ (ebd.: 56) verstanden werden, da sie im Sprechen besteht und durch die Sprechenden immer wieder neu geschaffen wird. Zwar richten sich diese nach gewissen Normen, die zur Fixierung der Sprache dienen, dennoch bietet ihnen die Sprache als System verschiedene Möglichkeiten, sich auszudrücken, was die Dynamik der Sprache ausmacht. Jede:r Sprechende kann also Sprachschöpfer:in für andere Sprechende sein, die die Neuschöpfungen übernehmen können.
Aufgrund der Dynamik der Sprache lässt sich erklären, warum es zu Veränderungen der Sprache kommt:
„Die Sprache wandelt sich gerade, weil sie ‚nicht fertig ist‘, sondern durch die Sprachtätigkeit ständig ‚geschaffen wird‘.“ (Coseriu 1974: 58 f.).
Dabei haben die Sprechenden nicht den Vorsatz, die Sprache bewusst zu verändern, sondern nutzen das ihnen zur Verfügung stehende System und passen die Sprache gegebenenfalls ihren Ausdruckserfordernissen an, wenn sich keine Ausdrucksmöglichkeit bietet.
Warum aber verändern sich einige Dinge, andere hingegen nicht oder nur selten? Dort sind zwei Veränderungen zu unterscheiden: einerseits diejenigen, die zur Verschiedenartigkeit führen, andererseits diejenigen, die zur Vereinheitlichung führen. Im ersten Fall könnten Sprechende Formen durch neue Formen ersetzen, um eine Verwechslung auszuschließen; im zweiten Fall könnte ein Sprecher unregelmäßige Formen durch nach der Norm gebildete regelmäßige Formen ersetzen. Eine Neuerung und deren Übernahme vollziehen sich allerdings immer nur dort, wo es nötig ist. Es werden somit nur die „schwachen Punkte“ (ebd.: 119) verändert. Erst bei der vollständigen Über[23]nahme einer Neuerung in den Gebrauch einer Sprachgemeinschaft kann von einem Sprachwandel die Rede sein (vgl. Coseriu 1974).
Wird der Blick an dieser Stelle und unter diesem Aspekt auf die vorliegende Untersuchung zur Entwicklung der lateinischen periphrastischen Perfekt- und Futurformen geworfen, kann bereits vermerkt werden, dass in diesem Fall ein merklicher Schritt hin zu regelmäßigen Formen und gleichzeitig zur Unterscheidung einzelner Formen passierte. Im klassischen Latein existierten sechs verschiedene synthetische Perfektbildungen,1 die Lateinlernende heute teils mühevoll auswendig lernen müssen, da es zahlreiche Unregelmäßigkeiten gibt. Zum Teil unterschied sich die Perfektform nur durch Betonung von der Präsensform oder sogar gar nicht, wodurch in der Schriftsprache keine eindeutige Trennung der Formen möglich war:
Perfektbildung
1.Sg.Präs.
1.Sg.Perf.
v-Perfekt
voco
‚ich rufe‘
vocavi
‚ich habe gerufen‘
u-Perfekt
teneo
‚ich halte‘
tenui
‚ich habe gehalten‘
s-Perfekt
dico
‚ich sage‘
dixi
‚ich habe gesagt‘
Dehnungsperfekt
lego
‚ich lese‘
lēgi
‚ich habe gelesen‘
Reduplikationsperfekt
curro
‚ich laufe‘
cucurri
‚ich bin gelaufen‘
Stammperfekt
defendo
‚ich verteidige‘
defendi
‚ich habe verteidigt‘
Tab. 1: Beispiel lat. Perfektbildung
Bei der klassischen Perfektbildung kommt es vor allem in der 3.Pers.Sg. und 1.Pers.Pl. zu Überschneidungen von der Präsens- und Perfektform. In vielen [24]Fällen unterscheiden sich die Formen nur durch einen Konsonanten oder eine Dehnung:
dicit ≠ dixit
legit ≠ lēgit
defendit ≠ defendit
‚er sagt‘ ≠ ‚er hat gesagt‘
‚er liest‘ ≠ ‚er hat gelesen‘
‚er verteidigt‘ ≠ ‚er hat
verteidigt‘
Beim Futur gibt es hingegen nicht so viele verschiedene Bildungsweisen und die Art der Bildungsweise lässt sich vereinfacht anhand der Konjugationsklasse bestimmen, die Formen ähneln zum Teil aber den präsentischen Formen:
Futurbildung
1.Sg.Präs., 2.Sg.Präs.
1.Sg.Fut., 2.Sg.Fut.
bo/bi/bu-Futur
voco, vocas …
‚ich rufe, du rufst …‘
vocabo, vocabis …
‚ich werde rufen, du wirst rufen …‘
a/e-Futur
dico, dicis …
‚ich sage, du sagst …‘
dicam, dices …
‚ich werde sagen, du wirst sagen …‘
Tab. 2: Beispiel lat. Futurbildung
Problematisch war außerdem die Unterscheidung einiger Perfekt- und Futurformen. Wie eingangs bereits erwähnt, ähnelten sich die Konsonanten ‚b‘ und ‚v‘ in der gesprochenen Sprache und wurden oftmals verwechselt.2 Dies führte insbesondere bei den regelmäßig gebildeten Verben der a-Konjugation zu phonetisch gleichen Formen:
lauda-v-it
(‚loben‘-3.Sg.Perf.)
‚Er/sie/es hat gelobt.‘
lauda-b-it
(‚loben‘-3.Sg.Fut.)
‚Er/sie/es wird loben.‘
Wird der Blick nach diesen Beispielen zurück auf den Sprachwandel gewandt, lässt sich anhand der klassischen Perfekt- und Futurbildung bereits erkennen, dass die Bildung der synthetischen Formen auf ein uneinheitliches System mit vielen Unregelmäßigkeiten und Überschneidungen zurückzuführen ist. Dass ein solches System mit der Zeit einen Wandel durchlaufen sollte, ist wenig verwunderlich.
[25]Bei der Durchsetzung sprachlicher Ausdrücke nehmen außerdem die verschiedenen Diskurstraditionen eine besondere Rolle ein, da bereits ein bestimmter Zusammenhang zwischen der Wahl einer Sprache oder Sprachvarietät und der Wahl einer Diskurstradition besteht.
„Diskurstraditionen, verstanden als konventionalisierte und kulturell bestimmte Zugriffsweisen auf Wirklichkeit, die in der Kommunikation mit anderen ausgehandelt, bestätigt und weitergetragen werden, spielen daher eine zentrale Rolle für die Verbreitung und kollektive Akzeptanz sprachlicher Neuerungen.“ (Frank-Job 2005: 180).
Besonders bedeutsam sind hierfür häufig auftretende sprachliche Ausdrücke. Da viele sprachliche Neuerungen textsortenspezifische Entwicklungsunterschiede aufweisen können, ist es von besonderer Wichtigkeit, die Ausbreitung von Wandelerscheinungen unter der Berücksichtigung unterschiedlicher Diskurstraditionen zu untersuchen (vgl. Oesterreicher 2001: 1569 f.; Frank-Job 2005: 179–182).3
Die Diskurstraditionen tragen außerdem eine besondere Bedeutung beim Ausbau der Schriftsprache. Oftmals prägen sich bestimmte textsortenspezifische Wortbedeutungen, die bedenkenlos aus einer einzelnen Diskurstradition in den Alltagssprachgebrauch übernommen werden. Diskurstraditionen können somit einerseits als „Manifestation von Übernahmen sprachlicher Neuerungen, deren Ursprung in Formen der Nähesprache zu vermuten ist“ (Frank-Job 2005: 186) verstanden werden, andererseits sind sie selbst für die Ausbreitung und Verbreitung der Innovationen verantwortlich (vgl. Frank-Job 2005: 182–188; Winter-Frömel/López Serena/Octavio de Toledo y Huerta/Frank-Job 2015: 4). Die Bedeutung der Diskurstraditionen und die Auswahlkriterien für die verwendeten Diskurstraditionen werden noch genauer erläutert (vgl. Kap. 3.4).
3.2Grammatikalisierung
3.2.1Begriffsbestimmung
Der Begriff ‚grammaticalisation‘ wurde erstmals von Antoine Meillet ([1912], 1921: 148) in seiner Abhandlung mit dem Titel „L’évolution des formes grammaticales“ über die Entstehung grammatischer Formen verwendet, doch finden sich bereits bei Wilhelm von Humboldt (1822) erste Hinweise auf einen solchen Prozess. Seither wurde der Begriff vielfach definiert, sodass sich spätestens mit [26]Lehmann ([1982], 1995) eine vollständige Theorie des grammatischen Wandels, die so genannte Grammatikalisierungstheorie, entwickelte, die in den vergangenen Jahrzehnten einen erheblichen Aufschwung erlebte (vgl. Lehmann 1985; 2004; Hopper/Traugott 2003: 19–38).
Grammatikalisierung ist ein Sprachwandelvorgang, den Lehmann ([1982], 1995) als „a process in which something becomes or is made grammatical“ (ebd.: 9) beschreibt, sowie „a process in which something becomes or is made more grammatical“ (ebd.), was er als „grammaticality“ (ebd.) bezeichnet. In gleicher Weise erklären Hopper/Traugott (2003) Grammatikalisierung als Entwicklung eines grammatischen Zeichens aus einem lexikalischen Zeichen. Als lexikalisch bezeichnen sie die Elemente, „die die Hauptbedeutung eines Satzes tragen und eine eigene lexikalische Semantik besitzen“ (Ferraresi 2014: 3). Dazu zählen Nomen, Verben, Adjektive und Adverbien. Als grammatisch werden die Zeichen beschrieben, die eine Verbindung oder Relation darstellen und die Interpretierbarkeit der lexikalischen Elemente ermöglichen. Grammatische Elemente können einerseits als gebundene, andererseits als freie Morpheme auftreten. Oftmals zeigt sich die Tendenz, dass lexikalische Elemente bei der Grammatikalisierung phonologisch abgeschwächt und zu gebundenen Morphemen werden, was als Grammatikalisierungspfad dargestellt werden kann:
content item > grammatical word > clitic > inflectional affix
(Hopper/Traugott 2003: 7)
Ein lexikalisches Element muss nicht zwingend alle Stationen durchlaufen, um als grammatikalisiert zu gelten (vgl. Hopper/Traugott 2003: 4–18). Der Pfad demonstriert aber die Unidirektionalität der Grammatikalisierung, die laut Lehmann oftmals betont wurde (vgl. Lehmann [1982], 1995: 16; Givón 1975: 96; Langacker 1977: 103 f.; Vincent 1980: 56–60; Haspelmath 1999).
3.2.2Parameter der Grammatikalisierung
Um den Grad der Grammatikalisierung zu bestimmen, entwickelte Lehmann ([1982], 1995) ein Raster, das verschiedene Eigenschaften oder Parameter beinhaltet. Sein Raster ist folgendermaßen aufgebaut:
paradigmatic
syntagmatic
weight
integrity
structural scope
cohesion
paradigmaticity
bondedness
variability
paradigmatic variability
syntagmatic variability
Tab. 3: Parameter der Grammatikalisierung von Lehmann 1995: 123
[27]Lehmann teilt sein Raster in eine paradigmatische und eine syntagmatische Dimension ein. Er untersucht die beiden Dimensionen bezüglich ihrer Autonomie anhand folgender Faktoren: Mit ‚weight‘





























