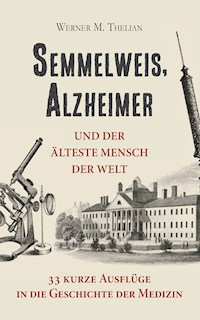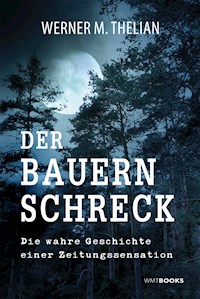
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vor etwas mehr als 100 Jahren, am Vorabend des Ersten Weltkrieges, versetzten merkwürdige Ereignisse die Bevölkerung der Steiermark und Kärntens in Angst und Schrecken und ganz Österreich-Ungarn in Erstaunen und Entsetzen. Von Mitte Juni 1913 bis Anfang März 1914 tötete ein unbekanntes, aber offenbar besonders gefährliches Raubtier die Schafe und Rinder der Bauern und das Wild. Das schreckliche Treiben, das auf der Stubalpe in der Steiermark begann und sich später bis mitten in das Herz des Kärntner Koralpengebietes fortsetzte, blieb sowohl den mit der Aufklärung des Falles beschäftigten Behörden als auch den Fachleuten lange ein Rätsel. Aber die Zeit drängte, denn schon bald waren auch Menschen in Gefahr. Vieles von dem, was damals passierte, erinnerte an Ereignisse, die sich 150 Jahre zuvor in Frankreich zugetragen und über 130 Menschen das Leben gekostet hatten. War der Albtraum von einst nun wiedergekehrt? Man setzte Krisenstäbe ein, gründete Sonderkommissionen, und in besonders gefährdeten Gebieten wurden aus Angst um die Kinder Schulen geschlossen und Hunderte von Jägern, Gendarmen und Soldaten auf die Almen entsandt, um der von dort ausgehenden Gefahr endlich Einhalt zu gebieten. Aber nichts half. Der „Bauernschreck“, wie man die mysteriöse Bestie bald überall nannte, tötete weiter. Dieses Buch ist die Erzählung einer ebenso seltsamen wie wahren und sorgfältig recherchierten Geschichte, die monatelang die Zeitungen und ihre Leser beschäftigte, berühmte „Afrikajäger“ auf den Plan rief und international anerkannte Fachleute an die Grenzen ihres Wissens und ihrer Erfahrungen führte. Sie nimmt den Leser mit in eine Zeit, in der gedruckte Sensationen zu kostbaren Waren wurden, Wandermenagerien ihr Publikum begeisterten, der Tiergarten von Schönbrunn seine bis dahin größte Ausdehnung erfuhr und Kaiser Franz Joseph I. sich höchstpersönlich für die merkwürdigen Vorkommnisse in der Provinz interessierte. Aber noch ahnte niemand etwas von dem merkwürdigen Zusammenhang, den es schließlich zwischen der Lösung des Rätsels und jenem Attentat in Sarajevo geben sollte, das den Ersten Weltkrieg auslöste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Die Zeit des »Bauernschrecks« beginnt
Tiere, die es auf Erden bisher nicht gegeben hat
Die Meldungen erreichen Wien
Die Geburt einer Zeitungssensation
Eine Belohnung wird ausgesetzt
Ein merkwürdiges Telegramm
Erinnerungen eines alten Pfarrers
Die Bestie von Gévaudan
Ein Koordinator wird eingesetzt
Die Jagd auf Löwen
Der »Afrikajäger« oder »Wie bitte erlegt man einen Löwen?«
Dem »Bauernschreck« auf der Spur
Interview mit Dr. Hoffer
Der Kaiser möchte Ergebnisse sehen
Das Jahr geht zu Ende
Das Ende des »Bauernschrecks«
Die Obduktion einer Bestie
Die Ausstellung in Graz
Der »Bauernschreck« im Museum
Vorläufiger Abschied vom »Bauernschreck« (1914)
Nachwort
Anhang
Über den Autor
2. Auflage Copyright © 2014 Werner M. Thelian Alle Rechte vorbehalten Cover Foto: CanStockPhoto
Werner M. Thelian 9400 Wolfsberg, Roßmarkt 5/9, Austria Website zum Buch: www.wmtbooks.at E-Mail: [email protected]
Prolog
Vor etwas mehr als 100 Jahren und nur wenige Monate vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges versetzten die merkwürdigen Ereignisse, die das Thema dieses Buches sind, die Bevölkerung Österreich-Ungarns in Erstaunen und Entsetzen. Von Mitte Juni 1913 bis Anfang März 1914 dezimierte ein unbekanntes, aber offenbar besonders gefährliches Raubtier in den Grenzgebieten zwischen der Steiermark und Kärnten das Weidevieh der Bauern und das Wild.
Das unablässige und brutale Töten, das im Frühjahr 1913 auf der Stubalpe in der Steiermark begann und sich später bis mitten in das Herz des Kärntner Koralpengebietes fortsetzte, blieb sowohl den mit der Aufklärung des Falles beschäftigten Behörden als auch den Fachleuten lange ein Rätsel. Aber die Zeit drängte, denn schon bald waren nicht nur Tiere, sondern auch Menschen in Gefahr.
Durch die enormen, für die betroffenen Bauern existenzgefährdenden Schäden und die in der Bevölkerung allmählich um sich greifende Panik wurden die Behörden nicht nur alarmiert, sondern zum sofortigen Handeln gezwungen. Man setzte Krisenstäbe ein, gründete Sonderkommissionen und ordnete »sicherheitspolizeiliche Maßnahmen« an. In den besonders gefährdeten Gebieten wurden aus Angst um die Kinder Schulen geschlossen und neben Hunderten von Jägern und Gendarmen auch Soldaten auf die Almen entsandt, um der von dort ausgehenden Gefahr endlich Einhalt zu gebieten. Aber nichts half. Der geheimnisvolle »Bauernschreck«, wie man die Bestie bald überall nannte, war nicht zu fassen, und er tötete weiter.
Unter dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit, der nicht zuletzt aus der Flut von Zeitungsberichten widerhallte, wurden alle zur Verfügung stehenden Mittel in den Dienst der Aufklärung des merkwürdigen Falles gestellt. Verdächtige Spuren wurden gesichert, vermessen und ausgewertet, die angerichteten Schäden registriert, grausam zugerichtete Tierkörper untersucht, angebliche Augenzeugen befragt und angesehene Fachleute im In- und Ausland konsultiert. Jedem noch so kleinen Hinweis ging man nach. Aber echte Erfolge, die eine baldige Lösung des Rätsels zumindest in Aussicht gestellt hätten, blieben sowohl den Ermittlern als auch den Jägern monatelang versagt.
Das ausgesetzte Kopfgeld lockte nicht nur Weidmänner von nah und fern an die Orte des Geschehens, sondern rief auch verwegene Abenteurer, Geschäftemacher und zahlreiche Reporter auf den Plan. Die Zeitungen verbreiteten die Nachrichten über das Wüten des »Bauernschrecks« und die Jagd nach ihm in allen Teilen Österreich-Ungarns, sodass es in der ganzen Donaumonarchie bald kaum noch jemanden gab, der von dem geheimnisvollen Untier in den Bergen nicht gelesen oder wenigstens gehört hätte.
Über Nachrichtenagenturen und Redaktionen in Wien, Graz, Klagenfurt, Marburg und Leoben gelangten die Meldungen von den Vorkommnissen in der Provinz bis nach Triest, Prag, Budweis, Budapest und Czernowitz und wurden dort ebenso interessiert aufgenommen wie in Berlin, Paris, London und St. Petersburg. Selbst in den allerhöchsten Wiener Kreisen, in den Kanzleien der Hofburg und den kaiserlichen Gemächern im Schloss Schönbrunn, ließ man sich regelmäßig über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten.
Die »Bauernschreck-Affäre« wurde, je länger sie dauerte und je verworrener sie erschien, zu einem umso größeren Medienereignis. Spezial- und Sonderberichterstatter wurden ausgeschickt, Leserbriefschreiber äußerten gewagte Vermutungen und die in hohen Auflagen gedruckten »Bauernschreck«-Ansichtskarten erfreuten sich großer Beliebtheit. So mancher Künstler nahm sich des Themas schon deshalb gerne an, weil das zunehmende Interesse der Öffentlichkeit besonders einträgliche Geschäfte mit den Fantasiebildern und Karikaturen verhieß.
Vieles von dem, was damals über die Telegrafen und die Telefonleitungen die Redaktionen erreichte, war aber auch durchaus geeignet, schon längst in Vergessenheit Geratenes wieder heraufzubeschwören. Erfahrene Journalisten gingen den unterschiedlichsten Aspekten der Geschichte nach und recherchierten in Bibliotheken und verstaubten Zeitungsarchiven, um ihre staunenden Leserinnen und Leser mit haarsträubenden Details über Ungeheuer, Werwölfe und andere Ausgeburten der Hölle und des Aberglaubens zu versorgen.
Nicht nur in Paris erinnerte man sich jetzt wieder einer Reihe ganz ähnlicher Begebenheiten, die sich fast genau 150 Jahre zuvor in Frankreich zugetragen und über 130 Menschen das Leben gekostet hatten. Betroffen waren damals fast ausschließlich Frauen und Kinder, von einer unheimlichen Bestie wie dieser getötet, furchtbar entstellt und grausam verstümmelt. War der Albtraum von einst nach so langer Zeit erneut wiedergekehrt?
Die ebenso wahre wie seltsame Geschichte von der monatelangen und zunehmend verzweifelten Jagd nach dem »Bauernschreck«, die sich in einigen der schönsten Regionen Österreichs zugetragen hat, ist zugleich auch eine Geschichte von Helden, Beinahe-Helden und Trittbrettfahrern. Sie erzählt nicht nur von einer der größten und aufwendigsten Raubtierjagden, die man in Europa jemals gesehen hat, sondern auch von namhaften Experten, die sich unter dem Eindruck der Ereignisse zu folgenschweren Fehlurteilen hinreißen ließen.
Aber in diesem Buch geht es um mehr. Denn die »Bauernschreck-Affäre« von damals ist, aus der Distanz eines ganzen Jahrhunderts betrachtet, auch ein Geschehen, bei dem sich am Vorabend des Ersten Weltkrieges und damit mitten in einer auf ihre technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften so stolzen Zeit längst schon überwunden geglaubte Urängste erneut an die Oberfläche wagten: die Furcht davor, einem bisher verborgenen Teil der Natur hilf- und wehrlos ausgeliefert zu sein, aber auch die in der ländlichen Bevölkerung noch immer tief verwurzelte Sorge, eines Tages für begangene Sünden und Verfehlungen kollektiv zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Und schließlich bietet die Zeitungssensation »Bauernschreck« die Möglichkeit, einen Blick auf die Veränderungen des Pressewesens zu werfen, das sich gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer der vielleicht entscheidendsten Phasen seiner Entwicklung befand. Weitreichende Umwälzungen, vor allem nachrichten- und drucktechnischer Natur, machten aktuelle, die Leser fesselnde Meldungen zu besonders kostbaren Waren, die mit immer größerer Geschwindigkeit an immer zahlreichere Abnehmer weiterverbreitet wurden.
Zu der Zeit, als das »Bauernschreck-Rätsel« auf diese zusehends an Dynamik gewinnende Presselandschaft traf und von ihr begierig aufgesogen und verwertet wurde, erlebten zahlreiche Blätter gerade einen kräftigen Modernisierungsschub. So gut wie alle Pressehäuser, Herausgeber und Redaktionen mussten schon aus wirtschaftlichen Gründen daran interessiert sein, an den vielversprechenden Entwicklungen des neuen, goldenen Pressezeitalters Anteil zu nehmen. Risikobereitschaft, Geschwindigkeit und Exklusivität zahlten sich mehr denn je aus und wurden gemeinsam zum beinahe alleinigen Maßstab des Erfolges, der sich vor allem in der Höhe der Auflage, der Anzahl der Leser und Abonnenten und der Zufriedenheit der inserierenden Kunden widerspiegelte. Auf diesem Nährboden konnte die Sensationsgeschichte vom »Bauernschreck« besonders gut gedeihen.
Kaum jemals zuvor und nur selten danach hat ein Thema abseits der großen Kriegsschauplätze und außerhalb der Zentren der politischen und der wirtschaftlichen Macht über einen so langen Zeitraum hinweg die Gemüter der Zeitungsleser ähnlich intensiv bewegt wie der »Bauernschreck«. Und trotzdem ging das Wissen darüber im Laufe der Zeit fast vollständig verloren.
Überschattet von den weltbewegenden und welterschütternden Ereignissen, die folgten, dem Ersten Weltkrieg nämlich, rückte die »Bauernschreck-Affäre« mehr und mehr in den Hintergrund, um schließlich zu verblassen und beinahe ganz in Vergessenheit zu geraten. Nicht einmal in den Gebieten, die einst so unmittelbar von ihr betroffen waren – in der Steiermark und in Kärnten – erinnerte man sich noch an sie. Erst eine Reihe glücklicher Umstände eröffneten nach über 100 Jahren die Möglichkeit, die wahre Geschichte vom »Bauernschreck«, die einst so viele Menschen in ihren Bann gezogen hat, wieder freizulegen und noch einmal zu erzählen.
Dieses Buch ist kein Roman, sondern die Erzählung einer wahren Begebenheit. Es beschreibt Tatsachen – und zwar so, wie sie aus den originalen Quellen, vorwiegend aus den österreichischen, aber auch den internationalen Zeitungen der Jahre 1913 und 1914 hervorgehen oder sich auf der Grundlage der damals sehr ausführlichen Berichterstattung im Nachhinein rekonstruieren ließen.
Alle Originalzitate sind entsprechend gekennzeichnet und lassen sich anhand der Quellenangaben im Anhang dieses Buches leicht nachverfolgen. Dabei wird wahrscheinlich auffallen, dass diese Abschnitte aus Gründen der Einheitlichkeit und der besseren Lesbarkeit in gemäßigter Form an die moderne Rechtschreibung angepasst wurden. Sämtliche Interviews, die in diesem Buch vorkommen, beruhen auf tatsächlich geführten Gesprächen zwischen Journalisten und Experten.
Werner M. Thelian
Abb. 1 Das steirisch-kärntnerische Grenzgebiet zwischen der Stubalpe (im oberen Kartendrittel) und der Koralpe (im unteren Kartendrittel) wurde 1913 und 1914 vom mysteriösen »Bauernschreck« heimgesucht. Original-Skizze.
»Wohl selten hat in unserer raschlebigen Zeit, die immer nach Neuigkeiten drängt, etwas so nachhaltig und so intensiv die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich gelenkt wie der Bauernschreck.«
Deutsches Volksblatt, Morgen-Ausgabe Wien, am 6. März 1914
»Wir sind dem Bauernschreck für immer verfallen, und unsere Nachkommen werden von unserer Zeit sagen, sie sei die Zeit des Bauernschrecks gewesen.«
Pester Lloyd, Morgenblatt Budapest, am 11. Februar 1914
»… da meinte dieser alte Mann: Das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn so ein wildes Tier in die Gegend kommt, dann gibt es meistens einen schlimmen Krieg und Teuerung.«
Zentralblatt für Okkultismus 1914/15 über den »Bauernschreck«
Die Zeit des »Bauernschrecks« beginnt
1
»Wohl wollen pessimistische Schwarzseher uns vor der Zahl 1913 gruseln machen und aus kindlichem Aberglauben heraus das neue Jahr voll Unglück sehen. Aber der klare Blick braucht sich vor Gespenstern nicht zu fürchten.«
Prager Tagblatt Prag, am 1. Januar 1913
Als das Jahr 1913 begann, das letzte vor dem großen Krieg, schickte man ihm von allen Seiten viele Erwartungen und noch mehr hoffnungsvolle Wünsche entgegen. Das soeben zu Ende gegangene Jahr 1912 war für die meisten der über 50 Millionen Menschen, die damals in Österreich-Ungarn lebten, alles andere als eine gute Zeit gewesen. Die Kriegsgefahr breitete sich vom Balkan her langsam, aber vielleicht schon unaufhaltbar immer weiter nach Norden und Westen aus und lag nun bereits seit geraumer Zeit mit erdrückender Schwere über den Völkern des Habsburgerreiches und Europas.
Aber ab und zu keimte auch noch in dieser äußerst angespannten Lage echte Zuversicht auf. Vielleicht, so hofften viele, würde es 1913 mit politischem Augenmaß gelingen, die gefährlich brodelnden Konflikte beizulegen und im Interesse aller zu »friedlicher Arbeit und sicherem Fortschreiten« zurückzukehren. Die Menschen in den Städten, Märkten und Dörfern sehnten sich nach Sicherheit und Frieden, während sich die Bauern draußen auf dem Land vom Sommer dieses Jahres endlich wieder eine gute und ertragreiche Ernte versprachen.
Während einige Zeitungen bereits vorsichtig dazu übergingen, in der momentan herrschenden »politischen Wetterlage« erste, wenn auch noch recht zarte Zeichen allmählicher Entspannung auszumachen, wurden die mittlerweile überall anzutreffenden Pazifisten rund um ihre Galionsfigur, die österreichische Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, nicht müde, vor einem bevorstehenden großen Krieg zu warnen. Dieser würde angesichts der neuen technischen Möglichkeiten alle bisher dagewesenen Kriege in den Schatten stellen und wohl den Rückfall Europas, wenn nicht sogar der ganzen Welt, in dunkelste Zeiten mit sich bringen.
1913 wurde kein gutes Jahr. Schon wegen des Wetters nicht. Nach einem außerordentlich strengen Winter wurden im Frühjahr und im Sommer weite Teile Europas von heftigen Unwettern heimgesucht. Orkanartige Stürme, heftige Wolkenbrüche und schwere Hagelschauer führten vielerorts zu Überflutungen und Zerstörungen wie auch zur Vernichtung der beinahe gesamten noch ausstehenden Ernte. Es war das erste große Wetterkatastrophenjahr des noch recht jungen 20. Jahrhunderts, und die zerstörerische Kraft der scheinbar außer Rand und Band geratenen Elemente war von Anfang an rund um den Erdball zu spüren.
Schon früh im März litten vor allem der Nordosten und der Süden der USA unter den Auswirkungen der Wetterkapriolen, die dort, begleitet von Stürmen und ungeheuren Wasserfluten, einige der schwersten Zerstörungen seit Menschengedenken anrichteten. Als Teile Ohios überschwemmt wurden, waren mehr als 1.000 Todesopfer zu beklagen. Mehr als 75.000 Amerikanerinnen und Amerikaner wurden praktisch über Nacht obdachlos.
In Mitteleuropa erwies sich das Wetter im März noch als viel gemäßigter, wenn es auch ausgesprochen kühl und wechselhaft war. Im April wurde es dann sogar richtig kalt für die Jahreszeit. In Deutschland verzeichnete man am 11. April 1913 eine mittlere Tagestemperatur von nur 0,6 Grad Celsius und damit den kältesten Apriltag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die frostige Kälte, die den Menschen so unbarmherzig in die Glieder kroch, zerstörte in Österreich und in Deutschland die Baumblüte, während in Ungarn, in Italien und in den österreichischen Gebieten an der Adria Schneestürme tobten.
Dann aber schlug das Wetter plötzlich um, und die Kälte des April wurde im Mai von einer beinahe ebenso unerträglichen Hitze abgelöst, die der ohnehin schon leidgeprüften Bevölkerung Tage mit Temperaturen weit jenseits von 30 Grad Celsius bescherte. Es war gefährlich trocken, was natürlich vor allem die Landwirtschaft zu spüren bekam. Aber auch dabei blieb es nicht. Kaum zeigte der Kalender den Beginn des Sommers an, herrschte wieder überall ungewöhnlich kaltes und nasses Wetter. Gewitter, Regenfälle, Stürme und Hagelschauer führten in Mitteleuropa zu einer Reihe von Überflutungen, von denen auch Wien, das Donautal und die gesamte Steiermark schwer betroffen waren.
Als wäre das alles jedoch nur das Vorspiel zu weitaus größerem Unheil gewesen, brach am Mittwoch, dem 16. Juli 1913, über die steiermärkische Landeshauptstadt Graz buchstäblich der Weltuntergang herein. Gegen 13 Uhr zogen dichte und dunkle Wolkenmassen auf, die bald alle Plätze, Straßen und Parks der Stadt in gespenstische Dunkelheit hüllten. Es war kurz vor 16 Uhr, als die Wolken brachen und sich wahre Unmengen von Regen auf die Straßen und die dicht an dicht gebauten Häuser ergossen.
Der Wolkenbruch, dessen Heftigkeit von Stunde zu Stunde weiter zunahm, dauerte bis kurz nach 21 Uhr. Das Hochwasser und die von ihm unterwegs mitgerissenen Baumstämme und Geröllmassen beschädigten nicht nur zahlreiche Brücken, sondern ließen einige auch krachend in sich zusammenstürzen. Die Mur trat über ihre Ufer und die schlammigen Wassermassen überschwemmten Straßen, Keller und Parterrewohnungen.
Menschen, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, wurden mitgerissen und ertranken hilflos in den schmutzigen Fluten. Über die Gebiete im östlichen Teil der Stadt wälzte sich eine meterhohe Flutwelle hinweg, die Häuser, Wohnungen und Geschäfte zerstörte und auch zahlreiche Villen, Gärten und Parks der besseren Gesellschaft dem Erdboden gleichmachte. Die Aufräumungsarbeiten in der steiermärkischen Landeshauptstadt sollten noch lange dauern.
2
Neben den Verrücktheiten des Wetters und den daraus resultierenden Zerstörungen widmete sich die Berichterstattung der österreichischen Zeitungen auch weiterhin Kriminal- und Unglücksfällen und den jüngsten »Sensationen« vom militärischen und politischen Parkett. Allen voran dem unerhörten Spionagefall um Oberst Alfred Redl, der als Generalstabschef des Prager Armeekorps und einer der ranghöchsten und bestinformierten Nachrichtenoffiziere der Monarchie offenbar nichts Besseres zu tun gehabt hatte, als militärische Geheimnisse an Russland, aber auch an Frankreich und Italien zu verraten. Darunter waren auch einige, die Österreich-Ungarn im Falle eines Krieges schweren Schaden zufügen konnten.
Ende Mai 1913 hatte man den Offizier, der so großen Wert auf sein Äußeres legte, in einem Wiener Postamt bei der Abholung eines Geldkuverts entlarvt und ihn bis zu jenem Hotelzimmer in der Innenstadt verfolgt, in dem er sich in der Nacht darauf das Leben nahm. Dann stellte sich auch noch heraus, dass der oberste Generalstab der Armee versucht hatte, die peinliche Affäre, in der neben Geld auch Redls Homosexualität eine Rolle spielte, zu verschweigen und unter den Teppich zu kehren. Nur durch Zufall stieß der Prager Journalist Egon Erwin Kisch auf die Wahrheit, erkannte die Tragweite des Geschehenen und brachte die Geschichte an die Öffentlichkeit.
Die »Affäre Redl« zeichnete ein ebenso schockierendes wie beklemmendes Bild von den Zuständen in der österreichisch-ungarischen Armee und sorgte noch wochenlang für Aufregung. Wo immer man in Wien, Prag oder in einer der anderen Städte Österreich-Ungarns zusammenstand, wurde zumindest hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen. Und denen, die zuvor noch so stolz ihre Offiziersuniform getragen hatten, schlug nun immer öfter ein rauer Wind des Misstrauens und der Schadenfreude entgegen.
Spürbar war das auch bei der großen Adria-Ausstellung, die man im Mai im Wiener Prater eröffnet hatte. Die vom österreichischen Flottenverein organisierte Schau wartete mit einem großen Themenpark auf und lockte Massen von Besuchern an. Obwohl es häufig regnete – genauer gesagt: an 79 von insgesamt 155 Ausstellungstagen – wurde die noch bis Anfang Oktober dauernde Ausstellung, die täglich von 10 Uhr vormittags bis 2 Uhr früh geöffnet hielt, zu einem großen Publikumserfolg. Über zwei Millionen Besucher wurden gezählt.
Darüber hinaus galt das Interesse der Öffentlichkeit auch weiterhin den andauernden Wirren am Balkan sowie dem 25-jährigen Regierungsjubiläum des deutschen Kaisers. Das Vierteljahrhundert der Regentschaft von Kaiser Wilhelm II. wurde in Berlin noch ausgiebig gefeiert, als man sich am Hof in Wien schon längst auf die bald wieder bevorstehende Sommerfrische von Kaiser Franz Joseph I. in Bad Ischl vorbereitete, ausgiebige Jagdausflüge des Monarchen inklusive. Die Abreise war für den 1. Juli geplant.
Ehe es jedoch soweit war, erregte in Wien auch der »Jubiläumsbesuch« des weltberühmten Grafen Zeppelin beträchtliches Aufsehen. So bevölkerten am Montag, dem 9. Juni 1913, Hunderttausende die Straßen und Plätze der Stadt, um schließlich zum Himmel aufzublicken, wo das majestätische Luftschiff »Sachsen« mit Zeppelin an Bord über die österreichische Hauptstadt schwebte.
In Schönbrunn war der Kaiser höchstpersönlich auf den Balkon getreten, um den Überflug zu beobachten. Der mittlerweile 82 Jahre alte Monarch, der nun schon seit sechseinhalb Jahrzehnten die Geschicke eines großen Reiches und seiner Menschen lenkte und dem technischen Fortschritt sonst eher ablehnend gegenüberstand, zeigte sich wenigstens diesmal ebenso begeistert wie die meisten Wienerinnen und Wiener.
Noch während die »Sachsen« in Richtung Aspern steuerte, um dort am erst vor kurzem eröffneten Flugfeld vor Anker zu gehen, bereitete sich Franz Joseph schon auf die für den nächsten Tag geplante Audienz vor, bei der er Zeppelin das Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft überreichen würde. Dann konnten die beiden längst schon in die Jahre gekommenen Männer, der mächtige Herrscher und der deutsche Luftschiff-Pionier, einander mit der Gewissheit in die Augen sehen, dass jeder von ihnen zwar noch die Tugenden der alten Zeit verkörperte, zugleich aber auch dazu bestimmt war, den Menschen den Weg in die Zukunft zu weisen.
3
Aber dann, gegen Ende Juni 1913, häuften sich in den Redaktionen der Zeitungen plötzlich Meldungen aus der Provinz, wonach auf den Bergen und den Almen im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet ein geheimnisvolles »Untier« wüte. Auf der Hirschegger Alpe in der Steiermark, mitten in einem beliebten Urlaubs- und Ausflugsgebiet, hatte man mehrere tote Rehe gefunden. Ihre Kadaver waren ungewöhnlich grausam zugerichtet. Einigen der Tiere waren große Stücke Fleisch aus dem Körper gerissen. An verschiedenen Stellen war ihre Haut von tiefen Kratzern zerfetzt. Einem der Rehe fehlte der Kopf.
Die angesichts so fürchterlicher Verletzungen weitgehend ratlosen Jäger verdächtigten zunächst wildernde Hunde, die in der Gegend öfter ihr Unwesen trieben. Sogleich waren die weidmännischen Sinne geschärft und ihre Träger fest entschlossen, in nächster Zeit auf ähnliche Vorkommnisse zu achten. Die aber hatte es, wie sich rasch herausstellte, auf der benachbarten Stubalpe schon kurz zuvor gegeben.
Weil die Strahlen der Sonne in diesem wettermäßig so unbeständigen Frühling viel länger als sonst benötigten, um den letzten Schnee auf den Bergen zurückzudrängen und ihn schließlich ganz zu besiegen, waren auch die Bauern und die Viehbesitzer ungewöhnlich spät dran. Erst nach mehreren Erkundungsgängen zu den Höhen lag endlich die Bestätigung vor, dass die Almweiden nun tatsächlich wieder schneefrei waren. So konnte man in der zweiten Junihälfte damit beginnen, die Rinder, Kälber, Schafe und Lämmer auf die Almen zu treiben, wo die Tiere, wie in jedem Sommer, bald schon herrlich blühende Almwiesen vorfinden würden, deren Gräser und Kräuter so saftig und nahrhaft waren, dass die Kühe hier oben weitaus mehr Milch als unten im Tal gaben.
Eigentlich sollte alles so verlaufen wie immer. War man nach oft langem und beschwerlichem Fußmarsch mit den Tieren gut auf der Alm angekommen, bezogen die Hüter die Hütten, wo sie den ganzen Sommer verbringen würden, um in der Nähe der ihnen anvertrauten Herden zu sein. Schließlich konnte es immer wieder vorkommen, dass sich das eine oder andere kostbare »Stück Vieh« im weitläufigen Gebiet verirrte, vielleicht sogar über einen Abhang stürzte oder nach einem Ausrutscher im oft steilen und felsigen Gelände hilflos in einem Bachbett liegen blieb.
Kündigte sich gar ein Unwetter an, was in diesem Sommer sicher öfter vorkommen würde, mussten die Tiere rechtzeitig in die Unterstände gebracht und dort beruhigt und entsprechend versorgt werden, bis das Schlimmste vorüber war. So war es immer gewesen, so würde es wohl auch diesmal sein.
Aber auch sonst konnte man sich oben auf den einsamen Almen über Mangel an Arbeit nicht gerade beklagen. Das Tagwerk der Hüter begann für gewöhnlich schon früh am Morgen, wenn sich die Kühe vor der Hütte versammelten, um anschließend zum ersten Mal am Tag gemolken zu werden. Neben dem Melken und Füttern der Tiere und dem Ausmisten der Ställe gehörte es zu den Aufgaben der Hüter, die Bergweiden regelmäßig abzugehen, um sich nur ja zu vergewissern, dass alle Tiere noch da, unversehrt und bei guter Gesundheit waren.
Dann wurden auch schadhafte Stellen an den Zäunen repariert, Tränken und Brunnen gereinigt, Gras und Unkraut gemäht und störende und das Vieh behindernde Sträucher und Büsche entfernt. Alle paar Tage hackte man Holz, machte Heu für Schlechtwetterzeiten und für den Winter unten im Tal und verarbeitete die Milch der Kühe und Schafe zu Butter, Topfen und Käse.
Das zumindest auf den ersten Blick so idyllisch erscheinende Almleben, das gewiss jederzeit genügend Motive für die bei Wanderern und Feriengästen immer beliebter werdenden Ansichtskarten geboten hätte, würde erst Anfang September enden, wenn die Tage schon merklich kürzer waren und es auf den Bergen zunehmend kälter und unfreundlicher wurde. Dann würden Mensch und Tier wieder ins Tal zurückkehren, wo der Almabtrieb freudig erwartet und gefeiert wurde. Waren die Tiere vollzählig und gesund in ihren Ställen angekommen, war der Sommer gut verlaufen. Dann konnten die Bauern zufrieden sein.
Aber dieses Mal kam alles anders, denn dieses Mal endeten schon einige der ersten Almauftriebe auf der Stubalpe in einem fürchterlichen Desaster.
Abb. 2 Im Frühsommer wurden die Tiere der Bauern auf die Almen getrieben und normalerweise Anfang September wieder ins Tal gebracht.
4
Kaum waren die Hüter mit den Tieren auf der Alm eingetroffen, hatten die Hütten bezogen, die Räume gereinigt und das im letzten Jahr sorgfältig in Kisten, Schränken und Truhen verstaute Inventar wieder ausgepackt, wurden einige von ihnen, wie von einem Blitz aus heiterem Himmel, vom Unglück überrascht. Im Laufe von zwei aufeinanderfolgenden Nächten tötete ein zunächst unbekanntes Raubtier nicht weniger als 27 Schafe. Der Räuber – vielleicht waren es auch mehrere – schlug im Schutz der Dunkelheit an verschiedenen Stellen der Stubalpe zu, überwand offenbar spielend leicht alle Hindernisse und Zäune und fügte den von ihm gejagten und in den meisten Fällen schließlich getöteten Tieren fürchterliche Verletzungen zu. Eine blutige Spur zog sich über die Alm.
Die ebenso erschrockenen wie ratlosen Hüter schworen, sie hätten nichts Außergewöhnliches bemerkt. Das Blöken der Schafe sei nicht anders als sonst gewesen. Freilich müsse man bedenken, dass Schafe, ganz im Gegensatz zu den Rindern, selbst bei größter Gefahr erst gar nicht ernsthaft zu flüchten versuchen. Sie drängen sich vielmehr möglichst eng aneinander, schieben andere zur Seite oder vor sich her, reißen schließlich unfreiwillig aus der Herde aus und werden gleich danach umso leichter zur Beute. Vor allem dann, wenn es sich bei dem Angreifer um einen großen, schnellen und kräftigen Räuber handelt, der genau weiß, wie man sich möglichst unauffällig nähert, eine Herde zunehmend beunruhigter Tiere umkreist, für Furcht und Verwirrung sorgt, die Kreise immer enger zieht und schließlich nicht nur ein einzelnes Lamm oder Schaf, sondern gleich zahlreiche Tiere tötet.
Erst wenn der Tag anbricht, wird das gesamte Ausmaß des nächtlichen Schreckens sichtbar. Überall geschundene, zerbissene und gerissene Tierkörper, die der in einen wahren Blutrausch verfallene Angreifer inmitten der noch Lebenden zurückgelassen hat.
Der mysteriöse Räuber schlug auch in den folgenden Nächten immer und immer wieder an verschiedenen Stellen der Stubalpe zu, nützte dabei stets die Dunkelheit, wechselte oft viele Dutzende Kilometer weit auf benachbarte Almen über, jagte und tötete dort erneut und blieb bei alledem von den Menschen unbemerkt wie ein Phantom. Nur die fürchterlichen Ergebnisse seines grausamen Wirkens waren unübersehbar.
5
Rasch gelangten die Nachrichten von den ebenso merkwürdigen wie besorgniserregenden Vorfällen nicht nur zu den Bauernhöfen und in die Ortschaften in den Tälern, sondern auch zu den lokalen Zeitungen. Am 23. Juni 1913 berichtete das »Grazer Tagblatt« bereits zum wiederholten Mal darüber:
»Zur Raubtierjagd an der steirisch-kärntnerischen Grenze. Man schreibt uns aus Voitsberg: Mittwoch nahm man die verderbliche Tätigkeit des Raubtieres wahr. Fünf Stück Rehwild und ein Stück Jungvieh wurden zerfetzt gefunden. Die Verletzungen ließen vermuten, dass das Raubtier seine Opfer von einem erhöhten Punkte aus anfalle. Dem Besitzer Gratz in Schiefling wurden fünf Schafe getötet, dem Märtemandre in Hirschegg-Rein sieben Schafe. Der Gesamtschaden wird auf 3.000 Kronen geschätzt.«
Aber auch danach riss die Schreckensserie nicht ab. Schon nach wenigen Wochen gingen zumindest 80 Schafe und Lämmer, 15 Rinder und möglicherweise auch zwei Fohlen, die wie vom Erdboden verschluckt waren und es auch blieben, auf das Konto des unbekannten Räubers. Die betroffenen Bauern wussten keinen Rat, verständigten in ihrer Not die Jäger und mussten dann oft erfahren, dass es nicht nur die eigene Herde, sondern auch die des Nachbarn getroffen hatte. Und oft noch viel schlimmer. Ein ebenso todbringendes wie mysteriöses Rätsel lag in der Luft, für das selbst die Erfahrensten unter den Bewohnern der immer stärker betroffenen Gebiete keine wirkliche Erklärung fanden. Jedenfalls konnte sich niemand unter den Bauern und Viehbesitzern daran erinnern, Ähnliches in dieser Gegend schon einmal erlebt zu haben.
Während die Jäger und die Bauern damit begannen, die Almen, Wälder und Wiesen nach den Anzeichen von gefährlichen Raubtieren abzusuchen, erzählten einige, dass es früher einmal auch in den Wäldern der Steiermark und im benachbarten Kärnten Bären, Luchse und Wölfe gegeben habe. Aber die waren, wie man sogleich überall versicherte, schon seit vielen Jahrzehnten ausgerottet oder wer weiß wohin vertrieben. Kaum jemand konnte sich auch nur die Möglichkeit vorstellen, dass gefährliche Tiere wie diese nach so langer Zeit wieder zurückgekehrt sein könnten.
6
Am Anfang war der Wald. Vor Jahrhunderten, als die Menschen längst schon damit begonnen hatten, der ursprünglichen und urwüchsigen Landschaft Platz für mehr Lebensraum, für Wiesen- und fruchtbare Ackerflächen, für den Bergbau, für Wege, Märkte und Städte abzutrotzen, waren ihre weit auseinanderliegenden Ansiedlungen noch überall von dichten, dunklen und schwer zu durchdringenden Wäldern umgeben. Dort vermutete man die Heimat jener Fabelwesen, von denen die Alten schaurige Geschichten zu erzählen wussten, und auch die Bären, Luchse und Wölfe, die damals noch in ihnen lebten, waren eine nicht zu unterschätzende Gefahr.
Vor allem in kalten und schneereichen Wintern, wenn die Nahrungsreserven in der Natur wie auch in den Häusern der Menschen knapp wurden und Hunger und Not wie ein brennender und schmerzender Schleier das Land überzogen, wagten sich die Raubtiere aus den Wäldern näher als sonst an die menschlichen Behausungen heran. Sie näherten sich vorsichtig den Ställen und den ohnehin nur noch spärlich gefüllten Vorratsspeichern.
Selbst später noch, als große Waldflächen bereits abgeholzt und gerodet waren, kam es gar nicht so selten vor, dass Fuhrleute oder Holzfäller in der Dämmerung einem Bären oder einem Rudel von Wölfen begegneten. Manchmal, so wird berichtet, musste man den hungrigen und bedrohlich knurrenden Tieren sogar einen Ochsen oder ein Pferd überlassen, um selbst mit dem Leben davon zu kommen.
Abb. 3 Auf der Stubalpe in der Steiermark hat alles begonnen. Im weiträumigen Gebiet kam es immer wieder zu Attacken.
Trotz aller Hindernisse und Gefahren waren die Wälder und die über den Wipfeln ihrer Bäume in weiter Ferne sichtbaren Berg- und Almregionen seit jeher wichtige Lebensgrundlagen für die Menschen. Von hier bezog man den kostbaren Rohstoff Holz, der zum Bauen, zum Heizen, zur Herstellung von Werkzeugen und Geräten, zur Errichtung von Befestigungen, Brücken und Zäunen so dringend benötigt wurde. Die Wälder waren Orte, die eine Vielzahl von Nahrungsmitteln boten, auch wenn das Jagen des Wildes fast immer den adeligen Grundbesitzern vorbehalten blieb und jede Form der Wilderei streng verfolgt und schwer bestraft wurde.
Auf den Wiesen an den Waldrändern wurden die Nutztiere – vor allem Schweine, Kühe, Ochsen, Ziegen, Schafe und Lämmer – gehalten, und im Schatten von Fichten-, Tannen- und Zirbenbäumen sammelte man die Früchte, die der Waldboden so reichlich hervorbringt: Kräuter, Beeren und Pilze. Aber auch die Nadeln, die Blätter, Blüten und das Harz der Bäume fanden Verwendung.
In den Tiefen der Wälder erntete man den Honig wilder Bienen und sammelte allerlei wertvolle Kräuter, die bei der Heilung von Krankheiten und der Linderung von Gebrechen seit jeher eine wichtige Rolle spielten. Auf den Lichtungen in den höher gelegenen Gebieten, wo der Wind beständig über den Boden jagt, legte man Brennöfen und Köhlergruben an, um in ihnen das Erz vom Gestein zu trennen und Holzkohle herzustellen.
Für die Vorfahren der Menschen dieser Gegend waren die Wälder aber auch Stätten der religiösen Verehrung. Lange Zeit, noch ehe christliche Kirchen gebaut wurden, galten manche Quellen, Felsen und Bäume als heilige Plätze, an denen man geheimnisvolle, von Generation zu Generation überlieferte Rituale vollzog und einst wohl auch Tiere opferte. Für die Angehörigen jener zunehmend in Vergessenheit geratenen Kultur lag nichts näher, als die scheinbar schon seit Anbeginn der Zeiten aufragenden Felsen und die uralten Bäume mit ihren tief im Erdreich verankerten, weit verzweigten Wurzeln als Mittler zwischen Diesseits und Jenseits anzusehen. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb wäre auch noch lange Zeit danach niemand ernsthaft auf den Gedanken gekommen, die Gefahren, die auf den Bergen und in den Wäldern lauerten, für gering zu schätzen.
Wölfe, Bären und Luchse hat es auf dem Boden des heutigen Österreich wie in den meisten Regionen Mitteleuropas schon immer gegeben. Aber ab dem späten Mittelalter wurden sie mit deutlich zunehmender Intensität verfolgt und gejagt. Die häufig stattfindenden, später oft behördlich koordinierten Treibjagden kosteten viele Tiere das Leben und zwangen die Wölfe, Luchse und Bären schließlich, ihre angestammten Reviere zu verlassen und sich anderswo, fernab von den Menschen, nach geeigneteren Lebensräumen umzusehen.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ordnete das österreichische Kaiserhaus sogar die vollständige Ausrottung von Bär und Wolf an, was schließlich dazu führte, dass es Wölfe und Bären spätestens im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts hierzulande praktisch nicht mehr gab. Sie waren allesamt vertrieben oder getötet und ausgerottet und damit der so unerbittlichen Konkurrenz des Menschen um Lebensraum und Nahrung zum Opfer gefallen. Zumindest vorläufig.
Tiere, die es auf Erden bisher nicht gegeben hat
7
Am 1. Juli 1913, einem Dienstag, trat Kaiser Franz Joseph I. wie geplant die Reise nach Bad Ischl an, um sich in seiner bevorzugten Sommerresidenz von den Anstrengungen der Regierungsgeschäfte zu erholen. Franz Joseph war mittlerweile ein alter, vom Schicksal geprüfter und gebeugter Mann, der in eineinhalb Monaten – am 18. August – 83 Jahre alt werden würde. Nach sechseinhalb ereignisreichen Jahrzehnten auf dem Thron und mehreren schweren Schicksalsschlägen war er nicht nur der am längsten regierende Herrscher Europas, sondern neuerdings auch immer öfter amtsmüde.
Wie in so vielen zurückliegenden Sommern seines langen Lebens freute sich der Kaiser auch in diesem auf Bad Ischl, die Kaiservilla, die Besuche bei Frau Schratt und die schöne und abwechslungsreiche Landschaft des Salzkammergutes, die ihm wieder genügend Gelegenheiten zur Zerstreuung bieten würden. Neben regelmäßigen Spaziergängen standen natürlich auch seine geliebten Jagdausflüge auf dem Programm.
Der Hofsonderzug verließ Wien pünktlich um 7.35 Uhr. Zunächst ging es nach Amstetten, wo Franz Joseph den Eisenbahnwaggon verließ und mit dem Automobil zum Schloss Wallsee gefahren wurde. Dort nahm er in der Schlosskapelle an der Taufe der jüngsten Tochter von Graf und Gräfin Waldburg-Zeil teil. Die stolzen Eltern hatten Erzherzogin Marie Valerie, die Schlossherrin von Wallsee und jüngste Tochter des Kaisers, gebeten, die Patenschaft für das Kind zu übernehmen.
Nach der Taufe und dem anschließenden Mittagessen ging es für den Kaiser weiter zur Bahnstation von St. Valentin, die der Zug um 14.30 Uhr in Richtung Bad Ischl verließ. Für die weitere Reise hatte sich Franz Joseph, schon aus Zeitgründen, jede weitere Unterbrechung durch Empfänge und Begrüßungs- und Dankesreden auf den Bahnhöfen entlang der Reiseroute verbeten.
Als der Zug schließlich kurz vor 18.30 Uhr in den Bahnhof von Bad Ischl einfuhr, warteten dort trotz des nach wie vor schlechten Wetters bereits Tausende Menschen auf die Ankunft des Monarchen. Ganz Bad Ischl war beflaggt. Der Kaiser nahm am Fenster des Hofsalonwagens stramme Haltung an, während sich draußen unter den neugierigen Blicken der Menge das Empfangskomitee formierte.
---ENDE DER LESEPROBE---