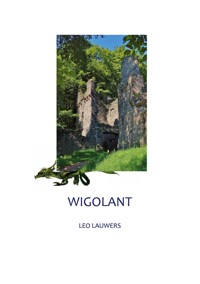Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was genau ist der Mensch eigentlich? Weshalb hat der Mensch Bedürfnisse? Was präzise sind seine Gefühle, seine Gedanken, sein Wollen, seine Bedürfnisse und wozu ist der Mensch auf das Zwischenmenschliche angewiesen? Welche Bedeutung haben Abhängigkeiten und Macht dabei? Gibt es kulturübergreifende, universelle Kräfte, die das Zwischenmenschliche ordnen und woher kommen sie? Hier wird ein breiter Bogen gespannt, der aus einer zeitgemäßen Betrachtung des Menschen als eine aus Energie bestehende Gestalt heraus, seine Wahrnehmungen, sein Verhalten, seine Gefühle und Gedanken, sein Bestreben im Zwischenmenschlichen, die dabei entstehenden Dynamiken von Abhängigkeiten und Macht, sowie die unentrinnbaren universellen Kräfte, die das Zwischenmenschliche ordnen, in einem harmonischen Zusammenhang bringt, der uns die Schönheit und die die Chancen des menschlichen Miteinanders mit neuen Augen sehen lässt und zahllose neue Lösungsansätze anbietet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
Was genau ist der Mensch eigentlich? Weshalb hat der Mensch Bedürfnisse? Was präzise sind seine Gefühle, seine Gedanken, sein Wollen, seine Bedürfnisse und wozu ist der Mensch auf das Zwischenmenschliche angewiesen? Welche Bedeutung haben Abhängigkeiten und Macht dabei? Gibt es kulturübergreifende, universelle Kräfte, die das Zwischenmenschliche ordnen und woher kommen sie?
Die akademische Psychologie und Soziologie versuchen, aus der Beschreibung des menschlichen Verhaltens heraus abzuleiten, wie all das funktioniert. Das hat uns einem besseren Verständnis des menschlichen Verhaltens durchaus nähergebracht. Sie versäumt es aber, sich auf einer präzisen Beschreibung dessen einzulassen, was die Gestalt „Mensch“ eigentlich ist, und drückt sich seit einem Jahrhundert davor, die tiefgreifende Implikationen der modernen Physik auf ein zeitgemäßes Welt- und Menschenbild in ihren akademischen Betrachtungen einzubeziehen.
Hier wird ein breiter Bogen gespannt, der aus einer zeitgemäßen Betrachtung des Menschen als eine aus Energie bestehende Gestalt heraus, seine Wahrnehmungen, sein Verhalten, seine Gefühle und Gedanken, sein Bestreben im Zwischenmenschlichen, die dabei entstehenden Dynamiken von Abhängigkeiten und Macht, sowie die unentrinnbaren universellen Kräfte, die das Zwischenmenschliche ordnen, in einem harmonischen Zusammenhang bringt, der uns die Schönheit und die die Chancen des menschlichen Miteinanders mit neuen Augen sehen lässt und zahllose neue Lösungsansätze anbietet.
Leo Lauwers, Dipl. Sozialarbeiter (FH), Supervisor, Sozialtherapeut, KI-Therapeut, wuchs in Flandern auf. Er studierte Soziale Arbeit, Wirtschaftswissenschaften und Pädagogik, arbeitete viele Jahre in verschiedenen Felder des Sozialwesens, lehrte an der Fachhochschule Fulda, leitete Fort- und Weiterbildungen am Synergie-Institut Odenwald und an zahlreichen anderen Instituten. Heute lebt er in einem kleinen Dorf im Odenwald.
Für alle meine Kinder.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Auf ein Wort
Erstes Buch: Ein zeitgemäßes Menschenbild
Kapitel 1: Der Mensch und den ganzen Rest
Vom Menschen als Energiegestalt und unlösbarer Bestandteil im durchgehenden Energiefeld des Universums und seiner Beziehung zur Unendlichkeit
Kapitel 2: Die Fensterscheiben meines Nachbarn
Von der zweckmäßigen Begrenztheit und Gerichtetheit aller beteiligten Kräfte als Bedingung zur Entstehung und Erhaltung einer Gestalt sowie von der uneingeschränkten Verantwortung des Menschen für sein Handeln und dessen Folgen
Kapitel 3: So ein Zufall aber auch …
Von der Zufallstheorie, von den Konsequenzen einer unserer Existenz zugrundeliegenden Absicht, von der Würde des Menschen und vom unentrinnbaren Bestreben aller Lebewesen, sich in voller Harmonie zu verwirklichen
Kapitel 4: Eine Gestalt in vierzehn Dimensionen
Vom Unterschied zwischen den Teilen oder Funktionen und den Dimensionen eines Menschen, von der universellen und der individuellen Seinsweise des Menschen und vom praktischen Nutzen auch mal anders hinzuschauen
Kapitel 5: Gefühle sind keine Fakten, Gewissen ist kein Luxus
Von unseren Gefühlen und unserem Gewissen als unentbehrlichen Wahrnehmungen dessen, was ist und was sein soll
Kapitel 6: Die Verwirklichung des Individuums auf teufelkommraus
Davon, was dabei herauskäme, wenn die ganze Gesellschaft sich in aller Konsequenz auf die vollständige harmonische Verwirklichung aller Individuen ausrichten würde und weshalb dies das Gegenteil von Egomanie wäre
Zweites Buch: Interferenzen
Kapitel 7: Der Stoff, aus dem soziale Systeme sind
Wie soziale Systeme als Energiegestalten aus dem Streben nach Verwirklichung hervorgehen und weshalb sie häufig nicht das tun, wozu es sie gibt
Kapitel 8: Wessen der Mensch bedarf
Von den Bedürfnissen als Ursache unserer Beziehungen, davon, weshalb wir so selten das Richtige tun, um sie zu befriedigen und wer am meisten Nutzen davon hat
Kapitel 9: Wenn ich auf deiner Mitwirkung angewiesen bin
Weshalb wir in vielerlei Hinsicht von anderen Menschen abhängig sind und inwiefern wir etwas daran ändern können, ohne uns selbst zu schaden
Kapitel 10: Wenn ich es machen könnte
Wozu es ‚Macht‘ überhaupt gibt, was sie einem so alles aufbürdet und wo es hinführt, wenn man sie missbraucht
Kapitel 11: Die vergessenen Naturgesetze
Wie man soziale Systeme am schnellsten kaputt kriegt, was das mit den Grundsätzen einer zwischenmenschlichen Ethik zu tun hat und weshalb es sich dabei um Naturgesetze handelt
Kapitel 12: Kleine Impulse – große Wirkung
Wie man im Zwischenmenschlichen vieles verändern kann und weshalb dazu häufig lediglich geringe Energien erforderlich sind
Kapitel 13: Der blaue Opal der Menschlichkeit
Welchen Unterschied es macht, ob wir uns nach den natürlichen Gesetzmäßigkeiten zwischenmenschlicher Wechselwirkung richten oder ob wir uns nicht darum scheren
Diagramm der Persönlichkeit in ihren Dimensionen
Nachwort
VORWORT
Nichts weniger als die Beschreibung und Erklärung des Zwischenmenschlichen an sich habe ich mir mit dieser Schrift vorgenommen. Nicht etwa aus Größenwahn oder Langeweile. Ich wüsste weiß der Kuckuck wohl Angenehmeres und Unterhaltsameres mit meiner freien Zeit anzufangen. Lediglich weil Dutzende Kolleginnen und Kollegen mich immer wieder bedrängt haben, habe ich mich dazu bereit erklärt, es zu tun. Ich habe euch gewarnt Leute, das habt ihr jetzt davon.
Die Grundzüge dieser Schrift wurden im Rahmen zahlreicher Seminare an der Fachhochschule Fulda sowie bei Fort- und Weiterbildungen für Fachkräfte des Sozialwesens entwickelt, die die unterschiedlichsten Aspekte der komplexen Beziehungen zwischen Menschen zum Thema hatten. Irgendwann begangen meine Seminarteilnehmer nachzufragen, ob es von dem, was ich dort unterrichtete, nicht auch ein umfassendes Skript gäbe. Natürlich gab es das nicht. Da war es wohl unausweichlich, dass gelegentlich vorsichtig angefragt wurde, ob ich nicht bereit sei, das Ganze einmal in einem Buch festzuhalten. Aber für so etwas hatte ich damals wirklich keine Zeit. Meine Tage waren mit einer Fülle von sozialpädagogischen Aufgaben, Seminare, Supervisionen, Einzel- und Paartherapien, sowie vielerlei persönlichen und familiären Erfordernissen mehr als reichlich ausgefüllt. Damals unterschätzte ich die Fähigkeit von Seminarteilnehmer, nachhaltig und immer drängender zu quengeln, doch sehr. Spätestens als ich mich aus der hauptberuflichen Tätigkeit zurückzog und meine beruflichen Aufgaben sich weitgehend auf gelegentliche Lehrtätigkeiten reduzierten, wurde mir jedoch klar, dass ich mich wohl nicht mehr viel länger würde drücken können. So habe ich mich eines Tages der Aufgabe gestellt und angefangen, all das, was über die vielen Jahre gemeinsam mit zahlreichen Seminarteilnehmern erarbeitet worden war, systematisch zu ordnen und niederzuschreiben. Hätte ich schon zu Anfang gewusst, was für eine mühselige und langwierige Arbeit das werden würde, hätte ich es wohl gelassen. Aber auf halber Strecke aufzugeben, ist nicht wirklich meine Art. Fünfundzwanzig Jahre sind darüber verstrichen. Nicht nur weil wiederholt ungeplante private und berufliche Anforderungen dazwischenkamen, die das Schicksal und der Lauf der Geschichte mit großzügiger Hand über uns Menschen zu verteilen beliebt. Auch weil mit fortschreitender Niederschrift immer wieder ganze Abschnitte präzisiert, korrigiert, angepasst und ergänzt werden mussten. Vor allem aber, weil ich sehr gezögert habe, diese Schrift so weit fertigzustellen, dass ich keinen plausiblen Grund mehr hätte, sie der Veröffentlichung vorzuenthalten. Und das beileibe nicht grundlos.
Es ist nicht etwa so, dass ich darauf hoffen kann, dass diese Schrift mit Begeisterung und Halleluja oder auch nur mit einem gewissen Wohlwollen aufgenommen werden wird. Vielmehr rechne ich zuverlässig damit, dass sie, sofern man überhaupt bereit sein wird, sie zur Kenntnis zu nehmen, in Fachkreisen der Sozialwissenschaften, der Pädagogik und des Sozialwesens vorwiegend auf Häme, Spott und Skepsis stoßen wird. Und dafür hätte ich sogar durchaus Verständnis. Denn die Sichtweise, aus der heraus das Zwischenmenschliche, die darin vorkommenden Kräfte und Gesetzmäßigkeiten, ja das Wesen des Menschen an sich und sein ganzes lebendiges Bestreben in der Welt in dieser Schrift analysiert und beschrieben werden, ist so grundverschieden von der Weise, wie sie bis heute im Mainstream der sozialwissenschaftlichen Theorie und Praxis gelehrt und angewandt wird, dass es schon eines ganz besonders offenen Geistes und einer besonderen Neugierde bedarf, um sich dem vorurteilsfrei zu stellen.
Wer in seinem Fachgebiet über Jahre aus einer bestimmten Weltsicht heraus gelernt, praktiziert und gelehrt hat, und sich damit in voller Übereinstimmung mit der übergroßen Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen in seinem Fachgebiet weiß, fällt es nicht leicht, sich für eine ungewohnte und alles andere als im Fachgebiet anerkannte Sichtweise zu öffnen. Zumal wenn diese neue Sichtweise auch hier und dort die gängige Theorie und Praxis gehörig hinterfragt. Bestenfalls wird solches mit scharf kritischem Blick und einer ordentlichen Portion Skepsis betrachtet. Nicht selten ruft es gar Gehässigkeit und Aggressionen hervor, weil man sich in seiner gewohnten Fachlichkeit angegriffen fühlt. In früheren Jahrhunderten riskierte man mit derart gewagten Thesen gehängt, gevierteilt oder verbrannt zu werden. Solch letale Folgen brauche ich heute nicht zu befürchten. Aber mit Stürmen der Begeisterung werde ich wohl kaum rechnen können.
Was ist denn im Vergleich zu dem, was im Bereich der Erkenntnisse des ‚Sozialen‘ und des ‚Zwischenmenschlichen‘ gängige Lehrmeinung und Praxis ist, in dieser Schrift so grundlegend anders? Nun, offen gesagt handelt es sich um einen kompletten Paradigmenwechsel, der sich gewaschen hat.
Bei aller Modernität und dem Hinterherhecheln sämtlicher aktuellen Hypes, die sich die jeweiligen Wortführer sozialer Wissenschaft und Praxis regelmäßig befleißigen, kommt man doch nicht umhin, festzustellen, dass das dieser Fachwelt eigene Welt- und Menschenbild einer gewissen Rückständigkeit eigen ist.
Na ja, eigentlich stimmt das so nicht ganz. Denn weiten Teilen dessen, was sich im Bereich des ‚Sozialen‘ umtut, scheint heutzutage bestens ohne jegliches explizite Welt- und Menschenbild auszukommen. Man muss nämlich schon sehr genau hinschauen, um in diesem Fachgebiet überhaupt konkrete Bezugnahmen auf irgendein Welt- und Menschenbild zu finden.
Ausnehmen muss man davon allerdings sämtliche soziale Institutionen der christlichen Kirchen. Sie legen ihre Tätigkeit immerhin die Annahme zugrunde, dass die Welt von Gott erschaffen wurde und jeder Mensch ein Kind Gottes sei. Allerdings ohne näher zu definieren, was ein Mensch ist. Wohlweislich, denn dabei kämen sie wohl rasch mit der eigenen Schöpfungstheologie in Konflikt. Und vor allem auch ohne darauf Bezug zu nehmen, dass Kinder es nun mal so an sich haben, erwachsen werden zu wollen und dann wohl auch Anspruch darauf hätten, Töchter und Söhne Gottes genannt zu werden. Was wiederum zu weiteren unerwünschten theologischen Peinlichkeiten führen würde. Von diesem recht dürftigen theologischen Hintergrund abgesehen, findet man auch dort keine solide Beschreibung dessen, was die Welt und was der Mensch eigentlich ist.
Wie aber wollen wir das beschreiben, was zwischen Menschen passiert, das ‚Zwischenmenschliche‘, wenn wir, von seiner einigermaßen gut bekannten Physiologie abgesehen, keine oder allenfalls eine außerordentlich nebulöse Vorstellung davon haben, was der Mensch eigentlich ist? Wie wollen wir die Regeln erkennen, wonach dieses nebulöse Wesen mit anderen, ebenso nebulösen Wesen in Wechselwirkung tritt?
Oder hat das, was wir an Erfahrungswissen über das Tun und Lassen von Menschen untereinander gesammelt haben, nichts damit zu tun, was Menschen eigentlich sind? Das wäre so, als würden wir annehmen, dass das Steuern eines Pkws und dessen Verhalten im Verkehr, damit, was ein Pkw eigentlich ist, nicht wirklich etwas zu tun hätte.
Oder müssen wir etwa davon ausgehen, dass das Zwischenmenschliche eigentlich keinerlei festen Regeln und Gesetzmäßigkeiten unterliegt, sondern eher ein zufälliges Zustandekommen von Ergebnissen chaotischer Ereignisse wäre? Dass man aus dem Beobachten von Menschen zwar gewisse Wahrscheinlichkeiten ableiten könne, aber diese soziokulturell so unterschiedlich sind, dass man dabei keine wirklich global verlässlichen Gesetzmäßigkeiten ausmachen könne?
Ich für meinen Teil gehe doch lieber von der gewiss altmodischen Annahme aus, dass es für das Verstehen und Wirken im Zwischenmenschlichen – und es ist doch wohl das, wozu die gesamte Sozialwissenschaft eigentlich gut wäre – von fundamentaler Bedeutung ist, erst einmal zu verstehen, was die Welt ist und was der Mensch ist.
Auch gehe ich immer noch davon aus, dass, wenn es im Feld des Zwischenmenschlichen überhaupt so etwas wie verlässliche universelle Gesetzmäßigkeiten und Regeln gäbe, die die gesamte Menschheit gleichermaßen betreffen, es schon arg wichtig wäre, diese zu kennen, bevor man Statistiker oder gar Pädagogen und Sozialarbeiter darin herumfuhrwerken lässt. Sicher, auch beim Herumstochern im Nebel kann man manch einen Treffer landen, aber der ist dann weder erklärlich noch mit einem Mindestmaß an Sicherheit reproduzierbar. Auch psychologisches, pädagogisches oder sozialarbeiterisches Erfahrungswissen ist von beschränktem Nutzen, wenn man es nicht verlässlich auf andere übertragen kann, weil es dabei allzu sehr auf die Persönlichkeit desjenigen ankommt, der die Erfahrung selbstgemacht hat.
Zudem will ich mich beim Verständnis dessen, was die Welt und was der Mensch ist, nur ungern auf Konzepte beziehen, die aus der Zeit Newtons stammen, wenn ich weiß, dass zu Anfang des 20. Jahrhunderts grundlegend neue Erkenntnisse über das Wesen der Welt mit aller Drum und Dran gewonnen wurden.
Überall dort jedoch, wo im Feld sozialer Forschung, Lehre und Praxis kein explizites Welt- und Menschenbild auszumachen ist, findet man beim näheren Hinsehen meist heraus, dass die Basis des dortigen Denkens und Handelns nichts anderes ist als das längst überwunden geglaubte Weltbild der Rationalisten des 17. bis 19. Jahrhunderts.
Tut mir leid Leute, aber so geht das nicht. Man kann sich nicht in Forschung, Lehre und praktischer Anwendung der Physik, Biologie und Medizin, in allen hochmodernen Wissenschaftsbereichen, in der gesamten Technologie, bis hin zu den aktuellen Entwicklungen der industriellen Fertigung, auf die Grundlagen der wissenschaftlichen Errungenschaften des frühen 20. Jahrhunderts beziehen, aber sich in Forschung, Lehre und Praxis vom gesamten Bereich dessen, was für die Menschen im Alltag am allerwichtigsten ist, ihr Miteinander, weiterhin an ein Weltbild klammern, dass schon seit mehr als einem Jahrhundert überholt ist.
Kann man doch? Der Mensch und sein Miteinander sei doch ganz etwas anderes und hätte weder mit irgendwelchen Relativitäts- noch mit gleichsam geheimnisvollen Quantentheoremen irgendetwas zu schaffen? Sorry Leute, der Mensch besteht nicht aus Märchen, Sagen und Legenden, sondern immer noch aus Materie! Also unterliegt er in allem, aber dann auch wirklich restlos allem, was er erfährt und tut, den Gesetzmäßigkeiten der Materie. Und da kann man, so leid es mir tut, die Quantentheoreme nicht von ausnehmen. Man kann sich nicht einerseits von den neuesten Erkenntnissen über die wundersame Wirkung der neuronalen Netzwerke im menschlichen Gehirn tief beeindrucken lassen, aber sich andererseits von deren wissenschaftlichen Grundlagen distanzieren, wenn es darum geht, das menschliche Miteinander zu untersuchen und beeinflussen zu wollen. Es sei denn, man will unbedingt für einen verbohrten Realitätsverweigerer gehalten werden.
Um es jetzt mal unmissverständlich zu sagen: Es ist allerhöchste Eisenbahn, dass sich die gesamte Sozialwissenschaft, einschließlich der Gesamtheit aller ihrer angewandten Handlungsentwürfe, die grundlegenden Änderungen der Erkenntnisse über die Welt zu eigen macht, um die allzu offensichtliche darin zutage tretenden Implikationen für diesen Fachbereich aufzudecken und in eine moderne Sozialwissenschaft zu integrieren.
Ein umfassender Paradigmenwechsel tut dringend not.
Nichts weniger als das ist es, was in dieser Schrift versucht wird, näher zu kommen. Es ist der Versuch einer Beschreibung dessen, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse des letzten Jahrhunderts für die Sozialwissenschaft und all ihrer angewandten Gebiete bedeuten.
Dabei gehen wir mit sehr kleinen Schritten vor, damit wir nicht ins Straucheln kommen oder an das ein oder andere unserer wohlgehüteten Vorurteile klebenbleiben. Und damit das Ganze möglichst für jeden nachvollziehbar ist, der diese Schrift mit einem Mindestmaß an Neugierde und Wohlwollen durchzuackern gewillt ist.
Wir fangen bei dem an, was die Welt als solche ist - bei der Materie, die, wie wir heute wissen, aus Energie besteht. Von dort wandern wir über die Bildung von einfachen zu komplexen Energiegestalten und finden heraus, wieso es dazu kommt, dass es sie überhaupt gibt. Irgendwann machen wir den Schritt zu der Energiegestalt Mensch und der erstaunlichen Vielfalt ihrer Dimensionen, die uns Aufschluss darüber geben, wie ein Mensch in dieser komplexen Welt überhaupt zurechtkommen kann, und was für eine unglaublich schöne und wundersame Komposition so ein Mensch eigentlich ist. Das bringt uns unweigerlich dazu, zu erkennen, wie es zur Bildung von vielfältigen kleinen bis hin zu riesengroßen sozialen Systemen kommt und wie sie funktionieren. Wobei wir selbstverständlich nicht an den wichtigsten Phänomenen menschlichen Miteinanders vorbeikönnen - die menschlichen Bedürfnisse und die facettenreichen Erscheinungsformen von Abhängigkeiten und Macht. Um letztendlich bei den Kräften, Dynamiken und Gesetzmäßigkeiten zu landen, die innerhalb des Zwischenmenschlichen gelten. Und dort festzustellen, dass es sich dabei mitnichten lediglich um Konventionen und Traditionen, sondern um nicht weniger als wahrhaftige Naturgesetze handelt, die global in allen sozialen Systemen dieser Welt gleichermaßen gelten, egal ob groß oder klein, privat oder öffentlich, und die die unausweichliche und universelle Gültigkeit eines Naturgesetzes haben. Eine Gültigkeit der wir zu respektieren allen Grund haben, wollen wir nicht selbst dafür verantwortlich sein, dass die Menschlichkeit und die gesamte Menschheit gleich mit bis in ihren Wurzeln zerstört wird.
Das Staunen über die grandiose Schönheit der Menschheit und ihr oberstes Potential, die nur der Menschheit eigenen Fähigkeit zur Menschlichkeit, bekommen wir so ganz nebenbei mitgeliefert.
Legen wir los.
AUF EIN WORT
Zwei Dinge sollten noch geklärt werden, bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen.
Erstens: Die in dieser Schrift aufgestellten Thesen scheinen an einigen Stellen im flagranten Widerspruch zu dem zu stehen, was im Feld der Sozialwissenschaften, der Psychologie, der Psychiatrie, der Pädagogik, der Seelsorge anerkannte Lehrmeinung ist. Ich selbst bin jedoch der Ansicht, dass dies nur an ganz wenigen Stelle tatsächlich der Fall ist.
Das, was in dieser Schrift beschrieben wird, ist nicht gemeint im Sinne von „So ist es, basta“, sondern vielmehr im Sinne von „Schau mal, wenn man in dieser Weise hinschaut, entdeckt man ganz neue Sachen und findet man völlig neue Lösungswege“. Will sagen: Hier wird eine völlig andere Weise hinzuschauen gezeigt, als die gewohnte Art hinzusehen.
Eine der Erkenntnisse, die die Quantenphysik uns gelehrt hat, ist, dass die Dinge anders sind, je nachdem, ob überhaupt bzw. wie man hinschaut. Die Dinge sehen nicht nur anders aus, je nachdem, ob bzw. wie man hinschaut, sie sind auch tatsächlich anders. In beiden Fällen nimmt man die Dinge nicht nur anders wahr, sie haben auch andere Eigenschaften. Und haben sie andere Eigenschaften, so unterliegen sie auch den Gesetzmäßigkeiten des Andersseins. M.a.W. die anderen Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten kann man nur dann erkennen, wenn man anders hinsieht. Wenn man immer nur in der gleichen Weise hinsieht, kann man sie nicht erkennen. Es bedarf tatsächlich die andere Sichtweise, um erkennen zu können, dass die Dinge auch andere Eigenschaften haben und auch den Gesetzmäßigkeiten der anderen Eigenschaften unterliegen.
Das bedeutet aber nicht, dass das, was man in der gewohnten Art hinzusehen an Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten erkannt hat, nun nicht mehr gilt. Es bedeutet lediglich, dass es nur unter der bisherigen Weise hinzusehen gelten könnte, unter der anderen Weise hinzusehen jedoch nicht oder zumindest zum Teil nicht. Und es bedeutet, dass man mit der neuen Weise hinzusehen Eigenschaften und deren Gesetzmäßigkeiten erkennen kann, die man zuvor nicht hat erkennen können.
Das kann allerdings auch bedeuten, dass man unter der neuen Sichtweise erkennen kann, dass es für manche Fragen und Probleme völlig neue und weit zweckmäßigere Antworten und Lösungen als die altbekannten gibt. Und in einigen Fällen kann es tatsächlich auch bedeuten, dass die bisherigen Antworten und Lösungswege in dem Sinne ‚nicht mehr richtig‘ sind, als man nun erkennen kann, dass manch alte Sichtweise zu Lösungswegen führt, die an bestimmten Stellen mehr Schaden anrichtet, als sie nutzt.
In manchen Bereichen kann man durch die neue Art hinzusehen erkennen, dass die bisher gewohnte Sichtweise für das sich stellende Problem wenig effizient ist, und man mit der neuen Sichtweise zu weit effizienteren Lösungswegen gelangen kann. Auf manche Fragen konnte man mit der bisherigen Sichtweise keine oder keine ausreichend hilfreiche und schon mal gar keine nachhaltigen Antworten bekommen. Ja, auf manche Fragen konnte man unter der alten Sichtweise gar nicht erst kommen, weil sie sich als Fragestellung lediglich unter der neuen Sichtweise zu erkennen geben.
So gilt: Überall dort, wo die bisherige Sichtweise umfassend zufriedenstellende Antworten liefert und zu ebenso zufriedenstellende wie effiziente Lösungswege führt, besteht kein Anlass, sie in Frage zu stellen oder gar zu verwerfen. Aber überall dort, wo eine neue Sichtweise Fragen erkennen lässt, die man zuvor nicht hat sehen können, oder sie weit effizienteren Antworten und Lösungswege aufzeigt, als man bisher zur Verfügung hatte, ist es sinnvoll, die neuen Sichtweisen anzuwenden. Denn, wozu soll man Fragestellungen, Antworten und Lösungsstrategien beibehalten, wenn man weiß, dass bei der Nutzung einer anderen Sichtweise weit hilfreichere und effizientere Fragestellungen, Antworten und Lösungsstrategien verfügbar sind.
In der ‚klassischen‘ Sozialwissenschaften, wie sie bisher betrieben wird, hat man vorwiegend vier Sichtweisen angewandt, um Lösungen für Fragen des Zwischenmenschlichen näher zu kommen. Die eine Sichtweise ist die der Psychologie, wie sie heute in entsprechenden Fachkreisen vorwiegend genutzt wird. Die Sichtweisen der Tiefenpsychologie, der Verhaltenspsychologie, der Entwicklungspsychologie und eher selten auch der sgn. ‚transzendentalen‘ Psychologie schienen bisher ausreichende Antworten im Bereich des ‚wie, warum, wohin, weshalb‘ zu bieten. Eine zweite Sichtweise ist die Herangehensweise der Psychiatrie, bzw. der Schulmedizin, die vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn es darum geht, Störungen im Sozialverhalten zu bestimmen, zu kategorisieren und abzustellen. Die dritte Sichtweise ist die der Mathematik, bzw. der Statistik, die immer dann angewandt wird, wenn man die Größenordnungen und Verbreitung von sozialen Phänomenen beschreiben will. Und die vierte Sichtweise ist die der Ökonomie, wenn man an Fragen heranzugehen versucht, die soziale Mängel beschreiben sollen und wo das Geld herkommen soll, das zur Behebung der sichtbaren Probleme benötigt wird. Für viele Fragen haben diese Herangehensweisen, mit den ihnen jeweils eigenen Ordnung, zu durchaus hilfreiche Antworten und praktizierbare Lösungswege geführt. Aber es gab auch immer viele Widersprüche, die anhand dieser vier Disziplinen nur schwer oder gar nicht gelöst werden können.
Die Sozialwissenschaft hat allerdings bis heute keine ihrer eigenen Wesenheit entsprechende Herangehensweise, keine ihrer eigenen Art entsprechende Sichtweise gefunden. Sie hat sich darauf beschränkt, die Sichtweisen und Methoden anderer wissenschaftliche Disziplinen anzuwenden, um Lösungen für ihre Fragen zu suchen. Weil ihr unter den bisherigen Betrachtungsweisen keine ihrer eigenen Wesensart wirklich voll und ganz entsprechenden Sichtweisen und Methoden zur Verfügung standen. Man ist offenbar nicht darauf gekommen, dass es eine solche schon längst gibt.
Was vielleicht auch etwas damit zu tun hat, dass der Einfluss der anderen wissenschaftlichen Disziplinen, vor allem der Psychologie, der Medizin und der Ökonomie, in der akademischen Sozialwissenschaft so umfassend und stark ist, dass es einem schwer möglich erscheinen konnte, gegen die erdrückende Herrschaft jener anderen Disziplinen anzukommen. Wer könnte es denn wagen, unter den in den Sozialwissenschaften vorherrschenden akademischen Einflüssen der Psychologie, der Medizin und der Ökonomie aufzubegehren und völlig neue Wege zu beschreiten, die die Vorherrschaft der von Psychologie, Medizin und Ökonomie vielleicht tangieren könnten? Wer die Gepflogenheiten der akademischen Welt kennengelernt hat, weiß genau, dass solches den raschen Karrieretod bedeuten würde. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die einflussreichsten Kräfte im Bereich der angewandten Sozialwissenschaft, nämlich die allmächtigen Wohlfahrtsverbände, die quasi ein Monopol auf die Trägerschaft nahezu sämtlicher sozialen Institutionen haben, ebenfalls weitestgehend von den Disziplinen der Psychologie, Medizin und Ökonomie und derer gesellschaftlichen Kräfte dominiert werden. Und dort geht es, wie wir wissen, nicht lediglich um die Ehre akademischer Karrieren, sondern um die Verfügungsgewalt über die sehr vielen Milliarden harten Euros aus den staatlichen Schatullen.
Vielleicht ist das eine der Gründe, weshalb hier eher jemand einen Anstoß geben kann, der unabhängig genug ist, um weder die Mächte des akademischen Gewerbes noch die der Wohlfahrtsverbände fürchten zu müssen.
Aber woher könnten denn eine Sichtweise und eine eigene Disziplin kommen, die der ureigenen Wesenheit des Sozialen entspricht? Die Antwort ist im Grunde denkbar einfach. Das ‚Soziale‘ ist immer und ausnahmslos eine Wechselwirkung zwischen Menschen. Oder, um es etwas genauer zu sagen, eine Wechselwirkung zwischen dem Bestreben von Menschen. Und ein Streben ist ausnahmslos immer Energie. Also kann es sich bei einer Disziplin und eine ureigene Sichtweise im Feld des Sozialen grundsätzlich nur um eine energetische Sichtweise handeln. Eine Disziplin, die die Wirkungsweisen und Gesetzmäßigkeiten der Energiefelder und Energieflüsse zwischen den Menschen beschreibt. Also muss eine Disziplin, die der ureigenen Wesenheit des Sozialen entspricht, dort ansetzen, wo die Welt als Energiegestalt beschrieben wird. Nun ja, und eine Sichtweise, die dem entspricht, gibt es tatsächlich seit gut einem Jahrhundert.
Das ist es, was in dieser Schrift versucht wird: Die nunmehr einem Jahrhundert alte Erkenntnisse über die Welt als hochkomplexe Energiegestalt zu nutzen als Ausgangspunkt zur Beschreibung und Erklärung dessen, was zwischen Menschen passiert: das Zwischenmenschliche.
Und genau so wenig wie einst die Erkenntnisse der Quantenphysik die bis dahin vorhandene Erkenntnisse der Physik entkräftet und als obsolet verworfen, sondern diese lediglich ergänzt hat, so kann die hier vorliegende Schrift die schon vorhandenen Erkenntnisse des Sozialen weder entkräften noch verwerfen, sondern lediglich ergänzen und allenfalls hier und dort etwas korrigieren.
Zweitens: Diese Schrift erhebt nicht den Anspruch, eine wissenschaftliche Abhandlung zu sein. Die vorliegende Arbeit in einer Form zu bringen, die den vielfältigen Anforderungen einer korrekten wissenschaftlichen Abhandlung genügen würde, hätte den Rahmen dessen, was ich zu leisten vermag in jeder Hinsicht bei weitem gesprengt. Es hätte bedeutet, für sämtliche Elemente, die hier zusammengefügt wurden, gewissenhaft den detaillierten wissenschaftlich tragfähigen Nachweis zu erbringen. Das hätte einen zeitlichen, sachlichen und kräftemäßigen Aufwand bedürft, der meine realen Möglichkeiten im Rahmen meiner realen Lebensbedingungen bei weitem überstiegen hätte.
Es ist zwar nicht etwa so, dass ich die Grundlagen dessen, was in dieser Schrift angeführt und entwickelt wird, mir allesamt aus den Fingern gesogen hätte. Das Allermeiste, was hier als Grundlagen angeführt wird, geht auf sehr viele Veröffentlichungen bedeutender Autoren und anerkannten Wissenschaftler zurück. Dass ich diese Quellen nur an einigen wenigen Stellen angeführt habe, hat als einziger Grund, dass der Zeit- und Arbeitsaufwand, den es bedürft hätte, um alle Quellen, alle Autoren, alle Veröffentlichungen präzise zu benennen, so gewaltig wäre, dass dies in meinen Augen keinen vergleichbaren Zugewinn für die Aussagefähigkeit dieser Schrift mit sich gebracht hätte. Von der Begrenztheit meiner eigenen Kräfte mal völlig abgesehen. Mir stand kein Lehrstuhl zur Verfügung, der es mir gestattet hätte, ein halbes Dutzend Assistenten und einigen Generationen von Doktoranden mit der Erforschung und wissenschaftlichen Dokumentation sämtlicher genutzten Quellen zu beauftragen.
Die Möglichkeiten, über das Internet und anderen Wegen nachzuforschen, was einem in dieser Schrift unsicher erscheint, sind heute so immens, dass ich es gerne der Leserschaft überlasse, die ihr zur Verfügung stehenden Quellen eigenständig zu nutzen, um alles nachzuforschen, was einem der Mühe wert erscheint. Wer zweifelt, soll eben selbst nachschauen, ob er anderswo etwas findet, dass hier getroffenen Aussagen belegt oder widerspricht. Mein Anspruch ist es nicht, all dies auf Punkt und Komma zu belegen und zu beweisen. Mein Anspruch ist lediglich, dazu zu animieren, die Blickrichtung zu wechseln.
Den einzigen Anspruch, den ich mit dieser Schrift verbinde, ist einen nicht allzu sanften Anstoß in einer neuen Denkrichtung zu geben. Ein Anstoß, der – so hoffe ich – hier und dort wissenschaftlich arbeitende Personen dazu bringt, wissenschaftliche Forschungen und Studien zu initiieren, disziplininterne und interdisziplinäre Dispute auszulösen, die dazu geeignet sind, das Theoriegebäude und die Methodiken der Sozialwissenschaft mit den gedanklichen Ansätzen dieser Schrift zu befruchten und zu einer eigenen, besseren, effizienteren, wirkungsvolleren und stärkeren sozialwissenschaftlichen Disziplin zu führen. Ein Anstoß, der – so hoffe ich – viele im Sozialwesen tätigen Fachkräfte dazu bewegen könnte, neue Strukturen und effizientere Methoden auszuprobieren, die dazu geeignet sind, erfolgreicher das zu tun, wozu sie da sind: Das soziale Leiden von Menschen konkret spürbar zu verringern, wo möglich zu beenden und in möglichst vielen Bereichen zu verhindern. Ein Anstoß, der – so hoffe ich – Menschen auf alle Ebenen der Gesellschaft dazu bringt, sich in ihrem Alltag wieder mehr danach zu richten, was die unzerstörbaren universellen Werte und Regeln des menschlichen Miteinanders sind.
ERSTES BUCH:
EIN ZEITGEMÄSSES MENSCHENBILD
KAPITEL 1: DER MENSCH UND DEN GANZEN REST
Wenn ich verstehen möchte, was sich zwischen zwei aufeinander zu bewegenden Pkws ereignet und wie sie sich gegenseitig beeinflussen, ist es eine unabdingbare Voraussetzung, zunächst einmal zu wissen; was ein Pkw überhaupt ist.
Wenn wir auch nur den Hauch einer Chance haben wollen, zu begreifen, was sich zwischen Menschen abspielt, das sogenannte Zwischenmenschliche, bleibt uns kaum anderes übrig, als uns der lästigen Mühe zu unterziehen, zunächst einmal zu überlegen, was ein ‚Mensch‘ überhaupt ist. Ohne genauere Vorstellung davon werden wir wohl kaum Verlässliches über das Zwischenmenschliche herausfinden können. Wie könnten wir denn herausfinden, wie die Beziehung zwischen zwei Objekte funktioniert, wenn wir nicht einmal wissen, was die beiden Objekte überhaupt sind, und wieso sie überhaupt irgendetwas miteinander zu schaffen haben.
Was also ist ein Mensch?
„Ach du grüne Neune“, wird der ein oder andere Leser stöhnen, „ein Mensch ist eben ein Mensch, fertig! Was gibt es da zu überlegen?“ und feuert diese Schrift unter irgendein verstaubtes Buchregal, um sich der Sportseite seines Lieblingsmagazins zuzuwenden. Mir soll’s recht sein. Auch die Leibesertüchtigung verdient die größte Aufmerksamkeit.
Die interessiertere Leserschar hat inzwischen scharf nachgedacht und überrascht mich mitten im abschweifenden Gedankengang mit der Feststellung, der Mensch sei ‚ein vernunftbegabtes Wesen‘.
Könnten wir uns rasch darauf einigen, was erstens ein ‚Wesen‘ ist und was zweitens unter der Kombination zweier so schwieriger Wörter wie ‚Vernunft‘ und ‚begabt‘ zu verstehen wäre, so könnte die Aufgabe als gelöst angesehen werden. Leider würde es mindestens zehnmal so viel Zeit in Anspruch nehmen, uns auf der Bedeutung solch scheinbar harmloser Begriffe zu einigen, als wir dazu benötigen würden, die Vorzüge von Muskatnuss bei der Herstellung meines vorzüglichen Kartoffelgratins zu ergründen. Weshalb ich zum Beschreiten eines, wenngleich nicht sehr bequemen und auch nicht sonderlich schnellen, so doch recht zielsicheren Weges, auf der Suche danach, was denn ein ‚Mensch‘ ist, einladen möchte.
Damit wir uns nicht gleich wieder an schwerverdaulichen Begriffen verschlucken, bemühe ich mich dabei um möglichst kleine Schritte. Auf die Gefahr hin, hier und dort längst vertraute Erkenntnisse aufzuwärmen. Da dieses Buch ohnehin nicht zum Zweck hat, so fürchterlich viele neue Erkenntnisse zu verbreiten, sondern eher an ein wenig in die Vergessenheit abgleitendes Wissen zu erinnern, stört mich diese Gefahr nicht sonderlich.
Zunächst stellen wir lediglich fest: Der Mensch ist ein Ding, das fortwährend damit beschäftigt ist, seine eigene Existenz zu erhalten. Das tut es, in dem es ununterbrochen mit seiner Umgebung in Austausch ist. Es nimmt Verschiedenes aus seiner Umgebung in sich auf und gibt seinerseits Verschiedenes an seine Umgebung ab. Die chilenischen Autoren Maturana und Varela nannten das ‚Autopoiese‘. Das kann man in ihrem außerordentlich interessanten Buch „Der Baum der Erkenntnis“ (Scherz-Verlag München, 1990) nachlesen. Überhaupt kann man dort sehr wissenswerte Dinge über den Menschen und seine Beziehungen mit seiner Umwelt nachlesen. Nicht dass die verehrte Leserschaft meint, ich hätte mir den ganzen Kram allesamt selbst aus den Fingern gesogen.
Nun, ich finde ‚Autopoiese‘ ein wirklich hübsches Wort. Es klingt schön und besagt ungeheuer vieles. Was kann man von einem Wort mehr verlangen. Es hat allerdings den klitzekleinen Nachteil, dass es kaum ein gewöhnlicher Sterblicher kennt. Ausgefuchste Systemiker sind erstens keine gewöhnliche Sterbliche, sondern irgend so was Ähnliches wie Außerirdischen, wie man an ihrer Sprache leicht feststellen kann, und zweitens lesen sie mein Buch sowieso nicht, alldieweil sie das nicht nötig haben. Das sei nur so nebenbei bemerkt. Lassen wir also ‚Autopoiese‘ schön und bedeutungsschwer sein. Auf der Gefahr hin, für einen altmodischen Einfaltspinsel gehalten zu werden, schreibe ich lieber einfach nur: ‚ein Ding, das sich selbst durch Austausch mit der Umwelt am Leben hält‘.
Es sei hier allerdings beiläufig darauf hingewiesen, dass ‚sich selbst mittels Austausches mit der Umwelt am Leben halten‘ an sich bereits eine außerordentlich komplizierte Angelegenheit ist. Magna zum Beispiel, dieses fürchterlich heiße Zeug, das schlecht erzogene Vulkane gelegentlich ausspucken, so ungeheuer interessant und vielschichtig es auch sein mag, ist sehr viel weniger komplex als die simpelste Autopoiese betreibenden Mikroorganismen. Höhere Lebewesen, wie zum Beispiel Kakteen, Mäuse und eben Menschen, sind noch um viele Potenzen komplexer.
Nun also wissen wir, dass der Mensch ein hochkomplexes sich selbst am Leben erhaltendes Ding ist. Leider sind wir damit erst einen kleinen Schritt weitergekommen. Machen wir also noch einen.
Was ist ein ‚Ding‘?
"Himmel-herrgott-noch-einmal kann der Typ blöde Fragen stellen!“ höre ich manch ein schon jetzt genervter Leser stöhnen. Recht haben sie, die genervte Leser, im Stellen von blöden Fragen bin ich spitze. Wenngleich das auch so ziemlich das Einzige ist, in dem ich spitze bin. Das aber kann ich wirklich gut.
Nennen wir das ‚Ding‘ zunächst einmal ein klein wenig anders. Nennen wir es einstweilen ‚Materie‘. Nicht dass das einen so großen Unterschied ausmacht, wenn es darum geht, ob wir wissen, was das eigentlich ist. Aber beim Begriff ‚Materie‘ finden wir die nun folgenden weiteren Schritte vielleicht nicht ganz so abwegig.
Der Mensch ist ein Lebewesen, ist Materie. Was also ist Materie?
Nun müsste die Leserschaft eigentlich von Amtswegen anfangen, in ihren grauen Zellen herumzukramen, ob da nicht doch noch ein paar Körnchen Bleibendes aus dem einstigen Physikunterricht aufzuspüren wären. Machen wir die nächsten Schritte deshalb etwas flotter: Materie, das sind doch die Moleküle. Und die bestehen doch aus Atomen, war es nicht so? Die wiederum, wenn wir uns recht entsinnen, bestehen ihrerseits aus subatomaren Teilchen: Protonen, Neutronen, Leptonen, und lauter so Kram. Die Reihenfolge tut hier zunächst wenig zur Sache.
Immer kleiner werden die Dinger. So klein, dass es einem richtiggehend schwindelig von wird. Ganz am Ende der Kette stehen die Quarks. Die Quarks sind so ziemlich die kleinsten Teilchen, die die heutige Physik aufzubieten hat. Dafür haben die Quarks es aber faustdick hinter den Ohren, wie wir gleich sehen werden. Aber machen wir hier erst einmal kurz Halt.
Der Mensch ist ein Lebewesen, ist Materie, ist Molekülen, ist Atomen, ist subatomaren Teilchen, ist Quarks. Zwar all das in ihrer jeweils höchst denkbaren Komplexität, aber genau genommen auch nichts anderes als eben Quarks.
Mir scheint, das bisher Erreichte kann einem schon nachdenklich stimmen. Der Mensch besteht, wie alle anderen Lebewesen und alle andere Materie auch, aus Quarks. Eine ungeheuer große Menge Quarks, die sich in einer ungeheuer großen Komplexität organisiert haben. Was offenbar zu ebenso ungeheuer komplexen Eigenschaften und Fähigkeiten führt. Aber eben doch nur Quarks.
Nur Quarks? Ja, ‚nur‘ Quarks. Denn beim gegenwärtigen Stand unserer Untersuchung haben wir keinerlei Anlass, davon auszugehen, dass den Quarks noch irgendetwas anderes, außer eben ihrer außerordentlich hohen Komplexität, hinzugefügt worden wäre. Nur Quarks also.
Ist das nicht höchst erstaunlich? Da organisieren sich die allerwinzigsten subatomaren Teilchen in einer Weise, dass da nicht nur so ein paar wild herumschwirrenden Atömchen oder gar Molekülchen bei herausspringen. Nein, zu richtig ganz tollen Sachen organisieren die sich. Und davon gar nicht einmal so wenig stellen wir fest, wenn wir uns mal eben einen Moment lang im uns vorläufig bekannten Kosmos umschauen. Ganze Galaxienhaufen sind unterwegs. Und dann auf unserem Globus erst. Schon einmal in Ruhe einer dieser Weltraumaufnahmen unserer Erde angeschaut? Atemberaubend schön ist dieser blaue Opal der Menschlichkeit! Und was für großartige Sachen es hier auf der Erde gibt. Kristallen und Wolken und Kuhfladen und Brombeeren und gratinierter Kartoffelbrei und eben … Menschen. Unglaublich, dass das alles nur Quarks sind. Clevere Kerlchen scheinen das zu sein, diese Quarks.
In der Tat, sehr clever! Aber das Schönste kommt noch. Oder das Ungeheuerlichste, wie man's nimmt.
Die Quarks nämlich .....
„Momentchen, Momentchen,“ höre ich manch eine Leserin oder Leser einwenden, „wir waren doch beim Menschen, oder? Aber bis jetzt haben wir nur berücksichtigt, dass der Mensch ein Lebewesen ist. Aber wir Menschen unterscheiden uns doch von anderen Lebewesen, oder? Wir haben doch Verstand und Gefühlen und so. Wo kommt das denn her? Sind das auch Quarks? Ich meine nur, das muss man doch klären, oder?“
Dem kann ich nur zustimmen. Das muss man klären. Also, ein paar Schritte zurück zu den Lebewesen.
Auf die Frage, was Verstand und Gefühle eigentlich sind, werden wir in einem späteren Kapitel sehr ausführlich eingehen. Diesbezüglich bitte ich deshalb um Geduld. Wenden wir uns einstweilen lediglich der Frage zu, ob bzw. inwiefern wir uns hinsichtlich Verstandes und Gefühlen von anderen Lebewesen unterscheiden.
Außer den Menschen gibt es eine ganze Menge andere Lebewesen, von denen wir ziemlich genau wissen, dass sie auch Gefühlen haben. Nicht nur weil die Gehirnforschung bei vielen Tieren längst nachgewiesen hat, dass die in ihrem Gehirn ablaufenden Prozesse völlig analog zu jenen sind, die während der unterschiedlichsten emotionalen Zustände im menschlichen Gehirn ablaufen. Von vielen Säugetieren wissen wir das auch aus dem Alltag recht gut. Wer einen Hund oder eine Ziege oder ein Pferd hat, kann das aus eigener Beobachtung bestätigen. Die Freude eines Hundes bei unserer Heimkehr ist umwerfend. Mitunter gar buchstäblich. Die Angst oder die Wut eines Pferdes könnte einem, wenn man nicht höllisch aufpasst, durchaus das Leben kosten. Von vielen Tierarten, wie beispielsweise Schnecken wissen wir nicht sicher, ob sie Gefühle haben, aber es gibt auch keinerlei konkreter Nachweis davon, dass sie keine Gefühle haben. Das müssen wir also offenlassen. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass Gefühlen, so wie wir sie kennen, mit einem bestimmten Organisationsgrad des Gehirns und des Nervensystems zusammenhängen. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass Lebewesen mit einem sehr viel einfacheren Gehirn, wie beispielsweise Muscheln, oder gar ohne Gehirn, wie alle Pflanzen, einen unseren Gefühlen analogen Zustand kennen. Biologen haben u. a. herausgefunden, dass Pflanzen durchaus so etwas wie Erregung und Freude kennen. Obwohl Pflanzen, sofern wir das erkennen können, weder über ein Nervensystem noch über ein Gehirn verfügen.
Beim Verstand ist es ähnlich. Die Tatsache, dass andere Lebewesen keine solche Vernunft zeigen, wie wir sie beim Menschen kennen, ist längst kein Beweis mehr dafür, dass es dort keine Vernunft gibt. Wir kennen sehr wohl „kluge“ Tiere. Das sagt uns nicht nur die Alltagserfahrung, die ein Mensch im Umgang mit manch einem Haustier machen kann. Da sind wir uns mitunter ganz sicher, dass dieser Hund sich gerade etwas ganz Schlaues ‚ausgeheckt‘ hat, dass jenes Pferd ein ganz ‚hinterhältiger‘ Gaul ist, und so weiter. Die Erforschung von Menschenaffen hat ergeben, dass z. B. Schimpansen durchaus imstande sind, einfache abstrakte Denkprozesse zu leisten, ja gar dazu imstande sind, eine Zeichensprache zu erlernen, mittels der sie eigene kreative Überlegungen ausdrücken können. Die moderne Forschung hat ergeben, dass nicht nur Primaten, sondern auch viele andere Säugetiere, Vögel und Fische dazu in der Lage sind, eigenständig Lösungen für schwierige Aufgaben zu erarbeiten, ohne dass sie diese von Geburt an kannten oder von Artgenossen übernehmen konnten.
Wir müssen es heute als durchaus möglich ansehen, dass die Vernunft, auf der wir Menschen so stolz sind, keineswegs ein Monopol unserer Gattung ist. Möglicherweise ist Vernunft eine Eigenschaft, die in einer großen Vielfalt von Abstufungen und Formen bei vielen Lebewesen, ja in allen Dingen vorhanden ist.
„Und unsere Seele ...?“ seufzt nun noch eine vereinzelte Leserin, „wir haben doch auch eine Seele.“
Richtig, die Seele! Genau genommen aber ‚haben‘ wir nicht eine Seele, sondern sind wir auch Seele. Auch darauf werden wir im weiteren Verlauf noch ausführlich zu sprechen kommen. Es sei mir gestattet, hier nur so viel vorwegzunehmen: Auch hinsichtlich der Seele mache ich keinerlei Unterschied zwischen dem Menschen und anderen physischen Gestalten. Insbesondere wegen des sehr engen Bezugs, der in der Quantenphysik zwischen Wahrnehmung und Teilchen einerseits und Energie bzw. Bewusstsein andererseits festgestellt wurde, halte ich es keineswegs für unwahrscheinlich, dass alle Dinge in unterschiedlichsten Abstufungen über etwas verfügen, das dem entspricht, was wir unsere Seele nennen, nämlich Bewusstsein.
„Ja aber, sehen Sie denn überhaupt keinen Unterschied zwischen den Menschen und anderen Lebewesen?“ hakt die Seeleninteressierte enttäuscht nach.
Doch, ich sehe ihn. Einen gewaltigen Unterschied sehe ich sogar. Einen so gewaltigen Unterschied, dass er unseren ganzen Planeten zu etwas ganz außerordentlich Besonderes macht. Zumindest in unserem Sonnensystem.
Der Mensch hat die ganz besondere Fähigkeit, in zahllosen Situationen und auf vielerlei Ebenen zwischen ‚Ja‘ und ‚Nein‘, zwischen ‚Annehmen‘ und ‚Abweisen‘ zu wählen. Eine Wahlfreiheit, die ihm in letzter Konsequenz u. a. dazu befähigt, mit einer nahezu unbegreiflichen schöpferischen Kraft zu lieben. Oder dazu, in einer ebenso unbegreiflichen Weise zu zerstören. Derartiges kann, sofern uns bekannt, weder ein Tier noch eine Pflanze.
Ach sicher, ich weiß, ein paar alles andere als unbegründet, grundsätzlich skeptischen Leserinnen und Leser haben nicht den geringsten Zweifel daran, dass man ihnen über die Liebe ohnehin längst nichts mehr vormachen kann und es sie zweitens sowieso nicht gibt. Wir werden sehen.
Erlauben Sie mir jedoch, verehrte Leserschaft, die Vertiefung dieses so ungeheuer wichtigen Themas der ‚Liebe‘ noch etwas vor mir herzuschieben. Zuvor hätten wir nämlich noch ein paar Kleinigkeiten zu klären, damit wir, wenn wir uns schon an der Sache der Menschlichkeit schlechthin heranwagen, doch so was Ähnliches wie einen blassen Dunst davon haben, was wir da überhaupt meinen. Kehren wir einstweilen zu den Quarks zurück.
Man kann ohne Übertreibung sagen, dass es, neben dem Menschen und seinen merkwürdigen Lebensformen, in unserem Universum kaum etwas Faszinierenderes gibt, als ausgerechnet dieses kleinste Ding unter den Dingen: das Quark.